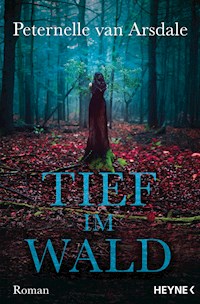
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Alys ist sieben, als die Seelenesser eines nachts in ihr Dorf kommen. Am Morgen danach sind alle Erwachsenen tot. Alys und die anderen Kinder müssen fortan in einem Nachbardorf leben, wo die Menschen gläubig sind und das Biest fürchten, das tief im Wald lebt. Doch das Biest ist nicht das, was es zu sein scheint – ebenso wenig wie Alys. Das Mädchen spürt, dass es in seinem Inneren mit den Seelenessern verbunden ist. Als Alys älter und ihre geheime Gabe stärker wird, sehnt sie sich immer mehr nach der Freiheit jenseits des Dorfes. Da schlägt das Schicksal erneut zu, und Alys macht sich auf die gefährliche Reise in den dunkelsten Teil des Waldes …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Ähnliche
Peternelle van Arsdale
TIEFIMWALD
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Michael Pfingstl
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Die Bestie ist ein Tier, schließ besser das Tor,
sonst kommt sie im Dunkeln und nimmt sich dich vor.
Die siebenjährige Alys lebt mit ihren Eltern in dem kleinen Dorf Weizheim am Rande des großen Waldes. Eines nachts, als sie nicht schlafen kann, schleicht sie sich aus dem Haus und streift durch die Felder. Dort trifft sie auf zwei seltsame und doch wunderschöne Mädchen, die mehr wie Bäume als Menschen aussehen: Die Seelenesserinnen. Sie berühren Alys, die daraufhin in einen tiefen Schlummer fällt. Dann schweben die beiden in Richtung Dorf davon. Als Alys am nächsten Morgen in den taufeuchten Feldern aufwacht und nach Hause zurückkehrt, sind alle Erwachsenen in Weizheim tot. Alys und die anderen Kinder werden im benachbarten Schafsdorf aufgenommen, wo die Menschen strenggläubig und furchtsam sind. Die Weizheimer wurden für ihre Sünden bestraft, so sagen sie. Dementsprechend begegnen sie den Neuankömmlingen mit Misstrauen. Ganz besonders Alys, die anders ist als die anderen Kinder.
Im Laufe der Jahre spürt Alys selbst, dass eine magische Gabe in ihr heranwächst und dass sie mehr mit den Seelenesserinnen gemein hat, als sie bisher glaubte. Dann kommt es zu ersten Todesfällen in Schafsdorf, und das Misstrauen der Bewohner gegenüber Alys verwandelt sich in blanken Hass. Um ihr Leben zu retten, macht sich Alys auf den Weg in den düsteren Wald und zu dem dunklen Geheimnis, das in seinen Tiefen haust …
Die Autorin
Peternelle van Arsdale wuchs in Newark, New Jersey, auf. Sie studierte Englische Literatur am Bryn Mawr College und arbeitete viele Jahre als Lektorin bei verschiedenen Verlagen. Inzwischen hat sie sich selbstständig gemacht und arbeitet hauptsächlich an ihren eigenen Romanen. Ihr Debütroman Tief im Wald soll von den Amazon Studios verfilmt werden. Die Autorin lebt und arbeitet in New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
THE BEAST IS AN ANIMAL
Deutsche Erstausgabe 06/2019
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2017 by Peternelle van Arsdale
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkterstraße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung eines Fotos von Sarah Ann Loreth / Arcangel Images
Margaret K. McElderry Books
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-23777-6V002
www.heyne.de
Für Galen
Die Bestie ist ein Tier
Schließ besser das Tor
Sonst kommt sie im Dunkeln
Und nimmt sich dich vor
Die Bestie ist ein Tier
Hör, wie sie kratzt an deiner Tür
Sie saugt deine Seele
Und will immer noch mehr
Die Bestie ist ein Tier
Frisst dich des Nachts
Während du schläfst
Und übrig lässt sie nichts
– Altes Kinderlied aus Erd
Die Geschichte beginnt so
Vor langer Zeit lebten zwei Schwestern.Sie wurden nur Minuten nacheinander geboren, jede mit samtschwarzem Haar auf dem wunderschönen Köpfchen. Die Mutter hatte volle zwei Tage in den Wehen gelegen, und dass sie überhaupt überlebte, glich einem Wunder. Mindestens einmal pro Stunde hatte die Hebamme befürchtet, sie zu verlieren, und die Kinder mit ihr. Aber die Kleinen begrüßten die Welt mit kräftigem Geschrei, und die Mutter weinte vor Erleichterung. Die Hebamme legte ihr die Mädchen in die erschöpften Arme, jedes auf eine Seite. Als der Mutter eines entglitt, fing die Hebamme es auf, gerade noch rechtzeitig, bevor es auf den harten Boden schlug. Damals dankte die Hebamme ihrem Glück noch. Wenige Monate später jedoch wünschte sie, sie hätte das böse Ding einfach fallen lassen.
Aber das war später. In der Zwischenzeit gab es andere Gründe, sich wegen der Kleinen Sorgen zu machen. Gesunde Zwillinge geschenkt zu bekommen, mag wie ein Segen erscheinen, aber in einem Dorf mit halb leeren Speisekammern und trockenen Feldern war die Geburt zweier Mädchen eher ein Grund für Beileidsbekundungen als zum Feiern. Die Dörfler schüttelten die Köpfe und hofften, das Pech der Mutter möge nicht ansteckend sein.
Der Vater wurde bedauert. Gewiss hatte er auf einen Sohn gehofft, auf zwei zusätzliche starke Hände zum Säen und Ernten. Ein Bauer brauchte einen geschickten Sohn, um die Zäune zu reparieren und die Ziegen vor den Wölfen zu beschützen.
Die Mutter wurde von niemandem bedauert. Statt zwei Mädchen zu gebären, hätte sie besser überhaupt keine Kinder in die Welt gesetzt. Manche sagten sogar, es wäre die reine Bosheit seitens der Mutter gewesen. Nur eine ungehorsame Frau könnte so etwas tun.
Die Mutter war schon immer eine stille Frau gewesen, die lieber für sich selbst blieb und, wenn überhaupt, nur in ihrem Kräutergarten gesehen wurde. Der Hof, auf dem sie mit ihrem Mann lebte, lag am weitesten von allen Höfen vom Dorfzentrum entfernt. Niemand kam dort vorbei, wenn er auf dem Weg irgendwohin war. Niemand kam je zum Plaudern. Wer den Hof besuchen wollte, musste absichtlich hingehen. Und diese Absicht hatte niemals jemand.
Von Anfang an fiel der Mutter etwas Interessantes an den Mädchen auf, aber sie erzählte niemandem davon, nicht einmal ihrem Mann. Die beiden glichen sich – sie hatten das gleiche schwarze Haar, die gleichen großen grauen Augen. Sie hatten sogar das gleiche Muttermal, einen mehr oder weniger sternförmigen Fleck auf der Wade. Einen einzigen Unterschied gab es allerdings: Die zwei Minuten ältere Tochter griff nach allem mit der linken Hand, die zwei Minuten jüngere nahm dazu die rechte. Die ältere hatte das Muttermal auf der linken Wade, die jüngere auf der rechten, und ihr Haar lockte sich auf exakt die gleiche Weise, nur in entgegengesetzter Richtung. Sie waren wie Spiegelbilder – gleich und doch nicht gleich.
Zu guten Zeiten, wenn die Ernten reich waren und es Essen im Überfluss gab, hätten derlei Dinge eine Mutter nicht beunruhigt. Doch wenn der Regen ausblieb und auf einen harten Winter ein trockener Sommer folgte, konnte alles, und sei es noch so unbedeutend, Furcht erwecken. Und die Zwillinge erschienen der Mutter seltsam genug, um ihr ein banges Flattern in der Brust zu bescheren.
Die Zwillinge gediehen, doch der Regen blieb aus. Wolken türmten sich auf – und mit ihnen die Hoffnungen der Dörfler. Aber nicht ein einziger Tropfen fiel vom Himmel. Als sich der Sommer dem Ende zuneigte und die Dörfler einen weiteren langen, kargen Winter auf sich zukommen sahen, wurde die Furcht zur Angst und die Angst zu einem Verdacht. Was, so fragten sie sich, hatte sich verändert, seit sie alle noch genug zu essen gehabt hatten?
Ein gesunder Instinkt zur Selbsterhaltung gab der Mutter ein, ihre Zwillinge vor den forschenden Blicken der anderen zu verstecken, und lange Zeit waren sie sicher. Doch dann kam eine Nachbarin mit einem Korb Eier, die sie im Dorf nicht hatte verkaufen können. Die Hühner der Mutter legten selten, und ihr Mann liebte Eier über alles, also nahm sie die Nachbarin mit in die Küche, um sich mit ihr auf den Preis zu einigen.
Die Nachbarin setzte sich an den Tisch und sah sich neugierig um. Nicht ohne Neid bemerkte sie den sauberen Boden, die weiße Schürze der Mutter und die prallen Wangen der Zwillinge. Sie waren kaum ein Jahr alt, und doch konnten sie schon laufen und plapperten allerlei Unsinn. Die Nachbarin sah, wie die ältere immer die linke Hand benutzte und die jüngere die rechte. Dann bemerkte sie die sternförmigen Muttermale an den wohlgeformten Waden. Ein Erkennen kitzelte ihren Nacken und verfestigte sich hinter ihrer Stirn. Dieses Muttermal war etwas anderes – etwas ganz anderes.
Die Nachbarin ging nicht sofort nach Hause, sondern zuerst zum Schmied, der sich gerade über den Zaun hinweg mit dem Wirt unterhielt. Nur wenige Minuten später kam die Frau des Hochältesten vorbei und konnte gar nicht anders, als das Gespräch zu belauschen. Normalerweise tat sie so etwas zwar nicht, aber dies hier waren wichtige Neuigkeiten: Eine Nachbarin hatte herausgefunden, was sich seit dem letzten Jahr im Dorf verändert hatte! Zwei spiegelbildliche Kinder waren geboren worden, und beide trugen das sternförmige Muttermal der Bestie – des Bösen, das den Regen abhielt.
Der Vater war eben erst von der Feldarbeit zurückgekehrt und setzte sich, um mit der Mutter zu Abend zu essen, da wurde das Mahl von einem lauten Klopfen an der Tür unterbrochen. Tatsächlich hatten die beiden das Dutzend Dorfbewohner schon lange vorher die Straße entlangkommen hören. Der Vater hatte seiner Frau einen fragenden Blick zugeworfen und dann zum Vorderfenster hinaus in die sommerliche Dämmerung geblickt. Ein Murmeln hatte sich über das Zirpen der Grillen erhoben. Die Mutter hatte schon zur Tür gehen wollen, doch der Vater hielt sie an der Schulter zurück. Dann warteten sie gemeinsam. Schritte scharrten über den Weg. Ein Zweierrhythmus löste sich von den anderen, und kurz darauf ertönte das Klopfen.
Der Vater ging zur Tür und hörte sich an, was die Dörfler zu sagen hatten. Sie sprachen recht vernünftig und gaben ihm keine Schuld, so sagten sie. Die Dürre war ganz offensichtlich das Werk einer Hexe und er ihr unschuldiges Opfer, so glaubten sie. Immerhin war es ganz gewiss nicht sein Wunsch gewesen, eine Tochter zu bekommen, geschweige denn zwei, die obendrein das Zeichen der Bestie trugen. Ganz bestimmt, so sagten sie, war seine Frau eine Hexe – und dann mussten die Zwillinge das Ergebnis ihres schändlichen Zusammenseins mit ihr sein. Der Bestie. Sie ließen dem Vater die Wahl: Er konnte die Hexe und die Kinder verbannen oder sich mit ihnen zusammen in die Verbannung begeben. Bei Anbruch des nächsten Tages würden sie wiederkommen, um seine Entscheidung zu hören.
Im ersten Augenblick war der Vater erleichtert. Die Dörfler hatten nichts davon gesagt, seine Frau und die Töchter zu verbrennen, totzuschlagen oder zu ertränken. Sein nächster Gedanke war schon düsterer: Wenn er gemeinsam mit ihnen in die Verbannung ging, würden sie alle hungern. Kein anderes Dorf würde sie aufnehmen, und er selbst hatte nicht die Mittel, um sie durch den Winter zu bringen – nicht ohne seinen Hof. Es wäre ein langsamerer Tod als das Verbrennen, auf seine Art aber noch schmerzvoller.
Als die Dörfler wieder fort waren, sagte der Vater zu seiner Frau, es gebe nur eines zu tun: Sie und die Mädchen mussten gehen. Sie sollten in den Wald, in dem – wie es hieß – alte, ruchlose Wesen hausten. Der Vater glaubte zwar nicht an solchen Unsinn, die aufgebrachten Nachbarn allerdings schon, und das bedeutete, dass sie ihnen nicht in den Wald folgen würden. Er versicherte seiner Frau, sie schon in wenigen Tagen zu besuchen. Er würde ihnen eine Hütte bauen und danach regelmäßig zu ihnen kommen, um ihnen Essen und Feuerholz zu bringen, bis seine Frau und die Kinder zurückkehren konnten. Mit etwas Glück, so sagte er, würde es schon lange vor dem ersten Frost Regen geben, die Nachbarn würden ihren Fehler dann einsehen und alles wäre vergessen.
Im Morgengrauen des nächsten Tages beobachteten die Dorfbewohner, wie der Vater seine Frau und die Töchter an den Rand der großen Wildnis begleitete. Die Schultern der Mutter waren gebeugt, denn sie schleppte so viel Essen und Kleidung mit sich, wie sie nur konnte, außerdem ein scharfes Messer und eine Axt. Die Hühner blieben auf dem Hof, doch führte sie eine Ziege an einem langen Seil. Der Vater wagte nicht, seine Frau oder die Kinder zum Abschied zu küssen. Er drehte ihnen den Rücken zu, als sie den Wald betraten, und einer der Dörfler schnappte laut nach Luft – später schwor er, er habe Mutter, Zwillinge und die Ziege direkt vor seinen Augen verschwinden sehen.
Im Wald war es sehr dunkel.
Die Mutter verbrachte die ersten Tage und Nächte in stiller Angst. Für Kleinkinder waren die Zwillinge bemerkenswert ruhig und folgsam, sie schienen zu spüren, dass jetzt nicht der Zeitpunkt war, um zu weinen und zu betteln. Die Mutter fand eine trockene Höhle, machte ein Feuer und schloss während der Nacht kein einziges Mal die Augen. Die Mädchen schliefen, während draußen die Wölfe heulten. Die Ziege schlief nicht.
Am fünften Tag, gerade als die Mutter schon die Hoffnung aufgegeben hatte, kam der Vater, schwer bepackt mit Nägeln und Vorräten. Der Rauch des Kochfeuers hatte ihm den Weg gewiesen. Vor dem Höhleneingang baute er ihnen eine zugige Hütte, danach sagte er zu seiner Frau, er müsse nun zurück zum Hof.
Aus Angst vor den Wölfen blieb die Mutter mit ihren Töchtern und der Ziege dauernd in der Hütte. Die Ziege gab Milch und hielt die Zwillinge nachts warm, während die Mutter nur die Tür anstarrte und darauf wartete, dass ihr Mann zurückkam und sie nach Hause holte.
Anfangs kam der Vater einmal in der Woche, dann einmal im Monat. Bei jedem Besuch fragte die Mutter wieder: »Wann können wir nach Hause?« Doch selbst als die Dürre vorbei und der Regen wiedergekommen war, sagte er, es sei noch nicht sicher. Die Nachbarn hätten noch nicht vergessen, und er habe von einer Hexe gehört, die im Nachbardorf verbrannt worden war.
Als die Mutter entgegnete: »Aber ich bin keine Hexe«, nickte der Vater und sah zur Seite.
Inzwischen hatten die Zwillinge den fünften Winter hinter sich. Der Vater kam jetzt überhaupt nicht mehr. Sie ernährten sich von zähem Wild und Ziegenmilch, und die Mutter überlegte laut, was aus ihnen werden sollte, wenn sie nicht mehr genug Futter für die Ziege hatten. Sie sagte das mit einem ernsten Blick, aber die Mädchen hielten zu der Ziege. Eher würden sie hungern, als die Ziege zu essen.
Die Mutter starrte schon lange nicht mehr auf die Tür. Schon seit einer ganzen Weile war ihr Mann nur noch gekommen, um Vorräte zu bringen. Er hatte seine Frau nicht angerührt und auch die Kinder keines Blickes gewürdigt. Als er dann gar nicht mehr kam, fragte sich die Mutter, ob er gestorben war. Sie glaubte allerdings nicht daran.
Eines kalten Morgens unter einem eisengrauen Himmel sperrte sie die Ziege in die Hütte und führte ihre Töchter wortlos durch den Wald. Diesen Weg waren sie seit vielen Jahren nicht mehr gegangen, aber sie kannten ihn noch immer auswendig. Als sie die Hintertür des Hofs erreichten, der einmal ihr Zuhause gewesen war, war es später Nachmittag und der Himmel wurde bereits dunkler. Die Mutter klopfte, eine beleibte Frau mit rotem Gesicht öffnete und schnappte laut nach Luft. Da kam der Vater zur Tür. Überraschung zeichnete sich auf seinem Gesicht ab, dann Scham. Er legte der Rotgesichtigen eine Hand auf die Schulter, und das bestätigte den Verdacht der Mutter: Sie war keine Ehefrau mehr, und ihr Mann war nicht mehr ihr Mann.
Im Lauf der Jahre waren die Zwillinge ein wenig verwildert und verspürten anfangs lediglich Neugier, als sie auf der warmen, vom Feuerschein erhellten Türschwelle des Hauses standen. Doch dann stieg ihnen der Duft von schmorendem Fleisch in die Nase. Das Wasser lief ihnen im Mund zusammen, die Erinnerung an den Duft folgte ihnen auf dem ganzen Weg zurück zu ihrer zugigen Hütte. Ihr Essen schmeckte nie wieder so wie zuvor. Die warme Ziegenmilch, die Forellen aus dem silbrigen Bach und die zähen Kaninchen, die sie über dem Feuer brieten, bis sie an manchen Stellen schwarz verkohlt und an anderen noch blutig rot waren – nichts wollte ihre Mägen mehr füllen. Selbst als sie satt waren, rumorte weiter eine nagende Unzufriedenheit in ihren Eingeweiden. Sogar dann noch, als die Erinnerung an das Schmorfleisch und den Duft von Essen, das man in einer richtigen Küche gekocht hatte, längst verblasst war.
Und während die ruhelosen Zwillinge wuchsen und gediehen, schwand die Mutter dahin. Mit jedem Jahr im Wald wurden ihre Schultern gebeugter und die Augen trüber. Während ihre Töchter über Hügel rannten, auf Bäume kletterten und mit bloßen Händen Fische fingen, saß sie in der dunklen, feuchtkalten Hütte. Dann begann der Husten. Die Mutter saß nun nicht mehr, sie lag auf der Seite. Ihr Atem ging rasselnd, und ihre Haut wurde immer dünner, bis sie ganz durchsichtig geworden war.
Von Jahr zu Jahr beschäftigten sich die Zwillinge weniger mit ihr, dafür umso mehr miteinander und mit dem Wald. Trotzdem war es ein Schock, als sie eines Abends zurückkamen und die Mutter tot in der Hütte fanden. Die Ziege lag neben ihr und hob den Kopf, als die beiden hereinkamen – mit ihrem Haar, das von Erde und Dreck verkrustet war. Die Zwillinge blickten einander unsicher an. Eine ferne Erinnerung an die Zivilisation sagte ihnen, dass sie die Mutter beerdigen mussten. Bis spät in die Nacht gruben sie ein tiefes Loch. Die Wölfe heulten, und vom Wald kam ein Rascheln, da zischte die ältere Schwester durch die Zähne. Als Antwort ertönte ein Knurren, doch die Wölfe kamen nicht näher.
Die Schwestern lebten nun allein. Die Ziege rollte sich nachts neben ihnen zusammen, so wie immer, und manchmal, wenn die Ziege am nächsten Morgen die Gesichter der beiden anstupste, kehrte die Erinnerung an ihre Mutter zurück, wie sie ihr Haar gestreichelt und sie geküsst hatte. Die seltsame Leere in ihren Bäuchen schlug in Bitterkeit um.
Eines Tages gingen die Schwestern erneut den Weg zum Dorf entlang. Jetzt mussten sie nicht mehr miteinander sprechen. Als die ältere Schwester in Richtung des väterlichen Hofes abbog, folgte die jüngere, ohne zu fragen. Sie warteten, bis es dunkel wurde. Längst schon hatte ihr Vater zum letzten Mal nach den Tieren gesehen und schlief an der Seite seiner Frau in dem warmen Haus. Die Schwestern schlichen zum Stall, öffneten die Türen und sperrten auch den Hühnerverschlag auf. Den Rest überließen sie den Wölfen. Bald war nichts mehr von den Tieren ihres Vaters übrig, nur noch Federn und Knochen.
Doch das linderte ihre Bitterkeit nicht. Also gingen sie zu den Höfen der anderen Dörfler und öffneten auch hier alle Ställe und Gehege. Danach kletterten sie auf einen Baum und lauschten dem Mahl der Wölfe.
Als wieder Ruhe eingekehrt war, kehrten sie zu ihrem Zuhause im Wald zurück. Sie lagen bis in die Morgendämmerung hinein wach, ihre Augen wollten sich einfach nicht schließen. Und während dieser Stunden geschah etwas mit ihnen. Etwas öffnete sich, und etwas anderes verschloss sich.
Am nächsten Morgen rochen sie einen Angsthauch in der Luft. Er füllte ihre Mägen und wärmte sie auf eine Art, die sie seit den beinahe vergessenen Tagen, als sie noch Babys gewesen waren und in ihren Betten geschlafen hatten, nicht mehr gekannt hatten. Sie beschlossen, dass es an der Zeit war, ihren Vater zu besuchen.
Die Sonne war kurz davor, hinter dem Horizont zu versinken, als sie auf den Feldern nach ihm suchten. Erde und Laub gehörten nun zu ihnen wie ihre Haut und die Haare. Sie standen bereits ganz dicht vor ihm, als der Vater die beiden Erdfrauen entdeckte. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen, und er schnappte laut nach Luft, da atmete die ältere Schwester sein Entsetzen ein. Vor Entzücken richteten sich die Härchen auf ihren Armen auf. Die Finger des Vaters krabbelten über seine Brust, als suchten sie verzweifelt nach etwas, das er verloren hatte, dann fiel er rücklings um und sank tot auf seinen eigenen Acker.
Mit der rechten Hand berührte die jüngere Schwester kurz das Gesicht der älteren – ihre Augen waren für einen Moment schwarz geworden und erst danach wieder grau.
Die ältere nahm sie bei der Hand, dann gingen sie gemeinsam los, um der Frau mit dem roten Gesicht einen Besuch abzustatten. Die jüngere Schwester klopfte, und die Rotgesichtige öffnete die Tür. Ihre Angst verströmte einen scharfen Geruch, wie verdorbene Milch. Die jüngere Schwester sah den einfachen Geist der Frau und ihre magere Seele – wie auf einem Teller lagen sie vor ihr ausgebreitet. Es glich einer Einladung zum Essen. Sie nahm diese Einladung an und atmete die ängstliche Seele ein, als sei es eine warme Mahlzeit.
Die Frau tat das Gleiche wie ihr Mann und fasste sich mit den Händen an die Brust, als hätte jemand etwas Wertvolles herausgerissen, dann sank sie tot auf den Küchenboden.
Die jüngere Schwester blickte auf sie hinab und spürte, dass ihr Hunger beinahe befriedigt war. Danach gingen die beiden nach Hause, und ihr Hunger nahm wieder zu.
Am nächsten Tag warteten die Schwestern, bis es tiefschwarze Nacht war, dann kehrten sie zurück.
Auf dem Weg sahen sie überrascht ein anderes Mädchen, eigentlich war es noch ein kleines Kind. Es stand ganz allein in der Dunkelheit, als wartete es auf sie. Das Mädchen war nicht wie der Vater der Schwestern oder die rotgesichtige Frau. Es fürchtete sich nicht, als es die Schwestern erblickte, es sah sie nur interessiert an, neugierig. Das beschwor eine Erinnerung in den Schwestern herauf, eine Erinnerung daran, wie sie selbst einmal Kinder in diesem Dorf gewesen waren. Und so beschlossen sie, das Kind zu verschonen, ja, sogar alle Kinder zu verschonen. Es waren die furchtsamen Erwachsenen, die beschuldigten und verbannten. Jeden, der älter war als sie selbst, wollten sie heimsuchen. Die Schwestern rochen ihre Furcht wie einen Rauch in der Luft. In gewisser Weise würden sie diese Furcht lindern, sie für immer von den Dörflern nehmen.
Die Schwestern gingen weiter und besuchten jedes Haus im Dorf. Die Kinder ließen sie schlafend in ihren Betten, die Erwachsenen aber lagen nach den Besuchen tot und leer da. Die Schwestern stahlen, was nicht gestohlen werden durfte.
Sie ließen ein Loch zurück, eine dunkle Leere anstelle dessen, was weggerissen worden war. Noch war das Loch klein, aber in den Jahren darauf wurde es immer größer und wuchs mit jeder Seele, die sie nahmen. Doch davon ahnten die Schwestern nichts.
Schließlich waren sie zufrieden. Der Mond senkte sich bereits und die Sterne am Himmel wurden blasser, als sie zu ihrer Hütte in der Wildnis heimkehrten. Ihre Füße berührten kaum das silbrig schimmernde Gras, als schwebten sie über den Waldboden.
Kurz bevor sie die Hütte erreicht hatten, rochen sie Blut, vermischt mit Schmerz und Angst, aber diesmal war ihnen der Geruch nicht angenehm. Die Schwestern beschleunigten ihren Schritt und fanden die Eingangstür der Hütte weit offen. Vielleicht hatte die alte Ziege sie aufgestoßen? Dort, wo sie an sonnigen Tagen oft gelegen hatte, war nur noch eine Blutlache. Den Rest hatten die Wölfe fortgeschleppt.
Die ältere Schwester fühlte gar nichts, nur die jüngere verspürte den Hauch einer Erinnerung an etwas, das Traurigkeit hieß. Doch dieser Hauch verschwand. Sie waren nun keine Mädchen mehr, aber auch keine Frauen. Sie waren zu etwas anderem geworden und merkten, dass sie kaum noch ein Bedürfnis nach Essen oder Wasser hatten. Es gab so viele furchtsame, verunsicherte Seelen auf der Welt, die nur darauf warteten, gegessen zu werden. Alles, was die Schwestern tun mussten, war, sie einzuatmen.
Die Schwestern hießen Angelica und Benedicta. Und sie waren Seelenesserinnen.
Erster Teil
WENN ES DUNKEL IST
1
Für Alys waren die Nächte lang.
Und sie waren alle gleich. Ihre Mama wusch sie und stülpte ihr ein Nachthemd über den Kopf. Sie steckte Alys zwischen ein Betttuch aus Leinen und Decken aus Wolle, die schwer auf ihren ruhelosen Gliedern lagen. Dann begann Alys’ nächtliche Gefangenschaft in der Dunkelheit, der Stille und der Abwesenheit von Schlaf.
Wenn Mama aus dem Zimmer ging, blickte Alys ihr sehnsüchtig hinterher. Mama drehte sich um und lächelte sie an, dann schloss sie die Tür hinter sich, und der Laternenschein aus der warmen Küche verlosch. Alys stellte sich vor, wie ihr Papa in der Küche saß, mit seiner Pfeife im Mund und den Zehen am Feuer. So lag sie im Bett und lauschte den Geräuschen des Hauses, den leisen Stimmen ihrer Eltern, dem Klappern des Geschirrs und den Schritten auf den Holzdielen.
Dann Stille.
Alys hörte die beiden atmen, Mamas leise Seufzer, Papas lautes Schnarchen, und dann ein Stöhnen. Sie war jetzt sieben Jahre alt und schon immer so gewesen. Sie fürchtete die Nacht.
Wenn sie nur aufstehen dürfte. Es war das Wissen, dass sie ihr Bett nicht verlassen durfte, was ihr das Schlafen unmöglich machte. Halt still und schlaf. Genau deshalb verspürte sie diesen überwältigenden Drang, das Gegenteil zu tun.
Ihre Lider flogen wie von selbst wieder auf, und so blieben sie. Alys hatte keine Geschwister, deshalb konnte sie nicht sicher sein, aber man hatte ihr gesagt, sie sei ein seltsames Kind. Die meisten Kinder verstünden es, dem Schlaf nachzugeben, wenn die Zeit dafür kam. Alys aber konnte das nicht.
Sie beschloss, dass sich ab jetzt etwas ändern würde. Heute Nacht, wenn Seufzer und Schnarchen die Luft erfüllten, würde ihre nächtliche Gefangenschaft ein Ende haben. Alys würde sich die Nacht zu eigen machen.
Nur um ganz sicher zu sein, wartete sie noch lange ab, nachdem Stille eingekehrt war, erst dann setzte sie ihre Füße auf die kalten Dielen. Der Sommer ging zu Ende, es war kurz vor der Ernte, und obwohl die Tage noch warm waren, roch Alys bereits den Herbst in der Luft. Sie holte ihre Wollstrümpfe und Stiefel hervor und auch das wollene Überkleid. Sie war kein Kind, dem man aussuchen musste, was es anziehen sollte. Mama sagte, dass sie in dieser Hinsicht sehr vernünftig war.
Aber jetzt war Alys nicht vernünftig. Es war nicht klug, ausgerechnet heute Nacht auf Wanderschaft zu gehen. Alys wusste das, und doch konnte sie nicht anders. Sie hatte einen Plan gefasst, und nachdem sie so lange gewartet hatte, so lange eine Gefangene gewesen war, weigerte sie sich, auch nur eine einzige Nacht länger zu warten. Alys konnte nicht mehr warten. Ausgeschlossen. Nicht einmal wegen dem, was letzte Nacht mit dem Bauern und seiner Frau passiert war. Auch nicht wegen der Ereignisse in der Nacht zuvor, als die Wölfe gekommen waren und alle Hühner, Ziegen und Pferde in ganz Weizheim gefressen hatten. Was mit Mamas Hühnern geschehen war, machte Alys traurig. Sie hatten sich so schön warm angefühlt auf ihrem Schoß und auch so schöne Eier gelegt.
Alys hatte mit angehört, wie sich ihre Eltern über den toten Bauern und seine Frau unterhielten. Die beiden hatten ganz am Rand des Dorfes gewohnt, fast schon im Wald. Mama hatte gesagt, man hätte sie überhaupt nur gefunden, weil jemand den Bauern hatte fragen wollen, ob er vielleicht wusste, was mit all den Tieren passiert war. Sie sagte, das Blutvergießen sei gewiss das Werk einer Hexe, und auf dem Hof hätte schließlich diese andere Hexe mit ihren Zwillingstöchtern gewohnt. Papa sagte, dass jemand, der einmal mit einer Hexe verheiratet gewesen war, gewiss kein zweites Mal eine heiraten würde. Mama war anderer Meinung und sagte, sie glaube, genau das sei passiert. Warum sonst sei der Bauer denn nun tot? Waren ihre toten Hühner nicht Beweis genug, dass ganz Weizheim für die Sünden des Mannes bestraft wurde? Für das, was er und seine Frau dort draußen, wo niemand sie sah, ausgeheckt hatten? Dann hatte Papa ihr einen ganz bestimmten Blick zugeworfen, der Mama sagte, dass Alys zuhörte, und dann … Nun, das war das Ende der Unterhaltung gewesen.
Eigentlich hätte Alys Angst haben müssen, einmal vor den Wölfen, aber auch wegen des toten Bauern, der mit einer Hexe verheiratet gewesen war. Doch sie hatte keine Angst. Alys hatte noch nie Angst gehabt. Die gruseligen Kinderlieder waren ihr die liebsten. Die Lieder, die von der Bestie handelten, die einem die Seele aussaugte und nur Haut und Knochen übrig ließ, gefielen ihr am besten. Jedes Mal, wenn ihre Freundin Gaenor kreischend die Augen schloss und sich die Hände auf die Ohren presste, lachte Alys nur. Manchmal versprach sie ihr aufzuhören, und genau in dem Moment, wenn Gaenor die Hände sinken ließ und ihre Augen wieder öffnete, sang sie weiter:
Die Bestie schaut zu dir rein
Wenn du fest schläfst
Mach ihr auf
Lass sie ein
Und deine Mutter wird schrein.
Alys trat aus ihrem Zimmer, lauschte noch einmal auf den Atem ihrer Eltern, dann ging sie zur Küche und war flugs zur Tür hinaus, bevor sie es sich noch einmal anders überlegen konnte.
Die Luft dort draußen war kalt und feucht und … alles offen. Und erst der Himmel, oh, der Himmel. So viele Sterne.
Alys blickte nach oben, und ihre Stimmung hob sich augenblicklich. Sie legte den Kopf in den Nacken, so weit sie konnte, und probierte, wie der Himmel dann aussah. Es war so schön, so frei zu sein. Alle im Dorf schliefen, nur Alys dachte nicht einmal an Schlaf. Wenn sie jede Nacht so verbringen könnte, sagte sie sich, hätte sie keinen Grund mehr, die Nacht zu fürchten.
Doch im Kräutergarten ihrer Eltern fühlte sie sich immer noch gefangen. Sie spürte das Haus in ihrem Rücken und die Ställe links und rechts. Außerdem wusste sie nur zu gut, dass ringsum in der Dunkelheit die Häuser der Nachbarn standen. Was Alys sich wünschte, war ein brachliegendes Feld, hohes Gras, das sich in alle Richtungen ausbreitete, weiter noch, als sie in der Dunkelheit sehen konnte. Und sie wusste, wo es genau so ein Feld gab. Sie musste nur der Straße aus dem Dorf hinaus folgen, da war es: groß und weit und nur vom Wald begrenzt, der sogar noch größer war als das Feld.
Ihre Beine trugen sie wie von selbst durch die Dunkelheit. Alys streckte die Arme zu beiden Seiten aus und spürte, wie die Nachtluft sie umfing. Sie mochte allein sein, aber einsam war sie nicht.
Dann das Feld. Sie lief mitten hinein, spürte, wie das Gras ihr Kleid streifte und noch durch die Strümpfe hindurch ihre Haut kitzelte. Sie spürte keinerlei Gebäude mehr um sich herum. Als sie die Mitte des Feldes erreichte, schaute sie wieder zu den Sternen hinauf. Der Himmel über ihr war wie eine endlose Kuppel, die Sterne schienen auf sie herunterzuprasseln wie Körnchen aus Licht. Alys öffnete die Augen, so weit sie konnte, und nahm sie alle in sich auf.
Sie spürte die Frauen, bevor sie sie sah.
Allerdings nicht, weil sie sie gehört hätte. Eher war es die Tatsache, dass sie überhaupt kein Geräusch machten, die Alys’ Aufmerksamkeit erregte. Das Gefühl einer körperlosen Gegenwart. Dennoch hatten die beiden Frauen einen Körper, Alys sah es deutlich: Sie bestanden aus Erde und Blättern. Sie schwebten durchs Gras und schauten Alys mit ihren großen grauen Augen an, die in der Dunkelheit schimmerten, als leuchteten sie von innen.
Alys hatte keine Angst. Lediglich neugierig war sie, denn solche Frauen hatte sie noch nie zuvor gesehen. Sie stammten nicht vom Dorf, zumindest nicht aus einem, von dem Alys jemals gehört hatte. Aber fahrende Händler waren sie auch nicht. Die fahrenden Händler mochten seltsam aussehen, doch die beiden Frauen waren noch seltsamer. Alys fand, dass sie eher wie Bäume aussahen, nicht wie Menschen.
Dann waren sie auch schon bei ihr. Sie schwebten direkt neben Alys und legten ihr jede eine Hand aus Erde und Lehm auf die Schulter. Sie waren schlank und viel größer als sie selbst, aber doch noch keine Frauen, wie Alys nun sah. Zwar älter als sie, aber nicht viel, und bestimmt noch keine Mütter.
»Wie heißt du?«, fragte die eine, und doch war es, als hätten beide gesprochen. Alys spürte etwas durch ihre Schultern fließen, als wären die Mädchen durch ein pulsierendes Band verbunden, das nun mitten durch Alys hindurchging.
»Ich bin Alys.«
»Alys, geh schlafen«, sagte die andere.
Alys bemerkte augenblicklich ein Ziehen in den Lidern, wie von einem fallenden Vorhang. Nein, sagte sie sich. Das war es nicht, was sie wollte. Sie hob den Vorhang wieder an und öffnete die Augen noch ein Stückchen weiter als zuvor. »Ich möchte nicht schlafen gehen.«
»Es ist keine Furcht in ihr, Benedicta.« Das Mädchen beschnupperte Alys, ganz so, wie Gaenors Hund sie einmal beschnuppert hatte.
»Nein, Angelica, sie hat keine Furcht.«
Benedicta. Angelica. Diese beiden Namen hatte Alys noch nie zuvor gehört, doch sie fand sie wunderschön. Auch die Mädchen selbst waren wunderschön – mit ihren Eulenaugen, mit ihrem langen dunklen Haar und den Zweigen und Blättern darin.
Dann ließen sie Alys allein. So schnell, wie sie gekommen waren, schwebten sie wieder davon und verschwanden in der Dunkelheit. Die Richtung, die sie dabei einschlugen, verriet Alys nichts darüber, wohin sie unterwegs sein mochten.
2
Alys erwachte im Gras, vom Tau waren ihr Haar und ihre Kleider feucht. Der Himmel über ihr war hell und von einem klaren Blau. Sie döste oft in den Morgen hinein. Wenn ihre Eltern aufstanden, der schwarze Himmel sich ein klein bisschen aufhellte und Alys wusste, dass die Welt um sie herum erwachte, schlief sie immer am leichtesten ein. Aber so lange hatte sie noch nie geschlafen. Sie fuhr ruckartig hoch. Ihre Eltern suchten bestimmt schon nach ihr.
Alys sprang auf und rannte zur Straße. In der letzten Nacht war ihr der Weg viel kürzer erschienen, aber jetzt war ihr Zuhause weit, weit entfernt. Ihr Atem ging schwer und schmerzte in der Brust. Alys hörte nur ihr eigenes Herz und ihren Atem, sonst nichts, und da merkte sie, wie seltsam das war. Normalerweise herrschte um diese Zeit immer reges Treiben im Dorf. Sie müsste den Lärm der Wagen hören können, das Hämmern von Eisen auf Eisen, Frauen, die nach ihren Kindern rufen, und auch die Rufe der Männer. Nichts. Nicht einmal Vogelgezwitscher. Die Stille war tiefer und umfassender, als Alys es je in ihren vielen durchwachten Nächten erlebt hatte.
Alys blieb stehen, sie konnte nicht mehr rennen, und da hörte sie doch etwas – die Räder eines Wagens hinter ihr, der über die Straße in Richtung Weizheim fuhr. Sie drehte sich um und sah einen Planwagen, gezogen von zwei grauen Pferden. Ein Mann saß auf dem Kutschbock. Er trug einen breitkrempigen Hut, den er tief in die Stirn gezogen hatte, sein langes rotes Haar wippte auf und ab wie die Flügel eines Vogels. Als er Alys sah, zog er die Zügel und hielt an.
»He, Kleine. Du bist weit weg von zu Haus.«
»Ja«, sagte Alys. »Aber ich bin auf dem Weg dorthin.«
»Kein Grund, noch weiter zu laufen. Kletter rauf, dann bring ich dich hin. Du musst mir nur sagen, wohin ich fahren soll.«
Alys ging zu dem Wagen und musterte den Mann. Seine Augen waren dunkelgrün wie Moos, der Bart rot und von weißen Strähnen durchzogen. Er lächelte und hatte ein freundliches Gesicht. Ein Gesicht, das sie gern ansah. »Ja, gut«, erwiderte Alys.
Der Mann streckte ihr eine Hand entgegen, und Alys setzte sich neben ihn. »Ich bin Alys«, sagte sie.
Der Mann tippte sich an den Hut. »Und ich bin Paul, hübsche Alys.«
Sie lächelte. Paul war ein freundlicher Mann, und es gefiel ihr, dass er sie hübsch nannte. Es hörte sich an wie in einer Geschichte. »Unser Haus steht gleich dort drüben, das dritte auf der linken Seite, nach der Schmiede. Mama und Papa werden sehr böse auf mich sein, deshalb wäre ich – wenn es dir nichts ausmacht – gern möglichst schnell dort.«
Paul nickte zwinkernd, als hätten sie und er jetzt ein kleines Geheimnis.
Je näher sie dem Dorf kamen, desto unbehaglicher wurde Alys zumute. Sie war nicht sicher, was ihr mehr Angst machte: die Aussicht auf den Zorn ihrer Eltern oder die eigenartige Stille, die sich über das Dorf gelegt hatte.
»Ganz schön komisch, findest du nicht?«, fragte Paul. »Wie still es ist.«
»Ja«, erwiderte Alys. »Vielleicht, weil alle Tiere tot sind.«
Paul zog die roten Augenbrauen nach oben. »Was sagst du da?«
»Die Tiere sind alle tot. Wölfe haben sie gefressen.«
Paul stieß einen Pfiff aus. »Hört, hört. Dann ist die Stille wohl kein Wunder.« Er schüttelte den Kopf. »Wo gibt es denn so was? Waren die Stalltüren nicht zu? Die Gehege nicht verriegelt?«
»Doch, waren sie.«
»Und wie sind die Wölfe dann deiner Meinung nach hineingekommen?«
»Der Hochälteste sagt, es war das Werk der Bestie«, antwortete Alys.
Paul sah sie nachdenklich an. »Ich habe noch nie einen Wolf gesehen, der Befehle entgegengenommen hätte. Du vielleicht?«
Alys schüttelte den Kopf. »Ich bin noch nie einem Wolf begegnet.«
»Nein? Na, dann sag ich dir was: Ich hab auch noch nie einen Wolf gesehen, der eine Stalltür öffnen kann.« Er schnalzte mit der Zunge. »Oh, meine Beti wird nicht zufrieden sein mit mir.« Er drehte Alys das Gesicht zu. »Beti ist meine Frau.«
»Warum wird sie nicht zufrieden sein?«
»Totes Vieh bedeutet, dass eine Menge Leute in Weizheim unglücklich sind und kein Interesse haben, mit mir ins Geschäft zu kommen. Ich bin ein fahrender Händler, du hübsches Mädchen, und ich bin hier, um mit deinen Leuten Handel zu treiben. Davon lebe ich. Wenn ich mit leeren Händen zu den Seen zurückkehre, wo ich herkomme … Tja, wie gesagt, von meiner Beti werde ich dann was zu hören bekommen.«
»Oh«, machte Alys. Pauls Worte sagten ihr nicht viel. Sie wusste nur, dass die Seen weit entfernt lagen und die fahrenden Händler das seltsame Volk waren, das dort wohnte. Sie kleideten sich komisch, kämmten sich die Haare nicht, und Alys hatte noch andere Dinge gehört – von der Sorte, über die Erwachsene immer nur ganz leise sprachen und nur dann, wenn sie glaubten, sie höre nicht zu. Dinge, die Alys nicht ganz verstand. Jetzt aber wollte sie nur nach Hause. Sie musste dringend pinkeln, und je mehr sie sich vor Mamas und Papas Reaktion fürchtete, desto mehr fürchtete sie auch, ihre Blase könnte sich noch hier im Wagen entleeren.
»Da ist es«, sagte sie. »Gleich hier.«
Paul hatte gerade vor dem Haus haltgemacht, da wollte Alys plötzlich nicht mehr aussteigen. Etwas sagte ihr, dass sie besser nicht ins Haus gehen sollte. Eine dunkle Vorahnung hielt sie eisern im Wagen fest.
»Soll ich mitkommen, Kind? Ein bisschen die Wogen glätten vielleicht?«
»Ja«, sagte Alys. »Vielleicht.« Doch das war es gar nicht, was sie wollte. Sie wollte alles so lassen, wie es war, und das Haus gar nicht erst betreten, aber da war Paul schon vom Kutschbock geklettert. Er hob sie vom Wagen und klopfte an der Eingangstür.
Doch niemand öffnete.
Paul klopfte erneut, lauter diesmal. Lauter, als man es tun würde, wenn man damit rechnete, dass jemand zu Hause war. Aber es kam immer noch keine Antwort.
»Warum gehen wir nicht einfach rein?«, schlug Paul vor. Er drückte auf die Klinke, dann waren sie drinnen. Das Haus war so still. Und kalt. Alys zitterte. Die Küche war leer, im Kamin brannte kein Feuer. Der Sonnenschein, der durch die Fenster hereinfiel, war grell und eigenartig. Nichts war so, wie es sein sollte. Alys spürte, dass Paul genauso beunruhigt war wie sie. Er schaute sie mit einem merkwürdigen Lächeln an. »Nun, Mädchen, warte doch einfach hier, während ich nachsehen gehe.«
»Nach was denn sehen?«, fragte Alys.
Paul öffnete den Mund und schloss ihn wieder, dann sagte er: »Nachsehen, was hier los ist.«
Alys setzte sich auf ihren Platz am Küchentisch. Sie starrte die geisterhaften Abdrücke der Teetassen auf dem Holz an – und auch die langen Messerfurchen. Und sie wartete.
Sie hörte Pauls Schritte, langsam und gleichmäßig, hörte, wie eine Tür geöffnet wurde, dann weitere Schritte und schließlich eine Pause. Dann einen Ton, halb ein Schrei, halb ein Nach-Luft-Schnappen. Alys sprang auf und folgte dem Ton.
Paul stand neben dem Bett ihrer Eltern. Beide lagen darin und rührten sich nicht, und da wusste Alys, dass sie tot waren. Sie wusste es, ebenso wie sie es bei Gaenors altem Hund gewusst hatte, als sie ihn unter der Veranda fand. Tote sahen einfach anders aus als Lebende.
Alys gab keinen Laut von sich, trotzdem drehte Paul sich ruckartig zu ihr um. »O nein, Kind. Nein, tu das nicht.«
Sie rannte an Paul vorbei zu Mama und hob ihre kalte Hand an. Aber es war nicht mehr Mamas Hand, und das hier war auch gar nicht mehr ihre Mama. Ihre Mama war tot, übrig war nur noch ein Körper, dem alles Wichtige entrissen worden war. Übrig waren nur noch eine leere Hülle und ein Nichts. Ein Lied ertönte in Alys’ Kopf, schnell und laut, und sie schwor, es nie wieder zu singen.
Die Bestie ist ein Tier
Frisst dich des Nachts
Während du schläfst
Und übrig lässt sie nichts.
3
Paul wollte Alys dazu bringen, zum Wagen zu gehen und dort zu bleiben, während er Hilfe holte, doch sie weigerte sich. Sie hielt sich einfach an seiner Hand fest. Paul machte es schließlich genauso, und so blieben sie.
Paul pochte gegen die erstbeste Tür, er pochte und pochte. Alys wusste nicht recht, was sie fühlte, nur Pauls Angst spürte sie deutlich. Ihr war kalt, und sie zitterte. Ihre Zähne klapperten. Als auf der anderen Seite der Tür das Scharren von Schritten ertönte, fühlte Alys Pauls Erleichterung bis in seine Fingerspitzen.
Enid öffnete. Sie war fünfzehn, im Vergleich zu Alys beinahe erwachsen. Ihr Haar war ungekämmt, sie trug noch ihr Nachthemd und rieb sich die Augen wie ein kleines Kind. »Tut mir leid«, sagte sie und sah die beiden an, als wüsste sie nicht recht, was ihr eigentlich leidtat, merke aber, dass irgendetwas nicht stimmen konnte.
»Deine Eltern«, sagte Paul. »Wo sind sie?«
»Sie …« Enid verstummte und warf einen Blick über die Schulter, dann schaute sie wieder Alys und Paul an.
»Kind«, sprach Paul weiter, »stimmt irgendetwas nicht? Sind alle im Haus wohlauf?«
Enid wirkte eigenartig. Im ersten Moment konnte Alys sich nicht erklären, warum, dann sah sie es: Das Hübscheste an Enid schienen ihr sonst ihre Augen zu sein, die von einem wässrigen Blau waren – wie der Himmel bei Sonnenaufgang. Doch jetzt waren sie dunkel, jede Iris nur ein hauchdünnes Band um die tiefschwarzen Pupillen.
Enid blickte Paul wortlos an, bis Paul sich an ihr vorbeischob und Alys hinter sich herzog. Erst in der Küche blieb er stehen.
»Kind«, sagte er zu Alys, »diesmal musst du auf mich hören. Bleib hier. Lass mich allein nachsehen.«
Alys protestierte nicht, sie wollte auch gar nicht. Sie drehte sich zu Enid um, die in ihrer eigenen Küche stand und dennoch nicht zu wissen schien, wo sie war. Sie dachte an Enids Geschwister und hob den Kopf, als könnte sie durch die Decke hindurch in ihr Zimmer schauen. Dann ging sie zu Enid und berührte ihre kalten Hände.
Enid war schon ein großes Mädchen, und Alys war noch so klein. Sie wollte nicht mehr die Einzige im Dorf sein, die richtig wach war, also tat sie das Erstbeste, was ihr einfiel: Sie nahm den Wasserkrug, den es in jeder Küche gab, und leerte ihn über Enid aus.
Enid schüttelte sich kreischend, doch als Alys sie ansah, waren ihre Augen wieder blau, nicht schwarz, und Alys fühlte sich nicht mehr so allein.
Enid fuhr sich mit den Händen übers Gesicht, dann schaute sie Alys an, als sehe sie sie zum ersten Mal. »Meine Eltern«, sagte Enid. »Wo sind sie?«
Enids Eltern waren genauso tot wie Alys’. So war es überall, in jedem Haus das Gleiche. Paul klopfte nicht einmal mehr, er ging einfach hinein und fand sie: alle Kinder unter sechzehn waren am Leben und fest schlafend, die Eltern, die älteren Geschwister, die Tanten, Onkel, Großmütter und –väter dagegen … alle tot. Ausgesaugt. In einer einzigen Nacht war Weizheim zu einem Dorf voller Waisen und toter, leerer Hüllen geworden.
Enid ließ ihre Geschwister schlafen und sagte zu Paul, sie müssten Madog wecken. Er war fünfzehn Jahre alt, so wie sie, und ihr Auserkorener. Als Madog wach war, ließ er seine beiden Schwestern schlafend im Haus zurück und folgte Paul, Alys und Enid in Alys’ Küche. Keiner sprach ein Wort. Enid und Madog hielten sich verängstigt an der Hand, ebenso wie Alys sich an Pauls Hand festhielt.
Jetzt wusste Alys, was echte Furcht war. Als sie ihre Eltern kalt und tot in ihrem Bett gefunden hatten, hatte Alys geglaubt, sich nicht noch mehr fürchten zu können, doch je höher die Sonne kletterte und alles in ein kahles, grelles Licht tauchte, desto mehr fürchtete sie sich. Anfangs war es ihr noch ein Trost gewesen, dass nun auch Enid und Madog wach waren. Umso verstörender fand sie allerdings, wie viel Angst die beiden jetzt hatten. Und Paul ebenfalls.
Als sie in Alys’ Küche waren, begann Paul ruhelos auf und ab zu gehen. Er stampfte an das eine Ende, blieb stehen und blickte zur Decke hinauf, dann stampfte er wieder zurück und schüttelte den Kopf. Schließlich schaute er die Kinder an. »Im Augenblick können wir nur eins tun: Ihr müsst hierbleiben und euch um die anderen kümmern, während ich Hilfe hole.«
»Hilfe?«, wiederholte Madog. »Der nächste Ort ist Schafsdorf, und das liegt zwei Tage entfernt.« Bis heute war er Alys immer wie ein richtiger Mann vorgekommen, auf seinem Kinn wuchs bereits ein goldener Bart, und sein Rücken war ganz breit von der Feldarbeit, doch jetzt hatte er die Augen eines Kindes, groß und rund.
»Ja, ich weiß«, erwiderte Paul. »Aber ich habe nur diesen einen Wagen, und ihr könnt nicht den ganzen Weg zu Fuß laufen. Die Hälfte von euch würde es nicht schaffen. Insgesamt dürften es im Dorf etwa fünfzig Kinder sein, oder?«
Madog antwortete nicht, er nickte nur.
»Und was ist mit den ganz Kleinen?«, fragte Enid. »Wie sollen wir sie versorgen? Mindestens zehn sind noch keine zwei Jahre alt. Und dann noch die anderen mit drei, vier oder fünf. Ohne ihre Eltern werden sie fürchterliche Angst haben.«
»Das ist wohl wahr.« Paul kratzte sich am Bart, dann hellte sich seine Miene plötzlich auf. »Weckt sie einfach nicht.«
»Wir sollen sie nicht wecken?«, fragte Enid. »Aber was, wenn sie von allein aufwachen? Und was, wenn sie als Erstes nach Mama und Papa fragen? Oder ihre Milch wollen, und ich habe keine?«
»Ich kann dir diese Fragen nicht beantworten, Kind, aber das eine kann ich dir sagen: Ihr seid verhext worden, und ich glaube nicht, dass die anderen Kinder von allein aufwachen werden. Lasst sie einfach in Ruhe und hofft das Beste. Mit diesem Dorf« – er beschrieb einen Kreis in der Luft – »ist etwas Entsetzliches passiert. Je früher ich euch alle von hier wegschaffen kann, desto besser. Und der schnellste Weg ist, wenn ich allein nach Schafsdorf fahre und mit so vielen Helfern wie möglich zurückkomme, um die schlafenden Kinder zu holen.«
»Was ist mit den … Leichen?«, unterbrach Madog. Seine Worte klangen tonlos, als wollte er sie von sich wegschieben, damit er die Bedeutung nicht begreifen musste.
»Schließt die Türen und lasst sie, wo sie sind«, antwortete Paul, dann starrte er zu Boden. »Und hofft, dass es schön kühl bleibt.«
Alys schaute zwischen Madogs weit aufgerissenen Augen und Enids blassem Gesicht hin und her.
Ihr Blick wanderte weiter zu Paul, und da fasste sie einen Entschluss. »Ich komme mit dir.«
4
Paul redete auf Alys ein, sie solle lieber bei Enid und Madog bleiben, aber Alys hielt sich einfach an ihm fest. Sie wusste, er würde es nicht übers Herz bringen, sich von ihr loszumachen. Schließlich sagte er, sie solle ihre Kleider zusammenpacken und sich beeilen.
Es war früher Nachmittag, als sie aufbrachen. Paul erklärte, sie würden unterwegs nur anhalten, wenn die Pferde sich ausruhen mussten, und dann so schnell wie möglich wieder weiterfahren. Während er das sagte, spähte er immer wieder in den Wald links und rechts der Straße. Alys folgte seiner Blickrichtung, schaute zwischen die Bäume und zog Mamas Mantel, den sie im letzten Moment noch vom Wandhaken in der Küche genommen hatte, fester um sich. Er roch ein bisschen nach ihr und ein bisschen nach Frühstück.
Nach ein paar Stunden hielt Paul an, um die Pferde an einem Bach neben der Straße zu tränken. Er wühlte in seinem Beutel und gab Alys etwas getrocknetes Fleisch, Käse und einen Apfel. Sie setzte sich auf einen Stein, Paul ließ sich auf einem Baumstumpf nieder, stand aber schon bald wieder auf. Er sah Alys an, dann den Wald, dann wieder Alys.
Paul hatte Angst. Alys hatte ihre eigene Angst ganz vergessen, als sie das Dorf hinter sich ließen. An ihre Stelle war ein schwerer Klumpen getreten, wie ein Fels lag er in Alys’ Brust und verlangsamte ihre Bewegungen. Doch Pauls Angst fachte auch ihre eigene wieder an. Alys spürte sie wie einen Fingernagel, der ihr über den Rücken fuhr. Sie beendete ihre Mahlzeit und stand auf.
Paul saß schon wieder auf dem Wagen und wartete nur noch darauf, sie hinaufzuheben. Die Sonne neigte sich bereits dem Horizont entgegen und Paul drehte den Kopf ständig von links nach rechts wie ein nervöser Vogel. Dann, als spürte er, dass Alys ihn beobachtete, hielt er plötzlich inne. »Fürchte dich nicht, hübsche Alys«, sagte er lächelnd. »Wir sind bald in Schafsdorf, dort sind wir dann sicher.«





























