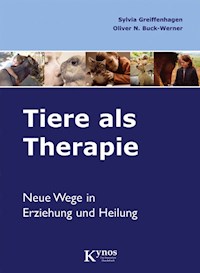
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kynos
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Endlich wieder auf dem Markt: Das deutsche Standardwerk zum Thema Tiere in Therapie und Pädagogik in aktualisierter Neuausgabe. Tiere können helfen, das Leben zu bewältigen: bei Schulangst und Autismus, Depressionen und Altersverwirrung, Herzkrankheiten und Sprachstörungen, Kontaktschwäche und Hyperaktivität. Davon berichtet das Buch mit lebendigen Beispielen. Gleichzeitig liefert es grundlegende Einsichten in das Zusammenleben von Menschen und Tieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sylvia Greiffenhagen &
Oliver N. Buck-Werner
TIERE ALS THERAPIE
Neue Wege in
Erziehung und Heilung
KYNOS VERLAG
© 2007 KYNOS VERLAG Dr. Dieter Fleig GmbH, Mürlenbach www.kynos-verlag.de
ebook-Ausgabe der Printversion (epub)
ISBN 978-3-942335-32-4
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort und Einführung
Leben mit Tieren
Pet facilitated therapy – eine neue Disziplin
Kulturgeschichtliche Phasen der Mensch-Tier-Beziehung
Domestikation
Du-Evidenz
Erste Beispiele tiergestützter Erziehung und Heilung
Tiergestützt – philosophisch betrachtet
Freude mit Tieren
Wirkungen von Tieren auf die menschliche Physis
Lachen als Therapie
Körperkontakt
Das Tier als ›sozialer Katalysator‹
Machen Tiere freundlicher?
Tiere können Ehen retten
Tiere als Familienmitglieder
Verständigung ohne Worte
Tiere fördern die Gesundheit
Ein nicht ganz ernstes Zwischenspiel
Pathologische Züge der Mensch-Tier-Beziehung
Tiere in der Stadt?
Wenn das Tier stirbt
Methodische Fragen
Großwerden mit Tieren
Kindheit in der modernen Gesellschaft
Das Tier als Quelle von Freude und Gesundheit
Das Tier als Erzieher
Erziehung zur Humanität
Das Tier als Freund und Gefährte
Kleinkinder, Kinder und Jugendliche mit Tieren
Tiere erleichtern Kontakt zu anderen Kindern
Sich ohne Worte verstehen
Tiere im Kindergarten
Tiere in der Schule
Tiere im Biologieunterricht
Tierbesuch in der Schule
Streichelgehege im Zoo, Spielplätze mit Tieren, Jugendfarmen und Schulbauernhöfe
Altwerden mit Tieren
Krisen im Alter
Ein Experiment aus der Frühzeit der Mensch-Tier-Forschung: Der Begonien-Wellensittich-Versuch
Tierbesitzer bleiben länger selbstständig
Weshalb Tiere für Alte?
Tierhaltung im Alter
Honey, Misty und Co: Frühe Versuche mit Tieren in stationären Alteneinrichtungen
Demente und depressive Patienten – Tiere in geriatrischen Therapien
Hundebesuch auf der Station
Freigehege und Mensch-Tier-Begegnungshäuser im Heim
Last oder Hilfe?
Behinderungen ertragen mit Tieren
Assistenztiere
Eine neue Sicht des behinderten Menschen
Zur Lebenssituation behinderter Menschen
Ziele und Leitlinien der Behindertenhilfe in Deutschland
Tiere als Faktor in den Leitlinien der Behindertenhilfe
Praktische Dienstleistungen
Früherkennung von Krankheit und Anfall
Psychische Hilfen – soziale Stützung
Das Begleittier als ständiger Gefährte
Begleittiere stiften menschliche Kontakte
Rechtliche Anerkennung des Behinderten-Begleithunds?
Besuchstier-Programme, Assistenztiere in stationären Behinderten-Einrichtungen und andere Mensch-Tier-Begegnungsmodelle
Behinderte Kinder und Tiere
Tiere in Einrichtungen für behinderte Kinder
Lernbehinderungen mit Tieren überwinden
Behinderte Kinder und Zoo-Pädagogik
Delfin, Esel, Ziege & Co.
Heilen mit dem Pferd
Chronisch Kranke mit Tieren
Gesundwerden mit Tieren
Wissenschaftliche Konzepte von Gesundheit
Tiere in Krankenhäusern
Tiere im psychiatrischen und psychotherapeutischen Umfeld
Erklärungen und Theorien
Tiere als Brücken zum verlorenen Paradies
In die Gesellschaft zurückfinden mit Tieren
Schwierige Kinder
Ziele tiergestützter Arbeit mit schwierigen Kindern
Vorbild für viele: Green Chimneys
Praktische Fallbeispiele
Jugendliche Straftäter
Suchthilfe
Strafvollzug
Reformen im Jugendstrafvollzug?
Tiere im Gefängnis
Tierquälerei?
Hygiene und andere Bedenken
Grundsätzliches zum Thema
Zusammenarbeit zwischen Human- und Veterinärmedizinern
Zoonosen kleiner Heimtiere (Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen)
Zoonosen der Ziervögel
Zoonosen der Reptilien
Zoonosen der Zierfische
Zoonosen der Katzen
Zoonosen der Hunde
Zoonosen der Rinder und Pferde
Immunsupprimierte Patienten und ihr Risiko
Es gibt auch andere Stimmen
Dem Tierschutzgedanken Rechnung tragen
Gesetzliche Grundlagen
Sozialkontakt und Verhaltensauffälligkeit
Prophylaxe von Krankheiten und Stress
Empfehlungen für die Haltung kleiner Heimtiere
Der Weg zum Behindertenbegleithund
Die ersten Schritte
Von Bedürfnissen und Prägung
In der Patenfamilie
Die Intensivausbildung
Hunde lernen nie aus ...
Ausbildungsprogramm für die Halter
Anforderungen an die Trainer
Der neue Tierarzt
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Über die Autoren
VORWORT UND EINFÜHRUNG
Viele dicke Aktenordner füllen inzwischen die Briefe und E-Mails mit Anfragen nach meinem 1991 erstmals erschienenen Buch »Tiere als Therapie«. Das Buch war damals zuerst als Leinenausgabe bei Droemer Knaur, zwei Jahre später auch als Taschenbuch beim Knaur Verlag herausgekommen. Es erhielt durchweg gute Besprechungen und verkaufte sich gut. Trotzdem entschloss sich der Verlag nicht zum Nachdruck, als ein Großteil der Auflage ausverkauft war. Einige Zeit waren noch Restexemplare zu ergattern, aber dann war das Buch restlos vergriffen.
Schließlich sah ich ein: Ich musste das Buch wieder herausbringen. Der Kynos Verlag hatte schon früh um die Rechte gebeten und bekam nun den Zuschlag. Leider zog sich die Bearbeitungszeit dann aus persönlichen Gründen noch jahrelang hin. Ich bin den Kollegen vom Kynos Verlag für ihre Geduld unendlich dankbar. Umso zufriedener macht es mich nun, das Buch wieder vor mir zu sehen. Es ist, so weit wie möglich, das ›alte‹, trägt aber natürlich der Weiterentwicklung des Arbeitsfelds ausreichend Rechnung.
Was hat sich im Arbeitsfeld Mensch-Tier-Beziehung inzwischen getan? Hier nur ein grober Überblick über Aspekte und Themen, die im Buch in verschiedenen Kapiteln ergänzt und vertieft werden:
Im Laufe des letzten Jahrzehnts erfuhren Praxisprojekte und wissenschaftliche Studien zum Thema »Tiere als Therapie« und »Mensch-Tier-Beziehung« im deutschsprachigen Raum einen großen Bedeutungszuwachs. Deutschland hat im internationalen Vergleich den Vorsprung anderer Nationen weitgehend aufholen können.
Die Zahl der Praxisprojekte sowie deren Qualität (im Blick auf ihr Reflexionsniveau, ihre Orientierung an festgelegten Qualitätsstandards, ihre Dokumentation) sind weitaus höher als im Erscheinungszeitraum der Erstauflage meines Buches Anfang der neunziger Jahre. Dieses günstige Urteil gilt für die wissenschaftliche Erörterung des Themas im deutschsprachigen Raum nur bedingt.
Eine Vernetzung der heterogenen Praxisprojekte, wie ich sie Anfang der neunziger Jahre vorschlug, hat auch im deutschsprachigen Raum inzwischen begonnen, kommt aber nur zögernd voran. Insgesamt überwiegen noch immer die individuellen Handlungsansätze, mit der Konsequenz einer unbefriedigenden Informationsweitergabe, mangelnden fachlichen Austauschs, mangelnder Bündelung von Ressourcen und Potenzialen, in der Folge auch einer entsprechend geringen politischen Durchsetzungskraft. Erst in jüngerer Zeit gibt es gemeinsame Symposien, die den fachlichen Austausch in Gang setzen wollen. Diesem Ziel dienen auch erste Versuche, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die berufliche Praxis zu etablieren. Aber von gemeinsamen Standards oder gemeinsamen ethischen Grundsätzen, auf die sich alle Akteure des deutschsprachigen Raums einigen könnten, kann auch heute noch keine Rede sein.
Die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas hinkt der Entwicklung der Praxis hinterher. Auch heute noch gibt es nur wenige Theorien, die das Phänomen einer gelingenden – und, wenn es gut geht, beide Seiten beglückenden – Mensch-Tier-Beziehung erklären. In einigen der beteiligten Fachdisziplinen und auf einigen Handlungsfeldern wurden zwar stimmige theoretische Ansätze entwickelt (insbesondere in den Disziplinen Ethologie und Psychologie), aber eine Integration zu einer grundlegenden Theorie der Mensch-Tier-Beziehung ist noch längst nicht in Sicht.
Nur in Teilen erscheint mir im deutschsprachigen Raum bisher auch die Integration von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Mensch-Tier-Forschung in den aktuellen Diskurs der jeweiligen Fachöffentlichkeit gelungen, am ehesten wohl auf den wissenschaftlichen und praktischen Feldern der Ethologie oder der Gerontologie. Eine gute Akzeptanz der Ergebnisse aus dem Forschungsfeld »Mensch-Tier-Beziehung« hängt allgemein eher mit der Akzeptanz der Forscher in deren Hausdisziplin (also Ethologie, Gerontologie, Psychologie, Sozialpädagogik etc.) zusammen als mit ihren Studien im Mensch-Tier-Bereich. Die Gruppe der in der breiteren Fachöffentlichkeit bekannten Mensch-Tier-Forscher ist im deutschsprachigen Raum nach wie vor klein. Studien zum Thema Mensch-Tier fördern die wissenschaftliche Reputation nur sehr bedingt. ›Leisten‹ kann sich dieses Thema eigentlich nur, wer keine Forschungskarriere anstrebt – oder wer sein Ziel schon erreicht hat und sich dieses Themas (neben anderen, wichtigeren) eher als eines Steckenpferds annimmt.
Eine bessere Vernetzung von wissenschaftlichen Studien zum Thema Mensch-Tier steht, wie eine bessere Vernetzung der Praxis, gleichfalls noch aus. Gegenwärtig entstehen an deutschen Hochschulen zwar zahlreiche Examens-, Diplom- und Magisterarbeiten; diese werden aber bisher kaum systematisch gesammelt. Ob eine Arbeit über die Hochschule hinaus ein interessiertes Fachpublikum findet, bleibt gewöhnlich dem Zufall überlassen. Einige Vereine nehmen sich dieses Mangels jetzt an, indem sie Belegexemplare erbitten, und das Internet liefert über verschiedenste Fundstellen hohe Trefferquoten zum Thema, freilich ohne eine Bewertung der Qualität der einzelnen Studien.
Insgesamt steigt aber die Zahl der wissenschaftlichen Studien auch im deutschsprachigen Raum gegenwärtig rasch an. Hilfreich (und das gleichermaßen inhaltlich und politisch-strategisch) erscheint mir die Tatsache, dass viele verschiedene wissenschaftliche Disziplinen das Thema in den letzten Jahren neu – oder wieder – entdecken: Philosophie, Theologie und Soziologie, Anthropologie, Historische Verhaltensforschung und Ethnologie, menschliche und Tierverhaltensforschung, Volkskunde und Kulturgeschichte, Pädagogik, Sonder- und Sozialpädagogik, Biologie und Zoologie, Tiermedizin und Humanmedizin, neuerdings auch die Sportwissenschaft. Allerdings weiß man im Allgemeinen immer noch wenig von den jeweiligen ›anderen‹ Themen-Zugängen. Interdisziplinarität ist erst in Ansätzen erreicht.
Forschung braucht Geld. Auf dem Forschungsfeld »Mensch-Tier-Beziehung« fließen öffentliche Mittel bisher nur spärlich, Studien zum Thema Mensch-Tier sind deshalb weitgehend auf private Sponsoren angewiesen. Die Auswahl von Aspekten und Feldern, auf denen geforscht werden kann, orientiert sich deshalb eher an der erwarteten Wirksamkeit in der breiteren Öffentlichkeit als in der Fachöffentlichkeit. Themen sind also eher alte Menschen und Kinder als Behinderte oder Gefängnisinsassen. Auch die Diskussion der wenigen Forschungsbefunde konzentriert sich aus diesem Grund eher auf Publikums- denn auf Fachzeitschriften. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, aber das Forschungsfeld verliert auf diese Weise in der Fachwelt an Seriosität und in der allgemeinen Öffentlichkeit die wünschenswerte Breite.
Meines Erachtens zu wenig berücksichtigt wird in Forschung und Praxis noch immer das Wohlbefinden der Tiere im Kontext der Mensch-Tier-Beziehung. Begriffe wie »art- bzw. tierangemessen« aus dem Tierschutzgesetz, »Leid«, »Wohlbefinden« und »Glück« bedürfen der Interpretation in Praxis und Forschung. Besonders die Tiermedizin ist hier gefordert, zum Beispiel auf dem Gebiet einer Messung von Stress, etwa bei der Ausbildung sogenannter Behindertenbegleithunde. Tatsächlich zeigt sich aber eine große Distanz der Tiermedizin von solcherlei Fragen. Ich wollte in der Neuausgabe des Buchs aus diesem Grund die früher nur skizzenhaft gestreiften Aspekte des Tiers in der Mensch-Tier-Beziehung erheblich verstärken. Als Ko-Autor konnte ich Oliver N. Buck-Werner gewinnen, einen praktizierenden Tierarzt, der vor Jahren mit mir eine Studie zu Tieren in der Behindertenhilfe erarbeitet hatte und seit dieser Zeit dem Mensch-Tier-Thema auf verschiedensten Wegen treu geblieben war. Wir haben das frühere Buch durch mehrere Kapitel zum Thema des Tieres in der Mensch-Tier-Beziehung ergänzt.
Im Übrigen folgen wir bei der Neubearbeitung des Buchs der Argumentationsund Kapitelstruktur des alten Buches weitgehend, haben es lediglich behutsam aktualisiert, korrigiert und ergänzt. Viele der Fallbeispiele, die im früheren Buch aus dem englischen, amerikanischen oder australischen Raum bezogen wurden, konnten durch Erfahrungen aus Praxisprojekten im deutschsprachigen Raum ersetzt werden. Das ist ein gutes Zeichen und stimmt hoffnungsfroh im Blick auf den weiteren Fortgang des Praxis- und Forschungsfelds Mensch-Tier-Beziehung. Wir wünschen uns, dass auch das neue Buch, so wie früher das alte, zu einer guten Entwicklung beitragen kann.
Esslingen im September 2007
Sylvia Greiffenhagen
LEBEN MIT TIEREN
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem starb seine Mutter. Da legte es sich ins Bett und sprach mit niemanden mehr. Sein Vater rief viele Ärzte herbei, aber keiner konnte helfen. Eines Tages kam eine Katze ins Zimmer, setzte sich auf ihr Bett und sagte: »Streichle mich!« Das Kind regte sich nicht. Da sagte die Katze noch einmal: »Streichle mich!« Aber das Mädchen sah starr vor sich hin. Da legte die Katze sich auf seine Brust, schnurrte und kitzelte es mit dem Schwanz an der Nase. Da lachte das Kind und streichelte die Katze. Danach stand es auf und wurde wieder gesund.
Es war einmal ein alter Mann, dem gefiel das Leben nicht mehr. Er wusch sich nicht, kochte kein Essen und ging nie aus dem Haus. Da kam ein großer Hund und sagte: »Ich habe Hunger.« Der Mann ging in die Küche und kochte Brei für ihn. Als der Hund gegessen hatte, sagte er: »Putz mir das Fell.« Der Mann nahm seine Bürste und striegelte den Hund. Als sein Fell glänzte, sagte der Hund: »Geh mit mir spazieren.« Der Mann nahm seinen Hut und ging mit ihm hinaus. Das gefiel dem Hund, und er blieb bei ihm, und der Mann wurde seines Lebens wieder froh.
Es war einmal ein Mann, der hatte Unrecht getan und saß im Gefängnis. Niemand hatte ihn gern, weil er die anderen Gefangenen schlug und auf die Wärter losging. Eines Tages kam ein Vogel, setzte sich an das Fenster der Zelle und sang ein Lied. Der Mann nahm einige Brösel von seinem Brot und gab sie dem Vogel. Der ließ es sich schmecken und kam am nächsten Tag wieder. Schließlich trippelte er durch die Gitterstäbe, setzte sich auf die Schulter des Mannes und knabberte an seinem Ohr. »Komm wieder, Vogel, und bleib bei mir«, sagte der Mann. Der Vogel blieb bei ihm. Von der Zeit an wurde der Mann freundlich, und alle mochten ihn.
Dies sind keine Märchen, sondern wahre Geschichten, Beispiele für tiergestütztes Heilen und Helfen.1 Das Wort ›tiergestützt‹ ist die Übersetzung des englischen Ausdrucks ›pet facilitated‹.
PET FACILITATED THERAPY – EINE NEUE DISZIPLIN
Tiergestützte Pädagogiken und Therapien wurden zuerst in angelsächsischen Staaten erprobt und angewandt. Auch die wissenschaftliche Erforschung des helfenden und heilenden Einsatzes von Tieren begann dort. Sie folgte der praktischen Anwendung nach, deren Erfolge die Wissenschaft in Erstaunen versetzte und in verschiedenen Disziplinen Forschungsinitiativen in Gang brachten.
In vergangenen Jahrhunderten wusste die Menschheit noch, dass ein »tier dem herze wôl macht« (Walther von der Vogelweide):2 Aus Belgien ist der Einsatz von Tieren für therapeutische Zwecke seit dem 8. Jahrhundert bekannt; in England gründeten Quäker im 18. Jahrhundert eine Anstalt für Geisteskranke, in der die Patienten kleine Gärten versorgten und Kleintiere hielten.3 Schon vor 200 Jahren empfahlen die Mönche des Klosters York: »Den in der Seele und am Körper Beladenen hilft ein Gebet und ein Tier.«4 Im 19. Jahrhundert entstand das Epileptiker-Zentrum im deutschen Bethel, das von Anfang an auf die heilenden Kräfte von Tieren vertraute und Hunde und Katzen, Schafe und Ziegen hielt.5 Doch diese Versuche waren entweder vergessen oder, wie im Fall Bethel, nicht dokumentiert und damit für die wissenschaftliche Erforschung ohne Wert. Die Weisheit der Alten musste von modernen Wissenschaftlern neu entdeckt werden. Zunächst blieb es bei einzelnen Versuchen und Vermutungen. Theorien wurden erst später entwickelt.
In der Praxis allerdings kam man rasch voran, und es ist nicht übertrieben, von einer Revolution zu sprechen, die weite Gebiete von Pädagogik, Therapie und Resozialisation erfasste: Die Einsicht, dass Tiere den Menschen nicht nur Fleisch liefern, Lasten tragen und Gesellschaft leisten, sondern helfen und heilen können, führte zu einer weltweiten Bewegung, die in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch Deutschland erfasste.
Alles begann Anfang der sechziger Jahre mit wenigen Zeitungsartikeln und ersten, noch kurzen und zuweilen belächelten wissenschaftlichen Berichten. Ein Buch des amerikanischen Kinderpsychotherapeuten Boris M. Levinson über seine Erfahrung mit Tieren als Kotherapeuten brachte 19696 dann den Durchbruch: Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Disziplinen und Angehörige verschiedener Heilberufe begannen Experimente, Versuchsreihen, Dokumentationen. Das Psycho-logen-Ehepaar Sam und Elizabeth Corson, die Soziologin Erika Friedmann und der Mediziner Aaron H. Katcher setzten später mit ihren Berichten über die heilsame Wirkung von Tieren auf kranke und einsame Menschen die medizinische Welt in Erstaunen.7 Der Begriff ›pet facilitated therapy‹ wurde zum Schlagwort eines neuen Wissenschaftszweigs, der ›Mensch-Tier-Beziehung‹. Anfang der achtziger Jahre legten Veterinärmediziner der Universität Pennsylvania eine erste, rund vierzigseitige kommentierte Bibliographie zum Thema vor.
Ende der siebziger Jahre gründeten Mediziner, Verhaltensforscher, Psychologen, Psychotherapeuten und Gerontologen aus den Vereinigten Staaten und England eine Gesellschaft, die sich die weitere Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung zur Aufgabe setzte. 1980 organisierte sie erstmals einen Kongress mit dem Thema »Human/Companion Animal Bond«, der in London stattfand und beträchtliches Aufsehen bei Experten und Laien erregte. Heute umfasst die Gesellschaft Unterorganisationen in fast allen Staaten der westlichen Welt. Zahlreiche Publikationen und internationale Symposien (unter anderem Philadelphia, Wien, Boston, Monaco, Prag, Glasgow) begründeten im Laufe der achtziger und neunziger Jahre den wissenschaftlichen Ruf der Gesellschaft und ihres neuen Wissenschaftszweigs ›Mensch-Tier-Beziehung‹.
Die Praxis kam rascher voran als die Theorie. In allen angelsächsischen Ländern entstanden in kürzester Zeit ›Pet Visiting Programs‹: Tierliebende Gruppen und Institutionen wie Tierschutzvereine oder Hundezüchterverbände besuchen mit eigens für diesen Zweck ausgebildeten ›Therapie-Tieren‹ Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser oder psychiatrische Anstalten. Sie unterhalten Streichelzoos für Großstadtkinder, vermitteln Heimtiere für kranke und einsame Menschen und bilden sogar einen ›Service-Hund‹ aus, der Körperbehinderten bei ihrer Arbeit im Hause zur Hand geht: als Gefährte und Diener zugleich.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























