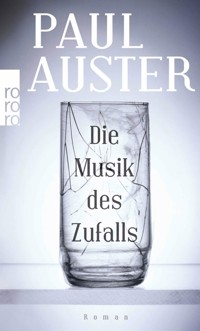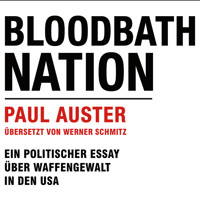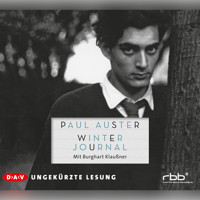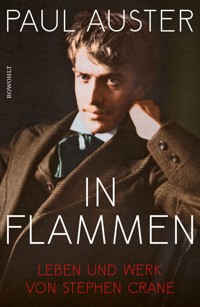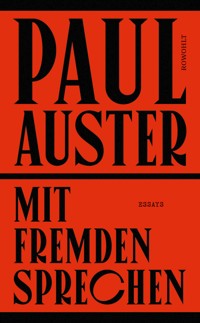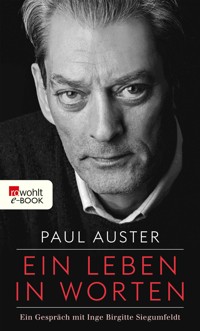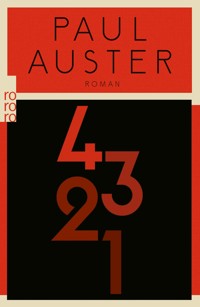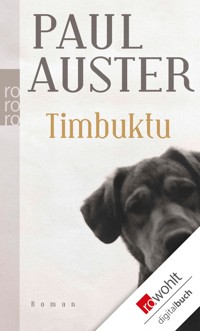
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mr. Bones, die spitzohrige Promenadenmischung, sieht die Welt durch die scharfen Augen dessen, der sie stets von unten hat betrachten müssen. Und er ist nicht auf den Mund, Pardon, auf die Schnauze gefallen. Seine weisen Erkenntnisse über das Hundeleben, das wir alle führen, sind ebenso amüsant wie traurig — denn in ihrem augenzwinkernden Humor ist ihnen jede Sentimentalität fremd. «Austers berührendstes, gefühlvollstes Buch.» (New York Times) «Ein großer Erzähler erzählt hier eine kleine Geschichte, und er erzählt sie groß.» (Elke Heidenreich) «Großartige Prosa.» (New York Times) «Eine poetisch versierte Promenadenmischung.» (Stern)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Ähnliche
Paul Auster
Timbuktu
Roman
Aus dem Englischen von Peter Torberg
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Robert McCrum
1
Mr. Bones wusste, dass Willys Tage auf dieser Welt gezählt waren. Er trug den Husten nun schon seit über sechs Monaten in sich, und es sah nicht so aus, als würde er ihn je wieder los. Langsam, aber unausweichlich hatte dieser Husten ein Eigenleben angenommen und sich, ohne je besser zu werden, von einem leisen, gurgelnden Rasseln in der Lunge am 3. Februar in den keuchenden Auswurf und die würgenden Krämpfe vom Hochsommer verwandelt. Das war schlimm genug, aber in den vergangenen zwei Wochen hatte sich ein neuer Ton in diese Bronchialmusik eingeschlichen – etwas Festes, Kieselhartes und Schlagendes –, und nun jagte ein Anfall den anderen. Mr. Bones rechnete jedes Mal schon fast damit, dass Willy unter dem explosionsartigen Druck gegen seine Rippen die Brust platzen würde. Als Nächstes würde es mit dem Blut losgehen, und als dieser verhängnisvolle Augenblick eines Samstagnachmittags schließlich kam, war es, als hätten sämtliche Engel im Himmel auf einmal den Mund aufgetan und zu singen begonnen. Mr. Bones hatte es mit eigenen Augen gesehen, dort am Straßenrand irgendwo zwischen Washington und Baltimore: Willy hustete ein paar jämmerliche Brocken roten Auswurfs in sein Taschentuch, und da wusste Mr. Bones, dass jede Hoffnung zunichte war. Der Hauch des Todes hatte sich auf Willy G. Christmas gesenkt, und das Ende nahte, so sicher, wie die Sonne eine Lampe in den Wolken war, die täglich an- und ausging.
Was konnte ein armer Hund da schon tun? Mr. Bones war seit seinen frühesten Welpentagen bei Willy gewesen, und eine Welt ohne sein Herrchen schien ihm unvorstellbar. Willy war in jedem Gedanken, jeder Erinnerung, jedem bisschen Erde und Luft präsent. Alte Gewohnheiten sind nicht leicht auszurotten, und auch der Hund ist ein Gewohnheitstier, aber es waren nicht nur Mr. Bones’ Liebe oder Treue, die seine Zukunftsangst verursachten. Es war das blanke ontologische Entsetzen. Eine Welt ohne Willy – da konnte sie genauso gut gleich ganz aufhören zu existieren.
In diesem Dilemma steckte Mr. Bones also an jenem Augustmorgen, als er mit seinem kranken Herrchen durch die Straßen von Baltimore trottete. Ein Hund allein war nicht besser dran als ein toter Hund, und wenn Willy erst seinen letzten Schnaufer getan hatte, konnte er eigentlich nur noch auf sein eigenes baldiges Ende warten. Willy hatte ihm seit Tagen klarzumachen versucht, dass er sich in Acht nehmen müsse, und Mr. Bones konnte die Litanei schon auswendig: wie man den Hundefängern und Streifenpolizisten entging, den grünen Minnas und Zivilstreifen, den Heuchlern von den sogenannten Tierschutzvereinen. Egal, was sie einem vorsülzten, das Wort «Tierheim» bedeutete nichts Gutes. Es begann mit Netzen und Betäubungsgewehren, wuchs sich zu einem Albtraum voller Käfige und Neonlicht aus und endete mit einer tödlichen Spritze oder einer Dosis Giftgas. Wenn Mr. Bones irgendeiner erkennbaren Rasse angehört hätte, wäre ihm vielleicht eine Chance im täglichen Schönheitswettbewerb um einen neuen Besitzer geblieben, aber Willys Kumpel war der reinste Gencocktail – teils Collie, teils Labrador, teils Spaniel, teils Promenadenmischung –, und was die Sache noch schlimmer machte, sein zottiges Fell hing voller Kletten, er roch nicht gut aus dem Maul, und der Blick aus seinen blutunterlaufenen Augen kündete von chronischer Traurigkeit. Niemand würde ihn retten wollen. Wie der obdachlose Barde zu sagen pflegte: Die Zukunft ist in Stein gemeißelt. Wenn Mr. Bones nicht fix ein anderes Herrchen fand, war aus die Maus.
«Und wenn die mit dem Betäubungsgewehr dich nicht erwischen», fuhr Willy fort, während er sich an jenem nebligen Morgen in Baltimore an eine Laterne klammerte, um nicht umzufallen, «gibt’s noch tausend andere Möglichkeiten. Ich warne dich, Kimo sabe. Such dir ’nen neuen Gig, sonst sind deine Tage gezählt. Schau dich doch bloß mal in diesem Kaff um: an jeder Straßenecke ein China-Restaurant, und wenn du glaubst, dass denen dadrin nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn du vorbeispazierst, dann hast du nicht den blassesten Schimmer von der asiatischen Küche. Die stehen auf Hund, Freundchen. Die Köche jagen Streuner und schlachten sie in der Gasse gleich hinter der Küche – zehn, zwanzig, dreißig die Woche. Auf der Speisekarte steht dann vielleicht Ente oder Schwein, aber die Insider wissen Bescheid, und Feinschmecker lassen sich keine Sekunde hinters Licht führen. Wenn du nicht als Ente süßsauer enden willst, solltest du dir ganz genau überlegen, ob du vor so einer China-Fressbude mit dem Schwanz wedelst. Hast du kapiert, Mr. Bones? Erkenne deinen Feind – und dann mach einen weiten Bogen um ihn.»
Mr. Bones hatte kapiert. Mr. Bones verstand alles, was Willy zu ihm sagte. Das tat er schon, solange er zurückdenken konnte, und mittlerweile beherrschte er dieses Engelsch so gut wie irgendein anderer Einwanderer, der seit sieben Jahren im Land ist. Natürlich war es eine Fremdsprache und unterschied sich deutlich von der, die ihm seine Mutter beigebracht hatte, doch obwohl seine Aussprache einiges zu wünschen übrig ließ, kannte er sich bestens mit den Feinheiten von Grammatik und Syntax aus. Bei einem Tier von Mr. Bones’ Intelligenz war das nicht weiter komisch oder ungewöhnlich. Die meisten Hunde eignen sich ziemlich gute Kenntnisse der Zweibeinersprache an, aber in Mr. Bones’ Fall kam noch der Vorteil hinzu, dass er mit einem Herrchen gesegnet war, das ihn nicht als untergeordnetes Wesen behandelte. Sie waren von Anfang an Kumpel gewesen, und wenn man berücksichtigte, dass Mr. Bones nicht nur Willys bester, sondern auch sein einziger Freund war, und zudem wusste, dass Willy sich gern reden hörte und ein lupenreiner Logomane war, der vom frühen Morgen, wenn er die Augen aufschlug, bis zum späten Abend, wenn er betrunken einschlief, kaum je zu plaudern aufhörte, dann war vollkommen klar, warum sich Mr. Bones in dieser Sprache so heimisch fühlte. So betrachtet war es nur merkwürdig, dass er sie nicht besser sprechen gelernt hatte. Nicht, dass er sich keine ernsthafte Mühe gegeben hätte, aber die Biologie war gegen ihn, und aufgrund der Gestalt von Schnauze, Zähnen und Zunge, mit der ihn das Schicksal bedacht hatte, war das Beste, was er hervorbringen konnte, ein Kläffen, Gähnen und Jaulen, was ein ziemlich irres, verworrenes Gebrabbel ergab. Ihm war schmerzlich bewusst, wie unverständlich diese Laute waren, aber Willy ließ ihn stets ausreden, und letzten Endes zählte nur das. Mr. Bones konnte zu allem seinen Senf dazugeben und sich der Aufmerksamkeit seines Herrchens sicher sein, und wenn man Willys Gesicht gesehen hätte, während er seinem Freund zuschaute, der sich mühte, sich nach Art der menschlichen Rasse verständlich zu machen, hätte man schwören können, dass er jedes einzelne Wort verstand.
An jenem trüben Sonntag in Baltimore hielt Mr. Bones allerdings hübsch die Schnauze. Ihnen blieben nur noch ein paar gemeinsame Tage, vielleicht Stunden, und dies war nicht der rechte Augenblick, lange Reden zu schwingen oder Hirngespinste auszubrüten und solchen Quatsch. Gewisse Situationen verlangten Takt und Disziplin, und in ihrer gegenwärtigen Klemme war es erheblich besser, stumm zu bleiben und den braven, treuen Hund zu spielen. Er ließ sich ohne zu murren die Leine anlegen. Er beklagte sich nicht darüber, dass er in den letzten sechsunddreißig Stunden nichts zu fressen bekommen hatte; er schnupperte nicht nach weiblichen Düften; er pinkelte nicht an jede Laterne und jeden Hydranten. Er trabte einfach neben Willy her und suchte mit ihm auf den verlassenen Boulevards die 316 Calvert Street.
Mr. Bones hatte nichts gegen Baltimore an sich. Es roch dort nicht schlimmer als in irgendeiner der anderen Städte, in denen sie über die Jahre gehaust hatten, aber obwohl ihm der Zweck der Reise klar war, bekümmerte es ihn, dass ein Mann seine letzten Augenblicke auf Erden freiwillig an einem Ort verbringen wollte, wo er noch nie gewesen war. Einem Hund wäre ein solcher Schnitzer nie unterlaufen. Er hätte seinen Frieden mit der Welt gemacht und dann dafür gesorgt, dass er den Geist auf vertrautem Terrain aufgab. Aber Willy hatte noch zwei Dinge zu erledigen, bevor er starb, und mit der ihm eigenen Sturheit hatte er sich in den Kopf gesetzt, dass es nur einen Menschen gab, der ihm dabei helfen konnte. Dieser Mensch hieß Bea Swanson, und da besagte Bea Swanson nach letztem Wissensstand in Baltimore lebte, waren sie hergekommen, um sie zu suchen. Alles schön und gut, aber wenn Willys Plan schiefging, würde Mr. Bones allein in dieser Stadt der crab cakes und der Marmorstufen enden, und was dann? Mit einem Anruf wäre die Sache in einer halben Minute erledigt gewesen, aber Willy hatte eine geradezu philosophische Abneigung dagegen, in wichtigen Angelegenheiten zu telefonieren. Lieber lief er tagelang, statt eines dieser Dinger in die Hand zu nehmen und mit jemandem zu sprechen, den er nicht sehen konnte. Also zogen sie nun zweihundert Meilen später ohne Stadtplan durch die Straßen von Baltimore und suchten nach einer Anschrift, die es vielleicht gar nicht gab.
Die zwei Dinge, die Willy noch vor seinem Tod zu erledigen hoffte, waren von gleichermaßen entscheidender Bedeutung, und da die Zeit zu knapp geworden war, sie einzeln in Angriff zu nehmen, hatte er sich etwas ausgedacht, was er das Chesapeake-Gambit nannte: ein allerletzter Trick, um beide Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Von der ersten Aufgabe war schon auf den vorangehenden Seiten die Rede: eine neue Bleibe für seinen strubbligen Begleiter zu finden. Die zweite bestand darin, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln und sicherzustellen, dass seine Manuskripte in gute Hände kamen. Im Augenblick lag sein Lebenswerk in einem Schließfach am Greyhound-Terminal in der Fayette Street, zweieinhalb Blocks nördlich von dort, wo Willy und Mr. Bones standen. Der Schlüssel steckte in Willys Tasche, und wenn er nicht jemanden fand, der es wert war, dass man ihm diesen Schlüssel anvertraute, dann würde jedes Wort, das er je geschrieben hatte, wie herrenloses Gepäck auf dem Müll landen.
In den dreiundzwanzig Jahren, seit er sich den Zunamen Christmas zugelegt hatte, hatte Willy die Seiten von vierundsiebzig Notizbüchern mit seinen Texten gefüllt. Darunter waren Gedichte, Kurzgeschichten, Essays, Tagebucheinträge, Epigramme, autobiographische Betrachtungen und die ersten achtzehnhundert Zeilen von Wandertage, einem Versepos, an dem er gerade arbeitete. Der Großteil dieses Werkes war am Küchentisch in der Wohnung seiner Mutter in Brooklyn entstanden, doch seit ihrem Tod vor vier Jahren war er gezwungen gewesen, unter freiem Himmel zu schreiben, und hatte oft in öffentlichen Parks und staubigen Gassen gegen die Elemente gekämpft, um seine Gedanken zu Papier zu bringen. Im tiefsten Inneren gab sich Willy keiner Selbsttäuschung hin. Er wusste, dass er eine gepeinigte Seele war und für diese Welt nicht taugte, aber er wusste auch, dass in diesen Notizbüchern viel gute Arbeit steckte, und zumindest in dieser Hinsicht brauchte er sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Wenn er ein bisschen gewissenhafter seine Medikamente genommen hätte, oder wenn er ein bisschen kräftiger gewesen wäre, oder wenn ihm der Whiskey und der Schnaps und das Treiben in den Bars nicht so zugesagt hätten, wäre vielleicht noch mehr gute Arbeit dabei herausgekommen. Schon möglich, aber nun war es zu spät, über Fehler und Versäumnisse zu jammern. Er hatte den letzten Satz aus seiner Feder fließen lassen, und seine Uhr war beinahe abgelaufen. Mehr als die Wörter in dem Schließfach hatte er nicht vorzuweisen. Wenn sie verlorengingen, wäre es, als hätte er nie gelebt.
Und hier kam Bea Swanson ins Spiel. Willy wusste, dass er nur im Dunkeln stocherte, aber falls er sie wirklich fand, würde sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihm zu helfen, davon war er fest überzeugt. Einst, als die Welt noch ganz jung gewesen war, hatte Mrs. Swanson ihn in der Highschool im Englischen unterrichtet, und wenn sie nicht gewesen wäre, wer weiß, ob er dann je den Mut aufgebracht hätte, sich für einen Schriftsteller zu halten. Damals war er noch William Gurevitch gewesen, ein schmächtiger Sechzehnjähriger mit einer Leidenschaft für Bücher und BeBop, und sie hatte ihn unter ihre Fittiche genommen und seine ersten Arbeiten so über den grünen Klee gelobt, dass deren wahrer Wert darunter schier verschwand und er sich schon vorgekommen war wie der kommende Hoffnungsträger der amerikanischen Literatur. Die Frage, ob sie ihm damit recht oder unrecht tat, spielt keine Rolle, denn in diesem Alter zählen Ergebnisse weniger als Erwartungen; Mrs. Swanson hatte das Fünkchen Talent in seinen Ansätzen erkannt, und kein Mensch auf der Welt kann etwas werden, wenn nicht jemand an ihn glaubt. Das ist eine Tatsache, und während der Rest der Klasse in der Midwood-Highschool in Mrs. Swanson nur eine füllige Frau um die vierzig mit speckigen Armen sah, die jedes Mal schwabbelten, wenn sie etwas an die Tafel schrieb, fand Willy sie schön, ein Engel, der vom Himmel gekommen war und menschliche Gestalt angenommen hatte.
Doch als im Herbst die Schule wieder anfing, war Mrs. Swanson nicht mehr da. Ihr Mann hatte eine Arbeit in Baltimore angeboten bekommen, und da Mrs. Swanson nicht nur Lehrerin, sondern auch Ehefrau war, blieb ihr keine andere Wahl, als Brooklyn zu verlassen und dorthin zu gehen, wohin Mr. Swanson ging. Für Willy war das ein schwerer Schlag gewesen, aber es hätte auch schlimmer kommen können, denn obwohl seine Mentorin nun weit weg war, vergaß sie ihn nicht. In den folgenden Jahren unterhielt sie eine lebhafte Korrespondenz mit ihrem jungen Freund, las und kommentierte weiterhin die Manuskripte, die er ihr schickte, vergaß seine Geburtstage nicht, zu denen sie ihm alte Charlie-Parker-Platten schenkte, und schlug ihm kleinere Literaturmagazine vor, bei denen er seine Arbeiten zur Veröffentlichung einreichen sollte. Das überschwängliche, geradezu schwärmerische Empfehlungsschreiben, das sie ihm im Abschlussjahr schrieb, half ihm, ein volles Stipendium an der Columbia University zu ergattern. Mrs. Swanson war Willys Muse, Beschützerin und Talisman in einer Person, und an diesem Punkt in seinem Leben gab es offenkundig nichts, was er nicht erreichen konnte. Doch dann kam der Ausraster im Jahre 1968, der schizophrene Schub, der wilde Tanz der nackten Wahrheit auf dem Hochspannungsdraht. Man sperrte ihn in eine Klinik, und nach sechsmonatiger Schockbehandlung und all den Psychopharmaka wurde er nie wieder ganz der Alte. Er schloss sich der Armee der herumirrenden Versehrten an, und obwohl er, ob gesund oder krank, ununterbrochen weiter Gedichte und Kurzgeschichten produzierte, konnte er sich nur noch selten dazu aufraffen, Mrs. Swansons Briefe zu beantworten. Die Gründe spielen keine Rolle. Vielleicht war es ihm peinlich, mit ihr in Kontakt zu bleiben. Vielleicht war er abgelenkt, hatte anderes im Kopf. Vielleicht verlor er das Vertrauen in die Post und verdächtigte die Zusteller, in den Briefen herumzuschnüffeln. Jedenfalls reduzierte sich seine einst umfangreiche Korrespondenz mit Mrs. Swanson auf ein Minimum. Ein, zwei Jahre lang bestand sie nur noch aus einer gelegentlichen Postkarte, dann aus dem vorgedruckten Weihnachtsgruß, und 1976 war sie ganz eingeschlafen. Seitdem hatten sie kein Wort mehr gewechselt.
Mr. Bones wusste das alles, deshalb machte er sich ja solche Sorgen. Siebzehn Jahre waren seitdem vergangen. Damals war noch Gerald Ford Präsident gewesen, und er selbst sollte erst zehn Jahre später auf die Welt kommen. Wollte Willy ihn für dumm verkaufen? Wenn man sich mal vorstellte, was in der Zeit alles passieren konnte. Wenn man sich mal vorstellte, was in siebzehn Stunden oder siebzehn Minuten alles passieren konnte – von siebzehn Jahren ganz zu schweigen. Zuallermindest war Mrs. Swanson doch bestimmt umgezogen. Das alte Mädchen würde inzwischen auf die siebzig zugehen, und wenn sie nicht völlig senil in einem Trailerpark in Florida lebte, schien es ziemlich wahrscheinlich, dass sie längst gestorben war. Das hatte auch Willy einräumen müssen, als sie sich an jenem Morgen in Baltimore auf den Weg gemacht hatten, aber zum Henker, hatte er gesagt, es sei nun mal ihre einzige Chance, und da das Leben sowieso nur ein Spiel sei, warum nicht alles auf eine Karte setzen?
Ach, Willy. Er hatte schon so viele Geschichten erzählt und mit so vielen verschiedenen Stimmen gesprochen, dass Mr. Bones längst nicht mehr wusste, was er noch glauben sollte. Was war wahr und was gelogen? Eine schwierige Frage bei einem so schillernden und schrulligen Typen wie Willy G. Christmas. Mr. Bones konnte sich zwar für das verbürgen, was er mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erfahren hatte, aber Willy und er waren erst seit sieben Jahren zusammen, und die Fakten aus den vorangegangenen achtunddreißig waren mehr oder weniger ungesichert. Wenn Mr. Bones nicht als Welpe mit Willys Mutter unter einem Dach gelebt hätte, läge die ganze Geschichte im Dunkeln, aber indem er Mrs. Gurevitch gut zugehört und ihre Aussagen mit denen ihres Sohnes verglichen hatte, war es ihm gelungen, sich ein halbwegs klares Bild davon zusammenzustückeln, wie Willys Welt vor seiner Zeit ausgesehen hatte. Tausend Details fehlten darin, tausend andere waren verworren, aber Mr. Bones hatte eine Ahnung davon, auch einen Riecher dafür, wie sie gewesen sein mochte und wie nicht.
Sie war zum Beispiel nicht reich gewesen und auch nicht fröhlich, und oft hatte ein Geruch von Verbitterung und Verzweiflung in der Wohnung gehangen. Angesichts dessen, was die Familie vor ihrer Ankunft in Amerika hatte durchmachen müssen, schien es ein Wunder zu sein, dass David Gurevitch und Ida Perlmutter überhaupt ein Kind gezeugt hatten. Von den sieben Kindern, die Willys Großeltern zwischen 1910 und 1921 in Warschau und Lodz gezeugt hatten, hatten nur sie beide den Krieg überlebt. Sie allein hatten keine Zahlen auf die Unterarme tätowiert bekommen, sie allein hatten das Glück gehabt, fliehen zu können. Nicht, dass sie es deswegen leicht gehabt hätten; Mr. Bones hatte genug Geschichten darüber gehört, bei denen sich ihm das Nackenfell sträubte. Die zehn Tage auf dem Kriechboden in Warschau. Der monatelange Marsch von Paris bis in die unbesetzte Zone im Süden, auf dem sie in Heuschobern schliefen und Eier stahlen, um zu überleben. Das Internierungslager in Mende, die Schmiergelder, die sie zahlen mussten, um sicheres Geleit zu erhalten, die vier Monate blanker bürokratischer Hölle in Marseille, in denen sie auf die spanischen Transitvisa warteten. Dann das Koma des langen Festsitzens in Lissabon, der Sohn, den Ida 1944 tot gebar, und die zwei Jahre, die sie auf den Atlantik hinausstarrten, während sich der Krieg dahinschleppte und ihnen das Geld ausging. Als Willys Eltern 1946 in Brooklyn ankamen, begann für sie weniger ein neues Leben als ein postumes, eine Zwischenzeit zwischen zwei Toden. Willys Vater, der in Polen ein cleverer junger Anwalt gewesen war, bettelte einen entfernten Cousin um Arbeit an und verbrachte die folgenden dreizehn Jahre damit, die U-Bahn zur Seventh Avenue zu nehmen und in einer Knopffabrik in der West 28th Street zu arbeiten. Im ersten Jahr konnte Willys Mutter das Einkommen noch aufbessern, indem sie verzogenen jüdischen Gören bei sich zu Hause Klavierunterricht gab, doch damit war eines Morgens im November 1947 Schluss, als Willy sein kleines Gesicht zwischen ihren Beinen hervorschob und sich unerwartet weigerte, das Atmen einzustellen.
Er wuchs als richtiger Amerikaner auf, ein Junge aus Brooklyn, der auf der Straße Schlagball spielte, nachts unter der Bettdecke Mad las und Buddy Holly und The Big Bopper hörte. Seine Eltern hatten von solchen Dingen nicht die leiseste Ahnung, aber das kam ihm eher gelegen, denn damals war es sein größtes Ziel, sich selbst einzureden, dass Mutter und Vater in Wirklichkeit gar nicht seine Eltern seien. Sie waren ihm fremd, peinlich und einfach lästig mit ihrem polnischen Akzent und ihrem gestelzten, seltsamen Benehmen, und ohne dass er lange darüber nachdenken musste, war ihm klar, dass seine einzige Überlebenschance darin bestand, ihnen bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit Widerstand zu leisten. Als sein Vater mit neunundvierzig an einem Herzanfall starb, linderte heimliche Erleichterung Willys Trauer. Schon mit zwölf, als er gerade in die Pubertät kam, hatte er seine Lebensphilosophie ausformuliert, die da hieß, sich Ärger aufzuhalsen, wo es nur ging. Je miserabler das Leben, das man führte, desto näher kam man der Wahrheit, dem unerbittlichen Wesen der Existenz, und was konnte schrecklicher sein, als sechs Wochen nach dem zwölften Geburtstag seinen Vater zu verlieren? Das brandmarkte einen doch geradezu als tragische Gestalt, disqualifizierte einen für die Hatz auf eitle Hoffnungen und sentimentale Illusionen und verlieh einem die Aura, sich das Leid rechtschaffen verdient zu haben. Fest stand allerdings, dass Willy nicht besonders litt. Sein Vater, ein Mann, der zu wochenlangem Schweigen und plötzlichen Wutausbrüchen neigte, war ihm sowieso immer ein Rätsel gewesen, und mehr als einmal hatte er Willy wegen der klitzekleinsten Verfehlung windelweich geprügelt. Nein, sich an ein Leben ohne diesen Pulverkopf zu gewöhnen, fiel ihm nicht schwer. Es machte ihm nicht die geringste Mühe.
So oder ähnlich hatte es sich der gute Doktor Bones zurechtgereimt. Man brauchte ja nichts auf seine Diagnose zu geben, aber wem sollte man sonst trauen? Nachdem er sich in den vergangenen sieben Jahren all die Geschichten angehört hatte, hatte er da nicht ein Recht darauf, sich als die weltweit führende Autorität auf diesem Gebiet zu bezeichnen?
Jedenfalls blieb Willy allein mit seiner Mutter zurück. Sie war nun wirklich nicht das, was man sich unter einem verträglichen Menschen vorstellte, aber wenigstens behielt sie ihre Hände bei sich und schenkte ihm ein erhebliches Maß an Zuneigung – genügend Herzenswärme zum Ausgleich für die Zeiten, in denen sie an ihm herumkrittelte, ihm Predigten hielt und ihm auf die Nerven ging. Im Großen und Ganzen versuchte Willy, ihr ein guter Sohn zu sein. In jenen seltenen Augenblicken, in denen er in der Lage war, nicht nur an sich selbst zu denken, bemühte er sich sogar ernsthaft, nett zu ihr zu sein. Die Zwistigkeiten, die sie hatten, entsprangen weniger persönlicher Animosität als vielmehr ihren vollkommen gegensätzlichen Ansichten von der Welt. Aus mühsam erworbener Erfahrung wusste Mrs. Gurevitch, dass die Welt ihr ans Leder wollte; sie lebte dementsprechend und tat, was sie konnte, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Willy wusste ebenfalls, dass die Welt ihm ans Leder wollte, doch anders als seine Mutter hatte er nicht die geringsten Skrupel, zurückzuschlagen. Der Unterschied lag nicht darin, dass die eine Pessimistin und der andere Optimist war, sondern darin, dass der Pessimismus der einen sie dazu brachte, die Furcht zu ihrem Lebensmotto zu machen, und der Pessimismus des anderen ihn zu allumfassender, lautstarker und streitlustiger Verachtung nötigte. Die eine zuckte zurück, der andere schlug um sich. Die eine zog einen Schlussstrich, der andere radierte ihn aus. Die meiste Zeit lagen sie sich in den Haaren, und weil Willy, wie er bald herausfand, seine Mutter so leicht schockieren konnte, ließ er nur selten eine Gelegenheit zum Streit aus. Wenn sie nur so viel Verstand gehabt hätte, ein bisschen nachzugeben, hätte er sich nicht so hartnäckig darauf versteift, seine Ansichten durchzusetzen. Ihr Widerstand reizte ihn, drängte ihn zu immer extremeren Haltungen, und als es Zeit wurde, das Haus zu verlassen und aufs College zu gehen, hatte er sich ganz auf seine selbstgewählte Rolle als unzufriedener Rebell, als geächteter Poet, der durch die Gosse einer kaputten Welt streift, festgelegt.
Gott weiß, wie viele Drogen der Junge in den zweieinhalb Jahren einpfiff, die er in Morningside Heights verbrachte. Er rauchte, schnupfte oder spritzte alles, Hauptsache, es war illegal. Es ist eine Sache, herumzulaufen und so zu tun, als wäre man der wiedergeborene François Villon, aber wenn man einem labilen jungen Mann so viele süße Pillen zuführt, dass man mit dem darin enthaltenen Gift eine Müllkippe in New Jersey hätte füllen können, dann ändert sich eben seine Körperchemie. Früher oder später wäre Willy wohl sowieso durchgeknallt, aber wer wollte bestreiten, dass die psychedelischen Cocktails seiner Studententage diesen Prozess beschleunigten? Als sein Zimmergenosse eines Nachmittags im ersten Collegejahr hereingeplatzt kam und Willy splitternackt auf dem Fußboden fand, wo er aus dem Telefonbuch von Manhattan rezitierte und eine Schüssel voll seiner eigenen Exkremente verzehrte, nahm die akademische Karriere von Mr. Bones’ zukünftigem Herrchen ein abruptes und endgültiges Ende.
Danach kam die Klapsmühle, worauf Willy in die Wohnung seiner Mutter in die Glenwood Avenue zurückkehrte. Nicht gerade der ideale Ort für ihn, aber wo sollte so ein Ausgebrannter wie der arme Willy denn sonst hin? In den ersten sechs Monaten kam bei diesem Arrangement nichts Gutes heraus. Abgesehen davon, dass er von den Drogen zum Alkohol überging, blieb im Grunde alles beim Alten. Dieselben Spannungen, dieselben Streitereien, dieselben Missverständnisse. Doch dann, Ende Dezember 1969, hatte Willy aus heiterem Himmel jene Vision, die alles ändern sollte, jene mystische Begegnung mit der Glückseligkeit, die sein Innerstes nach außen kehrte und seinem Leben eine völlig neue Richtung gab.
Es war halb drei morgens. Seine Mutter war schon vor Stunden ins Bett gegangen, und Willy fläzte sich mit einer Schachtel Luckys und einer Flasche Bourbon auf dem Wohnzimmersofa und sah mit halbem Auge fern. Fernsehen war eine ganz neue Angewohnheit von ihm, ein Nebenprodukt seines kürzlichen Krankenhausaufenthalts. Er interessierte sich nicht sonderlich für die Bilder auf der Mattscheibe, aber er mochte das Summen und Leuchten der Röhre im Hintergrund und fand Trost in den graublauen Schatten, die sie an die Wände warf. Die Spätshow lief (irgendwas über riesige Heuschrecken, die die Einwohner von Sacramento, Kalifornien, verspeisten), doch der Großteil der Sendezeit war geschmacklosen Ergüssen über bahnbrechende Wunderdinge gewidmet: Messer, die nie stumpf wurden, Glühbirnen, die nie durchbrannten, Lotionen nach irgendwelchen Geheimrezepturen, die den Fluch der Kahlköpfigkeit von einem nahmen. Bla, bla, bla, murmelte Willy vor sich hin, immer dasselbe blöde Gequatsche. Aber als er gerade aufstehen und den Fernseher abschalten wollte, kam ein neuer Werbespot, und darin kullerte der Weihnachtsmann bei irgendwem zu Hause aus dem Kamin in ein Wohnzimmer, das aussah wie irgendeines in Massapequa, Long Island. Weihnachten stand vor der Tür, und Willy hatte sich an all die Werbespots gewöhnt, in denen Schauspieler als Nikoläuse oder Weihnachtsmänner verkleidet auftraten. Doch dieser Weihnachtsmann war besser als die meisten anderen – ein kugelrundes Kerlchen mit rosigen Wangen und einem richtigen weißen Bart. Willy hielt kurz inne, um sich den Anfang des Werbegesülzes anzuhören, und rechnete schon damit, irgendetwas über Teppichshampoos oder Einbruchsmelder erzählt zu bekommen, als der Weihnachtsmann plötzlich die Worte sprach, die sein ganzes Leben verändern sollten.
«William Gurevitch», sagte er. «Ja, genau, William Gurevitch aus Brooklyn, New York, ich rede mit dir.»
Willy hatte in jener Nacht erst eine halbe Flasche getrunken, und seit seiner letzten ausgewachsenen Halluzination waren acht Monate vergangen. Niemand konnte ihn dazu bringen, diesen Blödsinn für bare Münze zu nehmen. Er kannte den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahn, und wenn der Weihnachtsmann aus dem Fernseher seiner Mutter heraus mit ihm redete, konnte das nur heißen, dass er, Willy, betrunkener war als angenommen.
«Du kannst mich mal, Mister», sagte er, und ohne noch länger darüber nachzudenken, schaltete er den Fernseher aus.
Leider konnte er es nicht dabei belassen. Aus Neugier, oder nur um sicherzugehen, dass ihm kein neuer Nervenzusammenbruch bevorstand, beschloss er, ihn noch einmal einzuschalten – nur für einen flüchtigen letzten Blick. Das würde doch keinem schaden, oder? Lieber der Wahrheit ins Auge sehen, als mit einem Sack voller Weihnachtsmist rumzulaufen, der ihm die nächsten vierzig Jahre auf der Seele liegen würde.
Und siehe da, da war er wieder. Da stand der verdammte Weihnachtsmann, drohte Willy mit dem Finger und schüttelte mit einem traurigen, enttäuschten Blick den Kopf. Als er den Mund aufmachte und zu sprechen begann (wobei er genau dort ansetzte, wo er zehn Sekunden zuvor aufgehört hatte), wusste Willy nicht, ob er laut herauslachen oder aus dem Fenster springen sollte. Es geschah also wirklich. Es geschah, was nicht geschehen konnte, und da ging ihm auf, dass ihm künftig nichts auf der Welt je wieder so erscheinen würde wie zuvor.
«Das war nicht nett von dir, William», sagte der Weihnachtsmann. «Ich bin hier, um dir zu helfen, aber wenn du mir keine Gelegenheit gibst zu sprechen, wird daraus nichts. Verstehst du mich, mein Junge?»
Die Frage schien nach einer Antwort zu heischen, aber Willy zögerte. Sich diesen Clown anzuhören, war schlimm genug. Wollte er wirklich alles noch schlimmer machen, indem er mit ihm redete?
«William!», sagte der Weihnachtsmann. Seine Stimme klang streng und vorwurfsvoll, und sie brachte die Macht einer Persönlichkeit zum Ausdruck, mit der man lieber nicht spaßte. Die einzige Hoffnung, sich je wieder aus diesem Albtraum herauszuwinden, bestand für Willy darin, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
«Jawoll, Chef», murmelte er, «ich höre dich laut und deutlich.»
Der Dicke lächelte. Dann fuhr die Kamera ganz langsam zu einer Nahaufnahme heran. Ein paar Sekunden lang stand der Weihnachtsmann da und strich sich gedankenverloren den Bart.
«Weißt du, wer ich bin?», fragte er schließlich.
«Ich weiß, wie du aussiehst», entgegnete Willy, «aber das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wer du bist. Erst habe ich dich für irgend so ’nen Schauspieler-Arsch gehalten. Dann dachte ich, vielleicht bist du ’n Flaschengeist. Und jetzt habe ich nicht mehr den blassesten Schimmer.»
«Ich bin der, dem ich gleiche.»
«Klar, Kumpel, und ich bin der Schwager von Haile Selassie.»
«Santa Claus, William. Der Nikolaus. Der Weihnachtsmann persönlich. Die einzige Macht des Guten, die es noch auf Erden gibt.»
«Santa Claus, hm? Und das buchstabiert sich nicht zufällig S-A-N-T-A, oder?»
«Doch, genau so. Genau so buchstabiert sich das.»
«Das hab ich mir schon gedacht. Und wenn wir die Buchstaben jetzt ein wenig verschieben, was haben wir dann? S-A-T-A-N haben wir dann. Du bist der gottverdammte Teufel, Alter, und du existierst nur in meiner Vorstellung.»
Bemerkenswert, wie sehr Willy gegen die Erscheinung anzukämpfen versuchte und wie entschlossen er war, ihren Zauber zu bannen. Er war doch kein spatzenhirniger Irrer, der sich von Eingebungen und Gespenstern herumscheuchen ließ. Er wollte nichts damit zu tun haben, und der Abscheu, der ihn überkam, die offene Feindseligkeit, die er jedes Mal zum Ausdruck brachte, wenn er sich an die ersten Augenblicke dieser Begegnung erinnerte, überzeugten Mr. Bones davon, dass die Sache tatsächlich so verlaufen war, dass Willy wirklich eine Vision gehabt und nicht alles einfach erfunden hatte. Wenn man seinen Worten glaubte, war es der reinste Skandal gewesen, eine Beleidigung seiner Intelligenz, und allein schon der Anblick dieses klischeebeladenen Ochsen brachte Willys Blut in Wallung. Solchen Klimbim mochte glauben, wer wollte. Weihnachten war ein einziger Mumpitz, eine Zeit des schnellen Geldes und der klingelnden Kassen, und der Weihnachtsmann als Symbol dieser Jahreszeit, als personifizierte Essenz dieses ganzen Verbrauchernepps, war der größte Beschiss von allen.