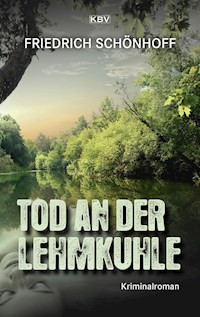
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Brockmann & Degraf
- Sprache: Deutsch
Ein bizarrer Mord im Naturidyll Ein packendes Krimidebüt aus dem Tecklenburger Land Das Haus Cappeln, ein altes Gut im Ortskern von Westerkappeln, ist das geistige Zentrum der Büßer Gottes, einer Gemeinschaft von Menschen, die sich den Himmel verdienen wollen. Ist der Preis dafür das Leben einer jungen Frau, die mit den furchtbaren Spuren einer Geißelung tot am Ufer der Lehmkuhle, einem kleinen Waldsee in der Bauernschaft Seeste gefunden wird? Den ungewöhnlichen Fall nimmt Hauptkommissar Matthias Brockmann aus Münster zum Anlass, nach zwanzig Jahren erstmals wieder in seinen Heimatort zurückzukehren. Gemeinsam mit der temperamentvollen Kollegin Julia Degraf aus Ibbenbüren beginnt er zu ermitteln, und schon bald verhaften sie einen jungen Mann, der in der Todesnacht am Tatort gesehen wurde und jetzt in die Wohnung der getöteten Frau einbrechen will. Die Aufklärung des Falls scheint eigentlich nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch dann wird plötzlich ein Polizist entführt, und die Kommissare stehen mit einem Mal wieder am Anfang ihrer Ermittlungen. Lange tappen sie im Dunkeln, bis Brockmann schließlich einer uralten Geschichte nachgeht, die ihm sein Vater früher einmal erzählte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich Schönhoff wurde 1956 in Hagen am Teutoburger Wald geboren. Schon früh schrieb er Gedichte, gründete eine eigene Jugendzeitung und war Mitte der 80er-Jahre Chefredakteur der Mitgliederzeitung der Christlichen Arbeiterjugend Deutschlands. Er verfasste Songtexte für die Friedensbewegung und war 2021 an einem Musical für die Waldbühne Georgsmarienhütte beteiligt.
Als Dipl.-Sozialarbeiter und Fachkrankenpfleger für Psychiatrie arbeitete er mit Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, und leitete 20 Jahre ein Alten- und Pflegeheim. Freiberuflich arbeitet er als Journalist, überwiegend für die Neue Osnabrücker Zeitung. Er lebt gemeinsam mit seiner Frau Carmen in Westerkappeln. Dort ließ er sich von der vielfältigen Natur entlang des Mittellandkanals zu seinem ersten Kriminalroman inspirieren.
Friedrich Schönhoff
TOD AN DERLEHMKUHLE
Originalausgabe
© 2022 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung
von © Givaga und © darkbird, beide stock.adobe.com
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-95441-604-2
E-Book-ISBN 978-3-95441-615-8
Für Carmen
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Danksagung
1. Kapitel
Der Alte brach am frühen Nachmittag von Münster auf und fuhr nach Westerkappeln. Er hatte einen Auftrag zu erfüllen, der ihn zur Lehmkuhle führen sollte, einem kleinen Waldsee in der Bauernschaft Seeste.
Von Westerkappeln folgte er den Verkehrsschildern Richtung Bramsche, verließ nach einigen Kilometern die Landstraße und lenkte seinen Wagen in einen Wirtschaftsweg. Dort war er allein auf den engen, provisorisch geteerten Wegen zwischen Wiesen und Kornfeldern.
In einer unübersichtlichen Kurve stieg er voll auf die Bremse, denn vor ihm versuchte ein schwerer Traktor, der im Schlepp ein Mähwerk hinter sich herzog, genau dahin abzubiegen, wo er stand und nicht ausweichen konnte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zurückzusetzen und eng an ein Kornfeld heranzufahren. Dem 80-Jährigen missfiel der Gedanke, dass er dabei reife Ähren zerstörte.
Der Traktor zog vorbei, und die beiden Männer winkten einander zu.
Der Alte fuhr weiter, bis er an einem Bauernhof von einem quer über die Fahrbahn gespannten Seil erneut aufgehalten wurde. Er stellte den Motor ab und sah zu, wie eine Karawane schwarz-weiß gescheckter Milchkühe den Weg überquerte. Voran ging die Bäuerin, die in der rechten Hand einen elastischen, fingerdicken Weidenast hielt. Dieser sauste gerade sanft hernieder auf den verlängerten Rücken des Leittieres, das den Löwenzahn am Wegesrand entdeckt hatte und sich anschickte, dorthin einen letzten Abstecher zu wagen, bevor es zurück in die Stallungen ging. Der sanfte Hieb erinnerte das Rindvieh an seine Pflicht, die ihr folgenden Milchkühe zum Melken in den Stall zu führen. Gehorsam setzte es seinen Weg fort.
Am Schluss ging der Bauer, der mit einem entschuldigenden Achselzucken das Seil losband und den Weg wieder freigab. So war das in der Bauernschaft Seeste, am nördlichen Ortsrand Westerkappelns, an der Grenze zu Niedersachsen. Die Landwirtschaft hatte hier in mancherlei Hinsicht noch immer Vorfahrt, auch wenn in den letzten Jahren immer mehr Bauern ihre Höfe hatten aufgeben müssen. Diese wurden schnell zu begehrten Objekten wohlhabender Städter, die es zuhauf aufs Land zog, um Pferdezucht zu betreiben oder einfach die ländliche Ruhe zu genießen.
Der Alte erreichte bald schon die Schachselbrücke, die sich majestätisch über den Mittellandkanal spannte. Er war am Ziel, stieg aus seinem Wagen und ging zum Kofferraum, dem er eine Tasche entnahm. Es bestand kein Grund zur Eile, denn bis zur Taufandacht an der Lehmkuhle, deren spiritueller Leiter er heute sein würde, war noch viel Zeit.
Nachdem er seinen Wagen abgeschlossen hatte, hielt einen Moment inne. Der Mann war schlank und von beachtlicher Größe. Trotz seines Alters besaßen seine Bewegungen eine erstaunliche Dynamik. Er hatte volles, langes und beinahe schneeweißes Haar, das er zu einem Knoten zusammengebunden trug. Auf der Brücke blieb er stehen und lenkte seinen Blick in die Ferne, aus der ein Schiff sich der Brücke näherte. Es schien, als käme es direkt aus der Sonne, die zu dieser Tageszeit mitten über dem Wasser stand. Der Alte genoss den wunderbaren Blick auf die Wasserstraße. An deren Seiten waren kleine Laubwälder angelegt, die sich durch eigene Aussaat mit den Jahren verdichtet hatten.
Nachher würde er neue Mitglieder seiner Gemeinde taufen, doch jetzt war er ganz im Augenblick und betrachtete voll Ehrfurcht den Pflanzenwuchs entlang des Uferweges. Wilde Lupinen wuchsen in prächtigem Violett, wurden von der weißen Schafgarbe und manch anderer blühender Pflanze umrahmt, die in gepflegten Gärten längst als Unkraut vernichtet worden wären. Hier bereicherten sie die Vielfalt der Natur und boten den Insekten einen bunten Tummelplatz.
Etwas wehmütig entriss sich der Alte diesem Anblick, verließ die Brücke und ging in den kleinen Wald. Dort musste er einmal abbiegen und sich durch das Unterholz kämpfen, um eine kleine, freie Fläche zu erreichen, von der aus er einen herrlichen Blick über die Lehmkuhle hatte. Bis vor wenigen Jahren durfte man hier noch schwimmen. Die Menschen kamen an den warmen Sommerabenden in Scharen oder zelteten am Wochenende gegenüber am größeren Ufer. Nach vielen vergeblichen Versuchen, dem hinterlassenen Müll Herr zu werden, hatte die Gemeinde sich inzwischen veranlasst gesehen, die Freiheiten an der Lehmkuhle einzuschränken. Einige vergleichbare Seen waren an Anglervereine verpachtet oder verkauft worden, und auch die Lehmkuhle gehörte inzwischen einem dieser Vereine. Was jedoch niemand wusste, war, dass hinter dem Verein, der die Lehmkuhle gekauft hatte, eine Gemeinschaft stand, der sich hier inmitten der Natur die Möglichkeit eröffnete, frei und ungestört ihre spirituellen Rituale auszuüben.
Der Alte hatte sich inzwischen an einer Stelle niedergelassen, an der der Blick auf den Natursee ihn jedes Mal aufs Neue überwältigte. Auf der Oberfläche schlängelten sich Wasserrosen, deren Knospen kurz vor der Blüte standen, und die Bäume des Ufers spiegelten sich in ihrem vielfältigen Grün im Wasser des Sees. So entstand ein Geflecht einer andächtigen Erhabenheit.
Plötzlich vernahm der Alte lautes Kreischen und sah, wie sich zwei Fischreiher auf dem Wasser um ihre Beute stritten. Der Sieger flog bald darauf mit vollem Schnabel davon.
Schade, dachte der Alte und schaute dem Vogel hinterher. Er hätte den beiden gern länger beim Fischfang zugeschaut.
Stattdessen kniete er nieder und war kurz darauf in seine Gebete versunken. So verweilte er beinahe eine Stunde, bis sein Geist langsam in die Gegenwart zurückkehrte. Er stand auf und entkleidete sich. Es war ein heißer Tag, und einen Moment lang war er versucht, ein Bad im See zu nehmen. Doch es war Zeit, sich vorzubereiten, und so nahm er seine Tasche, trank aus der mitgebrachten Wasserflasche und zog anschließend eine weiße Kutte über – ein Kleidungsstück, das denen glich, wie sie Ordensgemeinschaften trugen. Seine Straßenkleidung verstaute er in der Tasche und ging zurück auf den kleinen Feldweg, der sich zwischen einzelnen Bäumen bis zu einem sandigen Ufer schlängelte. Dort gab es einen großzügigen Zugang in den See. Der Alte setzte sich auf einen Baumstumpf und wartete.
Es verging noch einige Zeit, bis er die Schritte von Menschen vernahm. Es waren die Mitglieder der Gruppe, auf die er wartete. Durch den Wald drang ein leiser, monotoner Sprechgesang, der lauter wurde, bis die Worte eines Gebetes zu verstehen waren. Elf junge Menschen kamen auf ihn zu. Die Männer und Frauen waren genau wie er mit weißen Kutten bekleidet. Der alte Mann trat ihnen entgegen und hob die Hand. Die Gruppe blieb stehen und verstummte. Unaufgefordert bildeten sie einen Kreis um den Alten. Schweigend schaute er jedes Mitglied der Gruppe an und sagte dann mit kräftiger Stimme: »Wir sind heute hier, um dem zu entsagen, was uns von Gott fernhält. Wir bekennen unsere Sünden aus tiefstem Herzen und wissen um den Schmerz, den das Böse uns zufügt. Wir entsagen der finsteren Gestalt Satans und erkennen das neue Licht, das unser Herr durch den Opfertod seines Sohnes in die Welt gebracht hat.«
Mit gesenkten Häuptern verharrte die Gruppe, bis der Alte erneut die Hand hob. »Brüder und Schwestern«, sagte er. »Ihr alle seid einen Weg gegangen, der euch Demut und Hingabe lehrte. Denn wenn ihr stetig euren Glauben stärkt, werdet ihr am Jüngsten Tag an der Seite unseres Herrn eine neue Welt erblicken. Ihr habt euch entschlossen, unserer Gemeinschaft beizutreten und euch heute taufen zu lassen.« Während er die letzten Worte sprach, erhob er seine Hand und segnete die Gruppe. Dann griff er an den Saum seiner Kutte und zog sie sich über den Kopf.
Die Mitglieder der Gruppe taten es ihm gleich und schritten gemeinsam mit dem Alten nackt, wie Gott sie geschaffen hatte, in das flache Wasser. Dort bildeten sie erneut einen Kreis um ihn. Schweigend ging der Mann, den sie alle nur als »Vater Markus« kannten, zu jedem Einzelnen, legte ihm die Hand auf und drückte ihn sanft unter Wasser. Danach küsste jeder Täufling die Hand des Alten und verneigte sich.
Als das Ritual zu Ende war, stieg die Gruppe gemeinsam aus dem See. Jeder nahm seine Kutte und zog sie über den vor Nässe triefenden Körper. Inzwischen war es 21 Uhr, und noch immer betrug die Lufttemperatur mehr als 25 Grad.
Erneut versammelten sich alle um den Alten und sprachen ein gemeinsames Schlussgebet. Danach gingen sie in einer kleinen Prozession dorthin zurück, wo ein Kleinbus sie erwartete und zurück auf das alte Rittergut Haus Cappeln brachte.
Einzig eine junge Frau blieb an der Seite des Alten stehen. Sie schaute ihn an, als wartete sie auf seine besondere Weisung. Er nahm ihre Hand und ging mit ihr ans Wasser zurück.
»Du hast dich entschieden, Lea?«, fragte der Alte.
»Ja, Vater, ich will mich von der Schuld befreien, die ich auf mich geladen habe«, entgegnete die noch sehr mädchenhaft wirkende Neunzehnjährige.
Der Alte hatte in den letzten Wochen viele Gespräche mit ihr geführt und sich davon überzeugt, dass sie dem, was sie erwartete, psychisch und physisch gewachsen war. Er streichelte ihr sanft über die langen, blonden Haare. Anschließend forderte er sie auf, sich mit ihm hinzuknien und das Gesicht dem Wasser zuzuwenden. Sie vertieften sich in ein Gebet, sodass hinter ihnen eine schwarz gekleidete Gestalt unbemerkt aus dem Unterholz hervortreten konnte. Unter der Kleidung zeichneten sich die Konturen eines weiblichen Körpers ab, während das Gesicht hinter einer dunklen Maske verborgen war. In den Händen hielt die Frau ein Seil und eine Lederpeitsche.
Geräuschlos ging sie umher und blieb vor einem Baum stehen, dessen starke Äste dem gewachsen waren, was sie gleich im Namen des Herrn würde tun müssen. Sie legte die Peitsche ab und warf das Seil über den Ast. Mit aller Kraft zog sie daran und war zufrieden. Der Ast würde in der Lage sein, einen Menschen zu tragen – einen Menschen, der mit gefesselten Händen an ihm hing. Festen Schrittes ging sie anschließend zu dem Alten und der jungen Frau, die er vorhin im Gespräch Lea genannt hatte. Die Maskierte wurde erwartet. Sie beendeten ihr Gebet und standen auf. Während der Alte sich diskret abwandte, nahm die maskierte Frau Lea an die Hand und führte sie zu dem vorbereiteten Baum. Dort musste Lea sich entkleiden. Die Frau band ihr die Handgelenke mit dem vorbereiteten Seil zusammen. Mit einem einzigen Ruck straffte sie es, sodass Leas Zehen gerade noch den Boden berührten.
Nun trat der Alte zu ihr. Einem festen Ritual folgend sagte er: »Gesegnet bist du, Lea, Büßerin zum Wohlgefallen des allmächtigen Gottes.« Dann betete sie eine Art Glaubensbekenntnis. Danach segnete der Alte auch die maskierte Frau, die sich bereits so hingestellt hatte, dass die Peitsche in ihrer Hand die gefesselte Lea hart treffen würde.
Gnadenlos geißelte die Maskierte den entblößten Rücken Leas. Doch statt an ihren Fesseln zu zerren, betete und schrie sie Worte aus dem Schuldbekenntnis: »Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.«
Der nächste Schlag war noch härter und traf ihre Hüfte. Die Peitsche verletzte die Haut, und Blut tropfte an ihren Lenden hinab auf den ausgetrockneten Waldboden. Wieder schrie die Frau das Schuldbekenntnis, schwieg und erwartete in Demut den nächsten Schlag. Zehnmal wiederholte sich die furchtbare Folter, dann war es plötzlich still.
Die maskierte Frau hatte ihre Pflicht erfüllt. Ruhig legte sie die Peitsche aus der Hand, kniete vor ihrem Opfer nieder und küsste ihm die Füße. So grausam die Unbekannte Lea auch geschlagen hatte, jetzt versorgte sie sanft ihre Wunden. Vorsichtig löste sie die Fesseln und stützte sie auf dem Weg zurück ans Ufer. Dort breitete sie ein weißes Tuch aus und legte die verletzte Frau darauf. Ein weiteres Mal versorgte sie die Wunden mit einer vorbereiteten Tinktur und gab Lea einen gefüllten Becher.
»Trink ihn ganz aus, es wird deine Schmerzen lindern«, sagte die Unbekannte.
Lea tat wie ihr geheißen. Anschließend bedeckte sie sich mit einem zweiten Tuch. Erst dann trat der Alte hinzu und beugte sich hinab zu Lea. Er sprach eine Weile mit ihr, erhob sich und ging davon, bis sich seine Schritte langsam im Dickicht des Waldes verloren. Die maskierte Frau blieb noch eine ganze Weile an Leas Seite, nahm ihre Hand und streichelte sie sanft. Erst nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass ihr Opfer wieder zu Kräften kommen würde, ging die Maskierte zurück zum Baum, holte Peitsche und Seil und verschwand auf dem gleichen Weg, den sie gekommen war.
Lea blieb allein. Sie hüllte ihren gequälten Körper in die Tücher und blickte bewegungslos nach vorn. Sie atmete tief durch, senkte ihren Kopf und begann leise zu weinen. Es waren Tränen des Glücks und der Erleichterung, denn sie wusste, dass ihre Schuld getilgt war.
2. Kapitel
Frank Etgeton kam zusammen mit seinem Kollegen von einer abendlichen Streife zurück. Auf dem Polizeirevier in Ibbenbüren freuten sich die beiden auf einen frisch gebrühten Kaffee, als um 23:43 Uhr ein Notruf einging.
Der diensthabende Beamte am Telefon kratzte sich am Ohr. »Ihr müsst noch mal raus, es gibt eine Tote in Westerkappeln«, sagte er bedauernd. Kurz erklärte er den beiden Kollegen, wohin sie fahren mussten und wer sie vor Ort erwartete.
Keine halbe Stunde später parkten sie ihren Dienstwagen auf dem kleinen Parkplatz am Mittellandkanal in Seeste. Von dort folgten die beiden Beamten dem Waldweg zur Lehmkuhle. Schon bald trafen sie auf den Revierförster, der ihnen sichtlich erleichtert mit einer starken Taschenlampe entgegenkam. Sein Hund hatte gegen 23:15 Uhr noch einmal vor die Tür gemusst und war nicht zurückgekehrt.
»Ich bin ihm bis zum Seeufer gefolgt, wo er winselnd neben der Leiche kauerte«, berichtete der Förster, dem es bei dem bloßen Gedanken daran noch immer kalt den Rücken herunterlief.
Kurz darauf erreichten sie den Schauplatz des Verbrechens. Der Förster richtete seine Taschenlampe auf den Leichnam. Es handelte sich um eine junge Frau, die dalag, als schliefe sie.
Etgeton kniete sich zu der Toten hinab und versuchte, die Halsschlagader zu ertasten. Bedauernd schüttelte er den Kopf. Er stand auf und betrachtete die Leiche genauer. Die Haare der Frau waren feucht, ebenso die weiße Kutte, die sie trug. Sie lag auf dem Rücken, und ihre Handgelenke waren wund gescheuert, als wäre sie gefesselt gewesen. Ansonsten schien sie unversehrt zu sein.
Doch irgendetwas an ihr war ungewöhnlich. Etgeton nahm seine eigene Taschenlampe und richtete sie auf die Tote. Plötzlich fiel es dem erfahrenen Polizisten wie Schuppen von den Augen: Da lag kein Mordopfer, da lag eine junge Frau, die aussah, als wäre sie für den Himmel hergerichtet worden. Sie lag auf einem weißen Laken, ihre Hände waren gefaltet, die Augen geschlossen und die feuchten Haare frisch gekämmt.
Wortlos nahm der Beamte sein Handy und fotografierte den Leichnam. Er wandte sich an die beiden Männer, denen er im Licht der starken Taschenlampe ansah, dass sie angesichts der Toten vollkommen überfordert waren. Er rief die Wache in Ibbenbüren an, während sein junger Kollege planlos begann, die Umgebung mit der Taschenlampe abzusuchen. Ihm war die Szenerie mitten im Wald nicht geheuer.
Als Etgeton sein Gespräch beendet hatte, ging er zu ihm und legte beruhigend die Hand auf seine Schulter. »Keine Sorge«, sagte er. »Wer immer das hier getan hat, ist längst über alle Berge. Du gehst am besten gemeinsam mit dem Förster zurück zum Einsatzfahrzeug und wartest auf die Kollegen.« Ihm fiel der Campingplatz ein, der sich auf der anderen Seite des Mittellandkanals befand und um diese Jahreszeit ausgebucht war. Die ersten Camper würden bald mitbekommen, dass hier etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Er schärfte dem jungen Kollegen ein, keinen Unbefugten zur Lehmkuhle durchzulassen.
Als Etgeton allein war, setzte er sich auf einen umgestürzten Baum. Auch er konnte im Augenblick nichts anderes tun, als abzuwarten. Er erinnerte sich an seine ersten Jahre bei der Polizei. Damals war es ihm nicht anders ergangen als heute seinem Kollegen. Erst im Laufe seiner vielen Dienstjahre, in denen er alle Abscheulichkeiten des Lebens kennenlernen musste, hatte er zu seiner inneren Mitte und damit auch zur notwendigen Ruhe gefunden. Gewöhnen allerdings würde er sich nie an den Anblick eines gewaltsam zu Tode gekommenen Menschen.
Der Oberkommissar der Schutzpolizei brach seine Gedanken ab und bereitete sich innerlich auf den Ansturm von Polizisten und Feuerwehrmännern vor. Vor allem diese bereiteten ihm Sorgen, denn sie würden vermutlich mit viel zu viel Personal anrücken. Auch die gewieften Camper würden einen Weg finden, um nahe an den Tatort heranzukommen. Er würde dafür sorgen müssen, dass nicht noch mehr Spuren vernichtet wurden als die, auf denen der Förster mit seinem Hund, er selbst und sein Kollege bereits herumgetrampelt hatten.
Während er darüber noch sinnierte, wurde es lebendig an der Lehmkuhle. Grelle Lampen flammten auf, Autotüren öffneten sich und wurden laut zugeschlagen. Ein reges Treiben an der Lehmkuhle hatte begonnen. Wie erwartet tauchten nacheinander Notarztwagen, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Kleinbus der Spurensicherung auf. Mit ihnen kamen auch die ersten Schaulustigen vom Campingplatz. Noch bevor Etgeton zu den Kollegen ging, eilte er zu den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und wies sie an, eine Menschenkette möglichst groß um den Fundort der Leiche herum zu bilden und vor allem keinen der Schaulustigen durchzulassen.
Im Vorbeigehen hörte er die Schaulustigen bereits von einer Wasserleiche, von Vergewaltigung und Todesschüssen reden. Bald schon würden sämtliche gewaltsamen Todesarten aufgelistet sein.
Die Feuerwehr sicherte so gut es ging unter Etgetons Anleitung das Gelände. Der Förster begleitete den Notarzt, der sich zu fein dafür war, mehr als einen kurzen Blick auf die Tote zu werfen. Er hielt es, wie viele seiner Kollegen, für Unsinn, einen Arzt zu einem Mordfall zu rufen. Dafür gab es schließlich die Gerichtsmedizin. Er ließ seinen Unwillen an einem Feuerwehrmann aus, der vor Schreck zu seiner Zigarettenschachtel griff.
»Unterstehen Sie sich!«, vernahm er die Stimme einer Frau hinter sich. Sie schien aus dem Nichts gekommen zu sein. »Muss ich Ihnen das kleine Einmaleins der Verhaltensregeln an einem Tatort erklären?«, fragte sie und wies warnend auf die Zigarette.
Der Feuerwehrmann errötete und wollte die Kippe auf dem Boden austreten.
»Wehe!«, drohte die junge Frau, die sich neben den Tatort stellte.
Soeben hatte Julia Degraf damit das Kommando übernommen. Die junge Oberkommissarin besorgte sich, nachdem sie den Feuerwehrmann zurechtgestutzt hatte, kurzerhand eine Trittleiter, bestieg sie und rief mit kräftiger Stimme, die der zierlichen Person kaum jemand zugetraut hätte: »Guten Morgen, ich bin Oberkommissarin Julia Degraf, und das, was Sie hier sehen, nennt man einen Tatort. Das bedeutet für alle: raus aus dem inneren Kreis der Absperrung. Ich will höchstens zwei Leute, die hier für ausreichend Licht sorgen. Alle anderen sollten sich möglichst weit aus meinem Gesichtsfeld entfernen.« Einen Augenblick verharrte sie auf ihrer Leiter, dann schob sie einen beeindruckenden Satz hinterher: »Und das Wichtigste: zwischendurch einfach mal Fresse halten!«
Tatsächlich trat nach ihrem Auftritt Ruhe ein, und die Arbeit am Tatort bekam Struktur.
Die Freiwillige Feuerwehr erledigte die Technik, die Kollegen der Schutzpolizei sicherten das Gelände, und die Spurensicherung packte den Kleinbus aus.
Die Kommissarin wandte sich dem Notarzt zu, der im Begriff war, zusammen mit den Rettungssanitätern das Feld zu räumen. Sie hielt ihn fest. »Können Sie mir irgendetwas zur Todesursache der Frau sagen?«
»Weiß ich nicht«, antwortete der Arzt genervt und riss sich von der respektlosen Frau los. Er sagte hochnäsig: »Ich bin kein Pathologe, mein Job ist es, Leben zu retten.«
Julia blieb hartnäckig. »Kommen Sie, wenigstens eine Vermutung!«
»Ich spekuliere nicht«, antwortete der junge Arzt und ging grußlos zu seinem Fahrer, der bereits den Motor anließ.
»Blödmann!«, rief Julia ihm nach.
Die 33-jährige Oberkommissarin war bereits auf dem Weg zum Tatort von der Dienststelle über das informiert worden, was Frank Etgeton telefonisch berichtet hatte. Dass sie heute vor Ort war, verdankte sie ihrer dienstplanmäßigen Bereitschaft. Wurde sie angerufen, so handelte es sich in der Regel um Todesfälle, bei denen der Notarzt »ungeklärte Todesursache« vermerkt hatte. Das geschah seit Jahren immer häufiger sowohl im privaten Bereich als auch in Krankenhäusern und Altenheimen. Julia führte es darauf zurück, dass immer weniger Ärzte sich die Mühe machten, in die Krankengeschichte eines Verstorbenen zu schauen. Also stellten sie keinen Totenschein aus, sondern informierten die Polizei. Meistens reichte ein Anruf beim Hausarzt, um zu erfahren, dass die Person schon lange schwer erkrankt und der Tod absehbar gewesen war. Julia jedenfalls hatte noch nie Fremdverschulden in einem solchen Fall feststellen müssen.
Dieser Fall dagegen war anders. Es würde vermutlich ihr erster Mordfall sein, und sie hoffte, an den Ermittlungen beteiligt zu werden. Denn schon in Kürze würden die Kollegen des KK 11 aus Münster auftauchen. Das KK 11 gehörte zur Direktion Kriminalität und war speziell zuständig bei Tötungsdelikten. Doch auch bei Brand-, Sexual-, Waffen- und Sprengstoffdelikten übernahmen sie in der Regel die Ermittlungen. Bis die allerdings so weit waren, würde sie sich auf ihr Organisationstalent und ihr Durchsetzungsvermögen verlassen. Sie wusste, dass sie das konnte. Zwar war sie relativ klein und zierlich, aber jeder, der sie einmal erlebt hatte, vergaß sie so schnell nicht wieder.
Nach dem wenig aufschlussreichen Gespräch mit dem Notarzt machte sie sich auf die Suche nach Frank Etgeton, ihrem wesentlich älteren Lieblingskollegen aus Ibbenbüren. In seiner Gegenwart, da war sie sicher, konnte nichts schiefgehen.
Sie freute sich, als sie sah, dass er ihr vom Feuerwehrauto aus zuwinkte. Doch da sie sich dort gerade unbeliebt gemacht hatte, wartete sie, bis er zu ihr kam.
Er reichte ihr freundlich die Hand. Mehr Zuwendung war von ihm nicht zu erwarten.
»Kannst du mir irgendetwas zu der Toten sagen?«, fragte Julia.
»Leider nicht, von den Feuerwehrleuten aus dem Ort kennt sie offenbar niemand, und ein Totenhemd hat keine Taschen.«
Julia schaute ihn fragend an, sodass er sich zu einer Erklärung genötigt sah.
»Mir ist die Art der Aufbahrung der jungen Frau aufgefallen. Die hat jemand richtig liebgehabt, und das mit dem Totenhemd, na ja, die weiße Kutte, die sie trug, sieht beinahe genauso aus.«
Julia überlegte. »Du meinst, ihr Mörder hat sie gekannt, vielleicht sogar geliebt?«
Etgeton zog seine rechte Augenbraue in die Höhe. »Ich freue mich, dass ich das nicht herausfinden muss«, sagte er.
Julia hatte ihre Antwort darauf bereits parat, als ihr Handy vibrierte. Sie drückte auf den grünen Knopf und wartete.
3. Kapitel
Um drei Minuten nach drei klingelte an diesem Donnerstag das Telefon auf dem Nachtschrank eines schmucklosen Hotelzimmers. Hauptkommissar Matthias Brockmann schlief dort den Schlaf des Gerechten. Er war am Abend mit dem Zug vom Flughafen Frankfurt nach Münster gefahren und freute sich auf seine neue Stelle als Leiter des KK 11, im Allgemeinen bekannt als Mordkommission. Er kam gerade aus New York zurück, wo er ein Jahr lang beim NYPD Ermittlungsmethoden und Logistik studiert hatte. Vorher war er acht Jahre bei der Mordkommission in Köln gewesen. In seiner Bewerbung für die Stelle in Münster hatte er sich als »erfahren, ausgeglichen, engagiert und souverän« beschrieben.
Von Letzterem war der Hauptkommissar allerdings weit entfernt, als er schlaftrunken versuchte, im Dunkeln das mobile Telefon des Hotels auf seinem Nachttisch zu ergattern. Er griff daneben und hörte, wie es scheppernd zu Boden fiel.
Fluchend knipste er die Nachttischlampe an, rollte sich aus dem Bett und suchte auf dem Teppich. Der Apparat war verdammt weit unter das Bett gerutscht. Also robbte Brockmann hinterher und bekam es in dem Augenblick zu fassen, als es aufhörte zu klingeln.
Noch während er unter dem Bett wieder hervorkroch und sich dabei am Kopf stieß, vernahm er den Rufton seines eigenen Handys, das in seinem Sakko auf dem Stuhl an der anderen Seite des Bettes steckte. Er eilte hinüber und hielt nun zwei Geräte in der Hand. Aus einem erklang We are the champions, das er einprogrammiert hatte, als sein Lieblingsverein, der VfL Osnabrück, das letzte Mal in die Zweite Liga aufgestiegen war. Das Telefon des Hotels blieb stumm. Unschlüssig betrachtete er die beiden Geräte in seinen Händen. Wahllos drückte er auf die grüne Taste eines der beiden Telefone und hatte Glück, das richtige erwischt zu haben, denn er vernahm die Stimme seiner künftigen Vorgesetzten Stephanie Zwenger.
»Es gibt einen ungeklärten Todesfall, und wir dachten …«
Weiter kam sie nicht, da donnerte Brockmann ziemlich ungehalten: »Verdammt! Ich bin erst am Montag im Dienst.« Er wollte den Hörer auf die Gabel knallen und stellte dabei fest, dass es diese nicht gab. Zu seiner Verwunderung beruhigte ihn das. »Hör zu«, sagte er nun wesentlich freundlicher. »Ich bin gerade erst ein paar Stunden in Deutschland, habe weder einen Dienstausweis noch ein Fahrzeug geschweige denn Lust, jetzt zu arbeiten.«
Stephanie Zwenger wies Brockmann zurecht. »Erstens«, sagte sie, »habe ich bei der Einstellung schon darum gebeten, dass wir uns siezen, und zweitens, Herr Brockmann, hören Sie sich bitte in Ruhe an, was ich zu sagen habe.«
Brockmann musste unweigerlich schmunzeln, denn in den ersten Jahren ihrer gemeinsamen Tätigkeit bei der Polizei war ihr Verhältnis alles andere als förmlich gewesen.
Während sie weiter auf ihn einredete, erinnerte er sich an eine missglückte Anmache ihrerseits, als sie gemeinsam eine mehrtägige Fortbildung besucht hatten. Am Ende des ersten Tages waren viele der Teilnehmer an einen See gefahren. Sie hatten gemeinsam getrunken, und Stephanie und er hatten ein bisschen geknutscht. Sie war vor ihm ins Hotel zurückgefahren. Später, als er in sein Zimmer kam, lag sie nackt, wie Gott sie geschaffen hatte, in seinem Bett. Brockmann, der damals nicht auf eine Affäre aus gewesen war, hatte sich alle Mühe gegeben, Stephanie in ihr eigenes Bett zu verfrachten, ohne sie zu düpieren. Sie hatten diese Geschichte danach nie wieder erwähnt und sich kurze Zeit später ohnehin aus den Augen verloren. Als er sie kürzlich in mehreren Sitzungen auf Grund seiner Versetzung nach Münster wiedergetroffen hatte, war ihm klar geworden, dass Stephanie diese Geschichte nie vergessen hatte.
Gerade sagte sie: »Vielleicht habe ich Ihre volle Aufmerksamkeit, wenn ich Ihnen sage, dass der Mord in Westerkappeln geschehen ist.«
Die hatte sie nun tatsächlich, denn in Westerkappeln war Brockmann vor dreiundvierzig Jahren zur Welt gekommen. In diesem Dorf im Tecklenburger Land, das so gern eine Stadt wäre, war er in der altehrwürdigen evangelischen Stadtkirche getauft und konfirmiert worden und war dort fünf Jahre zur Schule gegangen. Vor allem aber hatte er so manche Kirmes gefeiert und erinnerte sich gern an den ersten schüchternen Zungenkuss im Musikexpress. Beim THC Westerkappeln hatte er Handball gespielt und war ein fröhlicher Junge mit vielen Freunden gewesen – bis zu dem Tag, an dem er Westerkappeln beinahe fluchtartig verlassen hatte.
Daran wollte er nicht schon in der ersten Nacht, die er zurück in Deutschland war, erinnert werden. Er merkte, dass seine Chefin am Telefon bereits ungeduldig mit den Hufen scharrte, also rang er sich dazu durch, den Fall anzunehmen. Anschließend erfuhr er von der Toten an der Lehmkuhle, und Frau Zwenger versprach, dass ein junger Kollege ihn in den nächsten zwanzig Minuten abholen würde.
Tatsächlich saß Hauptkommissar Matthias Brockmann eine halbe Stunde später bei Maik Zerhusen im Dienstwagen und war auf dem Weg zum Tatort. Zerhusen war ein junger, aufgeweckter Kommissar mit einer, wie Brockmann schon bald bemerken würde, ungewöhnlich ausgeprägten Spürnase.
Mit einem einfachen »Moin« hatte sich Brockmann auf die Rückbank des Wagens gesetzt und vermied zunächst eine Unterhaltung, während Zerhusen sich fragte, was für ein Mensch sein künftiger Chef wohl sein mochte, dass er sich lieber nach hinten statt zu ihm auf den Beifahrersitz setzte. Dabei war die Antwort ganz einfach, Brockmann war für ein Gespräch noch viel zu müde.
Am Himmel zeichnete sich das erste Morgenrot ab, als Brockmanns Handy klingelte. Der lautstarke Gesang Freddie Mercurys ließ Zerhusen zusammenzucken.
»Ich muss mir einen seriösen Klingelton zulegen«, sagte der Kommissar entschuldigend und nahm das Gespräch an. Es war noch einmal Stephanie Zwenger, die ihn informierte, dass sie Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufgenommen habe. Sie gab ihm die Handynummer von Dr. Robert Löbbel und betonte, dass dieser sehr viel Wert darauf lege, stets informiert zu sein.
»Korinthenkacker«, grummelte Brockmann, während seine Vorgesetzte ihm eine weitere Telefonnummer gab, die der Kollegin vor Ort, einer gewissen Julia Degraf.
»Der Name klingt nett und jung«, sagte Brockmann, ehe er begriff, dass Zerhusen nicht wissen konnte, worum es ging. »Ich habe nur laut gedacht«, entschuldigte sich der Kommissar. »Kennen Sie Oberkommissarin Julia Degraf?«
Zerhusen verneinte, während Brockmann bereits ihre Nummer wählte. »Hier ist Hauptkommissar Brockmann«, sagte er und kam direkt zur Sache. »Ich bin aus Münster auf dem Weg zu Ihnen. Ich hoffe, Sie kommen zurecht, bis ich bei Ihnen bin?«
Etwa fünfundzwanzig Kilometer entfernt machte Julia Degraf ein Gesicht, als hätte sie Zahnschmerzen. Die Arroganz war unüberhörbar, und so beschloss sie, ein kleines Spielchen mit dem Hauptkommissar durchzuziehen. »Eigentlich nicht«, antwortete sie mit nervöser, hilflos klingender Stimme.
»Ich stehe hier das erste Mal vor einem Mord. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn männliche Verstärkung eintrifft.«
Brockmann war zu müde, um die Anspielung zu begreifen. »Keine Sorge, ich bin gleich bei Ihnen!«, sagte er selbstgefällig. Anschließend ließ er sich die Situation vor Ort erklären.
Julia beantwortete bereitwillig alle Fragen und stellte sich vor, wie er in seinem Auto saß, gerade im Spiegel der Blende seine Frisur überprüfte und womöglich noch einmal den Deoroller aus seinem Herrentäschchen hervorholte. Sie gab ihrer Stimme einen devot klingenden Unterton, sodass der Kommissar den Eindruck gewinnen musste, vor Ort auf eine Kollegin zu treffen, die ihm von Anfang an überschwänglich dankbar sein würde.
Das Dienstfahrzeug erreichte den Ortseingang Westerkappelns, und prompt wurde Brockmann gesprächiger. Es war inzwischen hell, und er zeigte dem jungen Kollegen seine frühere Schule. Kurz bevor sie in die Bullerteichstraße abbogen, sahen sie hinter einer Tankstelle eine gut restaurierte, alte Villa.
»Hier hat unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff seine ersten Kindheitsjahre verbracht«, erzählte Brockmann. Gehorsam schaute Zerhusen zur Villa hinüber.
»Unsere Eltern haben sich gekannt«, fuhr er fort, und Zerhusen bemerkte, dass sogar ein wenig Stolz in der Stimme seines Chefs mitschwang.
Dabei kannte fast jeder Westerkappelner in den Sechzigerjahren den alten Wulff, der damals Betreiber eines Kinos im Ort gewesen war.
Zerhusen hatte im Auto das Navi eingeschaltet, doch Brockmann wollte den Weg zur Lehmkuhle unbedingt aus eigener Erinnerung heraus wiederfinden. Er freute sich, dass es ihm gelang. Eine Polizeisperre hinderte sie zuletzt weiterzufahren.
Maik Zerhusen zeigte dem Beamten an der Sperre seinen Dienstausweis und stellte Brockmann kurz vor.
»Tut mir leid«, sagte der Beamte, »aber Sie können trotzdem nicht näher an den Tatort heranfahren.«
»Na ja«, entgegnete der Kommissar, »ein bisschen Frühsport wird mir nicht schaden.«
Zerhusen bat er darum, am Auto zu warten, bis er abgeklärt hatte, ob sich bereits ein Team zur Aufklärung des Verbrechens gebildet habe und der junge Kommissar dort gebraucht werde.
Der Morgen war kühl, sodass Brockmann seine Fleecejacke überzog, die er vorsichtshalber mitgenommen hatte. Nun also begann sein erster Fall für die Mordkommission Münster. Der Hauptkommissar konnte seine Nervosität nicht leugnen. Auf dem Waldweg hatte er keinen Blick für die Schönheit des erwachenden Morgens. Dafür sah er etliche Schaulustige vom nah gelegenen Campingplatz. Einige von ihnen fotografierten und filmten, andere unterhielten sich mit Feuerwehrleuten und Polizisten.
»Filmt jemand die Schaulustigen?«, fragte er einen Polizeibeamten, der vorbeiging, ohne von Brockmann Notiz zu nehmen.
Brockmann sah ein, dass es zwecklos war, dies mit dem missmutig dreinschauenden Kollegen zu klären. In den USA gehörte es zum Standard, dass die Polizei am Tatort filmte, in Deutschland protestierte vermutlich jeder Datenschützer dagegen. Trotzdem nahm er sich vor, seine neue Kollegin darauf anzusprechen.
Brockmann hob das Absperrband und war erstaunt, dass es niemanden störte. Jeder war so mit sich selbst beschäftigt, dass er hier Gott weiß was hätte anstellen können. Doch Brockmann irrte sich.
»Hey, was machen Sie da?«, rief Frank Etgeton, der am Kleinbus der Polizei stand.
»Bitte gehen Sie sofort wieder hinter die Absperrung.«
Brockmann ging ungerührt weiter, während Etgeton ihm entgegenkam.
»Sie dürfen sich hier nicht aufhalten«, sagte der Kommissar der Schutzpolizei.
»Entschuldigung«, entgegnete Brockmann, »aber ich hoffe, man hat mich angekündigt. Mein Name ist Matthias Brockmann vom KK 11.«
Etgeton nickte sofort. »Tut mir leid«, sagte er, »aber hier muss man aufpassen wie ein Luchs, sonst sind bald keine Spuren mehr übrig. Natürlich wurden Sie uns angekündigt und …« Er sprach nicht weiter und beeilte sich, an einer anderen Stelle das Eindringen eines Passanten zu verhindern.
Brockmann hatte den Tatort erreicht und schaute sich nach der Kollegin um, die so dringend um Hilfe gefleht hatte. Er entdeckte sie, wie sie mit einem uniformierten Beamten am Feuerwehrwagen lehnte und sich unterhielt. Sie hatte ihn noch nicht gesehen, und Brockmann nutzte die Gelegenheit, sie zu mustern. Ihre kurzen, braunen Haare waren zerzaust, und ihre ganze Erscheinung hatte etwas von einem lauernden, ungezähmten Tier. Er korrigierte das Bild, das er sich von ihr am Telefon gemacht hatte. Die Frau schien alles andere als hilflos zu sein.
Nun hatte sie ihn entdeckt und winkte aufgeregt. »Ich komme sofort«, rief sie und beendete ihr Gespräch mit dem Kollegen in Uniform. Dann war sie an seiner Seite. »Guten Morgen«, sagte sie munter, »darf ich fragen, wer Sie sind?«
»Mein Name ist Brockmann«, sagte er leicht konsterniert, »Hauptkommissar! Wir haben gerade telefoniert.«
Julia ließ sich davon nicht beeindrucken. »Würden Sie sich bitte ausweisen!«
»Ich glaube, da erwischen Sie mich gerade auf dem falschen Fuß«, antwortete Brockmann und versuchte, jovial zu wirken.
»Wieso das?«, fragte die Kommissarin stur.
»Also in Kurzform: Ich bin gestern aus den USA gekommen und in Frankfurt gelandet, wollte in Münster übernachten, bekam einen Anruf und stehe jetzt hier. Am Montag übernehme ich das KK 11. Die Formalitäten konnte ich noch nicht erledigen, reicht das?«
»Tja, wie soll ich damit jetzt umgehen?«, fragte Julia ungerührt. »Ich werde mal die Dienststelle anrufen.« Sie war im Begriff, ihr Handy zu zücken, als bei Brockmann endlich der Groschen fiel.
»Okay«, sagte er. »Vielleicht habe ich mich vorhin am Telefon etwas zu sehr aufgespielt. Es tut mir leid. Können wir noch einmal von vorn beginnen?«
Die Kommissarin zuckte mit den Achseln. »Wie Sie wünschen«, sagte sie. Ihr unterkühltes Lächeln wirkte dabei schon nicht mehr überzeugend. Dieser gut aussehende Mann war ihr irgendwie sympathisch, und umgekehrt ging es Brockmann genauso. Er ahnte, dass er einer taffen, intelligenten Frau gegenüberstand, die ihm gewachsen war.
»Lassen Sie uns loslegen«, sagte der Kommissar und fragte als Erstes, ob sie veranlasst habe, dass die Schaulustigen gefilmt wurden.
»Ist bei uns nicht üblich«, antwortete sie verwundert. »Soviel ich weiß, verstößt es zudem gegen den Datenschutz.«
»Dann behandeln wir es als Gefahrenabwehr, um die zu dreist auftretenden Schaulustigen später ermitteln zu können«, sagte er seufzend und fügte hinzu: »Mein Gott, irgendetwas wird Ihnen doch einfallen, denn Sie machen nicht gerade den Eindruck, als hätten Sie das Polizeihandbuch auswendig gelernt.«
Julia beschloss einzulenken. »Die Idee ist gut«, gestand sie und winkte ihrem Kollegen Etgeton zu. Nachdem sie sich kurz abgesprochen hatten, wusste sie, dass die Angelegenheit bei ihm in guten Händen war.
Anschließend ging sie mit Brockmann zum Fundort der Leiche.
Brockmann zog sich die Schutzkleidung über, die sie ihm mitgebracht hatte. Sie selbst trug bereits einen der üblichen Overalls. Julia sprach kurz mit einem Mann von der Spurensicherung und ging dann schnurstracks zum Ufer. Brockmann folgte ihr. Über den Leichnam war inzwischen ein Pavillon als Sichtschutz aufgebaut worden. Davor hielten zwei Polizisten Wache, die höflich grüßten.
Brockmann entfernte das Leichentuch so weit, dass er das Gesicht der toten Frau sehen konnte. Dann besah er sich eines der Handgelenke. Ihm fielen die Spuren der Fesselung auf. »Was ist das?«, fragte er Julia.
»Soweit es die Gerichtsmedizinerin beurteilen konnte, muss die Frau an den Handgelenken gefesselt gewesen sein.«
»Hat sie noch weitere Verletzungen?«
»Und ob!«, hörte er hinter sich eine tiefe, weibliche Stimme.
Brockmann drehte sich um und sah in das Gesicht der etwa fünfzigjährigen Gerichtsmedizinerin.





























