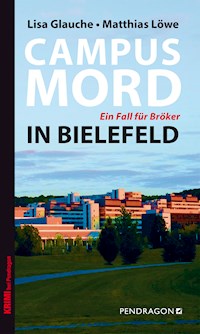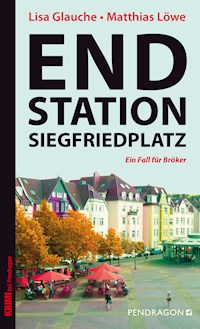Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bröker ist Privatier und führt in einer der besten Wohngegenden Bielefelds ein beschauliches Leben. Ohne Stress und mit viel gutem Essen. Ein Todesfall in der Nachbarschaft reißt ihn aus seinem Trott und weckt seinen detektivischen Spürsinn. Bröker wittert Mord. Unerwar tete Unterstützung erhält er von dem jugendlichen Hacker Gregor, der am Sparrenberg seine Sozialstunden ableisten muss. Als er endlich die Polizei davon überzeugen kann, dass das Opfer nicht an einer natürlichen Todesursache starb, ist der ansonsten eher gemütliche Bröker schon mitten in einem spannenden Fall. Das Autorenduo Löwe & Glauche legt mit seinem Debüt einen spannendenKrimi vor, der durch seinen Humor, seine liebevoll beschriebenen Charaktere und vor allem durch viel Lokalkolorit zu einem lesenswerten Ereignis wird. "Tod an der Sparrenburg" ist der erste Band einer neuen Krimireihe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Glauche · Matthias Löwe
Tod an der Sparrenburg
Bröker schätzt gutes Essen und sein ruhiges Leben am Fuße der Sparrenburg. Dank einer Erbschaft ist er von allen finanziellen Sorgen befreit – so kann er weiterleben, bis er 68 ist. Das hat er ausgerechnet, und älter will er eigentlich auch gar nicht werden. Doch dann wird er jäh aus seinem Trott gerissen. Sein Nachbar wird tot aufgefunden, mit dem Kopf in einem Teller Tomatensuppe. Seine Neugierde ist geweckt. Wurde der Bankier Wilfried Schwackmeier ermordet?
Die Polizei ermittelt nur mit halber Kraft und der ansonsten eher gemütliche Bröker dreht richtig auf. Unterstützung erhält er bei seinen Recherchen von einer attraktiven Journalistin und dem jungen Computer-Hacker Gregor, der sich mit seiner kleptomanisch veranlagten Freundin rumschlagen muss. Schon bald sind sie dem Täter auf der Spur …
Lisa Glauche wurde 1980 in Oldenburg (Niedersachsen) geboren. Sie studierte Philosophie und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft in Bochum. Seit 2007 lebt sie in Berlin und arbeitet als freiberufliche Texterin. Zusammen mit Matthias Löwe betreut Lisa Glauche seit 2005 das Online-Literaturforum www.blauersalon.net.
Matthias Löwe wurde 1964 in Löhne (Westfalen) geboren. Er studierte in Bielefeld und wohnte in der Teuto-Stadt – mit Unterbrechungen – von 1985 bis 1998. Nach einigen Lehrtätigkeiten in der Bundesrepublik und den Niederlanden ist er seit 2003 Professor für Mathematik in Münster.
Lisa Glauche · Matthias Löwe
Tod an der Sparrenburg
PENDRAGON
Kapitel 1Tod in der Tomatensuppe
Ein Mensch kann sich daran gewöhnen, am Morgen allerlei Seltsames in seiner Zeitung zu finden, ohne dass ihn dies aus seiner gewohnten Ruhe brächte. Er kann von einer Schuhverkäuferin lesen, die tagtäglich ihrer Arbeit nachgeht, um sich nach einem durchwachsenen Wetterbericht im Radio mit ihren beiden Kindern vom Balkon zu stürzen. Er kann im gleichen Blatt fünf Tage später von einem 28-Jährigen erfahren, der in seiner Wohnung fünfzehn Hunden Asyl gewährt, dann aber, als ihm der sechzehnte Hund gebracht wird, Amok läuft und dabei drei Menschen schwer verletzt. Oder er kann sich in einem populärwissenschaftlichen Artikel bestätigen lassen, dass Versuchspersonen bereit sind, anderen Menschen Stromstöße von mehr als 220 Volt zu versetzen, wenn man ihnen einredet, diese lernten dadurch schneller. Ein Mensch kann sich daran gewöhnen, all das allmorgendlich zu lesen, und trotzdem schmeckt das Salamibrötchen und der Orangensaft zum Frühstück kein bisschen schlechter. Man fühlt sich ein wenig nachdenklich, sinniert, wie die Welt beschaffen und zu erklären sei, und schenkt sich Kaffee nach.
Bröker wollte sich nicht gewöhnen. Er liebte es aber zu frühstücken. Jeden Morgen um halb elf, direkt nach dem Aufstehen. Er genoss sein Brötchen mit altem Gouda, am besten solchen, der ganz krümelig war, wenn man ihm vom Laib schnitt, und sein weiteres Brötchen mit Lachs und vor allem mochte er seine Rühreier mit Schinken. Und er liebte es, dazu Miles Davis’ Version von Porgy and Bess zu hören oder, wenn er melancholisch war, Louis Armstrong oder Stan Getz. Was blieb ihm also anderes übrig, als die großen überregionalen Tageszeitungen abzubestellen. Doch das war bei einem so ausgedehnten Frühstück, wie Bröker es mochte, nicht lange gut gegangen. Die Zeit war ihm lang geworden, die Mahlzeit ein wenig freudloser und Bröker hatte sich dabei ertappt, wie er begann, seine Lieblingssalami hastig in sich hineinzustopfen.
So hatte er schließlich einen Kompromiss gefunden und die beiden Bielefelder Lokalblätter, die Neue Westfälische und das Westfalen-Blatt abonniert. Natürlich berichteten auch diese über die Amokläufe dieser Welt. Doch ihr Budget gab nicht viel mehr her, als die üblichen Agenturmeldungen zu drucken, die man schnell überblättern konnte, und so blieben die einzigen wirklichen Hiobsbotschaften die Berichte über die Abstiege des heimischen Fußballclubs, der Arminia, aus der ersten Liga, die zwar seltener als Weihnachten, aber häufiger als die Schaltjahre waren. Dafür konnte man über die neuen Blitzgeräte am Ostwestfalendamm lesen, die Bröker als Nicht-Autofahrer beifällig nickend zur Kenntnis nahm, über archäologische Funde an der Sparrenburg, die das Gerücht von einem Fluchttunnel, der einst von der Burg bis zum Bunker Ulmenwall geführt haben sollte, neu belebten, oder von Bielefelds stadtbekanntem Flitzer, der sich, inzwischen mehr als 60-jährig, dieses Mal auf dem Zehnmeterturm des Wiesenbades entkleidet hatte, von dort jedoch entkommen war, bevor die Bademeister ihn hatten einfangen können.
Solche Nachrichten versetzten Bröker in die richtige Stimmung für ein ausgedehntes Frühstück, das er, sobald die Jahreszeit es zuließ, auch gerne im Freien zu sich nahm. Freilich, der Garten des gelben Stadthauses, das an einer Kreuzung am Sparrenberg lag, hatte seit dem Tod seiner Mutter vor ein paar Monaten seine wiedergewonnene Freiheit weidlich genutzt: Es waren nicht nur mehr Pflanzen als zuvor vorhanden, sondern vor allem auch solche, die niemand gepflanzt hatte, schon gar nicht Bröker. Zudem schienen sie besonders gut in den schmalen Fugen zwischen den Platten der Gehwege oder unter der Pergola zu gedeihen. Auch hatte das Gras trotz Brökers Bemühungen, es zumindest alle drei Wochen zu mähen, um weiterhin zu seinem angestammten Frühstücksplatz vordringen zu können, eine stattliche Höhe erreicht.
Bröker nahm all dies mit einer Mischung aus Interesse und Bedauern wahr. Auch wusste er, dass er selbst an den veränderten Zuständen, die seine Mutter nicht ganz zu Unrecht nicht nur im Garten als Auswüchse bezeichnet hätte, nicht unschuldig war. Es hatte keine vier Wochen gedauert, da hatte er sich sowohl mit der Haushälterin als auch mit dem Gärtner so überworfen, dass beide von sich aus gekündigt hatten. Während die Haushälterin die lästige Angewohnheit hatte, schon morgens um neun an Brökers Zimmertür zu klopfen (die der Mutter gab es ja nun nicht mehr), um nachzusehen, ob der Herr des Hauses bereit war, dem Tageslicht mit männlichem Mut entgegenzutreten, fand er den Gärtner, der tagelang Unkraut zupfen konnte, während Bröker in der Sonne saß, einfach nur beunruhigend und ein wenig spießig. Er brauchte kein Hauspersonal, hatte er für sich beschlossen, und sich so gar nicht erst nach neuem um gesehen.
Uli, Brökers rot gestreifter Kater, schien die üppige Vegetation auch besser zu gefallen. Er rollte sich meist während Brökers Frühstück hinter einem Strauch oder einem besonders prächtig sprießenden Grasbüschel zusammen und wartete, ob die Laune seines Herrchens so gut werden würde, dass für ihm ein Streifen Lachs abfiel. Uli war nach der ehemaligen Bielefelder Torwartlegende Uli Stein benannt. Doch Ulis Körper war nicht ganz so athletisch wie der seines Namensvetters zu guten Zeiten. Ja, wenn man ehrlich war, musste man Uli als fettleibig bezeichnen. Das taten auch alle, die Uli sahen, nur Bröker hielt sich eingedenk dessen, was ihm der Spiegel über seinen eigenen Körper wahrsagte, vornehm zurück. Diese Zurückhaltung war eher ungewöhnlich für Bröker: Obwohl er selbst bei einer mittleren Körpergröße zwei Zentner Lebendgewicht mit sich herumtrug, manchmal auch ein wenig mehr, kommentierte er gern und ausgiebig, wenn ihm selbst jemand ein wenig unförmig vorkam.
An diesem Morgen im Frühsommer aber wartete Uli vergebens. Wie immer saß Bröker – bereits mittelstark schwitzend – in den Strahlen der schon sehr kräftigen Vormittagssonne und las beim Frühstück in seiner Morgenzeitung. Die Arminia hatte am gestrigen Abend ihr Freundschaftsspiel bei den drittklassigen Stuttgarter Kickers verloren und Bröker verfolgte kopfschüttelnd den Spielbericht und die Einzelkritiken. Zwei Elfmeter und eine rote Karte hatten die Arminen gegen sich bekommen, das konnte doch nicht wahr sein! Er gestikulierte so heftig, dass Uli erschrocken aus seinem Versteck hervorgesprungen wäre, hätte ihn nicht seine eigene Körpermasse davon abgehalten. So sehr er sich auch an die Verhaltensweisen seines Herrchens angepasst hatte, an dessen Reaktionen auf Spielergebnisse der Arminia würde er sich nie gewöhnen können.
Während Uli noch seinen Fluchtinstinkt niederrang, hatte sich Bröker schon wieder in die Zeitung vertieft. Die Meldung auf der nächsten Seite nahm seine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch, dass er nicht nur die Niederlage der Arminia, sondern auch sein Salamibrötchen für einen Moment vergaß:
„Tod in der Tomatensuppe“ verkündete eine für die Neue Westfälische ungewohnt fette Schlagzeile. Der folgende Text, immerhin eine der wichtigsten Lokalnachrichten nach der Niederlage der Arminia, berichtete, dass der Bielefelder Bankier Wilfried Schwackmeier vorgestern Abend 67-jährig in seiner Villa am Bielefelder Sparrenberg gestorben war. Seine Putzfrau hatte ihn am gestrigen Mittwochmorgen tot aufgefunden, als sie wie üblich um neun Uhr gekommen war, um das Haus zu reinigen. Dabei hatte Schwackmeier dem Zeitungsbericht zufolge an einem feierlich gedeckten Tisch gesessen. Ein Glas Sancerre – dass es sich um diesen Tropfen handelte, war an der daneben stehenden Flasche erkennbar – hatte er anscheinend im Todeskampf umgeworfen, es hatte sich über das Tischtuch ergossen. Doch alles Aufbäumen hatte Schwackmeier nichts genützt – man fand ihn mit dem Gesicht in einem Teller Tomatensuppe liegend tot auf. Die von der Putzfrau herbeigerufene Polizei und Doktor Geringhoff, der Hausarzt des Toten, gingen von einem tödlichen Herzinfarkt aus. Dann folgte ein Absatz, der Schwackmeiers Wirken als Direktor einer Bielefelder Privatbank sowie in zahlreichen Organisationen der Bielefelder Oberschicht würdigte. Bröker schlug die Zeitung zu und widmete sich der Lektüre des Westfalen-Blatts. Hier war der Tod Schwackmeiers gar auf Seite eins der Lokalnachrichten gelandet, auch wenn den Redakteuren nur der vergleichsweise seriöse Titel „Tod eines Bankers“ eingefallen war. Auf das pikante Detail, dass man Schwackmeier mit dem Gesicht in einer Tomatensuppe gefunden hatte, mochte man aber auch hier nicht verzichten.
Ich hab ja geahnt, dass dieses vegetarische Zeug nicht gesund ist, dachte Bröker. Hoffentlich war sie wenigstens anständig gewürzt.
Als sich auch das Westfalen-Blatt in einem Lobgesang auf Schwackmeiers Verdienste erging, der in der Zeile „Bielefeld hat einen seiner bedeutendsten Mitbürger verloren“ gipfelte, beschloss Bröker, die Zeitungslektüre für den heutigen Tag zu beenden.
„Uli, komm einmal her!“, rief er seinen Kater und machte lockende Geräusche. Der Kater mauzte, aber bewegte sich keinen Zentimeter. Genießerisch blinzelte er in die Sonne, als wolle er sein Herrchen auffordern, doch selbst herzukommen.
„Uli, Schwackmeier ist tot!“, sagte Bröker. Dann noch einmal, wie zu sich selbst: „Schwackmeier.“
Natürlich kannte Bröker Schwackmeier. Nicht nur, dass dessen Villa sich kaum zweihundert Meter Luftlinie von seinem eigenen Haus entfernt befand, nein, vor vielen Jahren, Bröker war damals gerade einmal 15 Jahre alt gewesen, hatten er und Schwackmeier auch im selben Schachverein gespielt. Bröker, das potenzielle Jungtalent, Schwackmeier, knapp mehr als 40 Jahre alt, auf der Höhe seiner schachlichen Kraft, schon damals mehrfacher Vereinsmeister. So sehr sich Bröker auch gemüht hatte, er war Schwackmeier nicht gewachsen gewesen. Wahrscheinlich, weil ihn das gar nicht so gestört hatte, ihm fehlte der nötige Biss, den hatte er auch damals schon vor allem beim Essen gehabt.
Automatisch musste er an Palshöfer denken. Nicht einmal er, der damals Assessor gewesen war und heute den Rang eines Oberamtsrichters bekleidete, hatte ihn in entscheiden den Spielen schlagen können. Palshöfer war der ewige Zweite, obwohl er ehrgeizig war und unablässig an seiner Spielstärke arbeitete, auch um den Ansprüchen seines Vaters gerecht zu werden, der in den 50er und 60er Jahren verschiedene Titel im Schach errungen hatte.
Auch wenn Bröker schon längst nicht mehr im Verein spielte – wie so vieles war ihm irgendwann auch dabei der Ehrgeiz seiner Mutter gleichgültig geworden –, war die Freundschaft zu dem stets etwas eigenbrötlerischen Palshöfer bestehen geblieben. Ja, er war der Einzige, mit dem Bröker gelegentlich sogar noch eine Partie spielte, auch wenn er ihm aufgrund mangelnder Übung schon längst kein ebenbürtiger Gegner mehr war. Schwackmeier hingegen hatte er aus den Augen verloren, hatte hier und da mal von ihm gehört, am häufigsten wohl von Palshöfer, aber auch von seinen geschäftlichen Erfolgen oder seiner gesellschaftlichen Tätigkeit hatte er gelegentlich in der Zeitung gelesen.
Palshöfer und Schwackmeier aber waren auch über die nächsten 25 Jahre erbitterte Gegner im Schach geblieben und so verbissen Palshöfer auch trainierte: Nie hatte er seinen ewigen Opponenten überflügeln können, stets hatte dieser die Vereinsmeistertitel und Stadtmeisterschaften errungen, immer war er vor ihm gelandet, zuletzt, wenn sich Bröker richtig erinnerte, bei der Bielefelder Stadtmeisterschaft vor zwei Wochen.
Was wohl Palshöfer zu Schwackmeiers Tod sagt?!, fragte sich Bröker. Vermutlich wäre es sinnvoller, Palshöfer dies selbst zu fragen.
Kapitel 2 Verdauungsspaziergang
Bröker gab im Allgemeinen nicht viel auf die Wahrheit von Sprichwörtern, auf die einzelner dafür umso mehr. „In der Ruhe liegt die Kraft“ war eines, an das er sich häufig und gern erinnerte. Aber besonders mochte er „Nach dem Essen sollst du ruh’n oder tausend Schritte tun“, wobei sich Bröker zugegebenermaßen meist nur an den ersten Teil dieses vorgeschlagenen Rezeptes hielt.
Doch heute war es anders. Bröker verspürte beim Abräumen des Frühstücks eine seltsame Unruhe, die sich auch danach so hartnäckig hielt, dass er nicht wie gewöhnlich wieder in seinem Gartenstuhl Platz nahm, um ausführlich zu überlegen, wie er den weiteren Tag angehen würde, sondern sich einen leichteren Pullover um die Hüfte band, in ein paar Sandalen schlüpfte und zum Eingangstor ging.
„Uli, ich gehe ein wenig spazieren!“, rief er seinem Kater zu, der ihn unbeeindruckt ansah. „Na, wie es aussieht, wirst du eher nicht mitkommen“, sah Bröker etwas neidisch ein und ließ hinter sich das Tor zufallen.
Ohne es im Sinn zu haben, lenkte Bröker seine Schritte in Richtung der Schwackmeier’schen Villa, die im Vergleich zu Brökers Haus deutlich herrschaftlicher aussah und auch besser in Stand gehalten war. Ihre Giebel überragten die sie umgebenden Birken und glänzten weiß in der Sonne. Bröker verspürte eine Unruhe, die sicher durch die Meldung über Schwackmeiers Tod ausgelöst worden war.
Als er vor der Villa stand, linste er durch den schmiedeeisernen Zaun auf das Anwesen. Hinter den Fenstern regte sich nichts, das Haus schien nach Schwackmeiers Tod unbewohnt. Soweit sich Bröker erinnern konnte, hatte der Banker vor gut zehn Jahren seine Frau zugunsten einer deutlich jüngeren verlassen und war im Gegenzug wenig später von seiner neuen Geliebten für einen noch älteren, noch reicheren Altindustriellen aus Essen, dessen Familie durch die Montanindustrie zu Geld gekommen war, verlassen worden. Seitdem hatte es keine Meldungen über eine neue Liaison Schwackmeiers gegeben.
Während Bröker neugierige Blicke auf das Grundstück warf, bemerkte er, dass auch er nicht unbeobachtet blieb. Aus einem Fenster im oberen Stockwerk des Nachbarhauses lugte die graue Dauerwelle einer mindestens 80-jährigen Frau. Als Bröker zurückschaute, zuckte der Kopf zurück. Bröker wendete demonstrativ den Blick ab und spürte sogleich, wie der Kopf der Alten sich langsam wieder aus dem Fenster schob.
Wie eine Schildkröte, dachte Bröker und wiederholte das Spiel. Doch nach dem dritten Mal wurde ihm langweilig. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters schien der Alten noch mehr Zeit zur Verfügung zu stehen als ihm. Ein wenig bedauernd zuckte er mit den Schultern. Eigentlich hätte er gern erfahren, ob sie etwas Interessantes gesehen hatte, oder sich einfach nur mit ihr über Schwackmeier unterhalten, als Nachbarin bekam sie doch bestimmt vieles mit. Und sicher hatte sie eine Meinung über ihn. Da Bröker allerdings befürchtete, dass ihre Meinung die Spielchen vorab nicht wert war, verzichtete er lieber darauf, sie zu hören.
Palshöfer kam ihm wieder in den Sinn, er wohnte nicht weit von hier. Aber der war wie jeden Tag bis abends am Gericht. Bröker konnte sich nur schwer daran gewöhnen, dass ein Großteil seiner Freunde bis in den Nachmittag hinein beschäftigt war. Es war ihm tatsächlich ein paar Mal passiert, dass er vor verschlossener Tür gestanden und sich gewundert, ja beinahe gesorgt hatte, was seinen Freunden geschehen war. Bis ihm wieder einfiel, dass sie vermutlich einfach nur ihrer täglichen Arbeit nachgingen. Das war seine Sache nicht und Bröker war froh, dass ihm nach dem Tod seiner Mutter der Rest des Familienbesitzes, den irgendein Vorvorfahre mithilfe einer Textilfabrik erworben hatte, geblieben war. Bei seinem jetzigen Lebenswandel, so hatte Bröker errechnet, würde das kleine Wertpapierdepot zusammen mit dem Stadthaus so lange ausreichen, dass er bis zu seinem
68. Lebensjahr nicht arbeiten müsste. Und da er es für unwahrscheinlich hielt, dass er in einem so späten Alter nochmit dem Arbeiten beginnen würde, hatte Bröker irgendwann beschlossen, eben einfach nicht älter als 68 zu werden. Was bedeute, dass ihm gegenwärtig noch etwas weniger als 30 Jahre blieben, denn Bröker wurde in diesem Jahr 41. Vorausgesetzt seine Mutter hatte ihn mit seinem Geburtsdatum nicht bemogelt, denn manchmal kam er sich eher wie ein alt gebliebener Sechziger vor als wie jemand, der die Midlife-Crisis noch vor sich hatte.
Da Palshöfer arbeitete, Bröker seine Unruhe aber nicht loswurde, beschloss er, nicht ohne über diesen Entschluss zu staunen, seinen Spaziergang noch etwas fortzusetzen. „Cogitans ambulo“, murmelte er in Erinnerung an seinen Lateinlehrer, war sich aber der Formen nicht mehr so sicher. Nun, es war ja kein Römer in der Nähe.
Zunächst leise, dann vernehmlicher keuchend, machte er sich an den Anstieg zur Sparrenburg. Schon nach kurzer Zeit floss ihm der Schweiß über den Nacken und ließ das T-Shirt an seinem Oberkörper kleben.
Bestimmt kein Anblick, den man gerne sieht, dachte Bröker und fluchte leise angesichts dessen, dass sich bestimmt wieder ein Touristenbus auf die Sparrenburg verirrte hatte. Endlich war die ehemalige Zugbrücke erreicht. Bröker überquerte sie und ließ sich auf einen der großen Steine vor dem Innenhof der Burg fallen.
„Ach wär’ ich doch als kleines Kind gestorben!“, schimpfte er immer noch schwer atmend vor sich hin und schmiss den Pullover neben sich ins verdorrte Gras.
„Und an was?“, fragte eine Stimme.
„An Brechdurchfall!“, antwortete Bröker und schaute sich um, von woher die Stimme kam. Durch das Tor zum Innenhof der Burg trat ein etwa 16-jähriger Junge, der einen Greifstock in der Hand hielt, mit dem man Papierschnipsel und anderen Müll aufsammeln konnte. Bröker hätte ihn aufgrund seiner kleinen Statur jünger geschätzt, wäre da nicht sein waches Gesicht mit den fast schwarz wirkenden Knopfaugen gewesen, die ihn nun eingehend musterten.
„Ich kaufe grundsätzlich nichts, wenn ich im Freien sterbe!“, sagte Bröker. „Du kannst also weiterziehen.“
„Oh, du wollen nicht superschicke Sonnenbrille kaufen, ist auch gaaanz billig!“, duzte der Junge ihn zurück und rollte die Augen. „Hey, beruhig dich mal: Ich hab dich schnaufen hören. Wenn mein Roller solche Töne von sich gibt, muss dringend mal der Vergaser gereinigt werden.“ Dann schaute er ernster: „Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Kann ich was für dich tun?“
„Kennst du Diogenes?“ Bröker blieb mürrisch.
„Den Verlag? Also Bücher habe ich hier oben noch keine gefunden. Ich kann höchstens mit der neuen LIDL-Lektüre dienen, die Prospekte lagen dort drüben zuhauf im Gebüsch.“
„Oh Mann!“ Diesmal war es Bröker, der aufstöhnte. „Solltest du nicht eigentlich in der Schule sein? Kein Wunder, dass du die griechischen Philosophen nicht kennst, wenn du schon am Vormittag hier oben rumhängst.“
„Na ja, dein Musterknabe hat ja auch nur den ganzen Tag in der Tonne gehockt“, gab der Junge zurück. „Und wenn ich sehe, wie heiß dir ist, weiß ich nicht wirklich, ob ich dir aus der Sonne gehen soll.“
Bröker konnte es nicht unterdrücken, überrascht die Augenbrauen zu heben.
„Mal ganz abgesehen davon, dass den Griechen diese ganze intellektuelle Schiene nicht so viel gebracht zu haben scheint. Kann man ja jetzt an ihrer Finanzkrise sehen.“
Bröker schaute endgültig verwundert – das war nicht seine Vorstellung von einem 16-Jährigen, noch dazu von einem, der rund um die Sparrenburg Müll aufsammelte.
„Außerdem ist heute keine Schule, beweglicher Ferientag. Und ich bin hier auch nicht zum Vergnügen. Ich leiste Sozialstunden ab.“
„Sozialstunden, aha!“, erwiderte Bröker interessiert. „Hast du deinen Roller frisiert oder einer Oma die Handtasche geklaut?“
„Weder noch! Ich hab mich beim Hacken erwischen lassen.“
„Beim Hacken?“ Bröker schaute ungläubig. „Bundesbank, CIA, NASA?“
„Haha, na klar, wenn ich mich bei der NASA eingehackt hätte, dürfte ich jetzt wohl eher Weltraum-Müll aufpicken. Nee, ich bin in die Datenbank der Bielefelder Uni eingebrochen, weil ich wissen wollte, wer Diogenes ist.“
Bröker musste grinsen. Der Junge gefiel ihm. Nicht nur, dass er nicht auf den Kopf gefallen war – auch die Tatsache, dass er mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, machte ihn Bröker sympathisch. Irgendwie, so dachte er, war er ihm nicht unähnlich gewesen, nur war das schon ziemlich viele Jahre her.
„Nein, was ich wirklich gemacht habe, ist eine längere Geschichte, das wird heute nichts mehr“, fuhr der Junge fort. „Wenn ich jetzt nicht weiterarbeite, wird der Aufseher da drüben mir gleich was erzählen.“ Mit dem Kopf deutete er auf einen Mann am anderen Ende des Burghofes. „Und das brauche ich gerade nicht. Ich bin übrigens Gregor!“, fügte er hinzu und streckte Bröker die Hand entgegen.
„Bröker!“, erwiderte Bröker und ergriff sie. „Die Geschichte mit dem Hacken würde ich aber wirklich gern hören. Ich habe selbst mal ein paar Semester Informatik studiert. Gehackt habe ich aber nie, vielleicht zeigst du mir mal ein paar Kniffe. Ich wohne nicht weit von hier.“
Er griff in seine Hosentasche und zog einen abgegriffenen
Block und einen soliden Kugelschreiber hervor, riss einen Zettel ab, notierte seine Adresse und reichte ihn Gregor, der ihn lässig in seiner Hosentasche verschwinden ließ.
„Echt, du hast Informatik studiert? Gab es das denn damals schon?“
„Nun ja, nachdem ich zuerst ein paar Semester Mathematik und Physik studiert und mich dann noch mit ein paar Semestern Philosophie von dem Stress erholt hatte, war auch die Bielefelder Uni so weit und hat Naturwissenschaftliche Informatik angeboten. Das habe ich aber auch nur drei Semester durchgehalten. Dann fand ich Soziologie doch interessanter.“
„Donnerwetter, du musst ja einiges auf dem Kasten haben. Na, vielleicht schau ich wirklich mal bei deiner Tonne vorbei!“ Dann begann Gregor wieder den Müll vom Boden aufzusammeln.
Bröker hob seinen Pullover auf, wischte sich den Schweiß damit von Stirn und Nacken, stand auf und ging ein Stück weiter um die Burg herum, bis er seinen Blick über die Stadt wandern lassen konnte, die sich langsam in ihren Kokon aus Hitze verpuppte. Er stützte seine Arme auf der Mauer ab. Wieder ging ihm der morgendliche Bericht über Schwackmeiers Tod durch den Kopf. Was daran ließ ihn nur nicht los? Er rief sich noch einmal ins Gedächtnis, wie Schwackmeier dem Zeitungsbericht zufolge gefunden worden war. Er stellte sich den feierlich gedeckten Tisch vor, den Suppenlöffel neben der gefalteten Serviette, die verschiedenen Besteckreihen daneben. Automatisch schmückte er das Ganze mit einer weißen Tischdecke, einer Sauciere und einem silbernen Kerzenleuchter aus und empfand das selbst als albern. Auf dem Tisch hatte vielleicht ein Weinkühler mit einer Flasche Chardonnay gestanden, ach nein, die Zeitung hatte von einer Flasche Sancerre berichtet und ein Glas davon hatte sich über den Tisch ergossen. Und mitten in diesem Arrangement lag Schwackmeier vornüber mit dem Gesicht in der Tomatensuppe. Bröker musste zugeben, dass das Gesamtbild einer gewissen Komik nicht entbehrte. Auch farblich waren die roten Sprenkel auf dem weißen Tischtuch recht reizvoll, existierten jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso wie der Leuchter nur in seiner Phantasie. Und sie brachten ihn auch nicht darauf, was Bröker an dieser Schilderung nicht gefiel. Oder war es nur die Tatsache, dass jemand gestorben war, den er kannte? Dass der Tod einen Treffer unmittelbar in seiner Nähe gelandet hatte?
Erneut wischte Bröker sich den Schweiß von der Stirn und schaute über die Stadt. Er machte den Turm der Altstädter Nicolaikirche aus, den der Marienkirche und das Hochhaus der Telekom am Kesselbrink. Und was war dieser hohe Mast dort am Horizont? Der musste sich fast in Schildesche befinden, dort, wo es dunstig wurde. Bröker zuckte mit den Achseln.
Nein, es war etwas anderes, was ihn beunruhigte, etwas anderes als der Tod von jemandem, den er kannte. Irgendetwas an dem Bild stimmte nicht.
Bröker schaute sich um, ob Gregor noch auf dem Gelände zu sehen war. Manchmal half es ja schon, jemandem zu erzählen, worüber man grübelte, und während man noch erzählte, begann man allmählich klarer zu sehen. Das hatte schon der gute, alte Kleist gewusst. Doch Gregor war weit und breit nicht mehr zu entdecken.
Verdammt, Bröker war sich jetzt ganz sicher: Irgendetwas an der Szenerie in Schwackmeiers Haus passte nicht. War es nicht beispielsweise merkwürdig, eine so reichhaltig gedeckte Tafel allein für sich aufzubauen? Von weiteren Gedecken aber hatten die Zeitungen nicht berichtet. Auch nicht von einer Köchin, die bei der Zubereitung der Speisen behilflich gewesen wäre. Nun, das konnte eine Nachlässigkeit in der Berichterstattung sein. War es aber wirklich denkbar, dass sich Schwackmeier ein mehrgängiges Menü selbst zubereitet hatte? Nicht sehr wahrscheinlich. Aber auch nicht völlig unmöglich. Schließlich kochte auch Bröker gelegentlich üppiger nur für sich selbst, nicht zuletzt war diese Leidenschaft ein Grund für die unüberbrückbaren Differenzen gewesen, die sich zwischen ihm und der Haushaltshilfe aufgetan hatten. Aber: Wo waren die anderen Gänge? Davon, dass vielleicht noch ein Hauptgang und eine Nachspeise in der Küche gewartet hatten, war keine Rede gewesen. Nun, das mochte eine weitere Nachlässigkeit in der Berichterstattung sein, Nachlässigkeiten in Berichterstattungen kamen ja nicht allzu selten vor. Aber was, wenn nicht? Wenn er, Bröker, gekocht hätte, hätte er den Hauptgang zumindest schon einmal vorbereitet, da hätte schon ein Sößchen geköchelt oder ein Fisch in der Pfanne geschmurgelt. So ein Mahl musste man doch in einem Guss genießen! Wenn Bröker eines nicht leiden konnte, dann, wenn man gutes Essen nicht mit der gebührenden Sorgfalt behandelte.
Ja, das konnte es sein, was ihn an dem Bild von Beginn an gestört hatte. Aber was bedeutete das? Da hatte sich also Schwackmeier allein lukullischen Genüssen hingegeben, sich dazu einen Sancerre kredenzt, das Ganze dann aber so arrangiert, dass nicht klar war, was er nach der Vorspeise zu essen gedachte. Seltsam, sicher. Aber war das ausreichend, um einen Verdacht zu hegen? Moment! Bröker versuchte seine Gedanken rückwärts zu spulen wie einen Film. Er hatte etwas gedacht, das seinen Verdacht verstärkte, nur was verflixt? Noch einmal stellte er sich Schwackmeiers Tafel vor. Die Suppe, das Besteck, den Sancerre. Der Wein! Das war es! Das hatte ihn den ganzen Vormittag über nicht zur Ruhe kommen lassen. Sicher, er hatte Schwackmeier seit mehr als einem Viertel Jahrhundert nicht mehr gesprochen und in dieser Zeit mochte sich so manches geändert haben. Aber damals, vor 25 Jahren im Schachclub, wäre ein Schwackmeier mit einem Weinglas in der Hand nicht vorstellbar gewesen. Immer wieder hatte er ungefragt (und später auch des Öfteren gefragt, wenn die Schachkameraden ihn wieder einmal zu einer seiner Tiraden provozieren wollten) über die gefährlichen Folgen des Alkohols doziert. Gerne hatte er dabei auch mit einem Schuss Selbstgerechtigkeit darauf hingewiesen, dass es ja Gründe dafür gab, dass er sie allesamt im Schach besiegte – war er eben der Einzige, der auch nach der Partie nie einen Tropfen Alkohol anrührte. Bröker war sich sicher: Ein Schwackmeier mit einer Flasche Wein im Kühler wäre damals undenkbar gewesen.
Noch dazu Sancerre, dachte Bröker, der guten Wein liebte. Damals hätte Schwackmeier eine Flasche Sancerre nicht von einem Tetra Pak Pennerglück unterscheiden können! Wenn sich Schwackmeier seit ihrem letzten Zusammentreffen nicht in einigen Punkten ganz entschieden geändert hatte, dann war etwas faul an der Geschichte.
Bröker richtete sich wieder auf. Vor Aufregung vergaß er diesmal ganz, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Er empfand eine Mischung aus Erleichterung und Erregung. Leichter war ihm, weil ihm aufgegangen war, was ihn an der morgendlichen Meldung störte. Gleichzeitig war ein viel größeres Rätsel am Horizont aufgetaucht, dessen Dimensionen er noch nicht abzuschätzen wusste.
Kapitel 3 Bröker und die Obrigkeit
Bröker umrundete die Sparrenburg. Etwas musste unternommen werden! Der Tod Schwackmeiers war nicht mit rechten Dingen zugegangen und er hatte es bemerkt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!