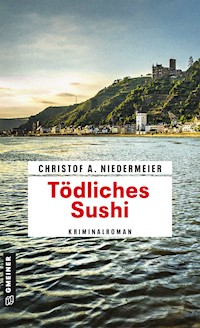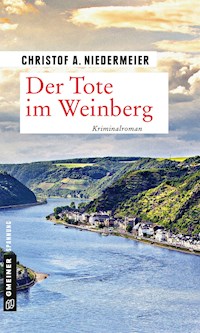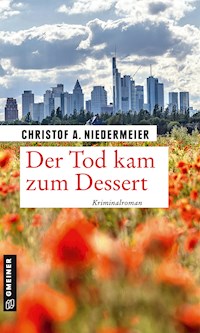Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Koch Jo Weidinger
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Als der Schiffer Otto Keller nach einer durchzechten Nacht in Frankfurt unter Mordverdacht gerät, zögert Jo Weidinger keine Sekunde. Der junge Küchenchef hat bereits einige Verbrechen aufgedeckt und glaubt an die Unschuld seines Freundes. Doch der kann sich an nichts mehr erinnern, nachdem er auf dem Frachter seines Konkurrenten neben dessen Leiche aufgewacht ist. Hat Otto seinen verhassten Rivalen im Rausch ermordet? Der komplexe Fall führt Jo und seine Restaurantleiterin Kati bis in den Drogensumpf von Amsterdam, wo sie in tödliche Gefahr geraten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christof A. Niedermeier
Tod auf dem Main
Kriminalroman
Zum Buch
Blutroter Main Als der Schiffer Otto Keller nach einer Nacht im Frankfurter Bahnhofsviertel an Bord eines fremden Frachters erwacht, klebt Blut an seiner Kleidung. Vergeblich versucht er sich an die letzten Stunden zu erinnern, da stolpert er über einen grausigen Fund: die Leiche seines verhassten Konkurrenten. Hat er den Mann etwa im Rausch getötet? In seiner Verzweiflung wendet sich Otto an seinen Freund Jo Weidinger, der in der Mainmetropole ein Gourmetrestaurant für einen Wirtschaftsmogul aufziehen soll. Der junge Küchenchef hat bereits mehrere Fälle auf eigene Faust gelöst und eilt zu Hilfe. Doch alle Indizien sprechen gegen Otto. Als die Polizei seine Fingerabdrücke auf der Mordwaffe findet, scheint er überführt. Jo ist jedoch von Ottos Unschuld überzeugt und stürzt sich gemeinsam mit seiner Restaurantleiterin Kati in die Ermittlungen. Während sich die beiden privat annähern, geraten sie in ein perfides Netz aus Geld, Macht und Drogen. Als sie einer Spur nach Amsterdam zum skrupellosen Drogenbaron de Koning folgen, geraten beide in tödliche Gefahr …
Christof A. Niedermeier stammt aus der Oberpfalz. Sein Studium der Sprachen, Wirtschaft und Kulturwissenschaften führte ihn nach Passau und Norwich in England, bevor er vor über 20 Jahren nach Frankfurt am Main zog. Neben seiner Arbeit bei einem internationalen Großkonzern schreibt er seit vielen Jahren Kriminalromane. Besonders faszinieren ihn als Schriftsteller die Psychologie seiner Figuren und das Eintauchen in fremde Welten. Bei seinen intensiven Recherchen begibt er sich regelmäßig in die unterschiedlichen Milieus und an die realen Schauplätze seiner Romane. Der neueste Fall seines sympathischen Ermittlers Jo führt ihn vom verruchten Frankfurter Bahnhofsviertel bis ins berüchtigte Amsterdam.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Ricarda Dück
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © time. / Photocase.de
ISBN 978-3-8392-7286-2
Widmung
In Erinnerung an Christian
Prolog
»Sind Sie sicher, dass Sie mich heute nicht mehr brauchen, Mijnheer?« Der Parlamentsfahrer sah Vincent van Doorn fragend durch den Rückspiegel an.
Der Politiker schüttelte den Kopf. »Setzen Sie mich an der gewohnten Stelle ab, Luuk. Ich nehme mir später ein Taxi.«
»Wie Sie wünschen, Mijnheer.«
Einige Minuten später hielt der Wagen in der Nähe des Bahnhofs. Vincent van Doorn öffnete die Tür und stieg aus. Er nickte seinem Fahrer zum Abschied zu und wartete, bis die schwarze Limousine um die Ecke gebogen war. Dann drehte er sich um und ging in die entgegengesetzte Richtung davon. Es war ein milder Abend und die Sonne stand bereits tief am Horizont. Vom Bahnhof war es ein Katzensprung bis zum Rossebuurt, der »roten Nachbarschaft«, wie die Einwohner Amsterdams ihr Rotlichtviertel liebevoll nannten. Vincent van Doorn war in der Stadt geboren und hatte den Großteil seines Lebens hier verbracht. Er konnte sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Deshalb hatte er auch den Wohnort nicht gewechselt, als er ins Parlament in Den Haag eingezogen war – obwohl er dafür an Parlamentstagen eine gute Stunde Fahrzeit in Kauf nehmen musste.
Van Doorn hatte den Bahnhof hinter sich gelassen und wandte sich in Richtung De Wallen, einem der drei Rotlichtbezirke. Er zählte zu den ältesten und schönsten Vierteln Amsterdams. Die schmalen gepflasterten Straßen mit ihrem mittelalterlichen Flair und den sorgfältig restaurierten Häusern aus dem 14. Jahrhundert beeindruckten ihn jedes Mal von Neuem. Links von ihm tauchte die Oude Kerk auf, die »alte Kirche«, mit ihrer wuchtigen gotischen Fassade.
Er verspürte Stolz auf seine Heimatstadt, denn wo sonst war die Prostitution derart gelungen ins tägliche Leben integriert, wechselten sich Bordelle, Sexshops und Stripklubs wie selbstverständlich mit Baudenkmälern, bekannten Restaurants und angesagten Bars ab? Sicher, dass Frauen aus aller Welt in rot gesäumten Schaufenstern ihre amourösen Dienstleistungen wie eine Ware anboten, mochte für Traditionalisten anstößig wirken. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern war die käufliche Liebe in den Niederlanden jedoch legal und musste sich nicht in dunklen Ecken verstecken, wo die Bedingungen für die Frauen oft härter waren. Aus der ehemals anrüchigen Gegend war inzwischen ein In-Viertel und Touristenmagnet geworden. Scharen von Männern, Händchen haltende Paare, trendige Hipster, Althippies und kichernde Gruppen von Frauen, die einen Junggesellinnenabschied feierten, drängten sich nebeneinander durch die engen Gassen.
Van Doorn wechselte die Straßenseite und blieb vor einer Seitengasse stehen. Unauffällig blickte er sich um. Die Niederländer mochten tolerant sein, aber er wurde als kommender Minister gehandelt. Er konnte es sich nicht leisten, dass seine spätabendlichen Besuche im Rotlichtmilieu in den Medien auftauchten.
Eine Gruppe japanischer Touristen marschierte an ihm vorbei. Der Fremdenführer sprach in ein Megafon und versuchte, seine Schäflein zusammenzuhalten. Van Doorn konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Ein junges Pärchen, das nur Augen für sich hatte, spazierte Händchen haltend vorüber. Sonst war niemand zu sehen – außer einem schlanken, augenscheinlich älteren Mann. Er lehnte am Brückengeländer gegenüber, wandte dem Politiker den Rücken zu und starrte hinunter auf den Kanal. Van Doorn wunderte sich, dass der Mann einen dunklen Trenchcoat und eine karierte Schiebermütze trug, obwohl es angenehm warm war. Doch er schenkte ihm keine weitere Beachtung, vergewisserte sich erneut, dass er nicht beobachtet wurde, und verschwand in der dunklen Gasse.
Der Mann im Trenchcoat wartete einige Augenblicke, bevor er sich umdrehte, seine Hornbrille zurechtrückte und van Doorn unauffällig folgte. Er steckte sein Smartphone in die Manteltasche, über dessen Bildschirm er dank einer Minikamera, die in seinen Mantel eingearbeitet war, alles beobachtet hatte, was sich hinter ihm abgespielt hatte. Er war dem Politiker bereits gefolgt, seit dessen Fahrer ihn am Bahnhof abgesetzt hatte.
Kapitel 1
»An Tisch sieben sitzt Urs Gassmann!« Kati Müller, die Restaurantleiterin und Sommelière des Waidhauses, sah ihre Kollegen in der Küche aufgeregt an.
»Wer soll das sein?«, fragte Jo Weidinger, ohne von dem Teller hochzublicken, den er gerade kunstvoll anrichtete. Als Hauptgang gab es in der Pfanne gebratene Medaillons vom Hunsrücker Reh auf Rouennaiser Sauce mit glasierter Victoria-Ananas, Vanille und Galabé.
»Ich glaube, das ist ein Schweizer Eishockeyspieler«, erklärte Pedro, ohne eine Miene zu verziehen.
»Ihr seid solche Banausen!«, schimpfte Kati und schüttelte ungläubig den Kopf. »Er ist ein bekannter Industrieller und Milliardär. Ihm gehören mehrere Sternerestaurants. Mensch, ihr müsst doch in den Medien was darüber mitbekommen haben! Es ist eine der heißesten Erfolgsgeschichten der letzten Jahre in der Gastro-Branche! Zwei seiner Läden haben inzwischen drei Michelin-Sterne.«
Jo dämmerte es. Er hatte vor einiger Zeit in einem Fachmagazin ein Interview mit Gassmann gelesen – wobei, ehrlicherweise hatte er es nur überflogen. Der Schweizer Unternehmer war mit dem Verkauf von Energieriegeln reich geworden und hatte aus dem Nichts ein Milliardenunternehmen aufgebaut. Im Lauf der Zeit hatte er expandiert und seinen Fokus erweitert. Neben verschiedenen Firmen für Nahrungsergänzungsmittel sowie Softdrinks und Spirituosen umspannte sein Imperium inzwischen zahlreiche Betriebe in unterschiedlichen Industrien in ganz Europa – von der Chemie- über die Pharma-, Luft- und Raumfahrtbranche bis hin zu regionalen Energieversorgern und der Abfallentsorgung.
Jo seufzte, als er daran dachte, wie lange er gebraucht hatte, sich mit seinem eigenen Restaurant im Rheintal einen Namen zu machen und eine Stammkundschaft aufzubauen. Obwohl er und seine Mannschaft jeden Tag hart arbeiteten und fantastische kulinarische Kreationen auf den Tisch brachten, besaß das Waidhaus immer noch keinen Stern. Und dann kam ein Großindustrieller, warb die besten Köche der Branche an und deckte sie mit den besten Zutaten und den teuersten Weinen aus aller Welt ein, sodass sie sich drei Sterne erkochen konnten.
»Er hat das vegetarische Menü bestellt«, informierte Kati ihn.
»Gut. Schreib einen Bon, und wir kümmern uns darum.«
Die junge Sommelière sah ihn erwartungsvoll an.
»Sonst noch was?«
»Vielleicht könntest du etwas Spezielles für ihn kreieren.«
»Aus dem Stand?«, fragte Jo entgeistert. »Wie stellst du dir das vor?«
»Keine Ahnung. Du hast doch immer gute Ideen. Wir sollten ihm was Außergewöhnliches servieren, das er nicht so schnell vergisst. Kommt schließlich nicht jeden Tag vor, dass so ein hohes Tier in unserem Restaurant sitzt.«
»Du weißt genau, dass meine Menüs bis ins Detail auf einander abgestimmt sind. Da fange ich nicht kurzfristig an herumzudoktern. Alles ist perfekt, so wie es ist. Außerdem ist dieser Gassmann für mich ein Gast wie jeder andere. Nur weil er ein paar Milliarden besitzt und sich die Sterne für seine Restaurants zusammenkaufen kann, ist er für mich niemand Besonderes.«
»Sehe ich anders«, widersprach Kati. »Gassmann hat Einfluss in der Szene. Wenn er uns weiterempfiehlt, ist das eine große Hilfe für uns.«
»Als ob wir so was nötig hätten«, entgegnete Jo herablassend.
»Genau«, stimmte Pedro zu. »Wir in der Küche sind hart schuftende Proletarier und leisten jeden Tag Kärrnerarbeit. Wir machen vor dem Großkapital keinen Bückling!«
»Ihr seid solche Idioten!«, fauchte Kati. »Da bietet sich uns eine große Gelegenheit und ihr lasst sie sausen.« Aufgebracht rauschte sie aus der Küche.
»Die ist heute wieder in Fahrt«, bemerkte Pedro. »Aber mit einem hat sie recht: Der Typ hat beste Verbindungen. Wenn er in seinen Kreisen Werbung für uns machen würde, wäre das nicht schlecht für uns. Sollen wir nicht doch etwas Spezielles für ihn zubereiten? Vielleicht einen zweiten Gruß aus der Küche?«
»Nein«, antwortete Jo barsch. »Alles bleibt, wie es ist!«
Als wenige Minuten später die Vorspeise für Gassmanns Tisch angerichtet wurde, übernahm Jo die Aufgabe persönlich. Es gab Zucchiniröllchen an einer Variation von bunten Sommertomaten mit Estragon und Safran, dazu angemachte Wildkräuterspitzen. Er schmeckte die Schalotten-Vinaigrette sorgfältig ab und würzte sie nach. Anschließend probierte er sie erneut. Er nickte zufrieden und betätigte die Klingel für den Service. Als er hochblickte, stand Kati vor ihm. Sie hatte ihn beobachtet und konnte sich ein süffisantes Grinsen nicht verkneifen.
»Ist was?«, fragte er in herausforderndem Ton.
»Nee, alles perfekt, Chef. Sieht toll aus!« Sie griff nach den Tellern und verschwand mit ihnen in Richtung Gaststube.
»Was meinst du, warum ist dieser Gassmann ausgerechnet zu uns gekommen?«, fragte Philipp, ihr Jungkoch. »Wenn er eigene Restaurants besitzt, kann er doch dort hingehen.«
»Soweit ich mich erinnere, hat er keines in Deutschland«, antwortete Jo.
»Vielleicht will er das Waidhaus kaufen«, mutmaßte Pedro.
»Quatsch«, wehrte Jo ab.
»Warum? Ist einfacher, ein Spitzenrestaurant wie unseres zu übernehmen, als ein neues aufzubauen, oder? Und unsere hervorragende Lage mit Blick auf die weltberühmte Loreley ist bestimmt ein überzeugendes Argument.«
»Dann halt dich besser ran an deinem Posten«, erwiderte Jo spitz. »Nicht, dass dein neuer Boss unzufrieden ist und dich als erste Amtshandlung rausschmeißt.«
Zusätzliche Bestellungen flatterten herein, sodass keine Zeit für weitere Frotzeleien blieb. Als der Hauptgang für Gassmanns Tisch anstand, übernahm Jo wieder das Anrichten. Auf das Gericht war er besonders stolz: hausgemachte Kartoffelgnocchi mit Steinpilzen und sanft gegartem Eigelb vom freilaufenden Landhuhn auf Waldpilzragout mit weißer Zwiebelmarmelade und cremiger Rotweinsauce. Es sah nicht nur hervorragend aus, sondern schmeckte auch so. Er mochte zwar keinen Stern haben, aber damit musste er sich vor niemand verstecken, dachte er grimmig.
Nachdem er und sein Team den Mittagsservice abgearbeitet hatten, begannen sie, die Küche aufzuräumen.
Plötzlich stand Kati in der Tür. »Das Menü hat Gassmann geschmeckt«, verkündete sie. »Außerdem hat er explizit gesagt, dass er meine Weinempfehlung hervorragend fand«, ergänzte sie stolz. Sie hörte sich aufgekratzt an.
»Dann ist ja alles bestens«, meinte Jo spöttisch, wobei er eine gewisse Genugtuung nicht verbergen konnte.
»Aber nur, weil ich euch Bescheid gegeben habe. So konntet ihr einen perfekten Teller vorbereiten«, behauptete Kati selbstzufrieden.
»Von wegen. Bei uns ist alles top, was wir schicken«, erwiderte Pedro großspurig.
»Wie auch immer. Herr Gassmann hat nach Jo gefragt und würde gern mit ihm sprechen.« Kati sah Jo mit ihren geheimnisvollen smaragdgrünen Augen aufmerksam an.
»Was will er denn?«, fragte er unwillig.
»Hat er nicht verraten.«
Widerstrebend band Jo sich die Schürze ab, die er sich für den Abwasch umgelegt hatte. Als er den Gastraum betrat, verharrte er für einen Augenblick. Er erkannte einige Stammgäste und grüßte freundlich. Unauffällig blickte er zu Tisch sieben. Selbst wenn er nicht gewusst hätte, wer Gassmann war, wäre der Mann ihm aufgefallen. Seine grauen Haare waren kurz, fast militärisch geschnitten. Sein Anzug saß wie angegossen, was darauf hindeutete, dass er maßgeschneidert war. Am Handgelenk trug er eine Uhr, die vermutlich so viel gekostet hatte wie Jos alter Volvo. Der junge Küchenchef versuchte einzuschätzen, wie alt Gassmann war. 50? 55?
Wären seine grauen Haare nicht gewesen, hätte Jo ihn für jünger gehalten. Er war schlank und machte einen sportlichen Eindruck. Neben ihm saß eine attraktive junge Frau in einem dunkelblauen Kostüm, die Jo neugierig musterte. Unwillkürlich straffte er die Schultern und trat an den Tisch der beiden.
»Sie wollten mich sprechen?«, fragte er und versuchte dabei, ruhig und geschäftsmäßig zu klingen. »Ich hoffe, unser Menü hat Ihnen geschmeckt.«
»Durchaus«, erwiderte der Unternehmer, erhob sich und streckte die Hand aus. »Mein Name ist Gassmann. Das ist meine Mitarbeiterin Cora Schneider«, erklärte er und zeigte auf seine Begleitung, die ebenfalls aufgestanden war.
»Haben Sie einen Moment Zeit für uns?«, fragte Gassmann und deutete einladend auf den Stuhl gegenüber.
Ohne große Begeisterung setzte Jo sich. Er machte zwar regelmäßig nach dem Service eine Runde durchs Restaurant, vermied es aber üblicherweise, Platz zu nehmen, da er sonst leicht in längere Gespräche verwickelt wurde.
»Kompliment an Sie und Ihr Team. Ihr vegetarisches Menü war exzellent. Und das, obwohl ich sonst kein großer Freund der vegetarischen Küche bin. Ganz im Gegensatz zu Cora – sie isst kein Fleisch und ist quasi eine Expertin. Du fandest es auch sehr gut, stimmt’s?«, fragte er die junge Frau.
»Absolut«, antwortete sie. »Herr Weidinger ist ein Meister seines Fachs.«
Unwillkürlich fragte Jo sich, ob Cora Schneider für Gassmann mehr als nur eine Mitarbeiterin war. Schnell schob er den Gedanken beiseite.
»Es freut mich, dass unser Menü Ihnen beiden zugesagt hat«, erklärte er steif. »Empfehlen Sie uns gerne weiter.«
Gassmann lachte. »Sehr geschäftstüchtig, Herr Weidinger. Aber so muss es sein, wenn man in der Spitzengastronomie tätig ist. Schließlich ist es kein einfaches Pflaster. Ich weiß nicht, ob Ihnen mein Name etwas sagt. Ich betreibe in Europa verschiedene Unternehmungen, darunter einige Restaurants.«
»Ist mir bekannt«, entgegnete Jo. »Ich habe Ihr Interview im Gastro-Magazin gelesen.«
»Umso besser. Dann muss ich Ihnen nicht viel über mich erzählen.«
Gassmann lächelte. Jo fiel auf, dass seine Augen nicht mitlächelten.
»Ich würde Ihnen gern ein Angebot unterbreiten.«
»Dieses blöde Scheißding!«, fluchte Otto Keller und schlug frustriert mit einem Schraubenschlüssel gegen den Dieselmotor.
»So wird das nix, Otto. Du musst dir Zeit lassen mit der alten Lady. Warum willst du immer alles hopplahopp machen?«
»Erzähl mir nicht, wie man einen Motor repariert, okay? Für den Fall, dass du es vergessen haben solltest – ich habe Schiffsingenieur studiert!«
Otto sah sich wütend um zur Luke, von der aus sein Steuermann Karl jeden seiner Handgriffe beobachtete.
»Ich weiß, aber wenn du erwartest, das geht so einfach wie die Reparatur an den modernen 30.000-PS-Motoren von den Kreuzfahrtschiffen, auf denen du gearbeitet hast, irrst du dich. Du musst in Ruhe einen Schritt nach dem anderen ausführen – so wie dein Vater es gemacht hat.«
»Wir haben keine Zeit, verdammt! Wenn wir nicht bis drei Uhr in Mainz sind, verpassen wir unser Zeitfenster fürs Löschen der Ladung.«
»Ist mir bekannt, junger Mann. Nur hilft Hektik uns an der Stelle nicht weiter.«
Otto seufzte. Auch wenn er es ungern zugab: Karl hatte recht. Am liebsten hätte er umgehend den Diesel gegen einen neuen ausgetauscht. Dafür fehlte ihm allerdings das nötige Kleingeld. Banken waren sehr zurückhaltend, wenn es um Investitionen in so ein altes Schiff ging wie die Rheinschwalbe. Bis er die nötigen Mittel zusammengespart hatte, musste er sich wohl oder übel mit der Anfälligkeit der Maschine arrangieren.
»Gib mir den Zehnerschlüssel«, bat er Karl.
Der reichte ihm das gewünschte Werkzeug. »Du schaffst das schon«, versuchte Karl, ihn aufzumuntern.
Eine halbe Stunde später war es so weit. Nach drei erfolglosen Versuchen sprang der Schiffsdiesel endlich an. Otto wischte sich den Schweiß von der Stirn und eilte hinauf auf die Brücke, wo Karl bereits das Steuer übernommen hatte.
»Gib Vollgas!«, ordnete er an.
»Bist du sicher?«, fragte Karl zweifelnd.
»Ja«, antwortete Otto grimmig. »Wenn sie unter Volllast nicht bis Mainz durchhält, können wir es sowieso vergessen.«
»Du bist der Boss«, bemerkte Karl und schob den Regler nach vorne. Mit deutlich vernehmbarem Brummen des Motors nahm die Rheinschwalbe Fahrt auf.
Kapitel 2
»Gefällt es Ihnen?«, fragte die Dame vom Catering-Service und blickte Jan de Koning erwartungsvoll an. »Wir haben diesmal eckige Teller genommen. Zusammen mit den modernen Kerzenleuchtern und der Tischdeko ergibt es ein stimmiges Bild, finden Sie nicht?«
»Ganz bezaubernd, meine Liebe«, lobte de Koning. »Wie sieht es mit dem Essen aus, alles im Plan?«
»Ich habe Mark, unseren Koch, persönlich instruiert. Er weiß Bescheid, wann er die einzelnen Gänge schicken soll, und wird sich strikt an Ihre Vorgaben halten.«
»Wunderbar. Er ist neu bei Ihnen, nicht?«
»Mark arbeitet seit zwei Monaten bei uns. Davor war er Souschef im Le Taillevent in Paris. Ich will nicht zu viel versprechen, aber Sie werden begeistert sein. Mark hat das Zeug zu einem Sternekoch. Die Kunden, bei denen er bisher gekocht hat, haben alle in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt.«
»Hört sich gut an.«
»Den Service übernimmt Thijs Vermeulen. Sie kennen ihn bereits von den letzten beiden Events. Er ist äußerst diskret, so wie Sie es wünschen.«
De Koning nickte zufrieden.
»Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich mich verabschieden.«
»Danke, meine Liebe. Tim wird Sie nach unten begleiten.«
Nachdem die Dame vom Catering-Service gegangen war, begab sich de Koning in sein Ankleidezimmer. Er legte bei den Treffen mit seinen Leuten Wert auf formelle Kleidung, auch wenn es mitten am Tag war. Anzug und Krawatte waren für ihn Pflicht, ebenso wie ein Hemd mit Manschettenknöpfen.
Als er umgezogen war, betrachtete er sich im Spiegel. Er sah genauso aus, wie ein erfolgreicher Geschäftsmann seiner Meinung nach auszusehen hatte. Das maßgeschneiderte Ensemble wurde durch eine dezente Krawatte und handgefertigte Schuhe komplettiert. Dazu trug er eine geschmackvolle Uhr, deren Wert dennoch für jeden auf den ersten Blick erkennbar war. Die einzige Extravaganz, die er sich leistete, war ein schwerer goldener Siegelring, den er am rechten Ringfinger trug. Wer Jan de Koning nicht kannte, wäre sicherlich nicht auf den Gedanken gekommen, dass er der Boss eines berüchtigten internationalen Drogenrings war.
Selbstzufrieden drückte de Koning die Schultern durch, während er seinen Kragen zurechtzupfte. Er hatte als kleiner Drogendealer im Rotlichtviertel Amsterdams begonnen und sich mit strategischem Geschick und einer gehörigen Portion Skrupellosigkeit bis an die Spitze seines Syndikats gearbeitet. Inzwischen kontrollierte er von Amsterdam aus einen Drogenring, der sich über halb Europa erstreckte. Alle drei Monate lud er die Statthalter der wichtigsten Regionen in seine Amsterdamer Villa ein. Bei einem aufwendigen Menü besprachen sie die aktuelle Lage, diskutierten neue Strategien und tauschten sich über den Wettbewerb aus. De Koning liebte exquisites Essen und verband gerne das Angenehme mit dem Nützlichen.
Tim, einer seiner beiden Leibwächter, klopfte und unterbrach de Konings Gedanken.
»Ja?«
»Die ersten Gäste sind eingetroffen.«
»Wer?«
»Nicolas Durand und Dirk Schmitt.«
De Koning lächelte. Dass der Deutsche überpünktlich war, fiel in die Rubrik »erwartbar«. Wenn allerdings ein Franzose eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn des gemeinsamen Mittagessens aufschlug, konnte man das als besonderen Respektserweis verbuchen.
De Koning begab sich ins Esszimmer in der unteren Etage seiner Villa und begrüßte seine beiden Geschäftspartner. Nach und nach trafen die übrigen Männer ein: Franco Marino, Juan Castillo, Pjotr Jankowski und Andris Berzina.
Nachdem sie ihren Aperitif ausgetrunken hatten, lud de Koning seine Gäste mit einer Handbewegung zu Tisch. Wie immer hatte er weder Kosten noch Mühen gescheut. Als Amuse-Bouche gab es Rosette von der gratinierten Jakobsmuschel mit Kürbis, Marone, Birne und Eisenkraut, gefolgt von bretonischem Steinbutt mit Walnusskruste und buntem Gemüse. Als Hauptgang ließ de Koning eine fein gebratene Taubenbrust mit Cassis-Glace an geräucherter Maiscreme und Romanasalat mit Himbeervinaigrette servieren. Zu jedem Gang wurde ein anderer Wein gereicht. Die Auswahl hatte de Koning selbst übernommen.
»Und, schmeckt es?«, fragte er in die Runde.
»Ausgezeichnet«, lobte Nicolas Durand überschwänglich. »Wie schaffst du es nur, jedes Mal so ein großartiges Menü auf den Tisch zu zaubern?«
»Für euch nur das Beste«, gab de Koning gönnerhaft zurück.
Nachdem der Hauptgang abserviert war und der Kellner jedem nachgeschenkt hatte, zog sich das Personal dezent zurück.
»Über die Planung für die nächsten Monate haben wir geredet, daher möchte ich zum Abschluss auf ein Thema zu sprechen kommen, das mir besonders am Herzen liegt«, ergriff de Koning das Wort.
Alle Augen richteten sich auf ihn. Er lächelte. De Koning liebte es, im Mittelpunkt zu stehen.
»Religion. Oder, um genauer zu sein: die Bibel.«
Die Männer sahen ihn überrascht an. Dass de Koning sich mit Religion beschäftigte, war ihnen neu. Zudem zeugte die Art und Weise, wie er sein Syndikat führte, nicht gerade von Nächstenliebe.
»Liest du in der Bibel, Dirk?«, fragte de Koning seinen Statthalter aus Deutschland, der ihm gegenübersaß.
Schmitt blickte ihn verständnislos an. Er schien abzuschätzen, ob de Koning ihn auf den Arm nehmen wollte. Er versuchte, in de Konings Gesicht zu lesen, doch dessen Miene war völlig ausdruckslos.
»Als Kind hatte ich Religionsunterricht«, antwortete Schmitt zögerlich, »aber, wenn ich ehrlich bin, habe ich mit Religion nicht viel am Hut.«
»Ist nicht schlimm«, winkte de Koning ab. »Ich schätze Ehrlichkeit. Wie ist es bei dir, Franco?«
Der Italiener, der gerade nach seinem Rotweinglas greifen wollte, stockte mitten in der Bewegung. »Ähm … Ich bin natürlich katholisch. Wie die meisten bei uns im Land. Wir gehen regelmäßig mit den Kindern in die Kirche. Zumindest an den wichtigen Feiertagen.«
»Sehr löblich. Vermutlich kennst du dich gut mit der Bibel aus.«
»Nun ja, als großen Experten würde ich mich nicht bezeichnen«, bekannte Franco und grinste unsicher.
»Sagt dir Matthäus 6, Vers 24 etwas?«
»Nicht aus dem Stand«, gab der Italiener zu.
»Das ist eine Stelle aus der Bergpredigt.«
»Aha.«
»Sie hat mich nachhaltig beeindruckt. Deswegen wollte ich sie euch nicht vorenthalten.« De Koning legte das Besteck zur Seite und ließ den Blick über die Männer am Tisch schweifen. »Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.«
Der Italiener versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, konnte aber nicht verhindern, dass er während des Zitats blass geworden war.
»Hasst du mich, Franco?«
»Nein, natürlich nicht«, verwahrte sein Gegenüber sich. »Wie kommst du auf so einen Gedanken?«
»Wenn du mich nicht hasst, warum dienst du dann noch einem anderen Herrn?«
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
De Konings Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Er sprach gefährlich leise. »Ich werde dir diese Frage nur ein einziges Mal stellen, Franco. Überleg dir also genau, was du antwortest. Hast du für die Kolumbianer 20 Kilo Kokain geschmuggelt?«
Der Italiener biss sich auf die Lippen. Er war jetzt kreidebleich. »Es war eine einmalige Sache …«, stotterte er. »Mein Schwager hat Krebs, und da gibt es diese Behandlung in den USA – die kostet mehrere Hunderttausend Dollar. Ich musste schnell Geld auftreiben, sonst …«
»Das ist mir scheißegal!«, donnerte de Koning ihn an und schlug mit der Faust so fest auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. Die Männer um ihn herum waren vor Schreck erstarrt. »Ist dir klar, dass du mit derartigen Deals unsere gesamte Organisation gefährdest? Was ist, wenn die Polizei den Kolumbianern auf die Schliche kommt? Dann stehen sie als nächstes bei uns vor der Tür. Darüber schon mal nachgedacht?«
Franco blickte stumm auf die Tischplatte.
»Steh auf!«, befahl de Koning.
Während der Italiener sich wortlos erhob, legte der Niederländer ein paar Handschuhe vor sich auf den Tisch. Sie waren an den Handknöcheln verstärkt.
»Für den Fall, dass es bei irgendjemand Unklarheiten darüber geben sollte: Euer Arsch gehört mir. Ich zahle euch mehr als genug Geld für eure Dienste. Dafür erwarte ich bedingungslose Loyalität. Ist das klar?«
De Koning streifte sich die Handschuhe über, stand auf und trat auf seinen italienischen Statthalter zu. Den ersten Schlag platzierte er mitten ins Gesicht. Francos Lippe platzte auf, und Blut spritzte auf seinen Hemdkragen. Der nächste Treffer ging in die Magengrube. Der Italiener knickte ein und stöhnte. De Koning hielt ihn mit einer Hand an der Schulter fest und schlug erneut zu. Die Hiebe kamen in immer rascherer Folge. Franco konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und sackte zusammen. Erst jetzt ließ de Koning von ihm ab. Er zog die Handschuhe aus, legte sie auf die Anrichte neben dem Esstisch und setzte sich seelenruhig auf seinen Platz. Doch seine glänzenden Augen verrieten, wie sehr er seinen Auftritt genossen hatte. Der Reihe nach blickte er jedem einzelnen seiner Männer direkt ins Gesicht. Keiner von ihnen wagte, auch nur zu blinzeln.
»Damit es keinerlei Missverständnisse gibt: Franco ist so billig davongekommen, weil ich heute gute Laune habe und das exzellente Mittagessen nicht verderben möchte. Sollte ich noch einmal einen von euch dabei erwischen, dass er Geschäfte nebenbei betreibt, werde ich nicht so großzügig sein. Und es ist mir scheißegal, ob euer Hund eine Darmspiegelung benötigt oder ihr eine Niere für den Papst organisieren müsst. Dem nächsten, der glaubt, er kann mich verarschen, werde ich jeden einzelnen Knochen brechen, ihm die Augen ausstechen und seine Leiche in Einzelteilen in einen unserer schönen Amsterdamer Kanäle werfen. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
Am Tisch herrschte atemloses Schweigen. Die Furcht stand den Männern ins Gesicht geschrieben. De Koning lächelte. Angst war ein hervorragender Motivator. Nur, wenn seine Leute überzeugt davon waren, dass er jederzeit bereit war, ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, die Kehle durchzuschneiden, spurten sie auch.
»Geht’s wieder?«, fragte er Franco, der immer noch am Boden kniete. »Putz dir das Gesicht ab. Du siehst ja aus, als wärst du die Treppe runtergefallen.«
De Koning reichte dem Italiener eine unbenutzte Serviette. Wortlos griff der Angesprochene danach und wischte sich das Blut von der aufgeplatzten Lippe. Langsam erhob er sich und setzte sich wieder an den Tisch. Obwohl er vor Wut kochte, versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen.
»Schön, dass wir das geklärt haben«, meinte de Koning gut gelaunt. »Das Dessert ist übrigens eine Wucht. Es gibt weiße Schokolade mit Passionsfrucht, Kokosnuss, Meringe und ein Ananas-Tamarindensorbet. Solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.«
Urs Gassmann und Cora Schneider blickten Jo erwartungsvoll an. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, dass sich Kati in der Nähe ihres Tisches herumdrückte. Offensichtlich versuchte sie, mit einem Ohr dem Gespräch zu folgen, während sie mit anderen Gästen plauderte. Jo musste daran denken, was Pedro gesagt hatte. Wollte Gassmann ihm wirklich sein Restaurant abkaufen? Wenn er das Gastro-Konzept dieses Moguls richtig verstanden hatte, war das Waidhaus dafür denkbar ungeeignet: viel zu klein und nicht in einer Metropole gelegen. Gassmanns Restaurants befanden sich in Zürich, Wien, Paris, Amsterdam und London.
Der Unternehmer schien seine Verunsicherung zu spüren. »Warum gehen wir nicht in Ihr Büro und ich erzähle Ihnen, worum es geht«, schlug er vor.
Jo überlegte. Dann nickte er.
Sie erhoben sich, wobei Jo den beiden höflich den Vortritt ließ. Er warf einen kurzen Blick auf Kati, die ihnen neugierig hinterherschaute. Sie brannte sicherlich darauf zu wissen, was Gassmann mit ihm besprechen wollte.
»Nach links«, dirigierte Jo, als sie den Gastraum verlassen hatten.
Siedend heiß fiel ihm ein, dass er sein Büro nicht aufgeräumt hatte. Sie wären besser im Restaurant sitzen geblieben. Aber dafür war es jetzt zu spät. Letztlich spielte es keine Rolle, beruhigte er sich. Schließlich hatte er nicht vor, das Waidhaus zu verkaufen. Egal, welchen Preis Gassmann ihm dafür bieten wollte.
»Bitte entschuldigen Sie die Unordnung«, erklärte er, während er den Unternehmer und seine Mitarbeiterin mit einer Handbewegung einlud einzutreten. Er schob die Rechnungen, die kreuz und quer auf seinem Schreibtisch verteilt lagen, auf einen Stapel zusammen. »Bitte nehmen Sie Platz.«
»Sie machen Ihre Bücher selbst?«, fragte Gassmann erstaunt.
»Für die Buchhaltung habe ich jemanden. Um das Rechnungsmanagement kümmern wir uns selber.«
»Erstaunlich. Ein Künstler am Herd wie Sie sollte seine Zeit nicht mit Papierkram vergeuden.«
»Vielen Dank für die Blumen«, entgegnete Jo. »Normalerweise erledigt das meine Restaurantleiterin Kati Müller. Sie hatte allerdings ein paar Tage frei. Deswegen ist einiges liegen geblieben.«
»Wenn Sie meinen Vorschlag annehmen, müssen Sie sich in Zukunft um solche Dinge keine Gedanken mehr machen«, versprach Gassmann. »Sie sagten vorhin, Sie hätten das Interview im Gastro-Magazin gelesen. Insoweit müssten Sie mit den Grundzügen unseres Geschäftsmodells vertraut sein. Trotzdem würde ich Ihnen gern einen tieferen Einblick geben, was mich zum Einstieg in die Gastronomie bewegt hat.«
»Wie Sie möchten«, gab sich Jo reserviert.
»Ich bin in der Nähe von Zürich aufgewachsen. Während meines Studiums habe ich viel Sport getrieben – Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen. Anfang der 90er-Jahre habe ich zum ersten Mal an einem Ironman teilgenommen. Der Sport stand in Europa noch in den Startlöchern. Ich habe begonnen, Qualifikationsturniere für Hawaii zu organisieren. Da kam mir die Idee für den ersten Energieriegel, den Gassmann Energize. Mit ihm kann man während des Wettbewerbs seine Energiespeicher optimal auffüllen. Seine Zusammensetzung wurde speziell auf die Bedürfnisse von Leistungssportlern abgestimmt. Die Leute haben mir das Zeug regelrecht aus den Händen gerissen. Und zwar nicht nur im Profibereich, sondern auch im Freizeitsport. Es war genau das, worauf der Markt gewartet hatte. Der Absatz ist so durch die Decke gegangen, dass wir mit der Produktion kaum hinterherkamen. Nach und nach ist ein breites Portfolio an Fitness- und Freizeitprodukten entstanden. Gleichzeitig haben wir ins Ausland expandiert. Zuerst in Europa, danach in Asien. Da viele unserer Geschäftspartner unsere Produktionsanlagen sehen wollten, hatten wir ständig internationale Gäste. Die muss man standesgemäß bewirten. Vor allem die Asiaten und Franzosen legen Wert auf gehobene Küche – je mehr Sterne, desto besser. Leider ist Zürich diesbezüglich lange Zeit eine Diaspora gewesen. In den vergangenen zehn Jahren sind zwar eine Reihe von erstklassigen Restaurants dazugekommen, aber keines hat es in Zürich zu drei Sternen gebracht.« Gassmann hielt inne. »Deswegen haben wir entschieden, es selbst zu machen«, fügte er lässig hinzu.
»Einfach so?«
Der Unternehmer lächelte. »Sie wissen am besten, dass in der Spitzengastronomie nichts ›einfach so‹ funktioniert. Es ist das Ergebnis harter Arbeit. Dazu braucht man – wie bei jeder Unternehmung – das nötige Quäntchen Glück. Davon abgesehen bin ich der Meinung, dass Erfolg planbar ist und man drei Sterne problemlos erkochen kann, wenn man es richtig anfängt und bereit ist, die nötigen Mittel einzusetzen.«
»Wenn man sie hat«, bemerkte Jo trocken.
»In meinem Fall ist das zum Glück nicht das Problem«, erklärte Gassmann, ohne eine Miene zu verziehen. »Im Lauf der Zeit hat sich mein Fokus erweitert. Inzwischen sind wir in zahlreichen europäischen Ländern und darüber hinaus vertreten. Mein Ziel ist es, an den für unsere Unternehmensgruppe wichtigsten Standorten eine Gastronomie auf Topniveau zu etablieren. Meiner Erfahrung nach beeindruckt man gestandene Geschäftsleute mit nichts mehr als mit einem eigenen Drei-Sterne-Haus.«
»Warum erzählen Sie mir das alles?«
»Wir haben in den vergangenen Jahren stark in Deutschland expandiert. Bislang ein weißer Fleck auf unserer kulinarischen Landkarte. Das wollen wir ändern und in Frankfurt ein neues Restaurant eröffnen.«
»Und was hat das mit mir zu tun?«
»Ich möchte Sie dafür als Küchenchef gewinnen.«
»Mich?« Jo war perplex. »Ich habe nicht einmal einen Stern, geschweige denn zwei oder drei. Sollten Sie nicht jemand einstellen, der sich seine Sterne bereits erkocht hat?«
»Davon abgesehen, dass man Sterne nicht von einem Restaurant zum nächsten mitnehmen kann, ist das nicht unser Ansatz. Einen prominenten Namen anwerben, kann jeder. Wir wollen beweisen, dass wir unsere Ziele organisch erreichen – ohne die Lorbeeren anderer oder fremde Hilfe. Wir setzen auf junge, unverbrauchte Gesichter. Die kommenden Stars in der Küche, die mit ihrer eigenen Handschrift die Branche in den nächsten Jahren prägen werden. Kurz gesagt: jemand wie Sie.«
Jo schüttelte den Kopf. Natürlich war er von sich und seinem kulinarischen Konzept überzeugt. Aber zwei oder gar drei Sterne?
»Es freut mich, dass Sie mir das zutrauen. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass Ihr Angebot schmeichelhaft ist. Aber ich fürchte, zum jetzigen Zeitpunkt wäre das eine Nummer zu groß für mich.«
»Sie sollten Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ihr vegetarisches Menü war brillant – eine Explosion am Gaumen mit den unterschiedlichsten geschmacklichen Nuancen. Dazu bis ins Detail perfekt abgeschmeckt. Ich esse oft in Sterne-Häusern rund um den Globus. Glauben Sie mir, Sie müssen sich vor niemandem verstecken.« Gassmann machte eine Pause, um seine Worte wirken zu lassen. »Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrer Küche? Acht? Neun?«
»Mich eingeschlossen? Sechs.«
Der Unternehmer sah zu seiner Mitarbeiterin. »Sechs Leute? Wahnsinn, oder?«
Cora Schneider nickte.
»Wenn Sie mit so einer kleinen Mannschaft bereits derartig gute und abwechslungsreiche Gerichte auf den Teller bringen – was glauben Sie, können Sie erst erreichen, wenn Sie 20 Köche unter sich haben? Cora wird dafür sorgen, dass Sie nur mit Topleuten arbeiten.«
20 Köche? Das Ganze wurde zunehmend surreal.
»Wie sind Sie auf mich gekommen?«, wollte Jo wissen. »Ich nehme nicht an, dass Sie zufällig bei uns hereingeschneit sind.«
»Wie ich Ihnen bereits erläutert habe: Unser Erfolg fällt nicht vom Himmel. Wir planen ihn minutiös. Seit wir uns vor gut einem Jahr dazu entschieden haben, ein Restaurant in Frankfurt zu eröffnen, arbeitet Cora an einer Liste der besten jungen Köche in Deutschland.«
Jo überlegte. »Ihr Angebot klingt verlockend. Aber wie Sie wissen, betreibe ich mit dem Waidhaus ein eigenes Restaurant.«
»Verkaufen Sie es. Oder wenn Sie das nicht wollen: Machen Sie beides! Mir reicht es, wenn Sie die Gerichte für unsere Karte kreieren und unsere Küchenmannschaft an das höchste Niveau heranführen. Dafür sollten fünf Tage in der Woche ausreichen. Die restlichen beiden Tage können Sie im Waidhaus nach dem Rechten sehen. Ich zahle Ihnen trotzdem das volle Gehalt als Küchenchef. Für jeden Stern, den Sie erkochen, bekommen Sie zusätzlich einen Bonus: 10.000 Euro für den ersten Stern, 20.000 für den zweiten und 30.000 für den dritten. Und jedes weitere Jahr, in dem Sie die drei Sterne halten, erhalten Sie 30.000 Euro.«
Jo starrte ihn ungläubig an.
»Überlegen Sie es sich. Aber nicht zu lange. Wir wollen im Herbst eröffnen. In spätestens zwei Wochen müssen wir unseren Küchenchef an Bord haben. Dann werden wir mit der Werbung starten. Logischerweise sind wir auch mit anderen Kandidaten im Gespräch. Sie sind allerdings unsere Nummer eins, das darf ich verraten. Es ist eine große Chance für Sie. Verpassen Sie sie nicht!« Gassmann erhob sich. »Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Cora wenden. Sie weiß über alles Bescheid.«
Die junge Frau zückte eine Visitenkarte und reichte sie Jo. »Über meine Mobilnummer bin ich rund um die Uhr erreichbar – Tag und Nacht«, erklärte sie.
Jo begleitete seine Besucher bis zur Eingangstür und blickte ihnen hinterher, als sie zu einer Limousine gingen. Ein Fahrer öffnete die Tür für Gassmann. Anschließend lief er auf die andere Seite des Wagens und ließ Cora Schneider einsteigen.
Plötzlich standen Pedro und Philipp neben Jo.
»Wow, das ist ein Maybach S 680 mit Zwölfzylindermotor«, rief Philipp ehrfurchtsvoll. »Die Kiste hat 612 PS und kostet über 200.000 Euro in der Grundausstattung. Dazu kannst du zig Extras ordern.«
»Ist nur ein Auto«, sagte Jo trocken.
»Ich finde die Farbkombination cool«, meinte Pedro. »Wenn ich im Lotto gewinne, hole ich mir die gleiche Karre, auch in Silber und Schwarz.«
»Was wollte er von dir?«, fragte Kati, die wie aus dem Nichts aufgetaucht war.
»Uns für unsere erstklassige Küche loben«, erwiderte Jo geistesabwesend.
»Dafür musstet ihr extra in dein Büro gehen?«, hakte seine Restaurantleiterin nach.
Jo zuckte mit den Schultern. Für einen Moment schwiegen alle vier.
»Habt ihr nichts zu tun?«, fragte Jo schließlich.
»Doch«, antworteten Pedro und Philipp unisono. Schnell verzogen sie sich in die Küche.
Bevor Kati eine weitere Frage stellen konnte, drehte Jo sich um, ging in sein Büro und schloss die Tür hinter sich.
Kapitel 3
»Zehn Minuten bis zum Abladetermin«, bemerkte Otto Keller ungeduldig.
»Wir werden nicht schneller, wenn du laufend die Zeit verkündest, die uns noch bleibt«, brummte Karl und schnitt eine Grimasse.
»Lass mich mal ran!«, befahl Otto und griff nach dem Steuerrad.
Widerstrebend trat Karl beiseite. Otto stellte den Geschwindigkeitsregler auf Volllast.
»Du legst es heute drauf an, was?«, meinte Karl und schüttelte missbilligend den Kopf.
»Wenn du das Tempo nicht gedrosselt hättest, während ich unter Deck war, hätten wir das Problem nicht«, knurrte Otto.
»Wir hätten den Termin ohnehin nicht halten können. Deswegen bin ich auf 80 Prozent gegangen. Ob wir fünf oder zehn Minuten zu spät kommen, ist egal. Wenn uns die Maschine um die Ohren fliegt, kommen wir heute gar nicht mehr ans Ziel. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns jemand den Platz wegschnappt, gering.«
Die nächsten Minuten hielten die Männer den Blick stumm nach vorne gerichtet. Schließlich zeichnete sich am Horizont der Mainzer Hafen ab. Als sie näherkamen, sahen sie, dass ein anderes Frachtschiff vor ihnen fuhr.
»Hoffen wir, dass der nicht in Mainz anlegt«, raunte Karl.
Otto schwieg eisern.
Karl griff zum Fernglas und spähte hindurch. »Es ist die Friederike II., das Schiff von Norbert Pfahl. Hattest du mit dem nicht neulich Ärger in Köln?«
Ottos Miene verfinsterte sich. Er griff zum Mikrofon seines Funkgeräts. »Hier spricht die Rheinschwalbe. Friederike II., bitte kommen.«
Es dauerte einen Moment, bevor sich eine männliche Stimme meldete: »Friederike II. hört.«
»Wir haben einen Abladetermin am Kai 7. Bitte lassen Sie uns passieren, falls Sie ebenfalls in Mainz anlegen wollen.«
Am anderen Ende war unvermittelt eine andere Stimme zu hören. »Hier spricht Kapitän Pfahl. Bist du’s, Keller?«
»Ja«, antwortete Otto.
»Wann habt ihr euren Termin?«
»Vor fünf Minuten.«
»Zu dumm.«
»Nimm Schub runter, und wir ziehen an euch vorbei. Ihr könnt nach uns anlegen.«
»Warum sollten wir?«
»Weil wir spät dran sind und sich sonst alles weiter nach hinten verschiebt.«
»Pech für euch! Wir müssen auch an Kai 7.«
»Kann nicht sein. Ich habe den Slot um 15 Uhr gebucht.«
»Während wir sprechen, hat uns der Hafenmeister euren Termin geben. Tut mir leid, Alter!«
»Das kannst du nicht machen!«, rief Otto wütend.
»Ist nicht meine Schuld, dass ihr zu spät seid.«
»Wir hatten Maschinenprobleme. Das kann jedem passieren.«
»Nur, wenn man mit so ’ner alten Schrottmühle rumfährt.«
Otto musste an sich halten, um nicht seine Selbstbeherrschung zu verlieren. »Sei vernünftig, Pfahl. Wir sind doch Kollegen«, stieß er hervor.
»Na gut. Aber nur, wenn du artig bitte sagst.«
Otto biss sich auf die Lippen. Er hielt das Steuerrad so hart umklammert, dass das Weiße an seinen Knöcheln hervortrat. »Bitte, Pfahl.«
Für einen Moment blieb es am anderen Ende stumm.
»Hab’s mir überlegt, Keller. Da wir heute ausnahmsweise früh dran sind, müssen wir das ausnutzen und unsere Ladung löschen. Du weißt, wie es ist: Zeit ist Geld.«
»Du blödes Schwein!«, brüllte Otto ins Mikro. »Wegen dir verliere ich meinen Anschlussauftrag.«
Sein Kontrahent lachte. »Ganz ruhig, Dicker. Sei nächstes Mal pünktlich, dann gibt’s keine Probleme.«
Otto knallte das Mikrofon auf die Halterung des Funkgeräts. Mit versteinerter Miene musste er mit ansehen, wie Pfahl seine Ankündigung wahr machte und am Kai anlegte. Otto hielt auf den Hafen zu, ohne die Geschwindigkeit zu drosseln.
»Du krachst nicht in den Idioten rein, oder?«, mahnte Karl und sah seinen Chef beunruhigt an.
Otto hielt den Blick starr auf Pfahls Frachtschiff gerichtet.
»Brems endlich ab!«, rief Karl und rüttelte an Ottos Schulter.
Otto riss sich los und steuerte weiter auf die Friederike II. zu. Im allerletzten Moment ging er auf maximalen Gegenschub. Der Dieselmotor heulte auf und die Rheinschwalbe ächzte, als habe ihre letzte Stunde geschlagen. Nur wenige Meter hinter Pfahls Schiff kam sie zum Stillstand.
»Übernimm das Steuer«, befahl Otto und war im nächsten Augenblick aus dem Führerhaus verschwunden.
Während Karl das Schiff vorsichtig an die Kaimauer manövrierte und ihre beiden Matrosen begannen, den Frachter zu vertäuen, sprang Otto von Bord und rannte die Kaimauer entlang.
Norbert Pfahl stand rund dreißig Meter von ihm entfernt und unterhielt sich mit einem Mann in Arbeitsmontur.
Otto stürzte auf ihn zu und packte ihn am Kragen. »Du mieses Schwein!«, schrie er und versetzte seinem Widersacher einen Schlag. Der korpulente Mann wich aus und schaffte es, Otto trotz dessen kräftiger Statur wegzuschubsen. Plötzlich blitzte ein Messer in Pfahls Hand.
»Glaubst du, ich hab Angst vor deinem Spielzeug?«, rief Otto verächtlich und griff nach einem Bootshaken, der auf der Kaimauer lag.
Die Metallspitze bedrohlich nach vorne ausgestreckt, ging er auf Pfahl zu. Dieser wich zurück.
»Ich mach dich platt«, schrie Otto wütend. Unvermittelt machte er einen Satz nach vorne und stieß zu.
»Ja?«, brummte Jo, als es an seiner Bürotür klopfte.
Kati steckte den Kopf herein. »Hast du ’ne Sekunde?«
Er nickte und legte die Rechnung beiseite, die er in der Hand hielt.
»Und?«, fragte Kati neugierig, während sie sich setzte.
Jo blickte sie verständnislos an.
»Wie war das Gespräch?«
»Welches meinst du?«
»Mensch Jo, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen«, murrte sie. »Was wollte Gassmann von dir?«
»Wie ich gesagt habe – er hat unser Menü gelobt.«
»Dafür hättet ihr euch nicht in dein Büro zurückziehen müssen. Er wollte was von dir«, mutmaßte Kati.
Jo zögerte. Er wollte nicht, dass sich Gassmanns Angebot unter seinen Mitarbeitern herumsprach und für unnötige Verunsicherung sorgte.
»War nicht wichtig.«
»Ein Mann wie Urs Gassmann kommt nicht zufällig in ein Restaurant wie unseres und bringt eine Mitarbeiterin mit. Der hat eine Agenda. Ich arbeite jeden Tag von frühmorgens bis spätabends hart daran, dass wir mit dem Waidhaus vorankommen. Findest du nicht, ich habe ein Recht zu wissen, was vorgeht?«
Jo überlegte. Ganz von der Hand zu weisen war ihre Forderung nicht.
»Sein Angebot ist irrelevant, weil ich nicht gedenke, es anzunehmen, okay?«
»Was hat er dir vorgeschlagen? Es wird gemunkelt, dass er ein Restaurant in Frankfurt eröffnen will und dafür Leute sucht.«
Jo seufzte. Er kannte Kati gut genug, um zu wissen, dass sie keine Ruhe geben würde, bis er mit der Wahrheit herausrückte. In der Hinsicht war sie wie ein Jagdhund, der sich in einen Knochen verbissen hatte. Er gab nach und erzählte ihr, worüber er mit Gassmann gesprochen hatte.
»Wow!«, rief sie aus. »Das finde ich mega. Warum willst du das Angebot nicht annehmen? So eine Chance bekommst du kein zweites Mal.«
»Mag sein. Aber Frankfurt ist nicht gerade um die Ecke. Wenn es blöd läuft, brauche ich eineinhalb Stunden mit dem Auto. Und wie du so schön ausgeführt hast, sind wir dabei, uns im Waidhaus etwas aufzubauen. Das schmeiße ich nicht weg, nur weil jemand mit ein paar Scheinen wedelt.«
»Alles Ausreden! Ums Geld geht’s mir auch nicht. Obwohl ich es, nebenbei bemerkt, äußerst großzügig finde, dass du quasi zwei Gehälter bekommen würdest. Wenn wir die zusätzliche Kohle in unseren Weinkeller stecken, würde es bestimmt mit einem Stern klappen …«
Jo schnitt eine Grimasse. Damit lag Kati ihm ständig in den Ohren. Sie wollte unbedingt, dass er mehr in französische und italienische Spitzenweine investierte. Beim Essen war das Waidhaus bereits top, aber im Weinkeller fehlten einige Spezialitäten, die ihrer Meinung nach für die Sterne-Gastronomie unabdingbar waren. Jo hatte sich bisher geweigert, ihrem Wunsch zu entsprechen, obwohl das Waidhaus genügend Gewinn abwarf. Er fand, Sterne sollten fürs Essen vergeben werden und nicht für den Weinkeller. Außerdem war es totes Kapital, denn kaum ein Gast wollte ein Vermögen für Wein ausgeben, jedenfalls nicht im Waidhaus. Die Flaschen würden im Keller verstauben.
»20 Köche und ein mehr oder weniger unbegrenztes Budget beim Einkauf! Stell dir vor, was du damit anfangen könntest!«, rief Kati begeistert. »So ein Angebot kannst du unmöglich sausen lassen.«
Seine Restaurantleiterin strahlte ihn mit ihren smaragdgrünen Augen an. Wieder einmal konnte er nicht umhin zu bewundern, wie intensiv sie leuchteten. Vor allem wenn sich Kati über etwas freute.
»Na schön«, lenkte er ein. »Ich denke darüber nach.«
»Cool. Ich würde nicht zu lange warten. Typen wie Gassmann fackeln nicht lange. Wenn er den Eindruck bekommt, du kannst dich nicht entscheiden, gibt er den Posten jemand anderem.«
Mit einer Behändigkeit, die man dem stämmigen Mann nicht zugetraut hätte, wich Pfahl dem Stoß aus. Bevor Otto ein zweites Mal attackieren konnte, packten in zwei kräftige Arme von hinten. Er versuchte vergeblich, sich loszureißen.
»Hast du den Verstand verloren? Der Kerl ist es nicht wert«, hörte er Karls Stimme an seinem Ohr.
Inzwischen waren Pfahls Matrosen von Bord gesprungen und stellten sich schützend vor ihren Kapitän.
»Schon gut«, murmelte Otto. Die unbändige Wut, die ihn so siedend heiß überfallen hatte, machte kalter Ernüchterung Platz. Er ließ den Bootshaken fallen.
»Das wird ein Nachspiel für dich haben, Keller. Ich werde dich anzeigen!«, drohte Pfahl im Schutz seiner Leute.
»Komm Otto, wir gehen«, erklärte Karl resolut und zog seinen Chef mit sich.
»Du bist nicht zurechnungsfähig«, schrie Pfahl ihm hinterher. »Ich werde dafür sorgen, dass sie dir dein Kapitänspatent wegnehmen.«
Otto wollte sich umdrehen, aber Karl zerrte ihn weiter.
»Lass uns einen Schnaps trinken«, schlug sein Steuermann vor, als sie bei der Rheinschwalbe angelangt waren.
Widerstrebend folgte Otto ihm an Bord.
Kapitel 4
Jan de Koning blickte auf das lang gezogene Lagerhaus, das sich neben dem Anlegeplatz befand. Nach dem Mittagessen mit den Statthaltern war er mit seinen Männern Joris Kuijpers, der in seiner Organisation für die Planung und Logistik zuständig war, und Victor Tschesow, seinem Mann fürs Grobe, in einen abgelegenen Teil des Amsterdamer Hafens gefahren.
»Ist das nicht zu klein?«
Joris Kuijpers schüttelte den Kopf. »Sieht nur so aus. Ich habe nachgemessen. Wir haben sogar ein paar Meter Luft.«
»Kommt die Ladung nicht mit einem großen Containerschiff?«
»Diesmal nicht. Wir haben ein kleineres Schiff für den Transport ausgesucht, damit wir hier abladen können. Du wolltest ja, dass wir es selbst machen.«
»Absolut. Dummerweise sehe ich keinen Kran.«
»Brauchen wir nicht. Wir nutzen einen Spezialgabelstapler. Die Ware ist auf drei Container verteilt. Das geht schnell.«
»Wo laden wir um?«
»Dort drüben.« Kuijpers deutete auf den vorderen Teil der Halle.
»Die Halle hat mehrere getrennte Abschnitte. Der vordere Bereich ist leer. Den habe ich angemietet. Wir fahren die Container rein und laden die Ware drinnen um. So kann uns keiner beobachten.«
»Sehr gut. Wie sieht es mit der Sicherheit aus?«, wandte de Koning sich an Victor Tschesow.
Der Mann hatte bei einer Spezialeinheit der russischen Armee gedient und kümmerte sich um alle sicherheitsrelevanten Fragen. Auch die heiklen.
»Alles im Plan.«
»Wie viele Leute hast du vorgesehen?«
»Außer mir? Fünf.«
»Wie kommst du auf die Zahl?«
»Wie du angeordnet hast, erledige ich das mit so wenigen Leuten wie nötig. Ich brauche zwei Mann draußen – einen an jedem Ende der Zufahrtsstraße. Sie werden ab dem Morgen da sein und alles im Auge behalten. Wir werden die Ladung auf vier Lieferwagen aufteilen. Joris fährt einen selbst, also brauchen wir noch drei Fahrer.«
»Wissen die Bescheid?«
»Dass sie gebraucht werden ja, aber nicht wofür.«
»Wer überwacht die Zufahrtsstraße?«
»Juri und Maxim.«
»Kennen sie den Ort fürs Abladen?«
»Ja, aber die quatschen nicht rum. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.«
Auch wenn de Koning es sich vor Tschesow und Kuijpers nicht anmerken ließ – er war nervös. Morgen Abend würden sie eine knappe Tonne Kokain anlanden. Es war die größte Lieferung, die er bisher bekommen hatte. Damit stieg er in eine andere Liga auf. Deswegen durfte nichts schiefgehen. Alles fand unter strengster Geheimhaltung statt. Außer Tschesow, Kuijpers und ihm wusste niemand in seiner Organisation, wann und wo die Lieferung ankam. Natürlich war es ein Risiko, die Ladung von so wenigen Männern bewachen zu lassen. Andererseits: Wenn keiner die Details kannte, konnte sie auch niemand ausplaudern.
De Konings Mobiltelefon klingelte. Er schaute auf die Nummer und bedeutete den beiden Männern, still zu sein.
»Ja?« Er lauschte den Ausführungen des Anrufers und beschränkte sich auf die relevanten Fragen: »Wann? Wo? … Bist du sicher?«
Je länger das Telefonat dauerte, umso mehr verdüsterte sich seine Stimmung. Als er aufgelegt hatte, verharrte er einen Moment regungslos.
»Was ist?«, erkundigte sich Tschesow.
»Es gibt ein Problem«, erwiderte de Koning.
Gedankenverloren blickte er auf die Lagerhalle. Je länger er vor sich hinstarrte, umso wütender wurde er. Tschesow war klug genug, nicht weiter zu fragen. Wenn de Koning schlecht gelaunt war, ging man ihm besser nicht auf die Nerven.
»Noch Fragen zur Logistik?«, fragte Joris Kuijpers unbedarft, dem de Konings Stimmungsumschwung offensichtlich entgangen war.
»Nein!«, blaffte de Koning. »Du kannst dich vom Acker machen. Wir sehen uns morgen.«
Der junge Mann nickte stumm und begab sich zu seinem Wagen, den er um die Ecke abgestellt hatte.
»Ich brauche nachher deine Hilfe, Victor«, sagte de Koning an Tschesow gewandt. »Du musst einer Sache für mich nachgehen.«
»Kein Problem.«
»Außerdem will ich morgen Abend ein paar Männer zusätzlich auf dem Gelände haben, wenn die Ladung eintrifft. Nimm Leute, denen du einhundert Prozent vertrauen kannst, verstanden?«
»Geht klar, Boss.«
»Sie sollen Nachtsichtgeräte mitbringen und am besten Scharfschützengewehre.«
Tschesow sah ihn erstaunt an. Der Russe wollte eine Frage stellen, schluckte sie jedoch schnell hinunter, als er de Konings Blick bemerkte. In seinen Augen stand die blanke Mordlust.
»Was machst du denn hier?«, fragte Jo überrascht, als er am Spätnachmittag aus seiner Wohnung im ersten Stock die Stufen nach unten ins Restaurant ging und Otto Keller im Eingangsbereich bemerkte.
»Wir liegen in Mainz vor Anker und haben etwas Zeit«, antwortete sein Freund. »Da dachte ich mir, ich gucke mal, ob das Waidhaus noch steht.«
Otto grinste, als Jo auf ihn zutrat und ihn umarmte. »Warum hast du nicht angerufen?«, fragte Jo vorwurfsvoll. »Dann hätte ich was für dich vorbereitet.«
»Hat sich spontan ergeben. Wir hängen außerplanmäßig für zwei Stunden fest. Einer meiner Wettbewerber hat uns vorhin unseren Anlegetermin vor der Nase weggeschnappt.«
»Sehr ärgerlich. Trotzdem schön, dass du da bist!«
»Störe ich auch nicht?«
»Quatsch. Wir fangen erst in einer Stunde mit den Vorbereitungen für den Abendservice an. Hast du Hunger? Dann zaubere ich schnell was für dich.«
»Nee, lass mal«, winkte Otto ab und klopfte sich lachend auf den Bauch. »Da ist genug Speck!«
In dem Moment tauchte Kati aus dem Keller auf. Jo blickte sie erstaunt an. Eigentlich hatte die junge Frau Pause. Vermutlich hatte sie sich einen Überblick verschafft, um abzuschätzen, wie viel Platz sie für neue Weine hatte, wenn er den Job bei Gassmann annahm. Jo musste bei dem Gedanken grinsen. Kati packte die Dinge immer gleich an.
»Otto? Was für eine nette Überraschung!«, rief sie und kam strahlend auf den Binnenschiffer zu.
»Hey, Kleine, wie ich sehe, arbeitest du immer noch für diesen Sklaventreiber«, dröhnte Otto und umarmte Kati.
Die beiden hatten sich während eines früheren Besuchs von Otto im Waidhaus