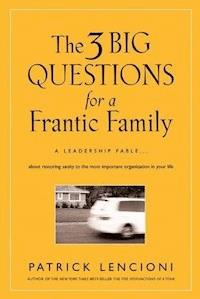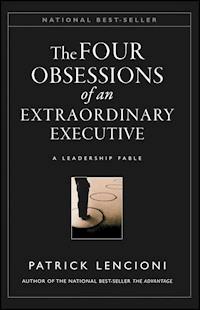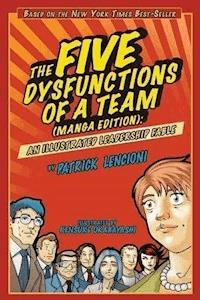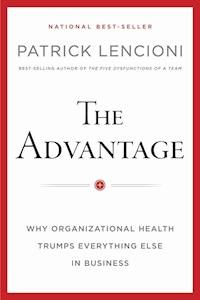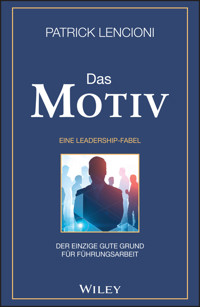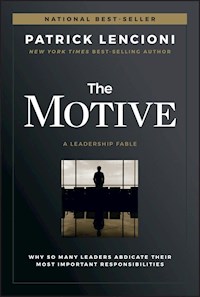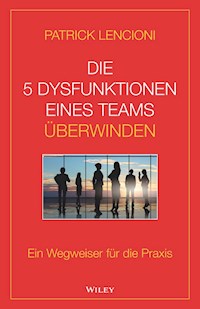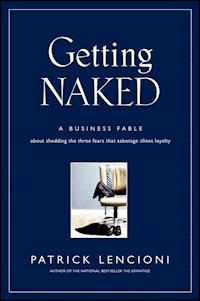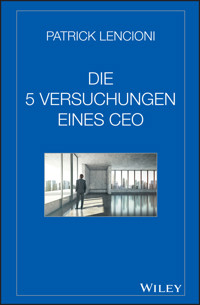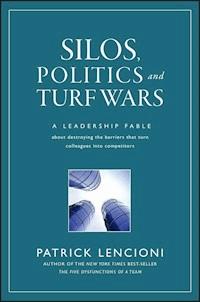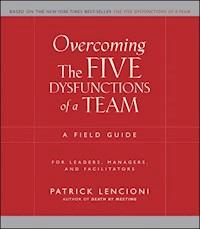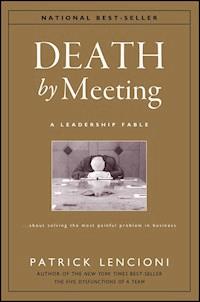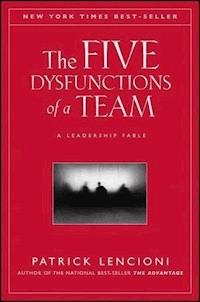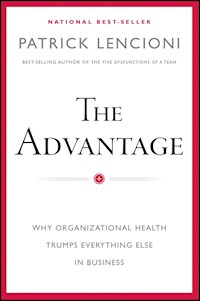18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Casey McDaniel war noch nie in seinem Leben so nervös gewesen. In 10 Minuten sollte DAS Meeting beginnen, und Casey hatte allen Grund zur Annahme, dass sein Auftritt während der nächsten 2 Stunden über seine weitere Karriere, seine finanzielle Zukunft und das Schicksal seiner Firma entscheiden würde.
"Wie konnte mein Leben nur so rasend schnell völlig aus den Fugen geraten?", fragte er sich.
In seinem Bestseller bietet Patrick Lencioni ein Heilmittel für das wohl schmerzhafteste und dennoch unterschätzteste Problem im heutigen Geschäftsleben: schlechte Meetings. Und was er vorschlägt, ist simpel und revolutionär zugleich.
Der Gedanke an Meetings verursacht bei den meisten Managern und Mitarbeitern Bauchschmerzen. Aber sie sind nun mal ein unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit. Anhand einer Leadership-Fabel, der dazugehörigen Theorie und praktischen Tipps zeigt Lencioni, wie Meetings von einer anstrengenden und nervenaufreibenden Angelegenheit zu produktiven, fesselnden und energiergeladenen Ereignissen werden können.
In der Fabel begegnen wir dem CEO Casey McDaniel, der die katastrophale Meetingkultur in seinem Unternehmen unbedingt verbessern muss, aber nicht weiß wie. Ihm hilft schließlich ein respektloser, junger Berater, Will Petersen, mit einigen unkonventionellen und radikalen Ideen zur Lösung des Problems (Meetings müssen dramatischer und konfliktgeladener sein, um nicht zu langweilen, und Meetings sollten kontextbezogene Strukturen aufweisen).
Das Buch ist ein Blueprint für Führungskräfte, die endlich wissen wollen, wie sie ihre Meetings optimieren können, damit Zeit sparen und Frustration verhindern sowie eine Kultur voller Energie, Leidenschaft und Engagement schaffen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Patrick M. Lencioni
Tod durch Meeting Eine Leadership-Fabelzur Verbesserung IhrerBesprechungskulturDeutsch von Brigitte Döbert
1. Auflage 2009
Bibliografische InformationDer Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiografie: detaillierte biografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das englische Original erschien 2004 unter dem Titel Death by Meeting. A Leadership Fable... about Solving the Most Painful Problem in Business bei Jossey-Bass, einem Wiley Imprint, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741.
Copyright © 2004 by Patrick Lencioni
All Rights Reserved. This translation published under license.
©2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-527-50465-7ePub ISBN: 978-3-527-64755-2Mobi ISBN: 978-3-527-64754-5
Meiner außergewöhnlichen Frau Laura, die mir mitunerschütterlichem Vertrauen und Optimismus beisteht.
Inhalt
Einleitung
Die Fabel
Vorschau
Erster Teil: Rückblende
Zweiter Teil: Unverhoffte Wendung
Dritter Teil: Der Protagonist
Vierter Teil: Action
Fünfter Teil: Der Entschluss
Das Modell
Eine paradoxe Veranstaltung
Executive Summary
Problem Nr. 1: Zu wenig Konflikt
Problem Nr. 2: Zu wenig Struktur
Vier Meetings
Schluss mit einem Mythos
Ein letzter Gedanke
Danksagung
Der Autor
Einleitung
»Wenn die Meetings nicht wären, würde ich meinen Beruf doppelt so gern ausüben.«
Diese Bemerkung habe ich bei meiner Zusammenarbeit mit Führungskräften im Lauf der Jahre oft gehört. Anfangs fand ich sie verständlich und irgendwie witzig, aber mit der Zeit wurde mir klar, dass dieser traurige Kommentar für den Zustand unserer Unternehmenskultur symptomatisch ist.
Ebenso gut könnte ein Chirurg zur OP-Schwester sagen: »Wenn ich diese Leute nicht operieren müsste, hätte ich richtig Spaß an meiner Aufgabe.« Oder wenn ein Dirigent während der Orchesterprobe seufzte: »Ohne die Konzertabende gefiele mir meine Arbeit besser.« Oder ein Profi-Fußballer: »Die Spiele vergällen mir den Job.«
Das wäre schlimm, oder? Genauso schlimm ist es, wenn Führungskräfte über Besprechungen klagen.
Denn ihre Arbeit besteht zum größten Teil daraus. Meetings nehmen viel Raum in ihrem beruflichen Alltag ein. Vorstände, Bereichsleiter, Geschäftsführer – sie werden nicht für etwas sonderlich Handfestes oder Greifbares bezahlt, sie holen weder Babys auf die Welt noch dreschen sie Bälle übers Netz noch liefern sie in einem Fernsehstudio im Minutentakt Kalauer ab. Was dem Chirurg der OP, dem Tennisprofi der Tennisplatz oder dem Entertainer der Auftritt vor der Kamera, ist ihnen die Sitzung. Meetings sind die Bühne, auf der Führungskräfte agieren.
Trotzdem hassen die meisten Meetings. Sie klagen darüber, meiden sie, wann immer möglich, können das Ende gar nicht abwarten, selbst wenn sie sie höchstpersönlich leiten! Es ist nicht gut, wenn man sich eingestehen muss, dass die für die Leitung einer Organisation bedeutsamste Tätigkeit als unangenehm und unproduktiv empfunden wird.
Das muss nicht so bleiben. Und es darf nicht so bleiben, denn Meetings bestimmen über Sein oder Nichtsein, Wohl und Wehe. In Besprechungen wird über Krieg und Frieden entschieden, über Steuersenkungen oder höhere Abgaben, über ein neues Markenimage, neue Produkte, über die Schließung von Standorten.
Und bedenken Sie folgende Frage: Wie sollen in fürchterlichen Besprechungen gute Entscheidungen getroffen werden? Können Meeting-Hasser erfolgreich eine Organisation leiten? Meine Antwort: Nein. Es gibt keine Alternative zu guten Meetings, in die jeder Teilnehmer mit leidenschaftlichem, konzentriertem Engagement sein ganzes Wissen einbringt. Schlechte Meetings führen fast immer zu schlechten Entscheidungen, und die führen geradewegs in die Mittelmäßigkeit.
Doch die Sache ist nicht hoffnungslos. Wenn wir Meetings unorthodox angehen, anders als bisher sehen und ein paar Richtlinien befolgen – die nichts mit Videokonferenzen, interaktiver Software oder parlamentarischen Spielregeln zu tun haben –, dann kann aus einer grauenhaft öden Veranstaltung ein produktives, anspruchsvolles und sogar anregendes Treffen werden. Die neue Besprechungskultur kann zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens werden, wenn die Konkurrenz weiterhin Zeit, Energie und Begeisterungspotenziale in stumpfsinnigen Marathonsitzungen verschwendet.
Um das anschaulich darzustellen, habe ich eine Geschichte erfunden. Sie handelt von einem CEO und dessen Kampf mit Meetings. Daran schließen sich praktische Vorschläge an, wie Sie die Ideen aus der Geschichte in Ihrem Unternehmen umsetzen könnten.
Ich wünsche Ihnen viel Glück auf dem Weg zu effektiveren Besprechungen – damit Sie die Begeisterungsfähigkeit retten, Ihre eigene ebenso wie die Ihrer Mitarbeiter!
Die Fabel
Vorschau
Casey McDaniel war noch nie so nervös gewesen. Nie im Leben. Nicht, als er mit 16 Jahren eine Rede auf der Beerdigung seines Vaters halten musste. Nicht, als er um die Hand seiner Frau angehalten hatte. Nicht vor dem Putt, der im wichtigsten Golfturnier seines Lebens über Sieg und Niederlage entscheiden sollte.
Nein, so nervös war er noch nie gewesen. In zehn Minuten sollte DAS Meeting beginnen, und Casey hatte allen Grund zu der Annahme, dass sein Auftritt während der nächsten zwei Stunden über seine Karriere, seine finanzielle Zukunft und das Schicksal des Unternehmens, das er gegründet und aufgebaut hatte, entscheiden würde. Einen Augenblick lang fühlte er sich richtig krank.
Wie konnte mein Leben nur so rasend schnell völlig aus den Fugen geraten?, fragte er sich.
Erster Teil: Rückblende
Der Mann
Mitarbeiter empfanden Casey als außerordentliche Persönlichkeit; seine Führungsqualitäten konnten sie maximal als »ganz ordentlich« beschreiben.
Als Mensch schätzten sie ihren Chef sehr. Casey war seiner Frau ein treuer Ehemann, seinen vier Kindern ein liebevoller Vater, er engagierte sich in der katholischen Kirche und half Freunden wie Nachbarn gern. Man konnte ihn eigentlich nicht nicht mögen. Und viele bewunderten ihn sogar.
Umso unverständlicher wirkten seine Grenzen als Führungskraft.
Herkunft
Die McDaniels waren vor 50 Jahren nach Carmel gezogen. Casey wurde auf den Golfplätzen der Gegend, wenn auch in bescheidenen Verhältnissen, groß und verdiente sich das Taschengeld als Caddie oder Gärtner. Seine Begeisterung für Golf wurde nur von seiner Begeisterung für Computer übertroffen, also studierte er nach der Highschool mit einem Golf-Stipendium an der University of Arizona Elektrotechnik und Informatik. Vier Jahre später erwarb er einen eher mittelmäßigen Abschluss in den akademischen Fächern, spielte sich aber gleichzeitig an die Spitze der Pac-10 Conference, den Uni-Meisterschaften für die Westküste.
Der Versuchung, bei den PGA-Meisterschaften (den Meisterschaften der Professional Golfers‘ Association) mitzuspielen und vor Freunden und Familie zu Hause in Pebble Beach zu glänzen, konnte Casey nicht widerstehen. Er schaffte die Qualifizierungswettbewerbe und war mit seinem trockenen Humor und der Großzügigkeit gegenüber anderen Spielern, die sich gern von ihm coachen ließen, bald einer der beliebtesten Teilnehmer.
Fünf Jahre lang gewann Casey etliche Turniere und verdiente genug Preisgelder, um sich damit mehr als nur über Wasser zu halten. Aber kurz vor dem eigentlichen Durchbruch entwickelte er immer beim Einlochen ein chronisches Zittern, das unter Golfern als Yips bekannt ist und schon so manche vielversprechende Karriere beendet hat. Es ist eine psychosomatische Störung, und Casey gestand sich irgendwann widerwillig ein, dass seine Zeit im Profisport vorbei war.
Aber er war keiner, der den Kopf hängen ließ, zog wieder nach Carmel und gab seinem Leben eine neue Wendung – mit einer neuen Idee. Innerhalb weniger Monate heiratete er, kaufte von seinen Ersparnissen einen kleinen Bungalow, stellte zwei Programmierer aus der Nachbarschaft ein und hackte die Grundzüge des realistischsten Golf-Computerspiels in den Rechner, das der Markt je gesehen hatte. Das war seine Vision.
Die ersten Ergebnisse übertrafen sämtliche Erwartungen.
Durchbruch
Zwei Jahre nach Gründung ging Caseys Yip Software mit dem ersten Produkt in den Markt und setzte über Nacht neue Maßstäbe für realistische Computerspiele. Dank seiner Insiderkenntnisse waren die detailreichen Animationen ausgesprochen hilfreich, und zwar sowohl hinsichtlich der Bewegungsabläufe als auch, was die Golfplätze und Putting Greens betraf.
Das Spiel wurde bei der wichtigsten Zielgruppe überhaupt – den Golfspielern – sehr schnell sehr beliebt.
Casey war mit etlichen Nachwuchstalenten auf dem Weg in den Profisport eng befreundet und schloss mit ihnen kostengünstige, äußerst werbewirksame Sponsoring-Verträge ab. Aber der entscheidende Kick, der Yip Software aus dem Heer der Start-ups auf die Titelseiten der Sports Illustrated katapultierte, war purem Zufall zu verdanken.
Einer von Caseys Freunden gewann knapp ein Jahr nach der Markteinführung des ersten Yip-Produkts die PGA-Meisterschaft. Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde er gefragt, wie er das Einlochen vervollkommnet habe. Beinahe beschämt gab er zu: »Das klingt irgendwie verrückt, aber es hat wohl etwas mit dem Computerspiel zu tun, das ich in letzter Zeit häufig gespielt habe ...«
Und der Teufel war los.
Unaufhaltsamer Aufstieg
Allüberall griffen Golfer zum Telefon und riefen die Bestell-Hotline von Yip an. Casey machte ein Büro auf, stellte ein Dutzend Leute ein und bewältigte den Ansturm.
Kurze Zeit später war das Spiel US-weit in jedem größeren Computer- und Spielwarengeschäft zu haben. Die nächsten acht Jahre stellte Casey immer neue Mitarbeiter ein, programmierte neue Spiele, erweiterte den Vertrieb auf immer neue Ketten, bezog mit seiner wachsenden Firma immer größere Bürogebäude und mit seiner wachsenden Familie immer größere Wohnhäuser.
Als seine Ehe und seine Firma ihr zehnjähriges Jubiläum feierten, hatte Casey mit seiner Frau, Patricia, vier Kinder, und über die Firma acht erfolgreiche Spiele am Markt, die sich mit Golf, Radsport und zuletzt auch Tennis beschäftigten. Da er immer noch ein Argusauge auf Details hatte, waren sie für ihre genaue Wiedergabe originaler Sportplätze berühmt: Vom schottischen St. Andrews über die Pyrenäen im Tour-de-France-Spiel bis zum Rasen von Wimbledon.
Von Anfang an schloss Casey die Herstellung von Kriegs- und anderen Gewaltspielen für Kinder und Jugendliche kategorisch aus. Yip Software beschränkte sich auf realistische, innovative Sportspiele. Deswegen gewann die Firma viele Anhänger unter sportlich ambitionierten Erwachsenen und Teenagern.
Caseys besonderer Stolz aber war die Tatsache, dass er 200 Mitarbeiter beschäftigte und die Fluktuation bei Yip extrem niedrig war. Und auf die Firmenzentrale war er stolz: Sie war in einem wunderschön renovierten alten Gebäude in Old Monterey untergebracht.
In der Küstenstadt und ihrer Umgebung war Yip neben dem berühmten Aquarium der einzige nicht-industrielle Arbeitgeber, der viele qualifizierte Arbeitsplätze anbot. Casey hatte mit seiner Idee ein Nischenunternehmen aufgebaut, das sich in seiner Heimat größter Beliebtheit erfreute und innerhalb der Branche für eine beispiellose Erfolgsgeschichte stand.
Aber wie viele Erfolgsgeschichten hatte auch die von Yip und seinem CEO eine Kehrseite. Sie ließ sich ebenso wenig begreifen wie leugnen.
Mittelmäßigkeit
Casey hatte viele Bewunderer und Förderer, aber selbst die gaben hinter vorgehaltener Hand zu, dass Yip unter einem disziplinierteren, fokussierteren Chef schon längst doppelt so groß sein könnte.
Casey war kompetent und hatte an seinem Unternehmen das größte Interesse, das war nicht das Problem. Vor allem hatte er ein sagenhaftes Gespür für die Wünsche der Kunden und feilte so lange an den Produkten, bis sie deren Bedürfnisse restlos erfüllten. Darin war er den Wettbewerbern weit voraus und stand im Ruf, den Markt besser als jeder Analyst, Journalist oder CEO der Branche zu verstehen.
Theoretisch hätten die Bilanzen für sich sprechen können. Yip schrieb schwarze Zahlen und heimste ständig Preise für seine Produkte ein. Dem bloßen Auge nach musste es als gut und straff geführtes Unternehmen erscheinen.
Aber tatsächlich blieb es hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und das lag an Casey, der sich mit schmalen Gewinnmargen zufrieden gab und in seinen Terminplan liebend gern ein paar Golfturniere quetschte, solange es in der Firma nicht gerade brannte. Mehr brauchte er nicht zu seinem Glück.
Die Mitarbeiter jedoch waren mehr als zufrieden, sie waren fast schon selbstgefällig. Gewohnt, dass die Zahlen irgendwie am Ende immer stimmten, die Gehälter bezahlt werden konnten und das Polster ausreichte, um Jahr für Jahr eine kleine Erhöhung sowie das große Sommerpicknick zu finanzieren, sorgten sie sich nicht im Geringsten um die Zukunft.
Aber etwas fehlte. Das Unternehmen produzierte an einem wunderschönen Standort, dem kalifornischen Monterey, Computerspiele, die neue Maßstäbe setzten, und angesichts dieser Umstände brachten die Mitarbeiter bemerkenswert wenig Begeisterung für Yip und dessen Produkte auf. Das zeigte sich am auffälligsten bei den wöchentlichen Sitzungen der Unternehmensleitung.
Das Ritual
Zäh. Unkonzentriert. Lustlos. Besucher, die sich, und sei es kurzzeitig, in ein Treffen der Yip-Firmenleitung verirrt hatten, beschrieben die Stimmung meistens mit diesen oder ähnlichen Vokabeln.
Den Beteiligten war die Langeweile ihres wöchentlichen Rituals schmerzlich klar, aber sie hatten irgendwann beschlossen, darüber hinwegzusehen: Meetings galten als notwendiges Übel, sie gehörten eben dazu, waren aber nicht weiter von Belang. In anderen Unternehmen war diese Übung schließlich genauso unbeliebt.
Sie redeten sich das Problem klein und erlagen damit einer krassen Fehleinschätzung. Keinem war klar, dass die Lustlosigkeit ihrer wöchentlichen Sitzungen auf die gesamte Unternehmenskultur durchschlug.
Mangelnde Begeisterung
In puncto Arbeitseifer unterschied sich Yip deutlich von der aggressiven Konkurrenz. Abends und am Wochenende waren die Büros verwaist, keiner fühlte sich berufen, länger als nötig zu bleiben, und jenseits des Firmengeländes wurde kaum über Berufliches geredet. Die Mitarbeiter diskutierten nur selten auf dem Gang oder am Fotokopierer über Branchenneuigkeiten. Das Fernsehprogramm, Fußballergebnisse oder das neblige Wetter waren viel interessanter.
Nahmen Mitarbeiter den Weg aus Monterey zu einer Messe oder einer Konferenz auf sich, kehrten sie stets fasziniert von der Leidenschaft zurück, die Kunden und Händler für Yip-Produkte aufbrachten und die in so eklatantem Kontrast zur Haltung der Yip-Belegschaft stand.
Sogar neu eingestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wunderten sich über den Mangel an Begeisterung in der Firma. Aber sie passten sich schnell an und nahmen hin, dass Yip wegen der erst auf den zweiten Blick wahrnehmbaren Mittelmäßigkeit nie das volle Potenzial seiner Produkte ausschöpfte.
Trotzdem verließ kaum jemand die Firma. Schließlich war der Mann an der Spitze ein exzellenter Kopf und ein netter Boss – da hatten sie schon deutlich schlimmere CEOs erlebt ... Und in dem vom Tourismus dominierten Küstenstädtchen bot der Arbeitsmarkt sowieso nicht viel Auswahl.
Selbst die ehrgeizigsten Mitarbeiter fanden sich mit der Situation ab, weil sie nicht umziehen wollten. Das war der Stand der Dinge, solange Casey Alleininhaber der Firma war.
Aber das blieb er nicht für immer.
Zweiter Teil: Unverhoffte Wendung
Der Stein kommt ins Rollen
Das Führungsteam wusste, dass die Arbeitsmoral in der Firma nicht optimal war. Andererseits war sie nie so schlecht, dass die Unternehmensleitung dem Punkt viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte.
Das änderte sich, als Casey die erste Personalchefin einstellte. Michelle Hannah verschaffte sich mit einer Mitarbeiterbefragung einen ersten Einblick in ihren neuen Arbeitgeber und fand heraus, dass die Arbeitsmoral definitiv niedriger als in anderen Unternehmen war, für die sie bisher gearbeitet hatte. Mehr noch: Den Mitarbeitern war, so ihre Worte, Wohl und Wehe der Geschäftsentwicklung herzlich egal.
Michelles Bericht rüttelte die anderen Führungskräfte ein wenig auf. Offenbar verliehen erst belastbare Daten dem Problem, von dessen Existenz jeder gewusst hatte, eine gewisse Dringlichkeit. Und obwohl sie bisher nie darüber geredet hatten, hatte plötzlich jeder eine Meinung dazu.
Matt McKenna leitete die Produktentwicklung und war seit sieben Jahren der stets kritische Kopf hinter den Yip-Spielen. Seiner Meinung nach hatten die Mitarbeiter keine Lust, ständig neue Produkte zu produzieren. »Meine Leute würden sich gern auf eine Sache konzentrieren und sich intensiver um die Qualität kümmern.« So wie er sein Statement vorbrachte, war klar, dass es eher sein Wunsch war als der seiner Abteilung.
Sophia Nikolas, die Vertriebschefin, sah die Dinge völlig anders. Mit gewohnter Verve stimmte sie ein Thema an, das die anderen Führungskräfte schon auswendig mitsingen konnten, so oft hatten sie es gehört. »Ich weiß, dass es der Firmenphilosophie zuwiderläuft, aber wir sollten die Entscheidung überdenken, keine Fantasy- und Abenteuerspiele für Kinder zu machen. Ich kenne den Markt, das Segment wächst definitiv am schnellsten.«
Casey schüttelte den Kopf und entgegnete: »Ich glaube eher, die Leute brauchen einen Ansporn, ein neues Ziel oder eine Herausforderung.« Einige nickten, Casey war auf der richtigen Spur. Aber bevor der Vorschlag diskutiert werden konnte, lag schon der nächste auf dem Tisch.
Er kam von Tim Carter, dem Finanzverantwortlichen, der in seiner brüsken Art wie üblich kein Blatt vor den Mund nahm. Seiner Meinung nach lag der Haken im Finanziellen: »Die Belegschaft sieht seit beinah zehn Jahren, dass unsere Produkte Preis um Preis gewinnen, und die Leute fragen sich, warum davon eigentlich nichts bei ihnen ankommt.«
Die anderen ließen die Bemerkung so stehen, teils, weil sie Zweifel an der Richtigkeit hatten, teils auch, weil sich das Thema über die Jahre zum heißen Eisen entwickelt hatte und insbesondere Casey empfindlich darauf reagierte.
Connor Michaels machte eine kaum wahrnehmbare Kopfbewegung, trotzdem drehten sich alle Köpfe zu ihm. Der Marketingleiter, zuständig auch für Marktforschung, sagte in seiner jovialen, flapsigen Art, in schwachen Momenten würde er Tims Erklärung sofort unterschreiben, aber er hätte sich inzwischen mit »seinem Schicksal« abgefunden ...
Alle Vorschläge brachten in Casey eine Saite zum Schwingen. Connors Kommentar jedoch hielt ihn in der auf die Sitzung folgenden Nacht vom Schlafen ab. Ihm persönlich bedeuteten finanzielle Anreize wenig, aber er war stolz darauf, dass der Unternehmenserfolg seinen Angestellten erlaubte, Hypotheken zu tilgen, in Urlaub zu fahren, die Kinder auf gute Schulen zu schikken und für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Vorstellung, sie könnten sich unterbezahlt fühlten, kam ihn hart an. Und dass das nicht realisierte Potenzial seines Unternehmens auf seine Kappe ging, konnte er nicht leugnen. Und das lag ihm schwer im Magen.
Fehleinschätzung
Bisher hatte sich Casey die offensichtliche Lethargie seiner Belegschaft mit dem verständlichen Wunsch erklärt, dass das Leben nicht nur aus Arbeit bestehen soll. Aber jetzt fragte er sich zum ersten Mal seit Gründung der Firma, ob er sie zu stiefmütterlich behandelt hatte.
Er wollte den Verdacht verdrängen, aber es gelang ihm nicht. Ständig liefen ihm Mitarbeiter über den Weg, denen die Unlust auf die Stirn geschrieben stand, und jedes Mal fragte er sich, ob finanzielle Frustration die Ursache war. Hatten Tim und Connor Recht? Irgendwann dachte Casey: Ich muss etwas unternehmen.
Das zehnjährige Firmenjubiläum feierte Casey mit der ganzen Belegschaft in einem Restaurant auf der Cannery Row. Nach dem Essen bat er um Ruhe, hob sein Glas und verkündete eine Entscheidung, die er bald schon bitter bereuen sollte: Yip würde an die Börse gehen.
Casey ignorierte seine Ängste, weil er seine Leute am Gewinn teilhaben lassen wollte. Und wenn sich Casey einmal zu einem Entschluss durchgerungen hatte, dann fand er leider immer Mittel und Wege, ihn in die Tat umzusetzen.
Trugbilder
Casey und Tim trafen sich mit Investmentbankern und holten Angebote für den Börsengang ein. Casey hatte das bisher immer abgelehnt, er wollte sich weder den Launen eines Aufsichtsrats noch denen der »Straße« ausliefern. Jetzt jedoch hatte er das Gefühl, es seinen treuen Mitarbeitern zu schulden. »Die Herausforderung wird mir gut tun«, redete er sich ein. Es half nicht viel.
Nach einigen Wochen voll quälender Sondierungsgespräche stolperte Casey über eine Chance, die er für zu schön hielt, um wahr zu sein. Er hätte sich auf seinen Instinkt verlassen sollen.
Der Anruf kam von J.T. Harrison, Mergers&Acquisitions-Manager von Playsoft, dem zweitgrößten US-Hersteller von Computerspielen. Das Unternehmen hatte seinen Sitz in San Jose und überwiegend herkömmliche Spiele für Kinder im Angebot. Im Sportsegment war es schlecht aufgestellt. Da junge Kunden nicht jung bleiben, hatten die Marketingstrategen empfohlen, das Produktportfolio auch für die Gruppe der »älteren Kinder« auszuweiten. Dafür war Yip der ideale Partner.
Erste Nachforschungen von Harrisons Leuten hatten ergeben, dass Casey McDaniels Firma weit hinter ihren Möglichkeiten zurückblieb. Angesichts der technologischen Überlegenheit müsste sich der Gewinn um einiges steigern lassen. Yip war die perfekte Akquisition: Mit ihr konnte sich Playsoft billig und schnell in den Sportmarkt einkaufen, und mit der verbesserten Performance würde sich die Investition rasch amortisieren.
Casey fand die Aussicht, zu einem der großen typischen Spieleproduzenten zu gehören, scheußlich. Trotzdem ließ er sich auf Verhandlungen ein. Wenn Playsoft drei Bedingungen erfüllte, war er bereit, Yip an den Branchenriesen zu verkaufen: Er wollte weiterhin autonom sein Unternehmen führen, er wollte sein gesamtes Führungsteam behalten, und er wollte Yip als vollkommen eigenständige Marke erhalten sehen.
Wenn der CEO von Playsoft, Wade Justin, diesen Bedingungen zustimmte, dachte Casey, konnte die Yip-Belegschaft ihre verdiente finanzielle Belohnung einstreichen, ohne dass er die Macht über sein Unternehmen abgeben musste. Und nebenbei hatte er keinen Stress mit dem Börsengang. »Es wäre das Beste aus beiden Welten«, sagte er zu seiner Frau, als er ihr sein Angebot an J.T. Harrison erklärte. »Aber die gehen bestimmt nicht darauf ein.«
Überraschenderweise nahm der Playsoft-Vorstand die Bedingungen ohne Wenn und Aber an. Wade Justin persönlich versicherte Casey, sie würden sich mit dem Sportsektor nicht auskennen und hätten ohnehin nicht vor, sich in das Tagesgeschäft eines erfolgreichen Markenherstellers einzumischen. Das würden sie auch mit den anderen Divisionen so handhaben, jede würde weitgehend autonom und mit eigenem Branding agieren.
Einige Wochen nach Caseys Angebot war der Deal unter Dach und Fach. Casey erhielt Hunderttausende von Playsoft-Aktien und verteilte sie unter seinen Mitarbeitern nach Betriebszugehörigkeit. Nach einer sechsmonatigen Haltefrist konnten sie die Papiere veräußern.
Als es soweit war, hatten sie keinen Grund mehr für Dankbarkeit. Aber das konnte er noch nicht ahnen.
Alarm
In den ersten Wochen nach der Übernahme war die Stimmung bei Yip fast übermütig. Es hatte sich zwar nichts im Arbeitsalltag geändert, aber der neue Reichtum beflügelte die Moral, auch wenn er nur auf dem Papier stand. Viele der langjährigen Mitarbeiter überlegten mit Wonne, ob sie sich ein neues Haus oder ein neues Auto kaufen würden. Aber was eigentlich zählte, war das Gefühl, dass ihre Geduld endlich belohnt wurde.
Und dann änderte ein einziger Tag die Lage komplett.
Casey sollte nie vergessen, wo er war und was er gerade getan hatte, als er die Neuigkeit erfuhr. Sein CFO, Tim Carter, kam früh am Morgen zu ihm ins Büro, während er gerade mit seinem Immobilienmakler telefonierte. Tim sah richtig krank aus, deswegen brach Casey das Telefonat ab.
»Mach die Tür zu, Tim«, sagte er, bevor der den Mund aufmachen konnte.
Dann legte Tim los: »Du warst heute noch nicht online, nicht wahr?« Es war eher eine Feststellung als eine Frage, denn Tim wusste, dass sein Boss im andern Fall auch schon richtig krank aussehen würde.
Casey rechnete mit schlimmen Nachrichten. »Nein, warum? Ist was passiert? Ein neuer Terroranschlag?«
»Nein, das zum Glück nicht.«
Casey seufzte erleichtert. »Du hast mir richtig Angst eingejagt.«
Tim redete weiter. »Die Börse ist seit Handelsbeginn um 12 Prozent abgestürzt.«
»Was ist mit ...«