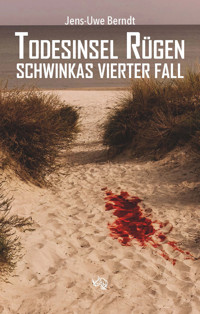Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hinstorff Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mörderjagd im Heute und Gestern Kommissar Karsten Schwinka ist mit brutalen Verbrechen konfrontiert: Auf Rügen wurden zwei Frauen auf skrupellose Art und Weise umgebracht. Seine Opfer scheint der Täter zufällig, fast ungeplant getötet zu haben. Der erfahrene Polizist fürchtet, dass es weitere Morde geben könnte. Alles erinnert an einen zwanzig Jahre alten Fall, bei dem ebenfalls zwei Frauen getötet wurden. Es gab zahlreiche Verdächtige, ein Täter konnte aber nie gefunden werden. Ist der Mörder von heute schon damals aktiv gewesen? Oder muss die Polizei neue Wege beschreiten, um jetzt endlich den Verbrecher von einst dingfest machen zu können? Die Beamten gehen schließlich an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit, um die Ermittlungen zum Erfolg zu führen und das Katz-und-Maus-Spiel mit dem Täter zu gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jens-Uwe Berndt
TODESFALLE RÜGEN
SCHWINKAS ZWEITER FALL
Inhalt
Jacko – komm!
Zu Kreuze gekrochen
Manchmal heulen
Wochenendreinigungsmarathon
Unbändige Wut
Bestimmt Touristen
Gut im Futter
Dezentes Hintergrundbrummen
Buschfunk funktioniert
Rangordnung klar
Kurz vorm Fall ins Koma
Wille zur Zerstörung
Fake News
Akte X
Erst die Dame
Sexualdelikt?
Sechs Ordner, zwei Kartons
Merkwürdiger Kerl
Ausschlussprinzip
Vornehme Blässe
Die absurdeste Variante
Klare Ansage
Kein Entrinnen
Ständig zum Rapport
Neuer Auftrag
Mentale Überforderung
Rituale
Knochen, Fleischreste, Hautfetzen
Beherzter Stich
Auf Schritt und Tritt
Im Cabrio
Besser für alle
Der leckere Pudding
Wie eine Sklavin
Aufmarschgebiet
Über die Stränge schlagen
Die ganzen Billionen
Auf den Knien
»Das war er«
Zur Jagd geblasen
Messer in den Rücken
Funkloch
»Haltet Ordnung!«
Urlaub ist Kapitalismus
Lehmann-Brüder
Heul nicht
Wie Hänsel und Gretel
Gekränkte Eitelkeit
Leben und leben lassen
Unangenehmer Abgang
»Haben Sie Angst?«
Was der Mensch aushält
Vermisstenanzeige
Es kommt noch schlechter
Keine guten Gedanken
Auf den Geschmack gekommen
Teufels Küche
Der letzte Baustein
Blackout
Private Mätzchen
Die wilda Männ’r
»Wollen Sie mich retten?«
Atmosphäre des Misstrauens
Mediale Vulkanausbrüche
Subversive Gedanken
Strenger Parfümgeruch
Maulschelle
Letzte Chance
Arsch auf Grundeis
»Liebesakt« und »Vereinigung«
Ärztliches Attest
Ein bisschen wie Krieg
Durchrütteln
Andere Seite der Medaille
»Der Mörder ist entfesselt«
»Wer schreit, der lügt«
Irgendwie brenzlig
Nur drei Sekunden
»Ich war’s«
Mutiger Schritt
Dunkelrote Schlieren
Wischiwaschi
Stunden über Stunden
Hausdurchsuchungen
Das zweite Mal geboren
»Sie ist nicht hier«
Anflug von Liebeskummer
Jacko – komm!
Horst nestelte an seinem Gürtel. Er war nervös. Obwohl man in der kleinen Parkanlage unter den Bäumen die Dinge nur undeutlich wahrnehmen konnte, fürchtete er, beobachtet zu werden. Als die Metallschnalle klirrte, hielt er inne und lauschte. Nein, niemand zu hören. Zu sehen auch nicht. Er fingerte den Gürtel auf, zog rasch Hose und Schlüpfer herunter und hockte sich ins Gebüsch. Dabei stöhnte er leise, korrigierte seinen Halt, und bevor er sich Erleichterung verschaffen konnte, hielt er noch einmal die Luft an und horchte mit geschlossenen Augen. Dabei begann er entsetzlich zu schwitzen. Aber er nahm immer noch keine verdächtigen Geräusche wahr, entspannte sich und verrichtete sein Geschäft.
Das Toilettenpapier hatte er neben sich ins Gras gelegt. Die Waden fingen an zu schmerzen. Der Schweiß rann ihm von der Stirn. Und er spürte, wie er verkrampfte. Das passierte ihm fast jedes Mal, was den gesamten Vorgang verlängerte. Dabei wäre es wichtig, dass das hier alles so schnell wie möglich vorüberging.
»Jacko – komm!«, hörte er plötzlich von rechts. Dem folgte ein helles kurzes Kläffen. ›Nein!‹, dachte Horst nur. ›Ich muss fertig werden!‹ »Jacko – komm schon!« Das war jetzt schon ein klein wenig näher.
Horst kniff alles zusammen, griff hastig zum Klopapier, stand dabei auf, versuchte sich zu säubern, musste wieder ein kleines Stück in die Knie gehen, rutschte ab, beschmutzte sich die Finger, schwitzte, schnaufte – und war kurz davor, sich zu übergeben … Da schauten ihn aus dem putzigen Gesicht eines Dackels zwei Knopfaugen an. Das Tier hielt den Kopf schief und hechelte, denn es war heute wie schon die vergangenen drei Tage höllisch heiß. Der Dackel wackelte mit dem Schwanz – und seine Besitzerin zog hektisch an der Leine.
»Komm schon, Jacko!«, zischelte sie. Die untersetzte Frau war von der Situation peinlich berührt und wollte den Abstand zwischen sich und dem Mann dort im Gebüsch, der seine Hose nicht hochbekam, rasch wieder vergrößern.
Horst schaute auf den Hund, der erneut kurz kläffte. Das war ein hohes, fast ängstliches Bellen – so, als hätte jemand dem Tier auf den Schwanz getreten. Dann blickte Horst die Frau an, die wiederum krampfhaft auf ihren Hund starrte. Horst merkte, wie ihm das Blut zu Kopf stieg, der Schweiß rann in dicken Tropfen vom Gesicht in den Kragen seines Hemdes, aus den Achselhöhlen die Hüften hinab in den Hosenbund, den er endlich mit dem Gürtel umschließen konnte.
Die Frau zog an der Leine, der Dackel fixierte Horst, kläffte und sträubte sich, mitzugehen. Das kleine Tier stand zwischen den beiden Menschen, wollte sein Frauchen beschützen und den Mann verscheuchen.
Horst wiederum wünschte sich nichts sehnlicher, als dass die Spaziergängerin in ihrem viel zu warmen Trainingsanzug den Köter schnappen und verschwinden möge.
Und die Frau wollte nur weg.
»Hau ab!«, fauchte Horst, der merkte, dass es ihm nicht gelungen war, sich vollends zu reinigen, bevor er die Hose hatte hochziehen müssen. Dabei nahm er eine leicht gebeugte Haltung ein. Da er ein wenig breitbeinig dastand, um nicht in den Haufen zwischen seinen Beinen zu treten, machte er den Eindruck, als wollte er sich auf den Dackel stürzen.
Die Frau, von der Pose des Mannes und seinem »Hau ab!« provoziert, ruckte zornig an der Leine, sodass der Hund den Halt verlor und seiner Besitzerin beinahe entgegenrollte. »Hau’n Sie doch ab!«, keifte die unscheinbare Dame, die im Ort ein kleines Haus besaß und in dem Mann ihr gegenüber jetzt Horst Schuster erkannte. »Was verstecken Sie sich auch im Gebüsch?« Natürlich war ihr aufgefallen, dass Schuster hier aus unerfindlichen Gründen wohl nach Erleichterung gesucht hatte. Das konnte sie aber wohl nicht aussprechen.
Horst schwitzte, die Hände zitterten. »Hau ab!«, brüllte er. Dabei ließ er nicht eine Sekunde die Augen von dem Hund. Wenngleich er diesmal die Frau meinte.
»Na, na!«, schulmeisterte sie. »Wenn Sie im Freien hinmachen, müssen Sie damit rechnen, dass jemand vorbeikommt.«
Horst rang nach Luft.
»Oder haben Sie zu Hause kein Klo«, fragte die Spaziergängerin pikiert und zerrte weiter an der Hundeleine, an dessen Ende sich der Dackel mit gespreizten Vorderbeinen weiter sträubte, zu folgen.
Horst legte den Kopf in den Nacken, als wollte er wie ein Wolf den Mond anheulen, brachte aber keinen Laut über die Lippen. Die Muskeln seines Körpers waren zum Zerreißen gespannt – da explodierte er. Mit einem Sprung stürzte er sich auf die Frau, die ungefähr vier Meter von ihm entfernt stand. Der Dackel zog winselnd den Schwanz ein und wich dem rasenden Zweibeiner aus. Die Angegriffene schrie kurz auf, wurde im selben Moment aber durch einen Faustschlag zu Boden gestreckt. Der Hieb war so heftig, dass die Mittvierzigerin in Ohnmacht fiel. Horst war wie von Sinnen. Schnaufend kauerte er sich mit den Knien auf die Brust der Niedergestreckten und schlug ihr dreimal mit aller Kraft ins Gesicht. Dann umfasste er den Hals der Frau und drückte zu. Horst stöhnte, schniefte, drohte selbst zu ersticken – drückte aber weiter zu. Immer stärker, sodass ihm die Arme erlahmten und die Hände schmerzten. Der Dackel sprang umher und kläffte. Dabei tat er so, als wollte er den Mann anspringen, beließ es aber bei Drohgebärden. Und Horst umklammerte den Hals der Frau wie ein Fischadler seine Beute. Als hätte er einen Krampf, drückte er mit seinen Daumen auf die Gurgel, die längst gebrochen war. Sein Opfer zuckte nicht mehr, der Kopf mit den blutenden Wunden hatte sich leicht blau verfärbt.
Schlagartig fiel alles von ihm ab. Er stand auf, schaute auf die Tote, ließ die Arme baumeln. Er fühlte nichts, dachte nichts. Aber ihm war leicht zumute. In die Realität kehrte er erst in jenem Moment zurück, als er den Dackel wahrnahm, der um ihn herumsprang und kläffte. Horst griff die Leine, zog den Hund brutal zu sich heran und hob ihn wie an einem Galgen in die Höhe. Jacko winselte und zappelte. Dabei schaute ihm der Mann ein paar Sekunden zu, bevor er blitzschnell den Körper des Hundes ergriff, die Leine zweimal um dessen Hals wickelte und mit einem Ruck zuzog, dass das Tier nur zuckte. Dann war auch der vierbeinige Begleiter tot.
Zu Kreuze gekrochen
Kommissar Michael Neumann nahm alle Kraft zusammen und rannte den Hügel hinauf. Seit über 20 Minuten joggte er bereits durch den Rugard in Bergen. Das war mittlerweile an jedem Wochenende sein Fitnessprogramm geworden. Manchmal hing er noch eine Stunde im Kraftraum ran. Zumindest am Sonnabend. Das reichte ihm häufig aber immer noch nicht. Er wollte sich schinden. Das war Ablenkung und Stärkung des Selbstwertgefühls zugleich. Auf der Kuppe der Erhebung angekommen, stoppte er. Seine Waden schmerzten, die Lunge auch. Scheinbar. Er wusste ja, dass das der Rücken und die Muskeln waren, die er seit Wochen übermäßig beanspruchte. Schnaufend stützte er sich mit den Händen auf den Oberschenkeln ab. Der Schweiß rann ihm in Bächen über den ganzen Körper. Eigentlich war es für sein intensives Training viel zu warm. Aber er wollte das so. An die Grenzen gehen. Gedanken ausschalten. Und die Wut bekämpfen.
Ja, Michael Neumann war wütend. Nachdem der Neue ihm den Leiterposten für die Kriminalpolizei in Bergen vor der Nase weggeschnappt hatte, war sein ganzes Streben darauf ausgerichtet gewesen, allen anderen zu zeigen, dass dieser Karsten Schwinka nicht der Richtige für die Insel-Kriminalisten sei. Was hätte da Besseres passieren können, als diese verdammte Mordserie bei den Störtebeker Festspielen. Gleich am Tag seiner Ankunft war Schwinka damit konfrontiert worden. Und eigentlich hätte er versagen müssen. Neumann selbst hatte einiges dafür getan: die Ermittlungen erschwert und versucht, den Neuen bei der Staatsanwaltschaft in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. Am Ende wurde der Fall gelöst und er – Michael Neumann, der Mann mit den besten Beziehungen und meisten Erfahrungen – war vom Dienst suspendiert worden.
Der Kommissar setzte sich auf einen Baumstumpf und streckte die Beine aus. Auch die Füße taten ihm weh. Vielleicht waren die neuen Laufschuhe doch nicht die beste Wahl gewesen, dachte er. Aber da kam ihm schon wieder der Neue in den Sinn. Warum der ihn nicht bei Vorgesetzten und Staatsanwaltschaft verpfiffen hatte, war Neumann heute noch, gut sechs Wochen nachdem Schwinka all das belastende Material gegen ihn ausgegraben hatte, ein Rätsel. »Vielleicht ist er ja doch ein Vollidiot«, brummte der Kripo-Mann vor sich hin. Wie oft er diesen Satz in den letzten Wochen schon gesagt hatte, wusste er nicht mehr. Bezeichnend war daran nur, dass er sich mit dem Rügen-Rückkehrer, der ja offensichtlich mal geglaubt hatte, woanders besser dran zu sein, beim besten Willen nicht versöhnen konnte.
»Ich hätte mich achtkantig gefeuert«, grinste Neumann. »Oder einen Kopf kürzer gemacht.« Sein Lächeln wurde breiter. »Aber ich bin immer noch da. Und so schnell kriegt mich da jetzt auch keiner mehr weg.«
Michael Neumann stand auf und schlenderte den Hügel hinab zurück zur Straße. Laufen wollte er jetzt nicht mehr. Zu sehr hielten ihn die Gedanken gefangen. Wie so oft in den vergangenen Wochen. ›Warum kann ich nicht zufrieden sein?‹, dachte Neumann. Nach der Suspendierung war er auf Anraten seiner Frau zu Kreuze gekrochen und hatte ohne Murren seine Arbeit in der Anklamer Kripo-Außenstelle in Bergen wieder aufgenommen. Nach den kompromittierenden Dokumenten und den Beweisen für seine Vorteilsnahme im Amt, hatte er sich nie wieder erkundigt. Warum eigentlich nicht? Damit hatte sein Chef doch eine Waffe in der Hand, die jeden Tag geladen auf ihn zielte. Wäre es nicht besser, einen Schlussstrich unter der Affäre anzustreben? Schwinka sprach das Thema aber auch nicht noch einmal an. Für Neumann war das ein Zeichen von Schwäche.
Als der Polizist an der Straße ankam, ging er noch 150 Meter bis zu seinem Wagen – einem gerade vor zwei Wochen gekauften Citroën. Bar bezahlt. Das machte ihn stolz. Wer konnte sich das schon leisten? Seinen über alles geliebten BMW hatte er abstoßen müssen. Auf Schlag waren mehrere kostenintensive Verschleißreparaturen angefallen. Das wäre extrem teuer geworden, also kaufte er sich lieber gleich etwas Neues. Und warum nicht mal den Franzosen eine Chance geben? Und Citroën hatte in den höheren Preislagen regelrechte Luxus-Limousinen. Neumann stieg ein und startete durch. Auf dem Beifahrersitz lag eine Sonnenbrille, bei der das linke Glas fehlte. ›Könnte ich endlich wegschmeißen‹, dachte der Polizist. ›Finde ich eh nicht wieder.‹ Und schon drehten sich seine gesamten Gedanken um den morgigen Montag. Der Alltag würde ihn wiederhaben. Und erneut würde er gute Miene zum bösen Spiel machen. Wie lange noch? Er wusste es nicht. Aber alles war im Fluss.
Manchmal heulen
Nadine Pollwitz saß auf einer Bank an der Binzer Promenade und rauchte eine Zigarette. Das empfand sie als kleines Vergnügen. Sie schaute den Urlaubern zu, die vorbeiflanierten. Jetzt, Mitte September, waren immer noch ausgesprochen viele Touristen auf der Insel. Logischerweise hing das auch mit dem sonnigen Wetter zusammen. Ihr war das eigentlich viel zu heiß, und für gewöhnlich saß sie bei 30 Grad im Schatten auch nicht draußen auf einer Bank. Aber seit es vor zwei Wochen mit Karsten Schwinka auseinandergegangen war, geisterte sie rastlos durch die Gegend.
Sie hatte sich viel zu viel davon versprochen. Und einmal mehr viel zu viel Gefühl in eine Beziehung investiert. Dieser Kriminaloberkommissar hatte an jeder Straßenecke eine Baustelle: die Arbeit, seine geschiedene Frau, die Kinder, Ärger in der Dienststelle, Anfeindungen aus der Öffentlichkeit – und vor knapp drei Wochen war sogar sein Auto abgefackelt worden. Für Nadine stand fest: Das musste mit den Störtebeker Festspielen zu tun haben. Denn denen hatte er mit seinen Ermittlungen hinter den Kulissen mächtig zugesetzt, sodass der Rest der Saison abgesagt werden musste. ›Was die das gekostet hat?‹, überlegte Nadine. ›Bestimmt Millionen.‹
Die schlanke Frau, die ihr schulterlanges Haar zu einem Zopf zusammengebunden hatte, ließ die Zigarette fallen und trat sie noch im Sitzen aus. Dann erhob sie sich, zog die figurbetonende Leggins straff, sodass diese etwas zu stark in den Schritt rutschte. Das korrigierte sie mit einem geschickten Griff und ging los. ›Am liebsten würde ich mich ins Auto setzen und zu Karsten nach Putbus fahren‹, dachte sie. Diese Begegnungen fehlten ihr. Und überhaupt – waren sie eigentlich wirklich und tatsächlich auseinander? Beide hatten sich in den letzten Tagen ihrer Zweisamkeit nur noch wenig zu sagen gehabt. Sie hatte gespürt, dass er mit seinen Gedanken meist woanders war. Und als sie das thematisierte, war er fast dankbar darauf angesprungen. »Ja, irgendwie kommen wir nicht mehr so recht zurande«, hatte er gesagt. Und dass er so viel zu tun habe. Ja, er möge sie zwar, aber widmen könne er sich ihr nicht so, wie sie es verdient habe. »Was für ein Scheiß!«, sagte Nadine Pollwitz zu sich selbst. Es war ihr ziemlich laut über die Lippen gekommen, sodass einige Passanten in ihrer Nähe sie erschrocken anschauten. ›Woher will der wissen, was ich verdient habe?‹, behielt sie ihre nächsten Gedanken wieder für sich. Wie oft hatte sie das schon gehört: »Du hast was Besseres verdient«, »Ich habe dich nicht verdient«, »Du kannst was viel Besseres haben«, »Ich bin nicht gut für dich«, »Blablabla«. Naja, sie war zwar auch nicht gerade die Ausgeburt der Direktheit, aber wenn Frauen herumdrucksen, sollten wenigstens die Männer klare Ansagen machen. Aber nein, aus deren Mündern kam auch immer nur Halbgares, wenn es um das Zwischenmenschliche ging.
Nadine fühlte plötzlich eine schreckliche Last. Unwillkürlich knickte sie in den Knien ein kleines Stück ein. ›Wie findet man den Richtigen?‹, dachte sie. ›Tolle Typen gibt es eine Menge. Aber wie findet man den, der zu einem passt?‹ Karsten Schwinka hätte wohl gepasst. Aber vielleicht auch nicht, denn sonst wäre das ja alles anders gelaufen.
Sie stand vor der Tür ihres Hausaufgangs. Immer, wenn sie alleine war, empfand sie die Anonymität in der Platte unerträglich. Erst recht, wenn sie bedachte, dass man in solch einem Neubaublock ja eigentlich nie allein war. Eine absurde Situation. Vielleicht würde sie sich nachher vor den Fernseher setzen und eine Liebesschnulze gucken. Manchmal wollte sie einfach ein bisschen vor sich hin heulen. Dabei halfen solche Filme. Vielleicht würde sie ihn anrufen? Mehr als eine brüske Abfuhr konnte sie nicht bekommen. Das wäre zwar verletzend, aber wozu Würde, wenn das Leben trist war.
Wochenendreinigungsmarathon
Horst schloss die Haustür auf. Er war in sich gekehrt. Als er unten im Hausflur stand und die Tür dumpf zuklappte, begannen wie durch einen Schalter unter Strom gesetzt die Gedanken zu zirkulieren. ›Wie kriege ich das sauber, ohne dass Gabi ausflippt?‹, dachte er. ›Nie und nimmer lässt die mich jetzt auf die Toilette!‹ Er zog hinten an der Jeanshose. Die unangenehme Stelle begann langsam anzutrocknen. Es roch auch ein bisschen. Die einzige Wasserquelle, die ihm auf die Schnelle einfiel, war die Pumpe auf dem Friedhof. Der war bei der Kirche und die wiederum lag gute acht Minuten weit entfernt. Mit Hin- und Rückweg sowie Säuberung käme er summa summarum auf fast eine halbe Stunde Zeitverlust. Das würde ihm Gabi ohne eine vernünftige Erklärung nie durchgehen lassen. Was also sollte er tun?
Horst zog seine Hose aus. Die war sauber. Erwischt hatte es nur den Schlüpfer. Auch den entfernte er, um ihn als Tuch zu benutzen. Er versuchte, sich die Reste der verunglückten Verrichtung zu entfernen. So viel war es ja nicht. Dazu spuckte er zweimal in den Schlüpfer, um den Reinigungseffekt zu erhöhen. ›Fertig!‹, dachte er und stieg hektisch zurück in die Jeans. Der Gürtel klimperte. Er hielt kurz inne. Aber von den anderen Hausbewohnern würde ihn niemand hören. Noch einmal ging er nach draußen, um den Schlüpfer in eine der Mülltonnen zu werfen. Gabi würde das Kleidungsstück zwar irgendwann vermissen, das hielt er aber aus.
Als der Mann die Treppe in die zweite Etage hinaufging, bereitete er sich auf eine mögliche Auseinandersetzung vor. Die müsste er so schnell wie möglich abbiegen, denn zu nahe durfte Gabi ihm wegen des verbliebenen Geruchs nicht kommen. Er schnupperte an den Fingern. Übel.
Er schloss mit der linken Hand auf. ›Bloß nichts am Schlüssel hinterlassen‹, dachte er.
Als er die Tür öffnete, rannte Gabi gerade vom Bad über den Flur in Richtung Wohnzimmer – und blieb abrupt stehen. »Du brauchst ja …«, keifte sie.
»Ja«, sagte Horst.
Seine Frau stand mit vor Hitze glühendem Gesicht vor ihm. Die Haare waren zerzaust und hatten wegen des Schweißes kleine, separat abstehende Löckchen gebildet. Die Hände in Gummihandschuhen. In der rechten einen blauen Wischlappen. Und wie seit gut 25 Jahren, wenn sie an den Wochenenden die Wohnung putzte, trug sie eine mit Blumenmustern übersäte Dederonschürze. Davon hatte sie mindestens fünf. Und manchmal dachte Horst, die müsste Gabi eigentlich von ihrer Großmutter geerbt haben.
»Bad ist jetzt auch sauber«, zeterte Gabi. »Da geht’s nicht mehr rein.«
»Ja«, entgegnete Horst demütig. Er wollte sie nicht reizen. Er fürchtete sich vor einer Standpauke. Und außerdem hätte sie ihm dann näher kommen können, als ihm lieb gewesen wäre. Den unangenehmen Geruch, der ihn immer noch ein klein wenig umgab, würde sie sofort wahrnehmen. Also blieb er einfach an der Wohnungstür stehen.
Gabi wollte sich schon abwenden, da fragte sie: »Was glotzt du?«
»Oh, nichts«, entgegnete er. »Ich wollte dir jetzt nicht im Weg stehen. Am besten, ich gehe auf den Balkon, und rauche eine.«
»Warte!«, kommandierte Gabi. »Ich bin gleich fertig, dann komme ich mit.«
Verdammt, er hätte es wissen müssen. Wie sollte er jetzt seine Situation verbessern, ohne dass sie etwas davon mitbekäme. Also blieb er weiter an der Tür stehen und wartete.
Gabi bückte sich hinab zum Plaste-Eimer, spülte den Lappen aus und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Pffffffff«, stieß sie hörbar die Luft aus und rief nach ihrem Sohn. »Jaiiiiiiiison!«
»Ja?« Die Reaktion des Achtjährigen kam unmittelbar. Er steckte den Kopf durch den Türspalt zu seinem Zimmer.
»Bleib drin!«, befahl seine Mutter. »Es ist jetzt alles sauber.«
»Ja, geht klar«, antwortete er und verschwand sofort wieder in seinem kleinen Reich.
›Der hat’s gut‹, dachte Horst und lächelte. Sofort verordnete er sich aber wieder Ernsthaftigkeit, denn es war nie angebracht, Gabi an den Sonntagabenden zu provozieren. Da hatte sie immer ihren Wochenendreinigungsmarathon hinter sich und war deshalb sehr aufgebracht.
Damals, als sich beide kennengelernt hatten, konnte er gut verstehen, dass sie die Wochenenden nutzte, um die Wohnung sauber zu halten. Das hatte er sogar sympathisch gefunden, brauchte er doch nie mit Hand anzulegen. Das wollte Gabi nicht. Irgendwann bemerkte Horst allerdings, dass seine Frau auch in der Woche putzte – weshalb sie manchmal erst sehr spät zur Ruhe fand. Thematisiert hatte er das in all den Jahren aber nie. Horst war nicht so der Typ fürs Reden.
»Kannst«, zischte Gabi.
Horst zog die Schuhe aus und tippelte über den Flur durchs Wohnzimmer bis zum Balkon. Die Wohnung sah wieder wie aus dem Ei gepellt aus. Vermutlich lag nirgends auch nur ein Staubkorn. Und seit Gabi Desinfektionsmittel für sich entdeckt hatte, waren wohl auch alle Bakterien und Keime einem Massensterben ausgesetzt gewesen. Bei diesem Gedanken musste Horst lächeln. Als Gabi zu ihm auf den Balkon trat, wurde er aber wieder ernst.
Sie zündeten sich Zigaretten an. Jeder hatte seine eigene Sorte. Gabi rauchte Marlboro, Horst bevorzugte noch diverse Marken, die es schon in der DDR gegeben hatte. Diesmal war es Cabinet. »Willst du noch was trinken?«, fragte Gabi.
Freudig hätte er »Gern« gesagt. Aber bevor er es sich mit seiner Frau vor dem Fernseher gemütlich machen könnte, müsste er die Hose wechseln. »Vorher würde ich mich gern schon zum Schlafen umziehen«, sagte Horst. »Es ist heute so heiß, dass es mir unangenehm wäre, mich verschwitzt auf die Couch zu setzen.«
»Gut«, kommentierte Gabi wohlwollend, »ich bringe dir eine Schüssel auf den Balkon. Mach aber nicht alles nass!«
Besser hätte es nicht kommen können. Aber genau darauf hatte er spekuliert. Er kannte sie nur zu gut: Das Bad war am Sonntagabend für alle tabu.
Sie zog ein letztes Mal an ihrer Zigarette, warf den Stummel achtlos über die Balkonbrüstung, holte ihm den Schlafanzug und die orangefarbene Schüssel, die sonst immer unter dem Waschbecken stand.
Horst zog sich aus und stellte sich hinein. Das Plastikteil war gerade so groß, dass er seine Füße darin platzieren konnte, ohne die Zehen einzudrehen. Dann wusch er sich. Schwerpunkt: Genitalbereich. Dabei dachte er ständig nur daran, nach nichts zu riechen.
Gabi bereitete den Wohnzimmertisch vor, stellte für sich eine Flasche Rotwein bereit, die sie heute Abend auch noch leeren würde. Und Horst bekam seine drei Flaschen Bier. Wie an jedem Abend. Nachdem sie das Wasser aus der Schüssel über die Balkonbrüstung gekippt hatte, zupfte sie die Überdecke auf dem Sofa zurecht und gebot Horst, Platz zu nehmen. Dann schaltete er mit der Fernbedienung auf ARD, wo die »Tatort«-Melodie einsetzte. Das rituelle TV-Erlebnis begann.
Beim Abspann war Gabi wie jeden Sonntagabend so betrunken, dass sie sogar im Sitzen ein wenig schwankte. Und wie immer ließ sie ihren Kopf in Horsts Schoß sinken, zog seine Schlafanzughose ein kleines Stück herunter und befriedigte ihren Mann oral.
Der legte seinen Kopf in den Nacken und genoss es. Jason hatte sich – wie jeden Sonntagabend – die ganze Zeit nicht blicken lassen. Das bemerkte Horst schon seit Jahren nicht mehr. Und das, was vor zwei Stunden unten vor dem Haus in den Büschen geschehen war, hatte er längst vergessen.
Unbändige Wut
»Nichts«, stöhnte Kriminalhauptmeister Danilo Schobel, »die Anwohner haben absolut nichts gehört. – Sagen sie zumindest.« Dabei pustete er sich seinen Scheitel aus dem Gesicht, dass er flatterte. Obwohl es gerade mal 9 Uhr war, drückte die Hitze schon immens.
Karsten Schwinka zuckte mit den Schultern. »War zu erwarten gewesen«, sagte er. »Der Mord wird gestern Abend passiert sein. Da bewegt sich hier in dem Dorf niemand mehr nach draußen. Schon gar nicht bei dem Wetter.«
»Aber dass so gar keiner aber auch gar nichts gehört hat …« Schobel überlegte. »Wenigstens den Köter …«
»Wir müssen warten, bis sich bei den Leuten der erste Schreck legt«, sinnierte Schwinka. »Im Moment haben vermutlich alle den Reflex, mit dieser Sache hier nichts zu tun haben zu wollen.«
Seit fast einer Stunde waren die Beamten in Trent auf der Halbinsel Wittow schon zugange. Die kleine Parkanlage inklusive Friedhof und Kirche war mit rot-weißem Flatterband abgesperrt worden. Der Erkennungsdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam war mit einer achtköpfigen Mannschaft auf die Insel gekommen.
›Beachtlich‹, fand Kriminaloberkommissar Karsten Schwinka, der die Ermittlungen leiten würde. ›Sind alle wegen der Störtebeker-Morde etwas sensibel geworden.‹ Bei dem Gedanken musste er lächeln.
Dabei war ihm sonst weniger zum Lachen zumute, wenn ihm der Fall von vor ein paar Wochen in den Sinn kam. Da hatten sie unter mächtigem Druck arbeiten müssen. Besonders, als während der Ermittlungen die Zahl der Opfer gestiegen war, wollten Vorgesetzte, Medien und die Rügener Einwohner Ergebnisse sehen. Und da Schwinka auf seinem Gebiet als absolute Koryphäe galt, war bei allen die Erwartungshaltung groß gewesen.
»Die liegt hier locker seit zwölf Stunden«, sagte Kriminalhauptmeister Rico Schirner. Er leitete den Erkennungsdienst und war ein Mann mit enormen Erfahrungen.
»Mmh«, entgegnete Schwinka. Er war wie die Kollegen der Spurensuche mit einem weißen Schutzanzug bekleidet. Obwohl der gefühlt dünn wie Papier war, staute sich darunter die Hitze.
»Außerdem ist sie eindeutig erwürgt worden«, fügte Schirner hinzu. »Die Verletzungen im Gesicht sehen zwar spektakulär aus, waren aber auf keinen Fall tödlich. Ich glaube, sie ist durch die Schläge gegen den Kopf ohnmächtig geworden.«
»Das denke ich auch, denn an der Stelle, an der sie liegt, gibt es kaum Kampfspuren«, sagte Schwinka und ging mit Schirner näher an die Leiche heran. Die beiden Kriminalisten hockten sich nieder und begutachteten den Boden.
»Sehen Sie?«, fragte Schwinka. »Sie hat nur ein wenig mit dem Hacken die Erde aufgescharrt. Nicht so, als hätte sie sich aufgebäumt, sondern müde, als würde sie sich im Schlaf nur mal eben umdrehen.«
Schirner nickte: »Nachvollziehbar. Hier, dieser Schlag traf sie an der rechten Augenbraue und am Jochbein. Das dürfte auch zertrümmert sein. Das ist schlimm, tötet aber nicht unbedingt. Eine weibliche Person von ihrer Konstitution kann das aber schon mal ausknocken.«
»Wenn jemand die Frau mit einem Schlag niederstreckt, sie praktisch erledigt auf dem Boden liegen sieht, und sie dann aber noch erwürgt …?« – Karsten Schwinka überlegte – » … könnte er sie gekannt haben. Vielleicht hat er ihr aufgelauert, und der Mord war geplant.«
»Dafür spräche auch, dass der Hund getötet wurde«, mischte sich Hauptmeister Danilo Schobel ein. Er hatte vor Kurzem gemeinsam mit Schwinka die Störtebeker-Morde aufgeklärt. Dabei waren die beiden zu einem glänzend aufeinander abgestimmten Ermittlerduo geworden. Karsten Schwinka hatte in den zurückliegenden Wochen häufig dem Schicksal gedankt, dass es ihm solch einen guten Mann an die Seite geführt hatte. Und Schobel freute sich immer wieder darüber, endlich wie ein echter Kriminalist arbeiten zu können. Nie im Leben hätte er geglaubt, dass es mal einen derart versierten Kripo-Mann auf die Insel verschlagen würde.
»Ja«, sagte Schwinka, der immer noch wie in Gedanken wirkte, »der tote Hund … Wozu tötete er den Hund? Weil der bellte? Oder weil der Hund ihn kannte?«
»Ich würde den Hund meines Opfers auch töten«, sagte Schobel.
»Sicher?«, fragte Schwinka. Und ohne die Antwort abzuwarten fügte er hinzu: »Der Hund hat den Mörder nicht angegriffen. Wäre es passiert, hätte man das anhand irgendwelcher Spuren gesehen. Also saß das Tier unbeteiligt daneben – was das Töten völlig absurd erscheinen lässt. Oder der Dackel hatte Angst und sprang lediglich kläffend um das Geschehen herum. Aber selbst dann hätte der Mörder den Hund nicht töten müssen, denn der bleibt bei seinem Frauchen, statt dem Täter hinterherzuhecheln.«
»Also geplant?«, fragte Schobel.
»Oder unbändige Wut …«
»Oder beim Kacken erwischt«, platzte Polizeimeister Gunnar Schick dazwischen. Der saß gerade im nahen Gebüsch und füllte Kot in eine kleine Plastikdose. Nach dem Versiegeln beschriftete er sie. Neben die Fäkalien platzierte er ein Schild mit der Aufschrift 11.
»Oh, da haben wir ja Glück, dass wir nicht reingetreten sind«, sagte Karsten Schwinka mit einem ironischen Unterton. Er fand es merkwürdig, dass die Hinterlassenschaft jetzt erst entdeckt wurde. Für einen kurzen Moment grummelte es in seinem nervösen Magen, was mit einer Art Ärger gleichzusetzen war. Wie oft gingen Ermittlungen schief, konnten offensichtliche Täter nicht verurteilt werden, weil die Polizei Fehler machte oder schlichtweg Details übersah. Und manchmal lagen diese Details weithin sichtbar mitten auf der Straße – bildlich gesprochen.
Schwinka, Schobel und Schirner gingen zu dem Haufen, stellten sich in einem gleichschenkeligen Dreieck um ihn auf und blickten zum braunen Kringel hinab – als könnte dieser den Kriminalisten den gesamten Tathergang erzählen.
»Ist das eine Meditation?«, rief Diana Chupaski.
Wie auf Kommando hoben die Männer die Köpfe und schauten sie verdutzt an.
Chupaski musste lachen. »Dieser Baumbestand muss so eine Art Treffpunkt für eine Clique sein«, sagte sie wieder ernst und kam weiter auf die drei Polizisten zu. Die junge Frau gehörte zum Erkennungsdienst. Das zwar erst seit vier Monaten, aber Schirner hielt große Stücke auf sie. Die zierliche 29-Jährige entdeckte an jedem Tatort mindestens eine Besonderheit, die allen anderen entging.
»Wieso?«, fragte Schirner.
»Es gibt hinten eine Bank, an der Kippen und Bierbüchsen liegen«, entgegnete die Kriminalhauptmeisterin. »Vielleicht war die gestern Abend ja auch besetzt.«
»Alles einsammeln, was einzusammeln geht!«, sagte Schwinka halb zu Chupaski, halb zu Schirner. »Wenn jemand die Frau aus Wut umgebracht hat, dann hat er hier nicht zum ersten Mal im Busch gehockt und sein Geschäft verrichtet. Unterm Laub schimmern alte Papierreste hervor. Auch ist der Bereich ungewöhnlich festgetreten.«
Schirner und die junge Frau nickten. Unverrichteter Dinge machten sie sich wieder an die Arbeit.
»Und du, Danilo, organisierst so schnell wie möglich eine Bestimmung der DNA! Wir brauchen einen deutschlandweiten Datenabgleich. Ich glaube zwar nicht, dass wir den Mörder schon gespeichert haben, aber das will ich so schnell wie möglich abgearbeitet haben.«
Bestimmt Touristen
In Trent hatte der Mord an Krista Schildt rasant die Runde gemacht. Die Tote war von ein paar Jungs entdeckt worden, die auf dem Weg zum Schulbus noch heimlich eine rauchen wollten. Das war gegen 6 Uhr gewesen.
Schildt hatte in einem Eigenheim ganz in der Nähe des kleinen parkähnlichen Waldes gewohnt. Und das seit über einem Jahr allein, denn ihr Mann war ausgezogen und nach Ulm zu seiner neuen Freundin abgehauen. Ihr waren das Haus und der Dackel geblieben. Und genau in diesem Dunstkreis hatte sich ihr Leben in den zurückliegenden Monaten abgespielt: Haus, Hund, Arbeit. Verkäuferin war sie gewesen. In Altenkirchen in einem Discounter, zu dem sie werktags mit ihrem Kleinwagen fuhr. Der Dackel war auf dem kleinen, eingezäunten Hof geblieben, hatte zu trinken, eine kleine Hütte, Hundespielzeug. Das war eingespielt. Vielleicht galt Schildt nicht gerade als besonders beliebt, aber Feinde hatte sie in dem Dorf keine. Und jetzt war sie tot.
»Ganz schreckliche Sache!«, antwortete Pastor Simon Juhrke auf die Frage, ob er schon von der Toten gehört habe. »Furchtbar, dass so etwas in diesem Dorf passieren kann!«
»Das waren bestimmt Touristen«, entfuhr es der alten Gundula Krüger, die fast täglich mehrere Stunden an der Kirche und auf dem Friedhof verbrachte. Heute war Pastor Juhrke sehr früh ins Gotteshaus gekommen, um hier wegen des Ereignisses nach dem Rechten zu sehen. Denn man konnte ja nicht wissen, was außer des Mordes in der Nacht noch so alles geschehen war.
Simon Juhrke, ein mittelgroßer unscheinbarer Mann mit schütterem Haar, wohnte eigentlich in der Pfarrei in Schaprode – westlich von Trent keine zehn Minuten mit dem Auto. Meist kam er aber mit dem Fahrrad hierher. Das war knapp eine halbe Stunde. Und er tat damit etwas für seine Gesundheit. Heute war Juhrke aber ins Auto gestiegen, nachdem er von einem Trenter Kirchgemeindemitglied angerufen worden war. Als er hörte, neben dem Gotteshaus sei die Schildt ermordet worden, hatte der Pastor sofort geglaubt, die Frau habe an der historischen Kirche Einbrecher erwischt. Denn zu klauen gab es in dem 700 Jahre alten Gebäude einiges. Aber wie sich die Dinge mittlerweile darstellten, hatte sich niemand an dem Haus vergriffen. Auch lag Krista Schildt nicht neben der Kirche, sondern noch einige Hundert Meter weit davon entfernt.
»Warum glauben Sie, dass es Touristen waren, Frau Krüger?«, fragte der Pastor höflich, wenngleich er sich vorstellen konnte, wie die 80-Jährige zu ihrer Ansicht kam.
»Glaub’n Se denn wirklich, dat macht einer von hier?«, entgegnete die gebrechliche Frau, die in der ersten Bankreihe des Kirchenschiffes saß und dem Pastor zuschaute, wie er Reliquien hin und her räumte. Dabei stützte sie sich mit den Händen auf einem Gehstock ab, den sie sich zwischen die Beine geschoben hatte.
»Ich glaube nur an den Herrn, liebe Frau Krüger«, entgegnete Juhrke salbungsvoll. »Und zum jetzigen Zeitpunkt kann man noch überhaupt nichts zu einem möglichen Täter sagen.«
»Nee, nee.« Die Alte schüttelte den Kopf. »Dat macht keiner von hier. Wir wissen doch gar nich’, wat da alles für ’n Gesocks immer auf die Insel kommt.«
»Es gibt überall schlechte Menschen, Frau Krüger. Sie haben doch selbst schon so viel erlebt. Auch hier auf Rügen.«
Gundula Krüger schwieg. Natürlich hatte sie viel erlebt. Und gerade hier auf Rügen, wo sie geboren und aufgewachsen war: Missbrauch durch den Vater, Schläge vom Ehemann, der ihr schon vor zwölf Jahren weggestorben war. Der Sohn ein gewalttätiger Trinker, der auch einige Male die Hand gegen seine Mutter erhoben hatte, jetzt aber – zum Glück – in Leipzig lebte. Und dann die Tochter. Die war noch hier, wohnte mit ihrer Familie in einem Eigenheim in Altefähr. Seit dem Tode ihres Vaters ließ sie sich bei der alten Mutter in Trent aber nicht mehr blicken. Auch Anrufe kamen eher selten.
Gundula wurden die Augen feucht. Das passierte der Greisin häufig. Der Schmerz der Jahre hatte sie aufgeweicht. Manchmal weinte sie schon, wenn sie einfach nur auf die Gräber schaute und sich an die Zeiten mit den Personen erinnerte, die dort unter der Erde lagen. »Ja, ja«, flüsterte die Frau.
»Außerdem haben wir hier in Trent im Moment gar nicht so viele Urlauber«, nahm der Pastor den Gesprächsfaden wieder auf. »Aber wie dem auch sei: Aus Trent muss der Mörder ja trotzdem nicht gewesen sein.«
»Ich hab den Hund gestern ja noch jaulen gehört«, sagte Krüger. »Drecksköter, dacht’ ich noch. Wat jault der denn nu’ schon wieder? Aber denn war’er plötzlich still.«
»Haben Sie das schon der Polizei erzählt?«, fragte Pastor Juhrke wie beiläufig, hielt in seinem Tun aber inne.
»Ja, ja«, log die Alte, »hab ich gemacht. Aber es geht ja um die Schildt und nich’ um den Köter.«
»Aber den hat der Täter doch auch getötet. Das wissen Sie doch Frau Krüger. Vielleicht waren Sie Ohrenzeugin des Verbrechens.«
»Ach wat«, winkte Krüger ab, »so gut hör ich auch nich’ mehr. Obwohl es damit immer noch besser is’ als mit dem Kucken und dem Gehen. Aber wer weiß, wat ich da gehört hab.«
Gut im Futter
Gabi Schuster rannte die Treppe runter. Wie konnte sie nur so mit der Zeit in Verzug geraten? Das war gar nicht ihre Art. Aber heute Morgen hatte ihr Horst ständig im Weg gestanden, war Jason übelgelaunt gewesen. Solch eine aufgeladene Atmosphäre in der Familie hielt auf. Als Horst endlich zur Arbeit gefahren war, hatte sie ihren Sohn noch ein bisschen angetrieben, sodass er den zweiten Bus geschafft hatte. Mit der Schülerbeförderung fuhr Jason nicht mit, da der für seinen Unterrichtsbeginn in Bergen immer viel zu früh kam. Ihr waren dabei aber die Minuten durch die Finger gerieselt wie Strandsand. Und noch während sie sich die modischen hochhackigen Sandaletten an die zierlichen Füße schnallte, hatte Katja unten gehupt.
Gabi und Katja arbeiteten in Boutiquen in Breege. Dort war ein reger Touristenverkehr, sodass sich selbst kleine Läden mit nur wenigen ausgesuchten Angeboten lohnten. Und da die Schusters nur einen Wagen besaßen, war Gabi auf die Idee gekommen, mit Katja Zeisler eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Zeisler lebte mit ihrer Familie jetzt seit drei Jahren in Trent. Sie stammte aus Thüringen und hatte sich eine Art Kindheitstraum erfüllt – auf Rügen zu leben. In dem Wittower Dörfchen hatte sie ein altes Haus gekauft und es gemeinsam mit ihrem Mann und Freunden ausgebaut. Irgendwie immer noch. Denn das Anwesen glich eher einer Baustelle als einem trauten Heim.
Katja Zeisler sah heute wieder perfekt aus. Kurzer hellblauer Rock zu hellblauen Pumps. Dazu eine auffällige Bluse, in der sich mehrere Blautöne trafen und schließlich große Ohrringe mit hellblauen Scheiben als Hingucker. Sie liebte es, ihren Anputz so zu kombinieren, dass eine Farbe dominierte. Das veranlasste die Kunden im Geschäft immer zu freundlichen Bemerkungen oder Komplimenten.
Gabi drehte unmerklich mit den Augen, als sie zu der gut zehn Jahre jüngeren Frau ins Auto stieg. Sie hielt das mit den Farben für eine Marotte. Außerdem musste sie immer wieder feststellen, dass Katja kurze Röcke eigentlich nicht tragen sollte. Ihre Beine waren zu stämmig, die Knie sahen aus wie zu klein geratene Handbälle. Nun gut, die Zeisler hatte zwar ein hübsches Gesicht, die Wangen wurden von Monat zu Monat aber immer runder – so wie ihre Oberschenkel. ›Steht gut im Futter‹, dachte Gabi. Ihr Gesicht blieb dabei aber ohne Regung. Es war erstaunlich, wie wenig man in der Miene der 44-Jährigen zu lesen vermochte. Sie konnte stundenlang einem Gespräch folgen, ohne auch nur einmal den Gesichtszügen eine Entgleisung zu erlauben.
Gabi Schuster war stolz auf ihren schlanken Körper, der sich durch Formen auszeichnete, die Männer in Wallung bringen konnten. Das war ihr in die Wiege gelegt worden, denn Sport trieb sie schon seit zehn, fünfzehn Jahren nicht mehr. Aber solange alles an den richtigen Stellen feste Rundungen aufwies, sah sie keinen Anlass, plötzlich im Schweiße ihres Angesichts zu joggen oder womöglich in ein Sportstudio zu gehen. Und genau genommen war Gabi Schuster sogar eine hübsche Frau. Ihre Züge wirkten vielleicht ein bisschen spitz, waren aber ebenmäßig. Dass das jedoch niemandem mehr auffiel, lag an den herabgezogenen Mundwinkeln, die ihr eine verhärmte Note verliehen. Manchmal, wenn sie in den Spiegel schaute, wurde sie sich dessen bewusst und versuchte zu lächeln. Aber das passte nicht mehr zu ihr, also ließ sie die Mundwinkel wieder herabfallen. Dann vergrub sie sich in ihren Frust über ein vertanes Leben an der Seite dieses langweiligen Mannes, der nichts an sich hatte, das man hätte lieben können. Warum sie Horst damals geheiratet, ja, warum sie ihn überhaupt erwählt hatte, konnte sie schon seit vielen Jahren nicht mehr beantworten. Da sie es aufgegeben hatte, sich selbst hübsch zu finden, war auch eine gewisse Nachlässigkeit eingezogen. Sie achtete nicht mehr so sehr auf das, was sie anzog, und kümmerte sich nur noch selten um ihre Haare, die wegen ihres Hanges zur Krause eigentlich mehr Aufmerksamkeit benötigten. Und so lief sie gerade an heißen Tagen, wenn man auch schwitzte, ohne sich groß zu bewegen, den ganzen Tag mit winzigen, fast wie Drahtkringel wirkenden Löckchen herum.
»Morgen Gabi!«, flötete Katja Zeisler.
»Morgen!«, grummelte die zurück. Sie hatte eine warme, fast tiefe Stimme, die mit den Jahren etwas heiser geworden war.
»Hast du schon gehört? Die Schildt wurde erschlagen.« Dabei fuhr Katja mit quietschenden Reifen los, schaltete zügig die Gänge hoch und frönte ihrem rasanten Fahrstil, an den sich Gabi längst gewöhnt hatte.
»Wie bitte? Nein … Was heißt denn erschlagen?«
»Na abgemurkst. Heute Nacht. Zwischen den Bäumen bei der Kirche.«
»Wie … an der Kirche?«
»Ja, da irgendwo.«
Das war ja ein Ding. Mitten in Trent wurde jemand erschlagen. Ein wohliger Grusel rann über Gabis Rücken. Endlich was los. »Weiß man denn, was passiert ist?«, fragte sie.
»Nicht so richtig. Mich rief Tini an, deren Sohn hat die Schildt wohl gefunden …«
›Ich werde von niemandem angerufen‹, dachte Gabi, ›schon seit Jahren nicht mehr.‹ Manchmal schaute sie zwei, drei Tage nicht einmal auf ihr Telefon.
»… sie meint, waren wohl Touristen oder welche von außerhalb.«
»Wie kommt sie darauf?«, wunderte sich Gabi.
»Naja, wer soll hier aus dem Dorf schon die Schildt erschlagen?«
»Tja, wer …?« Gabi sah aus dem Fenster. Die weiten Felder flogen an ihnen vorbei.
Katja Zeisler fuhr einen heißen Reifen. Auf der Landstraße locker 120 Kilometer pro Stunde. »Ich glaube ja nicht, dass das welche von außen waren. Sind ja kaum Urlauber im Dorf. Wer weiß, mit wem die Schildt Streit hatte. Oder vielleicht war’s ja auch ein heimlicher Liebhaber, den sie verlassen hat. Oder womöglich …«
Gabi ließ Katja plappern. Dabei verzog sie wieder keine Miene, denn sie war mit ihren Gedanken ganz woanders. Zuallererst bei sich und ihrem verkorksten Leben. Und auch die Arbeit in dem Schmuckladen bereitete ihr kaum Freude. Was sollte bloß noch werden? Für einen kurzen Moment erschien Jason vor ihrem geistigen Auge. Dessen Gestalt verschwand aber ebenso schnell wieder wie die Bäume und Häuser, die vorbeirauschten.
Dezentes Hintergrundbrummen
Horst Schuster arbeitete als Bauingenieur in Sassnitz. Das war jeden Tag eine nicht zu verachtende Strecke mit dem Auto. Vor allem wenn die Insel die Urlauberinvasion erlebte. Da konnten die Straßen morgens schon verstopft sein. Jetzt, im September, ging es.
Während der Fahrt dachte er an nichts. Und da das prinzipiell nicht geht, da unsere Gedanken im wachen Zustand unentwegt Bilder erzeugen, beschäftigte er sich ganz und gar mit dem, was auf der Straße passierte. Er las Autokennzeichen und überlegte, welchen Landkreisen die Buchstabenkombinationen wohl zuzuordnen seien. Er zählte zwischen zwei Abfahrten die Begrenzungspfähle am Straßenrand. Oder er konzentrierte sich darauf, ohne den Tempomaten die Nadel auf dem Tachometer genau auf der 100 zu halten.
Horst war nicht unansehnlich. Mit seinen 1,84 Metern Körpergröße galt er nicht gerade als klein. Auch kleidete er sich gut, trug meistens ein Hemd zur Anzughose und verzichtete an kühleren Tagen grundsätzlich nicht auf das dazugehörige Sakko. Dass er einen Anzug manchmal eine ganze Woche lang anhatte, fiel schlimmstenfalls den Kollegen auf. Seine Hemden wechselte er aber täglich. Zumindest fast.
Horst begann zu pfeifen. Dabei lächelte er gut gelaunt. Er hatte auch sonst ein einnehmendes Wesen, war meist fröhlich und kommunikativ. Das lenkte von seiner viel zu großen Nase und dem Bauchansatz ab, der sich mehr und mehr durch die Knopfleiste seiner Hemden schälte. Das waren aber nicht die Dinge, die ihn bewegten. Er lebte ganz für seinen Beruf. Und darin war er verdammt gut. Gab es knifflige Aufträge, zog sein Chef meist ihn zu Rate. Und er fand immer eine Lösung. Ja, immer.
Hatte Horst eben noch »Babička« von Karel Gott gepfiffen, das im Radio lief, war er allmählich in eine Fantasiemelodie übergegangen, die ihm gefiel. Also wiederholte er sie, nachdem er den Sender ganz leise gedreht hatte. Und gleich noch einmal. Dann baute er sie aus, wackelte mit dem Kopf hin und her – und pfiff auch noch, als er vor dem Ingenieurbüro aus dem Auto stieg.
Die Woche begann mit dem üblichen »Hallo!« und »Wie war dein Wochenende?«, was seinen rituellen Höhepunkt in einer Kaffeerunde in der Küche fand. Der Chef saß mit der Architektin am Tisch und schwatzte über dies und das, während Traber und Kauz am Kaffeeautomaten standen und über Politik philosophierten. Horst zur Rechten stand Peti, die kleine, kompakte Sekretärin. Wieso die sich so nennen ließ, war ihm ein Rätsel, hieß sie doch Petra und hatte damit einen derart kurzen Namen, dass der eigentlich nicht mehr hätte verkürzt werden müssen. Ihn nannte man ja auch nicht Hosi. Wenn überhaupt, würde sich Horsti anbieten, aber das wäre dann eine Verlängerung.
Petra schnatterte. Horst hörte ihr gern zu, weil sie eine angenehme Stimme besaß. Petra hatte einen Sound, der wie ein dezentes Hintergrundbrummen wirkte. Da war es gar nicht wichtig, was sie sagte. Hauptsache sie redete. Das tat sie gerade ausgiebig, denn am Wochenende waren ihre Eltern zu Besuch gewesen und es hatte bei der gemeinsamen Grillfete im Garten mächtig Krach in der Familie gegeben.
Horst nahm vom Inhalt des Berichts nur Bruchstücke wahr, schaute aber drein, als wäre er ganz bei Petra und ihrer Geschichte.
»Und was war bei dir so los?«, fragte die Sekretärin.
»Wir haben ja nicht so die Gelegenheit, im Garten eine Party zu machen«, entgegnete Horst. »Unsere Eltern sind deshalb auch viel seltener bei uns.«
»Also ein ganz normales Wochenende?«, fragte Petra weiter, die sich an die Art der Dialoge mit Horst Schuster längst gewöhnt hatte. Der redete immer um den heißen Brei herum, wenn es um mehr oder weniger persönliche Dinge ging. Dann antwortete er nie direkt und schien sich ständig für irgendetwas zu entschuldigen. Das änderte sich nur, wenn es sich um die Arbeit drehte. Da war er sortiert und klar. Zwar konnte er Leuten, die nicht so mit dem Bauingenieurwesen vertraut waren, mit seinem Fachchinesisch mächtig vor den Kopf stoßen, aber was er dann so von sich gab, hatte inhaltlich Hand und Fuß.
»Ich bin nicht so für große Feiern oder Ausflüge«, antwortete Horst. »Manche sehen das anders. Aber das kann ja auch jeder halten, wie er möchte, nicht wahr?«
»Na klar, Horst«, sagte darauf Petra, die ahnte, dass sie gut eine Viertelstunde brauchen würde, um den Ingenieur auf den eigentlichen Kern der Frage zu lenken. Also beließ sie es dabei, denn die Frage nach Schusters Wochenende hatte sie eh nur aus Höflichkeit gestellt. Was sollte bei dem schon passieren? Langeweile pur.
Da klingelte das Smartphone des Chefs. »Moment mal«, entschuldigte der sich bei der Architektin. »Na Siggi, was gibt’s?» – »Scheiße, echt?« Er stand auf und begann unruhig in der Küche auf und ab zu laufen. »Sicher?« – »Nee, der hat noch nichts gesagt.« – »Ja, ja, mach ich … jahaaa, mach ich. Grüß Kitty!« Mario Goroschka ließ seine Hand mit dem Smartphone langsam sinken. Dabei richtete der Inhaber des Ingenieurbüros seinen Blick auf Horst. »Was ist denn bei euch los?«, fragte er fassungslos in Richtung seines Mitarbeiters aus Trent.
Horst schaute verdutzt.
»Die haben da eine Frau gefunden. Die ist wohl ermordet worden. Erschlagen, wie es heißt …«
Alle schauten Horst an.
»Tja«, sagte der und blickte mit großen Augen in die Runde seiner Kollegen.
»Mann, und dann erzählst du uns davon nichts?«
»Tja«, wiederholte Horst.
»Du kennst ihn, Mario, wenn es nicht ums Bauen geht, sprudelt es nicht gerade aus ihm heraus«, warf die Architektin schnippisch ein.
»Aber sowas? Das passiert ja nun nicht alle Tage«, fand Goroschka.
Horst Schuster staunte über die Aufregung. Innerlich ärgerte ihn diese Sensationslust der Leute. Schlimm genug, dass da jemand zu Tode gekommen war! Warum das dann auch noch lang und breit auswalzen? Während die anderen noch über sein Defizit fabulierten, die Bedeutung von Informationen richtig einordnen zu können, sah er vor seinem geistigen Auge, wie Krista Schildt unter dem Druck seiner Hände die Zunge herausstreckte. ›Kein schöner Anblick‹, dachte Horst. ›Es kann sich hier niemand vorstellen, wie unwürdig jemand stirbt, wenn ihm die Kehle zugedrückt wird. In Filmen wird das ja auch nie real gezeigt. Und selbst wenn – es dringt nicht bis ins Bewusstsein derer vor, die sich das anschauen.‹
»Hast du davon denn nichts gewusst?«, fragte die Architektin plötzlich in seine Richtung.
»Ich bin heute ein bisschen zu spät aufgestanden und war dadurch etwas im Stress«, entgegnete der erneut an der Frage vorbei.
»Also hast du es noch nicht gewusst …«, bohrte die Architektin nach.
»Heute Morgen haben wir zu Hause nicht viel geredet. Und dann bin ich gleich raus ins Auto und hierher.«
»Soll ›nein‹ heißen«, übersetzte Goroschka amüsiert.
Buschfunk funktioniert
Am Nachmittag war die tote Krista Schildt abtransportiert worden. Unter den Bäumen und zwischen den Büschen kehrten Polizeibeamte in weißen Ganzkörperanzügen alles von unterst zu oberst, wendeten jedes Blatt zweimal, tüteten jeden Zigarettenstummel und jeden Kronkorken ein.
Unmittelbar nach dem Leichenfund sofort mit dem Erkennungsdienst aufzukreuzen, war unüblich. Schwinka hatte aber angewiesen, dass beim Auffinden von Toten zwar wie vorgesehen automatisch die diensthabenden Beamten den Fundort sicherten, dies aber grundsätzlich nicht mit typischen Erstermittlungen verbanden. Wurde ein Toter gemeldet, hatten seine Kollegen bei ihm anzurufen. Und er behielt sich vor zu entscheiden, ob sofort Dauer- bzw. Erkennungsdienst zum Zuge kamen. Er wollte bei einem Tötungsverbrechen keine Zeit verlieren. Und die ersten Stunden waren oft entscheidend.
So war es auch jetzt. Als das Telefon geklingelt und der Diensthabende ihm von der toten Frau und dem neben ihr liegenden Hund berichtet hatte, war ihm klar gewesen, dass er sich ein langes Rätselraten sparen konnte. Die Frau war weder bei einem Unfall, noch durch Selbstmord ums Leben gekommen.
Sie hatten eine Menge geschafft: Die drei Jungs, die auf die Leiche gestoßen waren, konnten nur wenig erzählen. Verdächtige Beobachtungen hatten sie schon gar nicht gemacht. In der Nähe Wohnende gab es nicht viele, weshalb diese Häuser schnell abgeklappert waren. Gebracht hatte das nach erstem Kenntnisstand auch nur wenig. Über die zwischen den Bäumen gefundenen Gegenstände und Hinterlassenschaften ließ sich überhaupt noch nichts sagen. Und Zeugen waren nicht aufzutreiben. Angeblich nicht einmal welche, die etwas Ungewöhnliches gehört haben wollten. Karsten Schwinka rechnete damit, dass die Spurensicherungskräfte hier wohl noch die ganze Nacht zu tun haben würden. Und vermutlich auch noch morgen. Er müsste so schnell wie möglich eine Mordkommission zusammenstellen, die auch im Bergener Revier emsig alles an Informationen zusammentragen würde, was die Ermittlungen voranbringen könnte. ›Mit Schobel allein ist die Befragung der Leute nicht zu wuppen‹, dachte er. Michael Neumann und Steffen Dorvitz hatten für Mordermittlungen nicht die nötige Ausbildung, weshalb sie nur zum Teil für eine Informationsgewinnung eingesetzt werden konnten. Sicher, Von-Haus-zu-Haus-Befragungen könnten sie erledigen, aber Neumann wollte Schwinka noch nicht an seiner Seite wissen. Und Dorvitz konnte er nach dieser kurzen Zeit nicht einschätzen. Zu unscheinbar, aber ein gut funktionierender Büropolizist, der mit Computer und Telefon rasend schnell Hintergrundinfos beschaffte. Schirner gefiel ihm. Das war ein gewiefter Polizist. Als Erkennungsdienstleiter konnte man ihn jedoch nicht ins Ermittlerteam berufen. Aber wie wäre es mit dieser Chupaski? Nicht nur Schirner war des Lobes voll. Ein vierter Mann würde sich schon noch finden. Und wenn nicht – drei gingen auch.
»Meine Fresse«, riss Schobel ihn aus seinen Gedanken, »der Buschfunk funktioniert in Trent perfekt. Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile jeder weiß, dass diese Krista Schildt tot aufgefunden wurde. Und alle wissen ganz genau, dass ein Mord geschehen ist …«
»Lass mich raten!«, unterbrach Schwinka. »Theorien zum Mörder liefern sie auch alle gleich mit.«
»Ja, so sieht es aus. Die meisten sind der Ansicht, dass Touristen schuld daran sind. Oder zumindest Leute vom Festland.« Schobel schmunzelte.
»Wie viele Leute habt ihr schon befragt?«, fragte Schwinka.
»Müssten jetzt 17 sein«, sagte Schobel.
»Personen oder Haushalte?«
»Sowohl als auch.«
»Irgendetwas dabei, das ich mir sofort anschauen sollte?«
»Eher nicht. Ich finde die Aussagen alle sehr schwammig. Es ist tatsächlich so, dass niemand etwas sah, hörte oder merkwürdig fand.«
»Nun gut, stell dich darauf ein, dass wir das gesamte Dorf durchwühlen werden«, sagte der Oberkommissar. »Ich lass mir das rechte Bein amputieren, wenn sich hier tatsächlich niemand finden lässt, der nicht etwas mitbekommen hat. Dafür ist Trent zum einen zu klein, zum anderen sind das hier alles keine Entfernungen. Da hört man das Kläffen von Hunden bis ins letzte Gehöft.« Wie zur Bestätigung erklang von weit her aus östlicher Richtung das Bellen eines Hundes. Karsten Schwinka hob die rechte Hand und streckte den Zeigefinger aus. Die beiden Kripomänner grinsten sich an.
Rangordnung klar
Michael Neumann gehörte per Anweisung zur Mordkommission für die Ermittlungen im Fall Schildt. Zwar fand er die eiligen Schlüsse von Oberkommissar Schwinka wieder einmal sehr verfrüht, aber er würde sich hüten, diesbezüglich auf die Dienstvorschriften hinzuweisen. Denn bis man tatsächlich sagen konnte, ob jemand ermordet worden ist, mussten alle Umstände vor Ort abgeklärt werden. Aber bei dem Herrn Schwinka genügte offensichtlich ein toter Dackel, um die halbe Kriminalpolizeiinspektion in Unruhe zu versetzen. Jedenfalls würde er die Klappe halten. Wenn Schwinka meinte, es sei ein Mord geschehen, dann war das wohl auch so.
Wieder kam Neumann in den Sinn, dass ausgerechnet mit Karsten Schwinkas Ankunft auf Rügen unentwegt Menschen starben. In den Jahren zuvor galt die Insel als beschauliches Dienstgebiet. Obwohl, zur Ferienhochsaison konnten die Parkplatzunfälle mit geringen Blechschäden schon nerven. Auch ruhestörender Lärm nahm in den Sommermonaten zu, oder Jugendliche bekamen sich in Diskotheken und auf Partys in die Haare. Aber Morde? Extrem selten. Michael Neumann befasste sich derzeit mit der Untersuchung von ein paar Ladendiebstählen, wofür es bereits zwei Verdächtige gab. Steffen Dorvitz, mit dem er sich ein Büro teilte und der ihm gegenüber an seinem Computer saß, arbeitete momentan offenbar als ganz persönlicher Ermittler des Chefs. Zumindest sah Neumann das so. »Wie kommst du mit deinem Brandanschlag voran?«, fragte er seinen Kollegen wie beiläufig. Das tat er jeden zweiten Tag, weshalb es vermutlich gar nicht mehr beiläufig wirkte.
»Du weißt doch, dass so was extrem schwierig zu ermitteln ist«, entgegnete Dorvitz höflich.
»Der Schwinka wird sauer sein, wenn du ihm nicht Hinweise auf einen möglichen Täter lieferst«, entgegnete Neumann mit Ironie in der Stimme.
»Ich kann ja keinen herzaubern«, sagte Dorvitz kleinlaut.
In dem Büro war die Rangordnung klar. Michael Neumann, kräftig gebaut, breiter Kopf, schmale Lippen, Bürstenfrisur, laut und Kommissar. Steffen Dorvitz, schmächtig, nervös, flackernde Augen, zurückhaltend und Obermeister. Seit Neumanns kurzzeitiger Suspendierung hatte sich zwischen den beiden Polizisten aber durchaus einiges verändert. Dorvitz benahm sich vorsichtiger. Er stieg nicht mehr bereitwillig in jedes Thema ein. Besonders, wenn es um Karsten Schwinka ging, beließ es Dorvitz meist bei Banalitäten. Als die Ermittlungen zu den Störtebeker-Morden begonnen hatten, sah das alles noch anders aus. Da werteten sie jeden scheinbaren Misserfolg des Neuen feixend aus und schmiedeten Pläne für die Zeit, wenn man den Oberkommissar wieder abziehen würde.
Das lief nicht mehr. Dorvitz wollte nicht bedingungslos auf das Pferd Neumann setzen. Vielleicht würde der es ja schaffen, den Neuen wegzuekeln – im Moment sah es danach aber nicht aus. Also kniete sich der Obermeister ganz in seine Ermittlungen zum abgefackelten Wagen des Bergener Kripo-Chefs. Die Indizienlage war dünn, Beweise gab es praktisch keine. Allerdings schien sich der Verdacht, es könnten Leute aus dem Umfeld der Störtebeker Festspiele gewesen sein, nicht zu erhärten.
Da öffnete Danilo Schobel die Tür und rief durch den Spalt: »Außerordentliche Dienstversammlung. Kommt, geht los!«
Kurz vorm Fall ins Koma
Ein verlorener Tag. Im Büro war heute mehr geredet als gearbeitet worden. Deshalb war schon gegen 16 Uhr Feierabend. Schlimm! Und immer wieder wollten die Kollegen von ihm etwas zu der Toten in seinem Dorf wissen. Horst Schuster widerte das an. Und als Traber und Kauz, die beiden anderen Ingenieure, anfingen, ihn wegen seiner Teilnahmslosigkeit aufzuziehen, hätte er sie am liebsten … Ach was, Blödsinn. Jeder denkt mal so was.
Horst zögerte, als er die Tür seines Wagens öffnete. Kurz verharrte er – dann klappte er sie wieder ran. Die Gedanken, nach Hause zu fahren, seine Frau zu sehen, ihre eindringliche Stimme zu hören und seinem Sohn zu begegnen, widerten ihn gerade genauso an, wie es seine Kollegen zuvor taten.
Horst ging die Hauptstraße entlang bis zur Gabelung Stubbenkammerstraße und nahm den Weg hinauf in den Wald. Hier ging es vorbei an der St.-Johannis-Kirche weiter in einen dichten Baumbestand hinein. Durchschnaufen, von Bäumen umgeben sein, nichts hören. Horst nahm die Anhöhe leicht. So sportlich war er noch, dass ihm das keine Mühe bereitete. Die Luft war inmitten des Grüns angenehm. Nicht kühl, aber längst nicht so drückend warm wie unterm wolkenlosen Himmel. Er hörte Schritte, leise nur. Sie waren noch weit weg. Da lief jemand den Waldweg hinab. Schon konnte er weiter oben Bewegung erkennen. Eine Frau. Sie war jung, schlank, sportlich, verschwitzt. Nun hörte er ihren