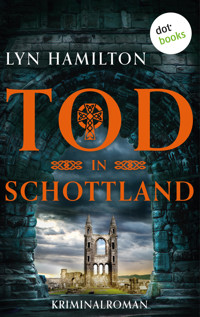4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Antiquitätenhändlerin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kann sie diesen Auftrag lebend überstehen? Der packende Kriminalroman »Todesklage in Italien« von Lyn Hamilton jetzt als eBook bei dotbooks. Eine tödliche Schatzsuche ... Ein neuer Auftrag führt die Antiquitätenhändlerin Lara McClintoch ins wunderschöne Italien – hier soll sie für einen exzentrischen Milliardär eine seltene etruskische Skulptur beschaffen. Doch der Zauber von Rom und der Toskana ist jäh gebrochen, als auf einmal einer ihrer Kontakte tot aufgefunden wird. Schlimmer noch: Jemand scheint sie auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Aber wer will verhindern, dass sie die etruskische Skulptur findet ... und wie groß ist die Gefahr, in der sie schwebt? »Hamilton serviert in ihrem gut recherchierten Krimi ihre gewohnt ansprechende Mischung aus Kunst und Mord.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Kriminalroman »Todesklage in Italien« von Lyn Hamilton ist der fünfte Band der Lara-McClintoch-Reihe; alle Romane können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine tödliche Schatzsuche ... Ein neuer Auftrag führt die Antiquitätenhändlerin Lara McClintoch ins wunderschöne Italien – hier soll sie für einen exzentrischen Milliardär eine seltene etruskische Skulptur beschaffen. Doch der Zauber von Rom und der Toskana ist jäh gebrochen, als auf einmal einer ihrer Kontakte tot aufgefunden wird. Schlimmer noch: Jemand scheint sie auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Aber wer will verhindern, dass sie die etruskische Skulptur findet ... und wie groß ist die Gefahr, in der sie schwebt?
»Hamilton serviert in ihrem gut recherchierten Krimi ihre gewohnt ansprechende Mischung aus Kunst und Mord.« Publishers Weekly
Über die Autorin:
Lyn Hamilton (1944–2009) wuchs in Etobicoke, Toronto auf und studierte Anthropologie, Psychologie und Englisch an der University of Toronto. Obwohl sie hauptberuflich in der Öffentlichkeitsarbeit tätig war, galt ihre Leidenschaft der Mythologie und Anthropologie. Ein Urlaub in Yucatán inspirierte sie dazu, ihren ersten Kriminalroman »Die Toten von Mexiko« zu schreiben.
Die Website der Autorin: www.lynhamiltonmysteries.com
Bei dotbooks erscheinen von Lyn Hamilton folgende Romane:
»Die Toten von Mexiko«
»Todesfurcht auf Malta«
»Totentanz in Peru«
»Ein Mord in Irland«
»Todesklage in Italien«
»Tod in Schottland«
***
eBook-Neuausgabe September 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2002 unter dem Originaltitel »The Etruscan Chimera« bei The Berkley Publishing Group, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Das etruskische Grabmal« bei Weltbild.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2002 by Lyn Hamilton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Marek Tr, Hoika Mikhail, ermess, Stafan ZZ
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-254-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Todesklage in Italien« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lyn Hamilton
Todesklage in Italien
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Christa Hohendahl
dotbooks.
PROLOG
Der Mann wischte sich den Schweiß von der Stirn und seufzte. Bei den Göttern, hier an den Brennöfen war es heiß. Er träumte von einem Ort auf den Anhöhen, wo die Zypressen im Wind säuselten, oder vom Meer, das hier in Velc fast nah genug war, um es sehen zu können ‒ von der höchsten Baumspitze aus ‒, doch nicht nah genug, als dass eine Brise sein Gesicht erfrischt hätte.
Das Gefäß hatte er mit Sorgfalt ausgewählt. Er hatte mehrere geprüft, ihr Gewicht und ihre Ausgewogenheit abgeschätzt, indem er eine gießende Handbewegung machte, und seine Finger über die Oberfläche gleiten lassen, um unebene Stellen im Ton zu ertasten, die seine Arbeit beim letzten Brennvorgang zerstören würden. Dieses hier war perfekt.
Auch über das Motiv hatte er lange und intensiv nachgedacht. Darüber, wie er den heroischen Kampf am besten im Bild festhalten sollte, den tödlichen Kampf zwischen zwei kühnen Gegnern, und darüber, wie er die schwarzen Figuren vor dem roten Hintergrund auf der leicht gewölbten Oberfläche am wirkungsvollsten anordnen sollte.
Die Wahl des Gegenstandes war einfach gewesen. Er hatte zum ersten Mal einige Griechen, die sich in seiner Werkstatt abrackerten, davon erzählen gehört. Es war die Lieblingsgeschichte seines Sohnes gewesen, diejenige, die der Junge allabendlich vor dem Einschlafen hatte hören wollen. Auch heute noch, viele Jahre später, konnte er sie auswendig vortragen, fast ohne nachzudenken. Die Geschichte von Proitos, dem König von Argos, der ein Komplott gegen den tapferen und schönen Bellerophon schmiedete, weil Proitos’ Frau, die hübsche, aber hinterlistige Antea, deren Avancen von dem edlen Bellerophon abgewiesen worden waren, ihrem Gatten schreckliche Lügen erzählt hatte. Der erzürnte Proitos schickte Bellerophon mit einer versiegelten Nachricht nach Lykien. Darin wies er den lykischen König an, dass Bellerophon sterben sollte. Dieser stellte dem jungen Helden die schier unlösbare Aufgabe, die gefürchtete Chimäre zu töten, ein scheußliches Wesen mit dem Haupt eines Löwen, einem zischenden Schwanz mit Schlangenkopf und dem Kopf einer Ziege dazwischen. Es spie Feuer und versengte mit jedem Atemzug den lykischen Boden.
Bellerophon, geführt von den Göttern und unterstützt von dem geflügelten Pegasus, hatte triumphiert. Er war über das Ungeheuer geflogen und hatte einen Pfeil aus Blei im Rachen der furchtbaren Bestie versenkt. Der feurige Atem der Kreatur schmolz das Metall, und ihre Eingeweide verbrannten. Das Wesen starb unter Höllenqualen.
Der Mann nahm seine Werkzeuge auf und machte sich nach kurzem Zögern an die Gestaltung der Oberfläche. Dieses Gefäß hier stellte er nicht für die Werkstatt her, nicht für die wohlhabenden Familien, die seine Arbeiten für die Grabmäler ihrer Lieben erwarben. Es würde nicht verkäuflich sein. Es würde sein Meisterstück werden.
ERSTER TEIL:DIE ZIEGE
KAPITEL 1
Rom
Als die Zellentür zuschlug, kam mir der Gedanke, dass der Weg zur Hölle weder mit guten Vorsätzen gepflastert ist noch aus einem einzigen brutalen und mörderischen Akt besteht, wenngleich auch das vorkommt. Nein, der Weg dorthin ist eine Folge von kleinen Entscheidungen, von kaum wahrnehmbaren Rissen im moralischen Gefüge, die, alle zusammen betrachtet, im Laufe der Zeit wie Wassertropfen auf Stein unser Gespür für Richtig und Falsch aushöhlen.
In meinem Fall begann die Reise mit einer Bestie, die unmöglich gelebt, aber noch weniger menschliche Gestalt angenommen haben konnte; außerdem mit einem Mann, von dem einige immer noch behaupten, er habe nie existiert. Die Kreatur war eine Chimäre, die Art von Ungeheuer, die in unserem Unterbewusstsein lauert und von dort auftaucht, um uns im Schlaf zu quälen. Der Mann hieß Crawford Lake.
Lake war einer jener Menschen, deren Name stets mit zwei zusätzlichen Attributen genannt wird, genau wie bei ehemaligen Präsidenten und Hollywood-Legenden.
In Lakes Fall lauteten diese Worte »öffentlichkeitsscheuer Milliardär«.
Die Erläuterung des zweiten Charakteristikums möchte ich den Finanzanalysten überlassen, die kürzlich in eine Art Fressrausch verfielen angesichts des Kadavers von Lakes einst so mächtigem Imperium, einem fast schon krakenartigen Konglomerat mit Fangarmen, die sich weit in die sogenannte Weltwirtschaft hineingedrängt hatten. Ich kann mich jedoch mit einer gewissen Berechtigung zu der ersten Eigenschaft äußern und jedem, der es wissen möchte, versichern, dass »öffentlichkeitsscheu« den Mann nur ansatzweise beschreibt.
Als ich ihn zum ersten Mal in seiner Wohnung in Rom traf, hatte sich Crawford Lake tatsächlich seit mindestens fünfzehn Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen. Die Medien beschränkten sich darauf, Fotos zu zeigen, die ‒ ich schwöre es ‒ von denselben Leuten aufgenommen worden waren, die behaupten, Bigfoot und das Ungeheuer von Loch Ness gesehen zu haben: unscharfe Schnappschüsse einer schemenhaften Gestalt, die in der Ferne verschwindet, oder ‒ falls man nicht bereit war, die Preise zu zahlen, die die Paparazzi für diese Bilder verlangten, so fragwürdig sie auch sein mochten ‒ Lakes Porträt aus dem Jahrbuch seiner Schule. Schon in jenen Tagen seiner Jugend zeigte Lake die Tendenz, sich zu verstecken; aber möglicherweise waren die zerzausten Haare, die seine Augen fast vollständig verbargen, in den Sechzigerjahren auch lediglich ein modisches Statement. Warum er ein Leben im Verborgenen vorzog, wusste ich zu der Zeit noch nicht, aber ich nahm an, dass jeder, der so reich war wie er, auch so gesellschaftsfeindlich sein konnte, wie es ihm gefiel.
Meiner Ansicht nach trieb er es jedoch zu weit.
»Das ist doch sicher nicht notwendig«, sagte ich zu meinem Begleiter, als er mir ein Zeichen gab, mich umzudrehen, damit er mir ein dunkles Tuch über die Augen binden konnte.
»Nein, wahrscheinlich nicht«, erwiderte er und lächelte nicht mich, sondern sein eigenes Spiegelbild im Rückspiegel des Wagens an. Er war ein attraktiver junger Mann, und das wusste er auch. Er hatte perfekte Zähne, braune Haut und dunkle Augen, er trug einen Anzug und ein Hemd aus zerknittertem Leinen, und an seiner Brust blitzte eine Goldkette ‒ einer jener italienischen Männer, die sich für unwiderstehlich halten und der Auffassung sind, alle Frauen auf der ganzen Welt sollten dies ebenfalls tun. »Allerdings«, fügte er hinzu, während er das Tuch über meine Augen legte, »müsste ich Sie töten, wenn Sie wüssten, wo mein Arbeitgeber lebt.«
Mir war nicht ganz klar, ob er scherzte. Sobald das Tuch befestigt war, klopfte er an die Glasscheibe zwischen uns und dem Fahrer, und die Limousine setzte sich in Bewegung. Mein Hotel befand sich in einer Seitenstraße am oberen Ende der Spanischen Treppe, und ich versuchte herauszufinden, wohin wir fuhren ‒ was sollte ich sonst tun, während ich mit verbundenen Augen dasaß? Nachdem wir im dichten Verkehr diverse Male abgebogen waren, angehalten hatten und wieder losgefahren waren, gab ich es jedoch auf. Nach ungefähr zehn Minuten blieb der Wagen stehen, und ich wurde mehrere Stufen hinaufgeführt, anschließend in einen Fahrstuhl verfrachtet, der langsam nach oben ratterte, dann ein paar weitere Stufen hinaufdirigiert. Als sich eine Tür hinter mir geschlossen hatte, wurde die Augenbinde entfernt.
Ich stand in einem Raum, der kaum zu beschreiben ist, da er so viele Dinge enthielt, die man bestaunen konnte. Vor den großen Fenstern hingen schwere, dunkelgrüne Vorhänge, die so angebracht waren, dass ich nicht nach draußen blicken konnte und deshalb keinerlei Anhaltspunkte hatte, wo ich mich befand. Ganz oben an den Fenstern ließen sie jedoch einen hellen Sonnenstrahl in das Zimmer dringen. Ich sah ein ziemliches Durcheinander an Möbeln, von denen die meisten kunstvoll verziert, aber recht abgenutzt waren, und fast jeder Zentimeter des Raumes, die Wände, die Tische, sogar der Boden, war mit Kunstgegenständen bedeckt. Am auffälligsten waren zwei große Fresken, die an einigen Stellen verblasst waren und ländliche italienische Motive darstellten ‒ neunzehntes Jahrhundert, würde ich sagen. Mehrere Dutzend goldene Cupidos waren über den ganzen Raum verteilt, und auf dem Boden und auf jedem Tisch lagen Massen von alten Büchern, wunderbare Exemplare mit Ledereinbänden und geprägten goldenen Lettern auf den Buchrücken. Auf einigen dieser Stapel standen kleine Skulpturen, die meisten aus Bronze. Auf einem Couchtisch waren Unmengen von Gefäßen gruppiert ‒ Vasen in Schwarz und Rot, möglicherweise griechisch, aber vielleicht auch etruskisch, und einige waren aus dem polierten schwarzen Material, das Bucchero genannt wird ‒ sowie ein paar sehr schöne Marmorbüsten von bedeutenden römischen Bürgern.
Es war fast wie in einem Museum. Mit nur einem Blick konnte ich griechische, römische und etruskische Objekte ausmachen, Figuren aus Meißener Porzellan, etwas, das wie ein Steinkopf aus Kambodscha aussah, auf den wenigen Zentimetern der Wand, die nicht mit Fresken bedeckt waren, mehrere Ölgemälde, Barockspiegel, ein Holzpferd ‒ vermutlich spätes achtzehntes Jahrhundert ‒ und nicht ein oder zwei, sondern gleich drei Kronleuchter, und zwar nicht aus Murano-Glas, wie man es in diesem Teil der Welt erwarten könnte, sondern vielmehr aus Kristall, wahrscheinlich böhmisch, aus dem achtzehnten Jahrhundert.
Zwei Dinge überraschten mich an dem Raum. Erstens war er einfach zu voll. Und ich bin wirklich kein Ordnungsfreak. Wie jeder bestätigen wird, der mein Antiquitätengeschäft oder mein Haus gesehen hat, lautet mein Einrichtungscredo eindeutig nicht »Weniger ist mehr«. Ich mag ein gewisses Maß an Durcheinander, verschiedene Objekte und Stilrichtungen, die sich gegenseitig ausspielen. Dies hier war jedoch zu viel des Guten, das Zusammentreffen zwanghafter Sammelwut mit unerschöpflichem Reichtum.
Zweitens würde man das meiste davon in meiner Branche eher herablassend als »Krempel« bezeichnen. Das heißt, dass keine wirklich ausgefallenen Stücke dabei waren ‒ mit »ausgefallen« meinen wir für gewöhnlich »atemberaubend teuer«. Über dem Kaminsims hing ein Gemälde, bei dem es sich offensichtlich um eine Kopie handelte ‒ das Original war wohlbekannt und befand sich in einem Museum. Die anderen Objekte waren echt, aber es gab nur wenige, die wesentlich mehr als fünfundzwanzigtausend Dollar gekostet haben konnten, und nicht eines, das mehr als fünfundsiebzigtausend Dollar wert gewesen wäre. Ich hätte mich glücklich geschätzt, wenn ich irgendetwas aus dem Zimmer an Lake verkauft hätte, aber es gab nichts, was auf die finanziellen Mittel hindeutete, über die ein Mann wie Lake verfügte, oder auf den Kunstliebhaber, der Lake meines Wissens nach war. In den Zeitschriften für Kunstsammler sorgte er regelmäßig für Schlagzeilen, und er war offensichtlich bereit, für etwas, das er haben wollte, Millionen zu zahlen, wenn es nötig war. Dieser Ort hier ließ das nicht erkennen.
Während ich mich bemühte, alles in mich aufzunehmen, betrat ein gut aussehender Mann von etwa fünfzig Jahren den Raum. Er hatte einen wohlgeformten Kopf mit dunklem, grau meliertem Haar und die Art von perfekter Sonnenbräune, die einen an Sonnenstudios oder ausgedehnte Aufenthalte auf einer privaten Jacht denken lässt. Ich suchte vergeblich nach Spuren des eher scheuen jungen Mannes auf dem Jahrbuchfoto. Offenbar war Lakes Selbstbewusstsein in den letzten dreißig Jahren rasant gewachsen. Ein jährliches Nettoeinkommen von sechs Milliarden Dollar ist in dieser Hinsicht offenbar sehr hilfreich. Zudem wirkte er für einen Mann, der in den Sechzigern volljährig geworden war, relativ jung, doch das führte ich ebenfalls auf die Tatsache zurück, dass er die nötigen finanziellen Mittel besaß, um gut auf sich achtzugeben.
»Lara McClintoch«, begrüßte er mich und reichte mir die Hand. Er stand genau unter dem einfallenden Sonnenstrahl, was ihn mit einer Art Heiligenschein versah. Das amüsierte mich. »Ich bin Crawford Lake. Danke, dass Sie gekommen sind. Bitte entschuldigen Sie das ganze Theater und dass ich Sie warten ließ. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Leider erachte ich eine solche Geheimhaltung für notwendig. Ich habe mich gerade um geschäftliche Dinge gekümmert, als Sie ankamen, und da ich so selten hier in Rom bin, musste ich das zuerst erledigen. Möchten Sie einen Tee? Oder vielleicht etwas Stärkeres?«
»Tee wäre großartig«, antwortete ich und dachte insgeheim, dass der Umstand, dass Lake die Wohnung so selten nutzte, sowohl die Ansammlung von Kunstgegenständen erklärte als auch die recht stickige Luft, die in dem Raum herrschte. Er betätigte eine Klingel, und sogleich erschien ein Dienstmädchen, als hätte es sich in der Diele aufgehalten und nur auf die Aufforderung gewartet.
»Tee bitte, Anna«, sagte er. »Und etwas von Ihrem herrlichen Zitronenkuchen.«
»Sofort, Mr Lake«, erwiderte die Frau und senkte leicht den Kopf, als würde sie sich vor einem niederen Mitglied der königlichen Familie verbeugen.
»Nun, was denken Sie?«, fragte er und machte eine ausladende Armbewegung. »Entdecken Sie irgendetwas, das Ihnen gefällt?«
»Die Alabastervasen sind exquisit«, antwortete ich vorsichtig.
»Vierzehntes Jahrhundert«, sagte er. »Nicht sehr alt, aber doch hübsch, nicht wahr? Was halten Sie von den Gemälden?«
»Die Fresken sind eindrucksvoll«, erwiderte ich. »Ich habe gerade das Ölbild über dem Kaminsims bewundert«, fügte ich hinzu und wählte sorgfältig meine Worte. »Ich frage mich, wo ich das Original gesehen habe. Im Louvre vielleicht?« Es hatte mich in der Tat überrascht, zwischen all diesen ungewöhnlichen Kunstgegenständen eine offensichtliche Kopie zu sehen, und ich wollte, dass Lake wusste, dass ich eine Kopie sofort erkannte.
Er runzelte die Stirn. »Dies ist das Original«, sagte er. »Aber in gewisser Hinsicht haben Sie recht. Die Kopie hängt im Louvre.«
»Oh«, war alles, was ich herausbrachte. Zu meiner großen Erleichterung wurde nun der Tee hereingebracht, in einem fantastischen silbernen Teeservice, außerdem, wie versprochen, Zitronenkuchenstücke auf einer Platte aus Sevres-Porzellan.
Eine Weile lang betrieben wir ein wenig Small Talk, wobei er auf etliche Gegenstände in dem Raum hinwies und mir erzählte, wie er sie erworben hatte, während ich anerkennende Laute von mir gab. Ich wusste, dass Lake ursprünglich aus Südafrika stammte, aber er hatte einen Akzent, der, glaube ich, »mid-Atlantic« genannt wird, ein irgendwo zwischen dem Britischen und dem Amerikanischen zu verortender Tonfall, den er sich hart erarbeitet haben musste. Tatsächlich war alles an ihm sehr gepflegt, was mich durchaus beruhigte, da ich in der letzten Nacht schlaflose Stunden damit verbracht hatte, mir eine Kreuzung aus einem Einsiedlertypen wie Howard Hughes ‒ mit Haarmähne und langen Zehennägeln ‒ und irgendeinem krankhaft schüchternen Computerfreak vorzustellen.
»Nun zum Geschäft«, sagte er schließlich, während er sich kurz bemühte, einen freien Platz zu finden, an dem er seine Teetasse abstellen konnte. »Sie fragen sich zweifellos, warum ich Sie hierhergebeten habe.«
Ich nickte. Selbstverständlich war ich entzückt über die Einladung, aber der Grund dafür war mir schleierhaft.
»Sie sollen für mich etwas erwerben«, sagte er. »Ein Kunstwerk. Etwas sehr Altes, von jemandem in Frankreich. Natürlich bekommen Sie eine Provision, und ich werde alle anfallenden Kosten tragen. Können Sie das übernehmen?« »Sie schmeicheln mir mit Ihrer Anfrage«, antwortete ich vorsichtig. »Aber, verzeihen Sie mir, dass ich so direkt bin, warum gerade ich? Warum schicken Sie nicht einen von Ihren Angestellten?«
»Die haben keine Ahnung von Antiquitäten«, erwiderte er mit einer herablassenden Handbewegung. »Sie dagegen schon, sagte man mir.«
»Dann Mondragon«, beharrte ich und verwies auf einen sehr bekannten Kunsthändler. »Er kauft doch oft etwas für Sie, nicht wahr? Außerdem kennt er sich ziemlich gut mit Antiquitäten aus.«
Lake wirkte ungeduldig. »Sie verstehen sicher, dass der Preis stets in die Höhe schießt, wenn mein Name mit einer bedeutenden Erwerbung in Verbindung gebracht wird«, sagte er langsam. »Weit über den wahren Wert hinaus.«
»Der Apollo«, sagte ich.
»Der Apollo«, pflichtete er mir bei. »Aplu oder Apulu nannten ihn die Etrusker. Bedauerlicherweise war es in diesem Fall so. Ich sehe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, Ms McClintoch.«
Ganz recht, ich hatte meine Hausaufgaben gemacht, auch wenn seine Bemerkung möglicherweise ein klein wenig herablassend war. Nicht dass es schwierig gewesen wäre, Nachforschungen über Lake anzustellen. Seine finanziellen Eskapaden tauchten regelmäßig in nahezu jeder erwähnenswerten Zeitung auf, genau wie einige fast schon aggressiv zu nennende Kunstkäufe. Es stand außer Frage, dass er sehr reich war. Doch er konnte nicht alles kaufen. Er war hinter einer zweitausenddreihundert Jahre alten Apollo-Statue her gewesen ‒ ein traumhaftes Stück, etruskisch, wie er eben angedeutet hatte ‒ und hatte gegen einen Sammler aus Texas verloren, der wahrscheinlich nicht die gleichen Geldmittel wie Lake besaß, sich jedoch als geschickt darin erwiesen hatte, ihn bei dieser speziellen Gelegenheit zu überbieten. Davor war Lake jährlich in fast jedem Kunstmagazinranking der hundert wichtigsten Sammler aufgetaucht. Nach der Geschichte mit dem Apollo schien er jedoch von anderen überholt worden zu sein.
»Er war nicht halb so viel wert, wie Mariani dafür gezahlt hat«, sagte Lake und erwähnte damit den stolzen Besitzer des Apollo. »Ich bin immer noch enttäuscht. Nachdem Sie den Fall selbst erwähnt haben, werden Sie sicher verstehen, dass ich meine recht beneidenswerte finanzielle Position nicht dadurch erreicht habe, dass ich mehr für einen Gegenstand zahle, als er wert ist, auch nicht, wenn er so wunderschön wie diese Statue ist. Um das Objekt zu kaufen, das ich haben möchte, brauche ich jemanden, der in keinster Weise mit mir in Verbindung gebracht wird.«
»Und um welches handelt es sich?«
»Darüber sprechen wir gleich.«
»Sie haben mir erklärt, warum Sie mit jemand Neuem Geschäfte machen möchten, aber noch nicht, warum Sie ausgerechnet mich ausgesucht haben.«
Er zuckte unmerklich mit den Achseln. »Ich stelle Nachforschungen an. Sie haben gerade demonstriert, dass Sie das ebenfalls tun. Man sagte mir, Sie würden sich auskennen und wären ehrlich und hartnäckig, wenn nicht sogar dickköpfig. Hartnäckigkeit bewundere ich. Es ist eine Eigenschaft, die wir möglicherweise gemeinsam haben. Darüber hinaus ‒ und ich hoffe, ich beleidige Sie nicht, wenn ich das sage ‒ ist Ihr Geschäft international nicht sehr bekannt. McClintoch & Swain ist nicht« ‒ er zögerte ‒ »die Art von Unternehmen, mit der ich normalerweise Geschäfte machen würde.«
Ich konnte ihm kaum widersprechen, da ich halbwegs sicher war, dass McClintoch & Swain, der Laden, den ich zusammen mit meinem Exmann Clive Swain besitze, außerhalb eines Umkreises von zwei Häuserblocks ziemlich unbekannt ist, und erst recht international.
»Wissen Sie, was eine Chimäre ist?«, fragte er mich unvermittelt.
»Eine mythologische Gestalt, nicht wahr? Ein Teil Löwe, ein Teil Schlange, und ein Teil irgendeines anderen Tieres.«
»Ziege.« Er nickte.
»Ziege«, stimmte ich zu.
»Sie enttäuschen mich nicht, Ms McClintoch«, sagte Lake. »Sie hätten antworten können, es wäre eine Bezeichnung, die von Naturwissenschaftlern für jegliche Art von Zwittern benutzt wird, Pflanze oder Tier, oder Sie hätten sagen können, es wäre der Name für ein Wesen, das seine Erscheinungsform beliebig zu verändern vermag. Aber Sie haben die richtige Beschreibung gewählt, soweit es unseren Gegenstand betrifft. Kennen Sie denn die Chimäre von Arezzo?«
»Sie meinen die bronzene Chimäre im archäologischen Museum von Florenz? Diejenige, die man in Arezzo in der Toskana gefunden hat?«
»Genau«, sagte er, griff nach einem großen Umschlag, der auf dem Tisch neben ihm lag, und zeigte mir eine Fotografie. »Ist sie nicht hübsch? Bronze, spätes fünftes oder frühes viertes Jahrhundert vor Christus. Eins der wirklich bedeutenden Stücke etruskischer Kunst. Wir verdanken ihre Entdeckung Cosimo de Medici. Er betrachtete sich selbst gern als Archäologen. Man sagt, er hätte die Funde selbst gesäubert, eine mühsame Arbeit. Er fand die Chimäre im Jahr 1553, und später, im Jahr 1566, den Arringatore, den Redner, beide etruskisch. Ich vermute, er widmete sich dieser Arbeit, weil er sie liebte. Aber sie kam auch seinen politischen Zielen gelegen. Sein Nachfolger wurde zum Dux Magnus Etruscus ernannt, zum großen etruskischen Führer. Wussten Sie das? Es genügte nicht, dass Cosimo im Jahr 1569 zum Großherzog der Toskana ernannt worden war. Wirklich dumm, diese Geschichte mit dem Dux Magnus Etruscus, wenn man bedenkt, dass die Etrusker mehr als zweitausend Jahre zuvor von den Römern besiegt worden waren, aber ich nehme an, es sagt etwas über die Macht aus, die die glorreiche Vergangenheit über uns hat. Ein zauberhaftes Kunstwerk, nicht wahr? Achten Sie auf die Kraft, die in dem Löwenkopf und den Lenden steckt, die Bedrohung, die von dem Schlangenschwanz ausgeht, und das störrische Wesen der Ziege, das so klar herausgearbeitet ist.«
Es war keine Frage, die Chimäre von Arezzo war wirklich ein Glanzstück etruskischer Bronzekunst. Es war ein Tier mit dem Haupt und dem Leib eines Löwen, einem Ziegenkopf und einem gebogenen Schwanz, der in einem Schlangenkopf endete. Dieser blickte sich um, als wollte er die Ziege beißen.
Interessant war jedoch, dass Lake so ausführlich über Cosimo de Medici sprach. Genau wie die Familie der Medici hatte Lake sein Vermögen im Bankgeschäft gemacht ‒ zunächst hatte er konventionelle Finanzdienstleistungen angeboten, dann wandte er sich frühzeitig dem Internetbanking zu ‒, und mit Cosimo teilte er sowohl das Streben nach einem Imperium als auch eine recht rücksichtslose Art, mit seinen Gegnern umzugehen. Während Cosimo alle Rivalen aus seiner Stadt Florenz vertrieben und die Nachbarstadt Siena annektiert hatte, indem er seine Feinde enthaupten oder in finstere Kerker einsperren ließ, hatte Lake mehrere feindliche Übernahmen von Konkurrenzunternehmen in die Wege geleitet und damit Erfolg gehabt.
Lake, der wahrscheinlich ein Fan von allen italienischen Dingen war, hatte sein Unternehmen Marzocco genannt, nach dem Wappentier von Florenz, einem Löwen. Es wird erzählt, dass man früher von den besiegten Feinden der Stadt verlangte, das Hinterteil einer Löwenstatue zu küssen, und das kam dem relativ nahe, was jeder, der mit Lake in Konflikt geriet, am Ende tun musste.
Auf der anderen Seite waren sowohl Lake als auch de Medici, obwohl fast fünfhundert Jahre zwischen ihnen lagen, bedeutende Kunstmäzene. Es war schwer einzuschätzen, wo dieses Gespräch über Kunst und Imperien enden würde. Die Chimäre von Arezzo wurde auf keinen Fall zum Verkauf angeboten, und ich hoffte inbrünstig, dass er nicht glaubte, ich würde ins archäologische Museum von Florenz einbrechen, um sie für ihn zu stehlen.
»Sie ist so naturgetreu, finden Sie nicht?«, sagte er nachdenklich. »Auch wenn sie niemals wirklich existieren könnte. Ich meine, schauen Sie doch mal. Sieht es nicht so aus, als würde sie gleich irgendetwas angreifen, wie bei einem tödlichen Kampf?«
»Irgendetwas oder irgendjemanden«, pflichtete ich ihm bei. »War nicht Bellerophon der Held, der die Chimäre tötete?«
»Brava«, sagte er. »Auch in diesem Fall werden Sie Ihrem Ruf gerecht, Ms McClintoch. Es war tatsächlich Bellerophon. Die Ilias von Homer, sechstes Buch. Das Ungeheuer, eine entsetzliche feuerspeiende Bestie, soll in Lykien in Kleinasien gelebt haben, und ja, die Chimäre ‒ ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie viele der Monster aus der antiken Mythologie weiblich waren? ‒ wurde schließlich von dem Helden, Bellerophon, getötet. Ein persischer heiliger Georg gewissermaßen. Ich nehme an, die Chimäre könnte die frühe Version einer Drachenlegende darstellen. Erinnern Sie sich, wie Bellerophon diese äußerst entmutigende Aufgabe bewältigte, die seine Feinde ihm gestellt hatten?«
»Flog er nicht auf einem geflügelten Pferd über das Ungeheuer und schoss einen Pfeil ab mit irgendeinem Pfropfen darauf, der durch den Atem der Chimäre schmolz? So etwas in der Art jedenfalls.«
»Das ist richtig. Ich sehe schon, Sie kennen sich in der Mythologie genauso gut aus wie mit Antiquitäten. Bellerophon erhielt das geflügelte Pferd Pegasus von dessen Vater Poseidon, dem Meeresgott, und setzte damit über die Chimäre. Er steckte einen Bleipfropfen auf die Spitze seines Pfeiles und schoss ihn in ihren Rachen. Das Blei schmolz, versengte die Eingeweide der Chimäre und tötete sie. Sie starb unter Höllenqualen. Ziemlich genial, finden Sie nicht auch?«
»Zweifellos«, antwortete ich. Irgendetwas an seinem Tonfall beunruhigte mich, die hämische Freude, mit der er die Erzählung wiedergab, und dass er die Tatsache betonte, die Chimäre sei weiblich. Konnte es sein, dass der Milliardär eine frauenfeindliche Ader hatte? »Das ist ja alles sehr interessant, Mr Lake, aber ich weiß immer noch nicht, was Sie von mir wollen.«
»Nun, Bellerophon natürlich«, sagte er, während er ein zweites Foto vor mich hinlegte. Es zeigte ein sich aufbäumendes geflügeltes Pferd mit einem Mann auf dem Rücken, der im Begriff war, einen Pfeil abzuschießen. Das Foto war nicht so scharf wie das erste, eher ein Schnappschuss als eine professionelle Aufnahme, aber ich konnte erkennen, dass es sich um eine beeindruckende Skulptur handelte. Lake legte die beiden Fotos aneinander, und es sah tatsächlich so aus, als würde die Chimäre von Arezzo das aufsteigende Pferd mit dem Reiter anfauchen.
»Wie sieht es mit den Größenverhältnissen aus?«, fragte ich. »Nach diesen Fotografien kann ich es nicht beurteilen.«
»Perfekt«, erwiderte er. »Die Chimäre von Arezzo ist nur etwa achtzig Zentimeter hoch, relativ klein für eine solche Skulptur eigentlich. Der Bellerophon ist ungefähr zwei Meter groß. Er überragt sie.«
»Ich erinnere mich an keinen Hinweis, dass es zu der Chimäre eine Bellerophon-Statue gab«, sagte ich etwas unsicher, aber ich spürte, dass sich langsam Erregung in mir ausbreitete.
»An dieser Stelle wird es interessant«, sagte Lake. »Ich habe die Stadtarchive von Arezzo auf den Zeitraum von 1550 bis 1560 hin durchforstet«, fügte er hinzu und hielt dann abrupt inne, als hätte er sich versprochen. »Korrekterweise sollte ich besser sagen, dass ich die Archive durchforsten ließ. Es gibt einen Hinweis auf eine große Bronzefigur wie die Chimäre, die am 15. November 1553 außerhalb der Stadttore entdeckt wurde. Später wurde noch der Vermerk hinzugefügt, dass der Schwanz fehlte.
Giorgio Vasari ‒ Cosimo de Medici war sein Mäzen, und Vasari hielt viele seiner Taten schriftlich fest ‒ schrieb im Jahr 1568, dass sie 1554 gefunden wurde, ein Jahr später als die Archivaufzeichnungen sagen. Er erwähnt den fehlenden Schwanz ebenfalls. Manche behaupten, Benvenuto Cellini habe den Schwanz ersetzt, aber ich bezweifle, dass das stimmt. Cellini war ein Künstler, der von den de Medicis unterstützt wurde. Jedenfalls interessiere ich mich nicht für die Chimäre, sondern für den Bellerophon. Meiner Ansicht nach sind die Anhaltspunkte dafür, dass in Arezzo mehr als nur eine große Bronzefigur entdeckt wurde, ausreichend, und angesichts der Überlieferung und dieses Fotos halte ich es für recht wahrscheinlich, dass ich sie ausfindig gemacht habe. Diese Figur will ich haben, Ms McClintoch, und ich möchte, dass Sie sie für mich beschaffen. Fühlen Sie sich der Herausforderung gewachsen?«
»Nun, ich … was würden Sie damit tun, sobald Sie sie besäßen, Mr Lake?«, fragte ich.
»Was ich damit tun würde? Oh, ich verstehe, was Sie meinen. Ich habe die Absicht, sie dem Museum in Florenz zu übergeben. Die Chimäre ist für sich genommen, auch wenn es sich um eine großartige Arbeit handelt, nicht besonders beeindruckend, darin stimmen wir sicher überein. Im Grunde ist das wohl eine Frage der Dimensionen. Aber zusammen, also mit dem Bellerophon ‒ wie es ja ursprünglich auch gedacht war ‒, werden die beiden Stücke eine erstaunliche Wirkung haben. Sie verdienen es, zusammen zu sein.« »Das ist eine sehr großzügige Geste, Mr Lake«, sagte ich. Derartiges war bei Lake schon mehrmals vorgekommen. Ich erinnerte mich, dass er im Laufe der Jahre mehrere erstklassige Antiquitäten an diverse Museen gestiftet hatte, aber ich war dennoch auf der Hut.
»Ja und nein«, erwiderte er mit einem ziemlich entwaffnenden Lächeln. »Um ehrlich zu sein, plane ich hier in Europa gerade einen neuen Hightech-Fonds und hätte gern ein paar Positiv-Schlagzeilen. Etwas, was die Leute überrascht und aufhorchen lässt und sie natürlich auch zum Kauf veranlasst. Den Bellerophon zu finden und ihn dann dem archäologischen Museum zu überlassen wäre eine gute Möglichkeit, das zu erreichen. Wohlhabender Philanthrop verbringt zehn Jahre damit, den vermissten Bellerophon aufzuspüren, kauft ein Kunstwerk für Italien, und so weiter und so fort. Ein paar Tage später gründe ich dann den Fonds. Das Ganze ist natürlich nicht vollkommen uneigennützig, aber die Sache ist es wert, da stimmen Sie mir hoffentlich zu.« Er sprach mit der Autorität eines Mannes, der erwartet, dass ihm alle zustimmen, und wie ich zu meiner Überraschung feststellte, tat auch ich es. Spielte es eine Rolle, welches seine Motive waren? Entscheidend war, dass der Bellerophon wieder mit der Chimäre vereint würde und jeder die Gelegenheit bekäme, sie zu bewundern.
»Ich frage Sie noch einmal: Glauben Sie, dass Sie der Herausforderung gewachsen sind?«, wiederholte er. »Ich werde Sie bezahlen, und zwar gut. Sie erhalten eine Provision für den Kauf ‒ wie viel, können wir noch besprechen ‒, und ich übernehme all Ihre Ausgaben. Ich habe mir die Freiheit genommen, für Sie ein Konto in der Schweiz zu eröffnen, ein Onlinekonto, natürlich bei meiner Bank, und wenn Sie einverstanden sind, werden zehntausend US-Dollar darauf überwiesen, um Ihre Kosten zu decken. Also«, sagte er und nannte einen Provisionssatz, »wäre das Ihre Zeit wert?«
Genau genommen habe ich noch nie darüber nachgedacht, wie viel meine Zeit wert ist, da ich glaube, dass es mich nur deprimieren würde, den relativ armseligen Gewinn, den McClintoch & Swain von Zeit zu Zeit erzielt, durch die Anzahl der Stunden zu teilen, die ich in die Arbeit stecke. Obwohl ich es vorziehe, im Allgemeinen nicht über Geld zu sprechen und besonders nicht über meine Provision, will ich dennoch verraten, dass der Betrag auf jeden Fall höher war als derjenige, den meine Arbeitszeit normalerweise einbringt.
Trotzdem zögerte ich, und er, der arme Mann, hielt das für ein Anzeichen dafür, dass der Betrag zu niedrig war. »Wenn Sie den Verkaufspreis unter zwei Millionen halten können, erhöhe ich Ihre Provision um einen weiteren Prozentpunkt. Unter anderthalb Millionen, noch einen zusätzlichen.«
»Das ist sicher ausreichend, Mr Lake«, antwortete ich im neutralsten Tonfall, zu dem ich imstande war. In Wahrheit schlug mir das Herz bis zum Hals. Auch wenn niemand jemals erfahren würde, dass ich Lakes Einkäuferin gewesen war, würde ich damit eine Ebene der Kunstwelt betreten, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie je zu Gesicht bekommen würde. Und dazu noch für einen guten Zweck: die Chimäre mit dem verschollenen Helden zu vereinen.
»Gut«, sagte er und reichte mir ein Blatt Papier. »Noch etwas?«
»Was ist, wenn ich den Bellerophon nicht bekomme, aus welchem Grund auch immer?«
»Ich belohne den Erfolg und nicht das Scheitern, Ms McClintoch. Aber ich versuche, fair zu sein. Die zehntausend, die ich auf Ihr Konto überweise, müssten Ihre Auslagen bei weitem decken; sie sind nicht zurückzahlbar, egal wie viel oder wie wenig Sie davon ausgeben. Ist das zufriedenstellend?« Ich nickte.
»Also, hier sind die Kontonummer und das Passwort. Ich schlage vor, Sie merken sich beides und werfen den Zettel dann weg.«
Ich blickte auf das Papier. Die Bank hieß Marzocco Financial Online, und die Kontonummer lautete 14M24S ‒ one for the money and two for the show. Das Passwort war ebenfalls einfach. Es lautete »Chimäre«. Ich zerriss das Blatt und reichte Lake die Papierfetzen. »Ich habe es im Kopf«, sagte ich. »Nun, wer hat also den Bellerophon?«
»Ich glaube, und ich weiß es aus ziemlich guter Quelle«, begann er, »dass er in den Händen eines französischen Sammlers namens Robert Godard ist. Ich habe den Mann nie kennengelernt, aber er hat ihn vermutlich schon seit mehreren Jahren. Möglicherweise ist er sogar schon seit ein oder zwei Generationen im Besitz seiner Familie. Ich bin nicht sicher, ob Godard weiß, was er da besitzt, die fehlende Hälfte der Arezzo-Bronzefiguren, meine ich. Allerdings bin ich überzeugt davon, dass er weiß, dass es ein kostbares Stück ist. Schließlich ist er ein Sammler, aber vielleicht hat er sozusagen noch nicht zwei und zwei zusammengezählt. Wahrscheinlich glaubt er, dass er eine recht ungewöhnliche Reiterstatue besitzt. Mir wäre es recht, wenn es dabei bliebe. Es würde den Preis niedrig halten.«
Ich nickte. »Ich bin selbst nicht vollkommen sicher, ob die zwei Stücke zusammengehören«, fuhr Lake fort, »aber ich glaube es, und wenn wir sie nebeneinander sehen, wird es ersichtlich werden.«
»Sie sagen, Godard besitze die Figur schon lange. Weshalb glauben Sie, dass er sie jetzt verkaufen wird?«
»Nach meinen Informationsquellen ist er bereit zu verkaufen. finanzielle Notlage‹ ist wohl der Begriff, der einem sofort in den Sinn kommt.« Er musste mir irgendetwas angesehen haben. »Ich hörte, Sie hätten einen etwas misstrauischen Charakter«, sagte er.
Mit wem, fragte ich mich, hat er über mich gesprochen? Ich würde mich selbst nicht als misstrauisch bezeichnen, lediglich als vorsichtig und skeptisch, das ist alles ‒ eine Einstellung, die ich als gesund bezeichnen würde in einer Branche, an der mitunter Menschen mit niederen Motiven Gefallen finden. Die Redewendung caveat emptor ‒ Käufer, sei wachsam ‒ ist in unserem Fach ein nützlicher Leitsatz, den man sich merken sollte. Was ich sagen will, ist, dass es im Antiquitätenhandel von Fälschungen nur so wimmelt. Und ich glaube behaupten zu können, dass ich noch nicht sehr häufig hereingelegt worden bin.
»Ich habe nichts mit seiner momentanen Situation zu tun, das versichere ich Ihnen«, sagte Lake. »Das hat er sich selbst eingebrockt. Ich hoffe lediglich, davon zu profitieren. Godard ist ein Sammler, der nicht weiß, wann er aufhören muss. Ich dagegen weiß das.« Er sah sich einen Augenblick lang im Zimmer um, betrachtete das Durcheinander von Kunstgegenständen und erlaubte sich anschließend ein kurzes Lachen. »Obwohl ich gestehen muss, dass das auf den ersten Blick möglicherweise nicht erkennbar ist.« Ich lachte ebenfalls. Eigentlich mochte ich den Mann.
»Wissen Sie, wo ich ihn finden kann?«
»Die beste Möglichkeit, ihn zu kontaktieren, ist über einen Händler, ein Freiberufler ‒ er betreibt keinen Laden ‒ namens Yves Boucher. Sie können sich mit Boucher in Paris treffen. Antonio wird Ihnen seine Nummer geben«, fügte er hinzu. Ich vermutete, dass Antonio der ziemlich hübsche junge Mann war, der mich zum Haus begleitet hatte. »Ich schlage vor, dass Sie sofort nach Paris fahren, schon morgen früh, wenn möglich. Von Antonio werden Sie die nötigen Mittel erhalten, mit denen Sie Ihre Unkosten decken können, bis das Geld überwiesen ist. Es wird heute Abend auf dem Konto sein. Das können Sie irgendwann morgen prüfen. Antonio wird Ihnen auch eine Telefonnummer geben, unter der man ihn erreichen kann. Er wird unser Kontaktmann sein. Wenn Sie sich mit Boucher und Godard in Verbindung gesetzt haben und eine ungefähre Vorstellung von der Preisklasse haben, können Sie Antonio anrufen. Sobald wir uns über den Preis geeinigt haben, überweise ich das Geld auf Ihr Konto. Sie verstehen doch, dass ich nicht möchte, dass mein Name auf irgendeine Weise mit der Sache in Verbindung gebracht wird?«
»Ja«, antwortete ich. »Sie haben mein Wort, dass Ihr Name nirgends erwähnt wird.«
»Danke«, sagte er. »Und Sie haben mein Wort in dieser ganzen Angelegenheit.« Ich hatte bereits gehört, dass Lake einer jener Menschen war, die Geschäfte über mehrere Millionen lediglich mit einem Handschlag besiegeln. Ich beschloss, dass, wenn es für ihn ausreichte, es auch für mich genügte. Der Himmel weiß, dass ich schon mehrmals die Gelegenheit hatte festzustellen, wie wertlos Unterzeichnete Verträge sein konnten.
»Die Banküberweisungen müssen Sie selbst organisieren«, fuhr er fort. »Alles wird auf Ihren Namen laufen. Aber ich werde sicherstellen, dass das Geld da ist. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Möglicherweise müssen Sie etwas anzahlen. Lassen Sie es Antonio einfach wissen. Nun muss ich wieder zurück an die Arbeit, auch wenn dies hier wesentlich interessanter ist, und ich fürchte, Sie müssen noch einmal diese theatralische Geschichte mit der Augenbinde über sich ergehen lassen. Ich entschuldige mich dafür«, sagte er, während er seine Hand ausstreckte und gewinnend lächelte. »Anna wird Sie zur Tür begleiten.«
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich noch Ihre Toilette benutze, bevor ich gehe?«, fragte ich und versuchte, einen verlegenen Gesichtsausdruck aufzusetzen. »Der ganze Tee …«
»Aber natürlich«, erwiderte er. »Wie gedankenlos von mir. Anna wird Ihnen den Weg zeigen.«
Er klingelte nach dem Dienstmädchen. »Ich werde ihn übrigens bekommen«, sagte er, während wir auf Annas Ankunft warteten.
»Den Bellerophon? Natürlich«, entgegnete ich.
»Den Bellerophon, ja. Aber ich meinte den Apollo. Mariani ist in finanziellen Schwierigkeiten. Ich gebe zu, dass ich in diesem Fall meine Hand im Spiel hatte. Er wird ihn bald verkaufen müssen, für wesentlich weniger, als er dafür gezahlt hat, und zu einem Preis, der näher an seinen tatsächlichen Wert herankommt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich werde zur Stelle sein.« Sein Tonfall war sanft, aber ich hegte keinen Zweifel bezüglich der skrupellosen Denkweise, die dahintersteckte. Ich stellte fest, dass ich ein wenig Mitleid mit Mariani hatte und dass ich etwas besorgt in Hinsicht auf meine eigenen Geschäfte mit Lake war. Ich glaubte nicht, dass er für ein Scheitern meinerseits Verständnis haben würde. Mir kam ebenfalls in den Sinn, dass Lake, zumindest soweit es um etruskische Skulpturen ging, wohl wie Cosimo de Medici den Titel des Dux Magnus Etruscus für sich anstrebte.
Das Gefühl dauerte jedoch nur einen kurzen Moment an. »Es war mir ein Vergnügen, Ms McClintoch«, sagte er. »Ich freue mich, dass wir miteinander ins Geschäft kommen.« Er schenkte mir ein weiteres reizendes Lächeln, und ich musste trotz meiner Bedenken, die ich ein paar flüchtige Sekunden lang gehabt hatte, feststellen, dass ich hoffte, unsere Geschäftsbeziehungen würden lange anhalten und für beide Seiten lohnenswert sein. Er nickte in meine Richtung und verschwand dann in die Diele.
Anna begleitete mich nicht nur einen recht düsteren Korridor entlang, dessen Zimmer zu beiden Seiten neugierigen Blicken wie dem meinen verschlossen waren, sondern wartete auch draußen vor der Tür. Das Fenster des Raumes bestand unten aus Milchglas, oben jedoch nicht, und so stellte ich mich so schnell und leise, wie ich konnte, auf den Toilettensitz und spähte hinaus. Ich blickte auf einen spektakulären Dachgarten mit blühenden Hängepflanzen und Stauden und einem kleinen Tisch mit zwei Stühlen. Hinten in einer Ecke stand das alles beherrschende Element, eine lebensgroße Statue von Michelangelos David. Ich musste lächeln. Ich war sicher, dass Lake, wenn ich ihn darauf angesprochen hätte ‒ was ich angesichts meiner Schnüffelei natürlich nicht tun konnte ‒, mir erzählen würde, der David in der Accademia von Florenz wäre eine Kopie und derjenige auf seinem Dach das Original. Als ich meinen Hals reckte, konnte ich unten auf der Straße mehrere Café-Sonnenschirme sehen und auf dem Sims eines hohen Gebäudes die Buchstaben FECIT. Ich wusste fast mit vollkommener Sicherheit, wo ich mich befand.
Ich kletterte vorsichtig hinunter, betätigte für Anna die Toilettenspülung, ließ das Wasser laufen und öffnete anschließend die Tür. Es war Zeit, aus meinem Hotel auszuchecken und nach Paris zu fahren, um die Spur von Bellerophon aufzunehmen.
KAPITEL 2
Paris
Ich bin kein unehrlicher Mensch und ‒ auch wenn die späteren Ereignisse einen dazu verleiten könnten, etwas anderes zu denken ‒ auch keine Närrin. Ich bin lange genug in diesem Geschäft, um zu wissen, dass man sehr achtsam sein muss, wenn man mit Antiquitäten handelt. Da ich bei Gelegenheiten, die zu verlockend wirken, um wahr zu sein, generell misstrauisch werde, tätigte ich am nächsten Morgen als Erstes einen Anruf bei den Zollbehörden in Frankreich und Italien und ging danach ins Internet, um die diversen Datenbanken, in denen gestohlene Kunstwerke aufgeführt werden, zu überprüfen. Ich fand weder Hinweise auf eine vermisste Bronzestatue eines Bellerophon noch irgendetwas, das ihr auch nur im Entferntesten ähnelte. Anschließend tat ich mich auf den Internetseiten mehrerer bedeutender Auktionshäuser um. Immer noch nichts. Zufrieden prüfte ich mein neues Bankkonto, wirklich das bestgefüllte, über das ich jemals verfügt hatte. Lake hatte Wort gehalten und dafür gesorgt, dass zehntausend Dollar darauf überwiesen worden waren.
Ich war nicht überrascht. Über Lakes Skrupellosigkeit und seinen Tatendrang hatte ich eine Menge gehört, ebenso über sein nur zu offensichtliches Streben, bei allem, was er in Angriff nahm, Erfolg zu haben. Ich hatte jedoch noch nie sagen hören, dass er in irgendeiner Weise als unehrenhaft bezeichnet wurde. Im Gegenteil, sogar seine Rivalen bestätigten widerwillig seine Integrität.
Nachdem das alles zu meiner Zufriedenheit geregelt war, rief ich Clive an und erzählte ihm, dass ich die Bauernmöbel und die Keramik aus der Toskana bekommen hatte, die wir für das kleine Landhaus brauchten, das wir nördlich von Toronto einrichteten, und dass ich einen kurzen Abstecher nach Paris machen würde, um die Flohmärkte nach alten Weißwaren und Ähnlichem zu durchstöbern.
Ich spielte mit der Idee, Clive die Wahrheit zu sagen, nämlich dass wir einen Auftrag von keinem Geringeren als Crawford Lake bekommen hatten, aber ich hatte mein Wort gegeben und war einigermaßen sicher, dass Lake es auf keinen Fall gutheißen würde, wenn ich Clive ins Vertrauen zog. Obwohl ich allen, die danach fragen, jederzeit bereitwillig von seinen vielen Fehlern erzähle ‒ manchmal auch denjenigen, die nicht fragen ‒, muss ich doch einräumen, dass Clive unermüdlich für unser Geschäft wirbt. Dabei erwähnt er gern den einen oder anderen bedeutenden Namen, da er der Auffassung ist, je berühmter unsere Auftraggeber wären, desto bekannter würden auch wir. Ich glaubte nicht, dass er sich zurückhalten könnte, wenn er wüsste, dass wir jetzt einen Milliardär auf unserer Kundenliste hatten.
»Irgendein Typ hat angerufen«, sagte Clive. »Antonio oder so ähnlich. Ich glaube, er arbeitet für D’Amato«, fügte er hinzu. D’Amato war unser italienischer Spediteur. »Offenbar wussten sie den Namen deines Hotels in Rom nicht mehr.«
Auf diese Weise hatte Lake mich also aufgespürt. Ich hatte mich bereits gewundert, wenn auch nicht besonders lange. Ich nahm an, dass jeder, der die finanziellen Mittel von Lake zur Verfügung hatte, so ziemlich alles tun konnte, was ihm gerade in den Sinn kam. Ich war nicht nach Italien geflogen, um ihn zu treffen; ganz im Gegenteil eigentlich. Ich befand mich auf meiner jährlichen Einkaufsreise in Europa, um ein paar Möbel für den Laden aufzutreiben.
Die Toskana war derzeit besonders gefragt ‒ Sie wissen schon: leicht abgenutzte Holzmöbel, Fliesenböden, grob verputzte ockerfarbene Wände, transparente Vorhänge, die bei der leichtesten Brise hin- und herwehen, etwas in der Art ‒, und wir waren gebeten worden, ein Haus auf dem Land und eines in der Stadt im toskanischen Stil einzurichten. Das hört sich einfach an, ist es aber nicht. Man muss auf die Details achten und braucht ein paar wirklich gute Stücke. Mit ihnen steht und fällt alles. Clive ist der Inneneinrichter, ich bin die Antiquitätenexpertin. Er entwickelt die Ideen, und ich versuche alles Nötige aufzutreiben, um sie zu verwirklichen. In vielerlei Hinsicht stellen wir ein merkwürdiges Team dar ‒ jedes geschiedene Paar, das zusammen ein Geschäft betreibt, ist merkwürdig, würde ich sagen ‒, aber wir sind ziemlich effektiv. Neben den Einkäufen für die toskanischen Häuser hatte ich einen Kunden, der immer an italienischen Antiquitäten interessiert war, egal was ich auftreiben konnte. Genau wie Lake sammelte er so gut wie alles Italienische, insbesondere venezianisches Glas aus dem achtzehnten Jahrhundert. Daher war ich nach Venedig geflogen, durch Florenz und Siena geschlendert und schließlich nach Rom gefahren.
»Hat er dich erreicht?«, fragte Clive.
»Ja«, antwortete ich. »Alles erledigt.«
»Gut«, sagte er. »Na dann, mach dir eine schöne Zeit, wenn du in Paris bist. Setz dich in die Sonne, in ein Café am Seine-Ufer, und beobachte die Passanten. Warum bleibst du nicht eine ganze Woche? Wir können es uns leisten.«
»Hast du während meiner Abwesenheit etwa wieder den Laden umgeräumt?«, fragte ich misstrauisch. Normalerweise will Clive, dass ich sofort zurückeile und ihm im Geschäft helfe.
»Nein, das habe ich nicht«, erwiderte er gekränkt. »Du solltest nicht immer das Schlechteste von mir denken, Lara. Mir ist nur aufgefallen, dass du in letzter Zeit müde aussahst. Alex und ich kommen noch ein paar Tage zurecht«, fügte er hinzu. Alex Stewart ist ein Nachbar und Freund, der im Laden aushilft. Zumindest wenn Alex da war, brauchte ich mir keine Sorgen zu machen, denn ich wusste, dass er nicht zulassen würde, dass Clive etwas allzu Schreckliches tat. Und, wie Clive betont hatte, auch wenn er nicht wusste, wie sehr er recht hatte: Wir konnten es uns tatsächlich leisten. Lakes Vorschuss würde meine Paris-Reise problemlos finanzieren, und wenn ich den Bellerophon bekommen konnte, würde ich mit einem neuen Online-Bankkonto und jeder Menge Geld nach Hause kommen.
»Das ist nett, Clive«, sagte ich in versöhnlichem Tonfall. »Ich glaube, ich nehme dich beim Wort. Ich lasse dich wissen, in welchem Hotel ich übernachte, falls dir noch etwas einfällt, was wir aus Paris brauchen könnten.«
Wie Lake betont hatte, mache ich stets meine Hausaufgaben. In erster Linie betrachte ich mich als Möbelexpertin, obwohl ich in der Branche, in der ich tätig bin, über viele Dinge Bescheid wissen muss. Bei Qualitätsurteilen verlasse ich mich vor allem auf meine jahrelange Erfahrung und eine Art sechsten Sinn, den man im Laufe der Zeit erwirbt. Ich konnte nicht eben behaupten, eine Expertin für etruskische Antiquitäten zu sein, aber ich wusste, an welchen Orten und wonach ich suchen musste. Zuerst fuhr ich zur Villa Guilia in Rom, einer der führenden etruskischen Kunstsammlungen, und sah mir alles, was dort ausgestellt wurde, sehr genau an. Unterwegs kaufte ich einen Stapel Bücher, die man mir zu dem Thema empfohlen hatte, mehrere über etruskische Kunst, ein weiteres über die Etrusker selbst, eine archäologische Studie, und schließlich, nur zum Spaß, ein Buch von D. H. Lawrence mit dem Titel »Etruskische Stätten«, eine Sammlung von Berichten über die Reisen zu etruskischen Schauplätzen, die der Autor in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts unternommen hatte.
Was ich interessant fand, war, wie viel und andererseits doch wenig wir über die Etrusker wissen, beziehungsweise über die Menschen, die wir heute als Etrusker kennen. Dass sie sich selbst jemals so bezeichneten, ist unwahrscheinlich. Der Name stammt von den Römern, die ihre Nachbarn, gelegentliche Verbündete und am Ende unnachgiebige Feinde, Tusci oder Etrusci nannten. Bei den Griechen hießen sie Tyrrhenoi ‒ daher kommt auch der Begriff »Tyrrhenisches Meer«. Die Etrusker bezeichneten sich selbst als Rasenna oder Rasna.
Ihre Sprache ist recht ungewöhnlich, anders als fast alle anderen europäischen Sprachen. Sie geht nicht auf indogermanische Wurzeln zurück, wurde aber weitgehend entschlüsselt, doch genau genommen gibt es außer Inschriften auf Grabmälern und Derartigem nur sehr wenige Quellen. Möglicherweise hatten sie eine umfangreiche eigene Dichtung, mit Sicherheit sogar, aber sie ist uns nicht erhalten geblieben, sodass alles, was wir über dieses Volk wissen, aus der Archäologie oder aus den Aufzeichnungen anderer stammt: von den Griechen und Römern zum Beispiel, in deren Darstellungen sich ihre eigenen Vorurteile widerspiegeln. Zudem müssen die Etrusker ein komplexes rituelles und religiöses Leben geführt haben, da wir wissen, dass die römischen Bürger, lange nachdem die etruskischen Städte unter die Herrschaft Roms gefallen waren, bei wichtigen Überlegungen und Entscheidungen immer noch die Hilfe etruskischer Haruspexe ‒ Wahrsager ‒ in Anspruch nahmen. Die Anzahl und die künstlerische Qualität ihrer Grabmäler weisen darauf hin, dass es eine Sozialstruktur gab, an deren Spitze eine wohlhabende Elite stand, aber auch darauf, dass sie an ein Leben nach dem Tod glaubten. Wie genau ihr Glaube jedoch beschaffen war, bleibt im Nebel der Zeit verborgen.
Wir wissen allerdings, dass Menschen, die eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Religion und dieselben Bräuche hatten, etwa von 700 v. Chr. bis zu ihrer Niederlage und Einverleibung durch die Römer im dritten Jahrhundert v. Chr. einen großen Teil von Mittelitalien beherrschten: die heutige Toskana ‒ schon das Wort lässt die etruskischen Wurzeln erkennen ‒, einen Teil von Umbrien und das nördliche Latium in der Nähe von Rom. Ihr Territorium wurde im Süden und Osten im Wesentlichen vom Fluss Tiber und im Norden vom Arno begrenzt. Im Westen lag das Tyrrhenische Meer. Sie lebten in Städten und nutzten die reichhaltigen Metallvorkommen entlang der tyrrhenischen Küste, um über Land und See ausgedehnten Handel zu betreiben. Mit der Zeit entstand ein lockeres Bündnis von zwölf Städten, die Dodekapolis. Die herrschende Elite dieser Städte, eigentlich regelrechte Stadtstaaten, traf sich jährlich an einem Ort namens Volsinii, um einen Führer zu wählen.
Während ihrer Blütezeit, vor der Entstehung der Römischen Republik, regierten in Rom etruskische Könige, die Tarquinier, die zwischen 616 und 509 v. Chr. wesentlich dazu beitrugen, die Stadt aufzubauen, die sie schließlich besiegen würde. Der letzte dieser Könige war Tarquinius der Stolze, der 509 v. Chr. aus Rom vertrieben wurde. Von dieser Zeit an waren Rom und die Etrusker Feinde und kämpften um jeden Zentimeter ihres Gebietes.
Am Ende konnte das etruskische Bündnis der römischen Macht nicht standhalten. Die Stadtstaaten schlossen sich nicht zusammen, um sich zu schützen, aus welchem Grund auch immer, und einer nach dem anderen unterlag. Die Städte wurden aufgegeben und zerfielen, oder ihre Stellung wurde schlichtweg von anderen eingenommen, bis sie im Mittelalter wieder in neuem Glanz erstrahlten. Einige von ihnen gehören zu den schönsten Italiens: Orvieto, Chiusi, Cortona, Volterra, Arezzo und Perugia.