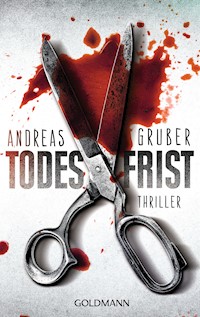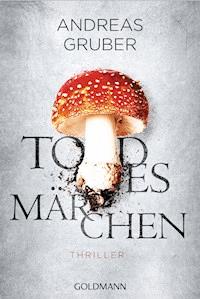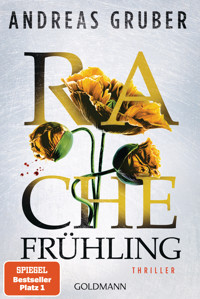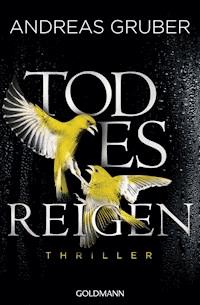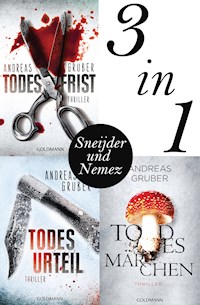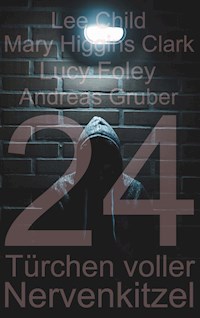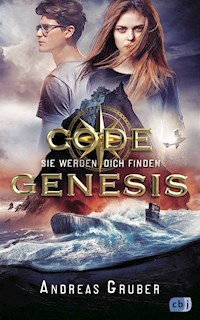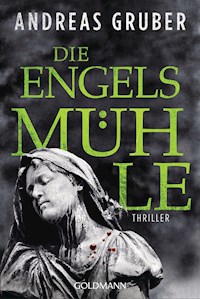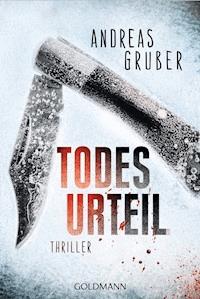11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maarten S. Sneijder und Sabine Nemez
- Sprache: Deutsch
Mitten in den brisanten Ermittlungen um einen Verräter in den eigenen Reihen werden BKA-Profiler Maarten S. Sneijder und sein Team abgezogen und nach Norwegen geschickt, um den Mord an der deutschen Botschafterin aufzuklären. Doch das Motiv bleibt rätselhaft, und die norwegische Polizei verweigert die Zusammenarbeit. Sneijder muss kreativ werden – und macht damit einen besonders mächtigen Gegner auf sich aufmerksam. Als dann noch ein erstes Mitglied von Sneijders Team einem kaltblütigen Killer zum Opfer fällt, steht Sneijder vor seiner bisher größten Herausforderung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Mitten in den brisanten Ermittlungen um einen Verräter in den eigenen Reihen werden BKA-Profiler Maarten S. Sneijder und sein Team abgezogen und nach Norwegen geschickt. Dort sollen sie den Mord an der deutschen Botschafterin Katharina von Thun aufklären. Doch das Motiv ist mehr als rätselhaft, und die norwegische Polizei verweigert die Zusammenarbeit. Sneijder steckt fest – dabei will er eigentlich nichts lieber, als schnellstmöglich nach Wiesbaden zurück.
Also muss er kreativ werden – und macht damit einen besonders mächtigen Kriminellen auf sich aufmerksam. Der scheint in den Mord an Katharina von Thun verstrickt. Ob als Auftraggeber, Mittäter oder sogar mögliches nächstes Opfer einer umfassenden Verschwörung, ist zunächst nicht auszumachen. Sneijder beschließt, sich direkt in die Höhle des Löwen zu begeben. Und lässt sich dabei auf einen Deal am Rande der Legalität ein, der am Ende nicht nur ihn selbst, sondern jedes einzelne Mitglied seines Teams das Leben kosten könnte …
Weitere Informationen zu Andreas Gruber sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Andreas Gruber
Todesschmerz
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Wilhelm Goldmann Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Ein Projekt der AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
www.ava-international.de / www.agruber.com
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Karte vom Oslofjord: © Peter Palm, Berlin
TH · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-26133-7V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Meinen Nachbarn am Römersee
Kurt und Simone Piltz
Eva und Norbert Reithofer
Eva Siebert und Jochen Eder
Gaby Horn und Wolfgang Sprung
Hisst die Piratenfahnen!
»Der Schmerz ist der große Lehrer der Menschen.«
– Marie von Ebner-Eschenbach –
PROLOG
Dienstag, 22. Mai
Die junge Frau war ganz nach seinem Geschmack. Knabenhafter Körper, kleine feste Brüste und langes schwarzes Haar. »Was für eine Ehre, Herr …«
»Keine Namen!«, unterbrach er sie. »Und nicht so förmlich.« Er musste nicht dran erinnert werden, dass er theoretisch ihr Vater hätte sein können.
»Wie du willst.« Sie lächelte verspielt, während sie aus der Bluse schlüpfte. Der Stoff glitt an ihrem Körper hinab, und sie stand nur noch in hochhackigen Schuhen und schwarzen Dessous vor ihm. Auch ihre Stimme war perfekt. Rau, lasziv, erfahren. Ungewöhnlich für eine höchstens Fünfundzwanzigjährige.
Sie sah ihn an. »Klären wir zuerst das Finanzielle?«
»Sechstausend Kronen, nicht wahr?« Er griff in die Seitentasche seines roten seidenen Morgenmantels und holte ein bereits abgezähltes Geldbündel hervor. Der Preis war okay, schließlich war sie keine Edelnutte. »Plus tausend Kronen extra für speziellen Service.«
»Danke.« Sie lächelte. »Und was machen wir?«
Er legte das Geld auf die Kommode und deutete zum Bett. »Zieh deinen Slip aus und mach es dir bequem.«
Sie steckte das Geld in ihre Handtasche, schlüpfte aus ihrem Höschen und nahm auf dem Rand des großen Himmelbetts Platz. »Soll ich …?«
Er sagte nichts, hob nur den Zeigefinger.
»Entschuldige bitte.« Sie fuhr sich mit den Fingern über die Lippen, als wollte sie einen Reißverschluss schließen. »Stimmt, mir wurde gesagt, ich soll keine Fragen stellen.«
Er atmete tief durch und ging durch das Zimmer. Am anderen Ende stand ein Flügel. Ein Steinway. Angeblich hatte Edvard Grieg irgendwann nach 1862 auf diesem Instrument komponiert. Er löste den Gürtel des Morgenmantels, öffnete ihn weit und nahm auf dem Klavierhocker Platz. Nachdem er mit den Fingern über das glänzende Holz gestrichen hatte, spielte er die schwermütige Melodie von Beethovens Schicksalssinfonie an. Wie er die satte Klangfarbe dieses Flügels liebte.
»Oh«, rief sie erstaunt. »Klingt gut. Woher kannst du …?« Sie verstummte.
»Das e2 ist verstimmt.« Er erhob sich, ging um das Instrument herum. Der Deckel stand offen, er griff in das Gehäuse hinein, werkelte darin herum und zog schließlich eine lange graue Nylonschnur heraus.
»Kann man die Saiten einfach so aus dem Klavier nehmen?«, fragte sie. »Funktioniert es dann überhaupt noch?«
Er gab keine Antwort. Während er sich das Ende der Schnur um die rechte Hand wickelte, ging er zum Fenster und schloss die Vorhänge. Nur noch mattes Licht fiel ins Schlafzimmer.
»Du magst es kuschelig«, stellte sie fest.
»Leg dich auf den Bauch«, befahl er.
»Warum denn?« Sie zog eine Schnute. »Ich finde dich wirklich sexy. Oder magst du es gern von hinten?« Lächelnd und entspannt sah sie ihn an.
»Leg dich auf den Bauch«, wiederholte er nur.
Nun blinzelte sie zur Klarsichtfolie, die über dem Laken lag. »Wozu ist die? Soll ich sie abmachen …?«, fragte sie, verstummte jedoch, als sie seinen Blick bemerkte. Rasch legte sie sich aufs Bett und rollte sich auf den Bauch. Das Plastik raschelte.
Ihr kleiner knackiger Po sah verführerisch aus. Er mochte es, wenn langes schwarzes Haar wie ein Strom aus Tinte zwischen den Schulterblättern über den Rücken floss. Ohne sich lange mit Zärtlichkeiten oder einem Vorspiel aufzuhalten, stieg er rittlings auf sie und drang in sie ein. Ihr Rücken bog sich durch. Nachdem er dreimal fest in sie gestoßen hatte, legte er ihr sanft die Nylonschnur um den Hals.
»Aber … das …«, röchelte sie.
»Keine Sorge, ich pass auf, dass deinen Haaren nichts passiert.«
Während er so fest zuzog, dass sich die Schnur tief in seine Hände grub und die Nutte sich schnaufend und verzweifelt aufzubäumen versuchte, kam er. Mit einem wohlwollenden Grunzen ergoss er sich in sie. Zuerst musste er sie wie ein Wildpferd im Zaum halten, damit sie ihn nicht abwarf, doch dann erstarb ihr Widerstand langsam. Er lockerte den Griff.
»Lass …«, röchelte sie, »… mich … bitte …«
Mit der freien Hand griff er unter das zweite, neben ihnen liegende Kopfkissen und holte ein Messer mit Elfenbeingriff und langer, krumm gebogener Klinge hervor.
»Bitte … ich …«
Er stieß ihr das Messer seitlich zwischen die Rippen bis zum Anschlag in die Lunge. Augenblicklich verstummte sie, spuckte nur noch Blut. Während er spürte, wie ihr Körper erschlaffte, und sah, wie ihre rosa Haut schlagartig an Farbe verlor, kam er ein zweites Mal. Nicht mehr so intensiv wie vorher, aber dafür hielt das Gefühl diesmal länger an.
Er beugte sich zu ihr hinunter. »Deshalb liegt die Folie auf dem Bett …«, flüsterte er ihr ins Ohr und betrachtete den dunkelroten Strom, der sich seitlich über das Laken ergoss. »… du hast übrigens recht … eine richtige Saite kann man nicht so einfach aus dem Klavier nehmen.« Aber das hörte sie nicht mehr.
Er ließ das Messer in ihr stecken und nahm nur die Angelschnur aus Nylon von ihrem Hals. So wartete er, bis die Blutung nachließ, dann löste er sich von ihr und nahm das Geldbündel aus ihrer Handtasche. Danach knotete er den Morgenmantel wieder zu und verließ das Zimmer. Er fühlte sich berauscht, als hätte er zu viel erstklassiges Gras geraucht. Gemächlich ging er über den handgeknüpften dicken Teppich durch den langen Korridor ins Wohnzimmer.
Dort kam ihm eine große, hagere Gestalt entgegen. »War alles in Ordnung?«, murmelte der Mann.
»Ja.«
»Kann ich Ylva schon wegbringen?«
Er sah ihn irritiert an. »Ylva?«
Der Mann nickte den Gang hinunter zum Schlafzimmer. »Das Mädchen.«
Nun wurde ihm bewusst, dass er sie gar nicht nach ihrem Namen gefragt hatte. »Ja, natürlich, und beseitige die Sauerei, bevor unsere Klienten eintreffen.«
Der Mann nickte. Hinter ihm betrat ein junges Dienstmädchen das Wohnzimmer. »Wünschen Sie jetzt das Frühstück einzunehmen?«
»Nicht jetzt, später. Vorher brauche ich einen Cognac.«
»Sehr wohl.« Sie verbeugte sich und verschwand.
Er ging durchs Wohnzimmer, öffnete die Balkontür und trat ins Freie. Es war kurz nach sieben Uhr früh und herrlich kalt. Nebel lag über dem Fjord, man konnte kaum das Meer sehen. Bloß die schroffen Felsen, auf denen das Haus stand, ragten aus der milchig grauen Suppe. Ein Adler kreiste über dem Wasser. Genauso fühlte er sich auch: schwerelos und frei.
Er zog den Gürtel des Mantels enger, griff in die Seitentasche, holte eine Zigarre heraus, packte sie aus dem Zellophan aus, schnitt die Spitze mit dem Cutter ab und steckte sie mit seinem goldenen Zippo an. Mehrmals paffte er und hielt den Rauch im Mund, ehe er das erste Mal genüsslich ausatmete. Dann hörte er leise Schritte hinter sich.
»Ihr Cognac.«
Ohne den Blick vom Fjord zu nehmen, streckte er den Arm aus. Das Dienstmädchen drückte ihm das Glas in die Hand. Außerdem stellte sie ein Tablett mit seinem Handy und einem speziellen Aschenbecher für Zigarren auf die Brüstung des Balkons.
»Sie hatten zuvor einen Anruf.« Mehr sagte sie nicht. Nachdem sie die Tür geschlossen hatte und er wieder allein war, nahm er einen Schluck Cognac und genoss die Wärme, die sich in seinem Magen ausbreitete.
Da läutete sein Handy. Er griff nicht hin, warf nur einen Blick auf das Display. Er kannte die Nummer.
Das deutsche BKA. Schon der dritte Anruf an diesem Morgen, wie er feststellte. Die haben schon seit einem Jahr nicht mehr hier angerufen. Muss wirklich dringend sein. Trotzdem drückte er den Anruf weg. Nicht jetzt!
Er wollte noch das Gefühl genießen, das ihn gerade durchströmte … endlich wieder halbwegs lebendig zu sein.
1. TEIL
WIESBADEN
Mittwoch, 23. Mai
Vormittag
1. Kapitel
Der Bus der Linie 8 scherte aus, nahm die enge Kurve und fuhr den Geisberg hinauf. Sabine Nemez stand in der Mitte des Fahrzeugs und hielt sich an der Deckenschlaufe fest. Noch eine halbe Stunde, dann würde ihr Vortrag an der Akademie des BKA beginnen.
Ihr gegenüber stand Marc Krüger. Seit zwei Tagen fuhren sie gemeinsam mit dem Bus. Seit Sabine ihren Wagen zu Schrott gefahren hatte, und zwar während der Verfolgung eines Verdächtigen, der dachte, er könnte durch die Wiesbadener Fußgängerzone abhauen. Marc war ihr Beifahrer gewesen und hatte ihr ins Lenkrad gegriffen. So hatten sie den flüchtenden Wagen rechtzeitig gerammt und zwischen zwei gusseisernen Parkbänken eingekeilt, bevor Schlimmeres passieren konnte. Als Folge stand Sabines Auto mindestens eine Woche lang in der Werkstatt, und da Marc noch nie einen eigenen Wagen besessen hatte, waren sie notgedrungen auf den Bus ausgewichen. Andererseits war das eine gute Abwechslung zu ihrem sonstigen Alltagstrott. Nur, dass sie heute leider beim Frühstück getrödelt hatten und sich nun sputen mussten.
Jetzt strich Sabine Marc über die Wange, wobei sie ziemlich weit nach oben greifen musste. Marc war einen guten Kopf größer als sie, was keine Kunst war bei ihren eins dreiundsechzig. Sie tätschelte seine kleine Schramme, die von dem Unfall stammte. »Armer Schatz … lässt du dir deshalb den Bart länger stehen?« Mit dem Stoppelbart, den widerspenstigen blonden Naturwellen, die ihn jünger machten, und dem weißen offenen Hemd über dem Star-Wars-T-Shirt, sah er eher wie ein klassischer Nerd aus als wie ein Abhörspezialist des BKA.
Oder ist es ein Star-Trek-T-Shirt? Er hatte ihr den Unterschied sicher schon ein Dutzend Mal erklärt, aber weil es sie nicht wirklich interessierte, konnte sie sich das nie merken. Am liebsten war ihr sowieso, wenn er bei ihr in ihrer Wohnung war und gar kein Shirt trug.
Er lächelte sie an, seine blauen Augen blitzten auf. »Bis die Schramme verheilt ist. Einwände?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sehen wir uns heute Mittag in der Kantine?«
Er senkte die Stimme. »Leider nein. Ich arbeite mit … du weißt schon wem … an einer streng geheimen Sache.«
Sie runzelte die Stirn. »Mit Sneijder?«
»Mit Maarten S. Sneijder«, korrigierte er sie.
»Mit meinem Partner? Du verarschst mich!«
»Nein, tu ich nicht«, sagte er. »Außerdem bin ich jetzt mit ihm per du.«
»Seit wann?«
»Seit Anfang dieser Woche.«
»Blödsinn! Sneijder ist mit niemandem von uns per du.«
Marc zuckte mit den Achseln. »Sneijder und ich sind beide Nerds – jeder auf seine eigene Art und Weise –, vielleicht bringt uns das einander näher.«
»Was willst du mir damit sagen? Dass ich zu normal bin?«
»Du bist eben nicht spleenig.«
»Vielleicht hat Sneijder ja auch nur Vatergefühle, wenn er dich sieht.« Sabine sah ihn skeptisch an, dann rückte sie noch etwas näher an ihn heran. »Und worum geht es bei eurer Arbeit, du Superspion?«, flüsterte sie.
Er senkte den Kopf und flüsterte ihr ins Ohr. »Ich könnte es dir verraten, aber danach müssten wir dich leider töten.«
Sie boxte ihn gegen die Schulter. »Probier das nur, Junge, aber verletz dich nicht dabei. Wenn ich dein Gedächtnis auffrischen darf, war ich es, die dir vor einem Jahr das Leben gerettet hat, als wir die Morde der Nonne aufgeklärt haben.«
»Das war reiner Eigennutz«, stellte er trocken fest.
»Ach, und warum?«
Er zögerte. »Weil du schon damals an mir interessiert warst?«
»Und wie kommst du darauf?«
»Weil …«, er räusperte sich, dachte anscheinend nach, wie er sich aus der Sache herauswinden konnte, gab sich dann aber doch einen Ruck. »… als wir in dem Hotel am Bodensee waren, hast du dich über Funk mit Tina unterhalten. Und zwar über mich.«
Sabine spürte, wie sie rot wurde. »Davon hat dir Tina erzählt?«
Er presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf.
»Was dann?«
»Ich … äh … saß im Abhörwagen, hatte alle Frequenzen freigeschaltet und dabei …« Er verstummte.
Oh, Mist! Daran hatte sie gar nicht gedacht. Nun wurde sie erst recht rot.
»Kann passieren, Anfängerfehler«, sagte er, nahm sie an der Hüfte und wollte sie an sich drücken.
»Lass mich!« Sie strampelte sich frei. »Und du hast ein Jahr lang nichts gesagt?«
»Na ja«, druckste er herum. »Eigentlich hatte ich es auch jetzt nicht sagen wollen.«
»Anfängerfehler«, konterte sie. Plötzlich wurde sie ernst und senkte erneut die Stimme. »Apropos … ist dir eigentlich aufgefallen, dass …?«
»… die zwei Typen im dunklen Anzug ständig hersehen?«
Sabine nickte. »Die sind mit uns eingestiegen und haben uns seitdem nicht aus den Augen gelassen.« Unauffällig blickte sie zum Ende des Busses, von wo aus die Kerle sie stumm beobachteten. Beide mit hartem, kantigem Gesicht, grau meliert und für die Jahreszeit untypisch braun gebrannt.
Marc zuckte mit den Achseln. »Zufall?«
»Möglich«, sagte sie, obwohl sie nicht daran glaubte.
Als der Bus an der Station Tränkweg hielt, stiegen Sabine und Marc aus. Von hier waren es nur ein paar Minuten zu Fuß. Auch die beiden Schlipsträger im Dreiteiler verließen den Bus und folgten ihnen. Seltsam, dass die keinen Dienstwagen hatten oder sich zumindest ein Taxi leisteten, so elegant wie die aussahen.
Nach einer kurzen Umarmung trennte sich Sabine von Marc. Er ging zum Haupteingang des BKA in sein Büro, und sie nahm den Weg am Pförtnerhäuschen vorbei auf das Areal der Akademie.
Mist, jetzt hatte sie ihn gar nicht gefragt, ob er tatsächlich mit Sneijder an einer geheimen Sache arbeitete oder sie wieder einmal nur verarscht hatte.
Nachdem sie die Akademie betreten und die Unterlagen aus ihrem Spind geholt hatte, brummte ihr Handy. Eine SMS von Marc.
»Die zwei Typen aus dem Bus sind im BKA«, lautete die Nachricht. »Haben sich nach Sneijder und dir erkundigt.«
2. Kapitel
Dr. Karin Ross sah mit einem absurden Gefühl des Neides der Putzfrau nach, wie diese ihr Wägelchen durch den Korridor schob, und sperrte dann ihre Bürotür im ersten Stock des BKA-Hauptgebäudes auf. Ob sie vielleicht doch einen anderen Beruf hätte ergreifen sollen? Betriebspsychologin stand unter ihrem Namen auf dem Türschild. An diesem Mittwoch hatte sie eigentlich nur einen Klienten – aber der reichte für zehn. Nun gut, Augen zu und durch. Danach würde sie endlich Zeit haben, die fünf Protokolle und Gutachten zu schreiben, die noch ausständig waren.
Sie betrat ihr Büro und prallte zurück. Es war viel zu dunkel im Raum, die Vorhänge waren zugezogen, und es roch penetrant nach Vanilletee. Dann sah sie den großen dürren Mann, der im maßgeschneiderten Anzug auf ihrem Besuchersessel saß. Ein Bein über das andere geschlagen und mit einem Feuerzeug in der Hand. »Wie sind Sie hereingekommen?«
»Die Frage meinen Sie doch nicht wirklich ernst«, erklang eine Stimme mit unverkennbarem niederländischem Akzent.
»Doch, das meine ich sehr wohl ernst.«
»Ich habe mich selbst hereingelassen. Ich dachte, ich fang schon mal an, damit es nicht so lange dauert.«
»Die halbjährlich vorgeschriebenen psychologischen Sitzungen habe nicht ich erfunden«, konterte Dr. Ross bissig, ging zum Vorhang, zog ihn zurück und riss das Fenster auf.
»Haben Sie überhaupt schon mal irgendetwas erfunden?«
»Darauf werde ich nicht antworten. Sie können nicht einfach so nach Lust und Laune hereinspazieren, auch wenn Sie der große Maarten Sneijder sind«, sagte sie.
»Maarten S. Sneijder«, korrigierte er sie.
»Oh, wie konnte ich das nur vergessen. Ja, von mir aus.« Sie warf ihre Aktenmappe auf den Schreibtisch und setzte sich Sneijder gegenüber in ihren Sessel. »Ich arbeite in diesem Büro. Ich habe hier sowohl eine Privatsphäre als auch sensible Daten, für die ich verantwortlich bin. Außerdem habe nicht ich diesen Termin vorgeschlagen, und ich habe mich an die vereinbarte Zeit gehalten …«
»Ich … ich … ich«, unterbrach er sie schroff. »Ich dachte, wir wären hier, um über mich zu sprechen?«
»Herrgott!« Sie strich sich die langen blonden Haare hinters Ohr. »Also schön …«, sie atmete tief durch, sah auf die Uhr und richtete den Kragen ihrer Bluse, »… beginnen wir und reden wir über Sie. Haben Sie den Test schon ausgefüllt?«
»Diesen Test?« Er griff in sein Sakko und zog fünf blaue zusammengeheftete Blätter heraus, die er von seinem Sessel aus achtlos auf ihren Schreibtisch warf. »Den alten Test habe ich mitentwickelt, der war viel besser. Dieser neue Test ist völliger Müll.«
»Warum ist er das Ihrer Meinung nach?«
»Weil eine Truppe junger Korinthenkacker die Abteilung übernommen hat. Die mögen zwar Psychologie studiert haben, sind aber völlig ahnungslos, was in der Psyche der Leute vorgeht.«
Aber Sie wissen das natürlich, wollte sie schon mit einem spitzen Unterton sagen, verkniff es sich jedoch. Natürlich hatte er Ahnung davon. Immerhin hatte er selbst unter anderem Medizin und Psychologie studiert, war Fallanalytiker und forensischer Kripopsychologe. »Und deshalb meinen Sie, dass Sie den verpflichtenden Test nicht machen müssen?«, hakte sie nach.
»Da sind so schwachsinnige Fragen darunter wie: Würden Sie Ihrer Frau einen Ring zum Hochzeitstag schenken?« Er rückte nach vorn an die Sesselkante, hob die Hand und streckte der Reihe nach drei Finger aus. »Erstens bin ich nicht verheiratet. Zweitens bin ich schwul. Und drittens mache ich keine Geschenke.«
»Ich finde, das sagt sehr viel über Sie aus. Beantworten Sie die Frage eben so.«
»Hören Sie mal!« Sneijder kam auf Tuchfühlung heran. »Die einzigen Ringe, mit denen ich mich beschäftige, sind Drogenringe oder Kinderpornoringe, die ich zerschlage. Für allen anderen Quatsch habe ich keine Zeit.«
Sie atmete wieder tief durch. »Fein, dann wechseln wir das Thema. Haben Sie schon die ärztliche Untersuchung und den Fitness-Test gemacht, den das BKA alle zwei Jahre vorschreibt? Soweit ich mich erinnere, liegt Ihrer schon mindestens vier Jahre zurück.«
»Seien Sie ehrlich. Sehe ich so aus, als würde ich den Test bestehen?«
Seine Haut war blass, das Gesicht hohlwangig, das Kinn spitzer als sonst. »Haben Sie Angst davor durchzufallen?«
Er gab keine Antwort.
»Na ja«, sagte sie. »Immerhin haben Sie es geschafft, diese Tür zu öffnen und sich in der Küchennische selbstständig fragwürdigen Tee zu kochen. Ist ja schon mal ein Anfang.« Sie lächelte.
Für einen Moment setzte auch Sneijder ein seltsam kaltes Lächeln auf, das sie schon öfter bei ihm gesehen hatte und das sie jedes Mal innerlich erschauern ließ. Ein Friedhofslächeln, das auch gleich wieder verschwand.
»Also gut, lassen wir die Tests, und reden wir eben so über Sie«, lenkte sie ein.
Er lehnte sich wieder zurück. »Mir geht es beschissen, danke der Nachfrage. Ich konnte in den letzten sechs Monaten zwar siebzehn völlig unwichtige Fälle lösen, aber einen nicht, den größten, und der liegt mir schwer im Magen, deswegen kiffe ich zu viel, trinke zu viel Wodka mit Tabasco, ernähre mich schlecht … eigentlich gar nicht, wenn man es genau nimmt … und schlafe hundsmiserabel. Und nein danke, Schlaftabletten nützen nichts, schon ausprobiert, und Autogenes Training, Bachblüten und Globuli aus Ihrer Psycho-Apotheke können Sie sich in Ihren Allerwertesten schieben.«
Ihr Augenlid zuckte kurz. »Wie ich diese Sitzungen mit Ihnen vermisst habe«, seufzte sie und betrachtete ihn nun genauer. Er sah tatsächlich nicht gesund aus. Die polierte Glatze und das blasse Gesicht konnten schon seit Monaten keine Sonne mehr gesehen haben. Im Gegensatz dazu wirkten die bleistiftdünnen Koteletten, die beim Ohr begannen und in einer schmalen Linie bis zum Kinn verliefen, wie der Kontrast in einem der großen Schwarz-Weiß-Gemälde ihres Vaters. »Ist es derselbe Fall wie vor einem halben Jahr, der Ihnen zu schaffen macht?«
»Darf ich hier rauchen?«
»Immer noch nicht.« Sie blickte zur Decke. Wenigstens hatte er diesmal nicht den Rauchmelder abmontiert.
»Ja, es ist derselbe Fall.«
»Wollen Sie darüber reden?«
»Selbst, wenn Sie Ihre Schweigepflicht tatsächlich ernst nähmen, dürfte ich über laufende Ermittlungen nicht reden.«
Sie neigte den Kopf. »Das würden Sie natürlich nie tun, aber wenn Sie sich ausnahmsweise mal nicht an die Vorschriften hielten?«
»Tja dann …«, er zog die Augenbrauen hoch, »… würde ich vermutlich sagen, dass wir seit genau einem Jahr ein Informationsleck im BKA haben.«
»Dann würde ich vermutlich fragen, was daran so schlimm wäre.«
»Was daran so schlimm wäre?, würde ich wiederholen«, sagte Sneijder, lehnte sich zurück und schloss die Augen. »Fänden Sie es schlimm, wenn jemand geheime interne Daten nach außen transferieren würde, wodurch BKA-Einsätze gegen das organisierte Verbrechen sabotiert würden?«
»O ja, das würde ich schlimm finden.«
»Sehen Sie, ich auch.« Er öffnete die Augen. »Bei einem dieser verpatzten Einsätze des SEK ist vor Kurzem Schönfeld gestorben, ein ehemaliger Schüler von mir an der Akademie. Seine Frau, Meixner, auch eine ehemalige Schülerin, ist jetzt alleinerziehend mit einer sechsjährigen Tochter. Ich und Marc Krüger …«
»Es heißt Marc Krüger und i…«
»Wollen Sie es nun hören oder nicht?«
»Fahren Sie fort«, seufzte sie.
»Also ich und Marc sind dem Maulwurf schon dicht auf den Fersen, trotzdem belastet mich das Thema, weil die Ursache des Lecks ein Top-Insider sein muss. Aber dafür kommt fast niemand infrage.«
»Dann ist der Kreis der Verdächtigen also schon ziemlich stark eingeschränkt?«
Er sah sie überrascht an. »In der Tat. Der Maulwurf kann nur aus der obersten Riege des BKA kommen. Beunruhigt Sie das nicht?«
»Sollte es das?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin davon überzeugt, dass Sie ihn finden werden.«
»Ich …« Sein Handy klingelte. Er ließ das Feuerzeug in der Sakkotasche verschwinden und holte stattdessen sein Telefon heraus – kaum zu übersehen in einer Hülle mit den rot-weiß-blauen Streifen der niederländischen Flagge. »Ja?«, murrte er.
Er hörte zehn Sekunden lang zu. »Danke, kein weiteres Wort mehr … ich komme sofort«, sagte er schließlich und beendete das Gespräch. Dann nippte er an seiner Tasse und erhob sich. »Ich muss zu Marc, er hat vielleicht eine neue Spur.«
»Sie verlassen die Sitzung frühzeitig?«
»Sie vergessen, dass ich schon eine halbe Stunde vor Ihnen da war. Danke für den Tee und das Gespräch.« Dann verschwand er aus dem Büro.
Sie sah ihm verdutzt nach. Er hat sich tatsächlich bei mir bedankt.
3. Kapitel
Sabine Nemez betrat mit Laptop und Unterlagen den Hörsaal III und ging zum Pult. Der Raum war bereits voll. Fünfundzwanzig Studenten der BKA-Akademie für hochbegabten Nachwuchs warteten darauf, dass sie ihre vorletzte Stunde abhielt. Obwohl die Vorlesung verpflichtend war, hatte sie auf eine Anwesenheitsliste verzichtet. Erstens wollte sie keine Zeit mit dem Abhaken von Namen verschwenden. Und zweitens würden Schwänzer das Modul sowieso nicht schaffen, da sie jedes Semester etwas anderes drannahm und es demzufolge kein Skript gab.
Sie hielt die Vorlesung nicht allein, sondern wurde dabei von einem Gastdozenten unterstützt, den Sneijder an die Akademie geholt hatte. Dass dieser noch viel mehr als sie selbst aus dem Praxis-Nähkästchen plaudern konnte, war offenbar auch ein Grund, weshalb die Vorlesung so gut besucht war.
»Guten Morgen«, sagte Sabine und ging hinter das Pult. Rudolf Horowitz, ehemaliger Profiler der Berner Kripo, war bereits da und saß in seinem vollelektronischen Rollstuhl, den ihm das deutsche BKA vor einem Jahr gekauft hatte.
»Steigen wir gleich ein. Heute geht es schwerpunktmäßig darum, dass ein BKA-Ermittler nicht erst eine Theorie aufstellt und danach die Beweise dafür sucht«, begann Sabine ihren Vortrag, »sondern zuerst die Beweise sicherstellt und danach seine Theorie aufstellt.« Sie nickte Horowitz zu. Während sie ihren Laptop an den Videobeamer ansteckte und das Bild justierte, übernahm Horowitz.
Er rollte mit seinem Gefährt hinter dem Pult hervor in die Mitte des Hörsaals. Im letzten Jahr hatte sich sein grauer Haarkranz ziemlich ausgedünnt, und auch seine Falten und Tränensäcke sorgten dafür, dass man ihm die dreiundsiebzig Jahre ansah. Allerdings hatte er einen absolut klaren Verstand und war geistig fitter als viele der Studenten, die ihn jetzt erwartungsvoll anblickten.
»Man kann nie vorhersagen, wie oder wann sich die Lösung eines Falls ergeben wird«, sprach er mit seiner knarrenden Stimme im Schweizer Dialekt in das Mikrofon, das an der Lehne seines Rollstuhls befestigt war. »Wenn Sie an einem Fall arbeiten, sind alle Daten in den Tiefen Ihres Unterbewusstseins gespeichert, wie auf der Festplatte Ihres Computers oder auf Servern in der Cloud. Und dort werden sie verarbeitet. Ihr Gehirn stellt neue Eiweißverbindungen her, verknüpft Erinnerungen mit Assoziationen. Sie müssen nur dafür sorgen, dass die Internetverbindung zu Ihrem Server nicht zusammenbricht – in unserem Beispiel also der Kontakt zu Ihrem Unterbewusstsein – und die Daten jederzeit abrufbereit sind. Ermittlungsarbeit hat viel mit mentalen Techniken zu tun. Irgendwann wird die richtige Taste gedrückt, und plötzlich kommt das Ergebnis zutage.«
»Und manchmal muss man sich dabei mit kleinen Tricks helfen, die sich spontan einsetzen lassen.« Sabine klickte durch die Videodateien, öffnete eine davon und drückte sofort auf die Pausentaste. In groben Grautönen war ein fensterloser Verhörraum zu sehen; die Perspektive war die einer Überwachungskamera in der oberen Ecke des Zimmers. Sabine und Sneijder saßen einer Frau mittleren Alters gegenüber. Auf dem Tisch zwischen ihnen befanden sich nur ein Mikrofon, ein Glas Wasser und eine ausgebreitete Landkarte.
Ein erfreutes Raunen ging durch den Saal. Sabine schmunzelte. Sie wusste, dass die Studenten am liebsten Anschauungsmaterial von Sneijders Ermittlungen sahen. Und gerade jetzt, wenn das Sommersemester sich dem Ende zuneigte, war es gut, die jungen Männer und Frauen noch einmal ordentlich zu motivieren.
»Vor zwei Wochen haben Sneijder und ich eine Verdächtige verhört, von der wir ziemlich sicher glaubten, dass sie den Mord an ihrem Mann nur deshalb zugab, um den wahren Täter zu schützen. Hören und sehen Sie selbst.« Sabine drückte auf Play.
»Wohin haben Sie die Beweismittel verschwinden lassen?«, fragte Sneijder.
»Sie meinen die Mordwaffe?«
»Und Ihre blutige Kleidung, Ihre Handschuhe und den blutigen Teppich aus Ihrem Wohnzimmer.«
»In die Truhe, von der ich Ihnen erzählt habe.«
»Und die haben Sie selbst beschwert, damit sie untergeht?«
»Ja, mit Steinen.«
»Muss verdammt schwer und unhandlich gewesen sein, diese Truhe.«
»Ja, war sie.«
»Ebenso die Leiche Ihres Mannes.«
»Ja, war sie.«
»Hatten Sie einen Helfer?«
»Nein.«
»Sie haben die Leiche Ihres Mannes und die Truhe also selbst nachts im Wagen zum Stausee gefahren und ins Wasser geworfen?«
»Ja.«
»An der Stelle, die Sie uns auf dem Plan gezeigt haben?«
»Ja.«
»Diese Stelle?« Sneijder zeigte auf den Plan.
»Ja, es war exakt dort.«
»Und wie haben Sie das alles über den zwei Meter hohen Zaun gebracht?«
»Wenn eine Frau willensstark ist«, sagte sie selbstbewusst, »kann sie über sich selbst hinauswachsen.«
Sneijder nickte. »Das ist wahr, allerdings stimmt eine Sache nicht. An dieser Stelle ist gar kein Zaun.«
Nun stutzte die Frau. »Was?«
»Fast hätte ich es Ihnen geglaubt, aber Sie waren schlecht vorbereitet«, sagte Sneijder.
Nun starrte sie auf die Karte, dann knirschte sie mit den Zähnen. »Scheiße …«, entfuhr es ihr.
Sneijder drehte den Kopf zur Spiegelwand und nickte. Daraufhin betraten zwei uniformierte Beamte den Raum und führten die Frau ab.
Nachdem die Tür wieder geschlossen wurde und sie allein waren, drehte sich Sabine zu Sneijder. »Woher wussten Sie, dass dort kein Zaun ist?«
Bevor Sneijders Antwort zu hören war, drückte Sabine die Pausentaste. »Woher wusste er es?«, fragte sie.
»Er war dort«, rief ein Student sofort heraus.
»Er hat sich die Stelle auf Google-Maps angesehen«, lautete eine andere Antwort.
»Er weiß es aus dem Polizeiprotokoll vom Leichenfund.«
Es kamen noch einige andere Antworten, doch weder Sabine noch Horowitz kommentierten eine davon mit Worten oder Gesten. Sabine hatte ihr Pokerface aufgesetzt und hörte einfach nur zu.
Schließlich wurde es ruhig im Saal. Dann meldete sich Miyu zu Wort, eine junge Halbasiatin mit langen, glatten schwarzen Haaren, die selten etwas sagte, aber wenn, dann immer ins Schwarze traf. Beinahe hätte sie es nicht auf die Akademie geschafft, weil ihr psychologisches Profil Hinweise auf eine Störung im Autismus-Spektrum aufwies – vermutlich Asperger-Syndrom –, aber Sabine, Horowitz und sogar Sneijder hatten interveniert, weil sie der Meinung waren, dass diese junge Frau großes Talent besaß, das unbedingt gefördert werden musste.
»Ja, Miyu, bitte«, forderte Sabine sie zum Reden auf.
»Sneijder wusste es gar nicht. Er hat hoch gepokert.«
Ein Raunen ging durch den Saal.
»Das ist absolut richtig«, sagte Sabine schließlich. »Wie sind Sie darauf gekommen?«
»Ich hätte es genauso gemacht.«
Sabine verkniff sich ein Schmunzeln. Sie wusste, dass es keine Arroganz war, die sich hinter Miyus Antwort verbarg, sondern einfach ihre ergebnisorientierte Logik, die sie in der Tat mit Sneijder zu teilen schien.
In diesem Moment öffnete sich die hintere Tür des Hörsaals, und zwei Männer traten ein. Sie trugen dunkle Dreiteiler und hatten schroffe, kantige Gesichter. Schweigend setzten sie sich in die letzte Reihe und hörten zu.
Es waren die Männer aus dem Bus.
4. Kapitel
Sneijder trat die Tür mit dem Fuß hinter sich zu, die Hände in den Hosentaschen. »Was gibt es so Dringendes?«
Marc Krügers Arbeitszimmer lag im ersten Untergeschoss und war fensterlos, aber mit einer Klimaanlage ausgestattet, die wegen der vielen Geräte immer auf Hochtouren lief. Auf nicht einmal fünf Quadratmetern fristete Marc hier freiwillig sein Dasein, mit zwei Laptops, einem Standcomputer, drei breiten Monitoren und Filmpostern von Amazing Stories, Outer Limits und Akte X an den Wänden.
The Truth is out there.
I want to believe.
Wenn er sich in Gegenwart von diesem Quatsch wohlfühlte, sollte es Sneijder recht sein. Als jemand, der exzessiv Vanilletee trank, regelmäßig Marihuana rauchte, sich Akupunkturnadeln in die Handrücken stach und gerne mal mit Leichen sprach, konnte er Marcs Spleens akzeptieren. Schließlich schienen sie dessen Urteilskraft nicht zu beeinträchtigen, denn er war wirklich gut in dem, was er tat.
»Habe ich dich von etwas Wichtigem weggeholt?«, fragte Marc.
»War nur das psychologische Gespräch mit Dr. Ross.«
Marc grinste. »Dann solltest du mir eigentlich dankbar sein.«
Sneijder hob die Hand und streckte drei Finger aus. »Worum geht’s? In drei knappen und präzisen Sätzen.«
»Ja, keine Sorge, ich werde dir keinerlei weiteren Smalltalk zumuten.« Marc rollte mit seinem Stuhl zu einem anderen Monitor und klapperte auf der Tastatur davor. »Die Programme sind über Nacht durchgelaufen. Ich habe alles gecheckt. Mittlerweile wissen wir, dass die Informationen aus dem Datenleck mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit weder telefonisch noch elektronisch oder online irgendwohin transferiert worden sind, weil es keinerlei digitale Spuren gibt. Kein unbefugter Login in die Datenbanken, kein unautorisierter E-Mail-Verkehr über die Server.«
»Auch nicht über private E-Mail-Dienste?«
Marc schüttelte den Kopf. »Ich habe alle Log-Einträge überprüft, kein einziger digitaler Fußabdruck. Es gab nicht einmal Spuren von Kopien auf externe Festplatten, USB-Sticks oder CD-Brenner.«
»Hast du die Handy- und Festnetzdaten geprüft?«
»Natürlich, waren alle negativ. Ich habe sogar sämtliche Festplatten der Kopiergeräte kontrolliert.«
»Und die Scanner und Drucker?«
»Ja, habe alle Protokolldateien gesichtet. Nicht mal da wurden die dafür infrage kommenden als geheim eingestuften Dokumente dupliziert.«
Sneijder dachte nach. »Dann gibt es bloß noch diese eine Möglichkeit, dass …«
»Nein«, widersprach Marc. »Alles, was ins Gebäude reinkommt, muss durch den Scanner. Ich bin sicher, dass weder eine Kamera noch ein portables Kopiergerät reingeschmuggelt wurden.«
Sneijder nickte. »Wenn du das alles gecheckt hast, warum sprichst du dann nur von einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent?«
»Weil es Dinge gibt, die wir wissen, und Dinge, die wir nicht wissen. Aber es könnte auch Dinge geben, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Diese Möglichkeit besteht immer.«
Sneijders Kiefer mahlten. Deswegen mochte er diesen Jungen so sehr, weil er komplex denken konnte, aber nie davon ausging, dass er alles wusste oder absolut richtiglag. Das wäre ein fataler Fehler, den allzu viele regelmäßig begingen. »Und wie wurden die Daten deiner Meinung nach aus dem BKA geschafft?«, fragte er.
»Ziemlich old school – als händische Abschriften der Originale in einem Kuvert oder Koffer.«
Sneijder selbst war auch schon zu diesem Schluss gekommen. Diese Variante war am wahrscheinlichsten, denn im Zeitalter des digitalen Wahnsinns, wo jede Bewegung eine elektronische Spur hinterließ, war das mittlerweile der sicherste Weg. Zurück zu den Anfängen – wie in den Siebzigerjahren. »Wie weit bist du mit dem Weg-Zeit-Diagramm?«
»Die Idee war gut«, sagte Marc.
»Hör auf, mir zu schmeicheln, das weiß ich selbst. Verrat mir lieber das Ergebnis.«
Marc rollte mit dem Stuhl zu einem anderen Monitor. »Wenn wir die ausschließen, die nichts von den Infos wussten oder gar keine Möglichkeit hatten, an die detaillierten Daten zu gelangen, und die ausschließen, die bereits durchsucht wurden oder zur fraglichen Zeit im Urlaub, Ausland oder krank waren, bleiben nur diese Personen übrig.« Er tippte auf eine Taste, woraufhin eine Liste mit vierzig Namen auf dem Bildschirm erschien.
Es hatte bereits zahlreiche auf den Kopf gestellte Büros und Hausdurchsuchungen verdächtigter Mitarbeiter gegeben, doch die hatten allesamt nichts gebracht. Was Marc jetzt gemacht hatte, war eine klassische Rasterfahndung, nur dass sie diesmal die eigenen Leute, über fünftausend Mitarbeiter des BKA, unter die Lupe genommen hatten.
»Wenn wir herausfinden, wer auf keinen Fall davon profitieren würde, könnten wir weitere Verdächtige ausschließen …«, überlegte Sneijder laut.
»… und den Kreis der Personen noch enger ziehen«, ergänzte Marc und drückte auf eine weitere Taste, woraufhin nur noch knapp über zwanzig Namen übrig blieben.
»Mein Name ist auch darunter«, stellte Sneijder trocken fest.
»Ich weiß«, antwortete Marc, »aber ich möchte ihn nicht von der Liste nehmen. Würde gegen das Grundsatzprinzip eines Programmierers verstoßen. Außerdem müsste dir das Ergebnis doch schmeicheln, denn hier ist die komplette Führungsriege zu sehen sowie alle Kollegen ab einer gewissen Gehaltsstufe.«
Sneijder verzog das Gesicht. »Eine Liste mit den hellsten Köpfen des BKA würde mir schmeicheln, aber so etwas nicht!« Er las sich die Namen durch. »Wir haben also einen Maulwurf in den höchsten Kreisen.«
»Ich hab es dreimal gecheckt, in der Hoffnung, dass sich eines der Programme oder ich mich geirrt haben könnten, aber …«
»Du hast dich nicht geirrt«, unterbrach Sneijder ihn. »Dr. Ross hat mich heute Morgen auf denselben Gedanken gebracht.« Vervloekt! Dieses Ergebnis würde Dirk van Nistelrooy, dem Präsidenten des BKA und Sneijders unmittelbarem Vorgesetzten, gar nicht schmecken. »Was hat die Zeitskala ergeben?«
»Die Zeitskala, richtig.« Marc schnippte mit den Fingern. »Auch eine brillante Id… sorry! Ich habe festgestellt, dass sämtliche Infos, die das BKA verlassen haben, immer mindestens drei Tage alt waren, ehe sie – wo auch immer – angekommen sind und verwendet wurden.«
»Drei Tage …« Sneijder kaute an der Unterlippe.
»Wenn eine Genehmigung für einen Einsatz und der darauffolgende Zugriff in weniger als drei Tagen erfolgt sind, gab es keine Sabotage.«
»Das könnte am Transportweg der Daten liegen.«
Marc nickte eifrig. »Und würde somit bedeuten, dass der Transportweg drei Tage dauert.«
»Was ebenfalls darauf schließen lässt, dass die Daten tatsächlich auf konventionellem Weg transportiert werden … und zwar ins Ausland.« Sneijder spürte in den Eingeweiden, dass sie knapp davor waren, die Identität des Maulwurfs aufzudecken. Unwillkürlich merkte er, wie ihm Hitze ins Gesicht schoss und eine Energie ihn durchströmte, wie es immer nur dann passierte, wenn er auf einer heißen Spur war. Dieser Fall entpuppte sich als genauso belebend wie die Mörderjagd.
»Darf ich noch etwas Privates anmerken?«, fragte Marc.
»Wenn es sich nicht vermeiden lässt.«
»Du hast mir ja vor zwei Tagen das Du angeboten … und …«
»Und was?« Sneijder kniff die Augenbrauen zusammen und sah ihn an.
»Ich habe Sabine heute Morgen davon erzählt, sie hätte es sowieso bald herausgefunden, und ich meine nur, wahrscheinlich würde sie sich freuen, wenn du …«
Sneijder schüttelte den Kopf.
»Ihr kennt euch doch schon so lange.«
Stimmt. Und nicht nur das. Sabine Nemez war sein Eichkätzchen. Er hatte in München ihr Talent entdeckt, als sie noch beim Kriminaldauerdienst gearbeitet hatte, hatte sie nach Wiesbaden an die Akademie geholt, sie unter seine Fittiche genommen, zwei Jahre lang unter härtesten Bedingungen ausgebildet, dann zu seiner Kollegin gemacht und mit ihr gemeinsam sein Team aufgebaut. Und jetzt spürte er, dass er sie auf keinen Fall noch näher an sich ranlassen durfte. Einerseits sollte sie nicht genauso werden wie er – ein solches Leben hatte sie einfach nicht verdient –, andererseits wusste sie ohnehin schon zu viel über ihn. Oder ich mache mir was vor, unddas ist alles nur reiner Selbstschutz.
»Ich mag sie«, gab Sneijder zu, »sogar mehr als dich. Aber ich schwöre dir …« Er zeigte mit dem Finger auf ihn. »… wenn sie das jemals herausfinden sollte, bist du ein toter Mann. Und ich weiß, wie man Leichen für immer spurlos verschwinden lässt.«
Marc presste die Lippen aufeinander. »War nur Spaß, richtig?«
»Nein.«
Sneijders Handy klingelte. Zur gleichen Zeit poppte eine E-Mail auf einem der Bildschirme auf.
Sneijder ging ans Telefon. Es war Dirk van Nistelrooys Sekretärin. Der Chef wollte ihn um zehn Uhr vormittags in seinem Büro sehen. Sneijder blickte auf das rot-weiß-blau beschriftete Zifferblatt seiner Armbanduhr. »Ich muss in einer halben Stunde zum Chef.«
Marc öffnete die E-Mail. »Ich auch.«
»Dann wird er uns wohl …«
5. Kapitel
»… in derselben Sache sprechen wollen. Anscheinend geht es um das Datenleck«, drang Sneijders Stimme dumpf aus dem Lautsprecher. »Niet goed.«
Die beiden unterhielten sich noch eine halbe Minute lang, dann verabschiedete sich Sneijder und verließ mit einem Klacken der Tür den Raum.
Im Lautsprecher raschelte es. Das Quietschen von Marc Krügers Stuhl war zu hören. Danach das Klappern auf der Tastatur. Musik erklang. Es hörte sich an wie die sphärischen Klänge eines Science-Fiction-Films.
Der Mann, der das alles vom Schreibtisch in einem Büro aus mitgehört hatte, berührte den Bildschirm seines Handys, und die Musik erstarb. Er massierte seine Schläfen.
Verdammt. Es sah ganz danach aus, als würde er in Kürze ein großes Problem bekommen. Es wurde Zeit, eine bestimmte Nummer zu wählen.
6. Kapitel
Der Einsatz, der im Morgengrauen im Westen Frankfurts in einem schäbigen gelb angestrichenen Einfamilienhaus begonnen hatte, war soeben zu Ende gegangen. Tina Martinelli strich sich das schwarze Haar, das ihr an einer Seite bis zur Schulter ging, hinter das Ohr. Die andere Seite war kahl rasiert. Mit dem Piercing und den Tattoos sah sie so gar nicht aus wie eine offizielle BKA-Ermittlerin, sondern wäre bestenfalls als Undercoveragentin durchgegangen.
Nachdem die Kollegen vom SEK der Frankfurter Polizei, die den Einsatz unterstützt hatten, abgerückt waren, schlüpfte Tina aus der schweren Kevlarweste und warf sie in der Küche über eine Stuhllehne. Die Spurensicherung war zwar in den zwei Stockwerken noch an der Arbeit, aber die Chance, in diesem Haus etwas Brauchbares zu finden, war nahezu null. Hier war keine Menschenseele. Dabei hatten sie den Inhaber über zwei Wochen lang beschattet. Er nannte sich selbst Der Kuppler, weil er – mutmaßlich – Geschäfte zwischen einer zahlungskräftigen Klientel und minderjährigen Mädchen abwickelte. Dabei wussten sie weder, wo diese Geschäfte stattfanden, noch, wo er die jungen Frauen unterbrachte. Leider hatte ihnen der Richter keine Abhöraktion genehmigt, aber zumindest hatte der Staatsanwalt eine Hausdurchsuchung herausholen können. Doch anscheinend waren sie zu spät gekommen.
Der Safe in jenem Raum, den sie für das Büro des Kupplers hielten, war offen gewesen und leer geräumt worden. Ziemlich hastig, denn einige völlig unbedeutende Rechnungen lagen noch auf dem Boden. Keine Kundenkartei, keine Bankbelege, kein Notizbuch, kein Handy, kein Notebook, kein Fahrzeug. Ja nicht einmal ein Wandkalender mit Anmerkungen hing in diesem Haus. Absolut kein Hinweis auf irgendwas. Das einzig Verdächtige, das es hier gab, war die Tatsache, dass sie eben nichts Verdächtiges gefunden hatten.
Tina stand am Küchenfenster und starrte in den Garten, der soeben von den Kollegen der Frankfurter Polizei umgegraben wurde. Sogar Leichenspürhunde waren im Einsatz. Spart euch die Mühe, dachte sie. Der Mistkerl hat einen Tipp gekriegt und ist rechtzeitig mit allen Beweisen abgehauen.
Eigentlich hätte ja Sabine den Einsatz leiten sollen, doch die beendete das Sommersemester mit den Studenten, also war Tina eingesprungen. Sie waren sowieso wie Schwestern und halfen sich ständig gegenseitig und ohne viele Worte zu verlieren. Rivalitäten oder Kompetenzstreitigkeiten hatte es zwischen ihnen noch nie gegeben – nicht einmal damals, als sie noch die Schulbank an der Akademie gedrückt hatten und selbst noch Frischlinge gewesen waren.
Soeben betrat Krzysztof die Küche. Er trug auch eine kugelsichere Weste über dem kurzärmeligen schwarzen Rippshirt, hatte aber keine Waffe. Aus gutem Grund: Er war vorbestraft, hatte in jungen Jahren als Auftragskiller einige Leute über den Jordan geschickt und dementsprechend lange im Knast gesessen. Sneijder hatte ihn damals hinter Gitter gebracht und ihm nach der Haft eine Wohnung und einen Job verschafft – anscheinend war das sein Beitrag zum staatlichen Resozialisierungsprogramm. Weil Sneijder Krzysztofs Stärken kannte, hatte er ihn dann vor einem Jahr mit einem externen Beratervertrag in sein Team beim BKA geholt.
»Ist scheiße gelaufen«, murmelte Tina.
»Aber wir beide waren ein gutes Duo«, witzelte Krzysztof mit leicht polnischem Akzent. »Wir passen einfach gut zusammen – du und ich –, ich meine, so optisch und rein figürlich.« Er ließ seinen Bizeps und die Unterarmmuskeln spielen und wollte damit wohl auf seine Tätowierungen hinweisen, die er sich damals im Knast hatte stechen lassen. Doch mit seinen leicht vergilbten Seejungfrauen, Ankern und Messern konnte Tina nichts anfangen. Und mit großmäuligen Kerlen schon gar nicht. Auch wenn sie eingestehen musste, dass dieser großmäulige Kerl hier mit seinen grauen Bartstoppeln, dem grauen Zopf und der sehnigen Boxerstatur für seine siebenundsechzig Jahre immer noch verdammt gut aussah.
Sie hob kurz den Blick. »Lass gut sein«, sagte sie knapp. »An deiner Masche musst du noch arbeiten.« Dann runzelte sie die Stirn. »Außerdem dachte ich, du hättest eine Freundin?«
»Maya, die Apothekerin?« Krzysztof nickte. »Die den geilsten Arsch der Welt hatte …?«
»Ja, ich weiß, nämlich dich«, unterbrach Tina ihn. »Aber wieso hatte?«
Für einen Moment grinste Krzysztof, dann sagte er schließlich mit ernsterem Unterton: »Wir haben uns vor ein paar Monaten getrennt. Ist wohl besser so. Sind noch befreundet und gehen ab und zu gemeinsam essen, aber da läuft nichts mehr.«
»Und jetzt versuchst du es bei mir?«
»Dachte, du stehst auf ältere und erfahrene Männer.«
»Witzig.«
»Ich könnte …«
»Danke, da gibt es nichts, was du tun könntest, es sei denn, diesen Fall lösen.«
»Na schön.« Er zuckte die Achseln. »Ich habe im Keller merkwürdige Schleifspuren auf dem Estrich entdeckt.«
»Hab ich auch gesehen. Vor dem Schrank. Der wurde vermutlich mal weggeschoben. Und?«
»Wurde anscheinend ein bisschen oft hin- und hergeschoben«, ergänzte Krzysztof. »Die Spuren sind ziemlich tief. Und der Schrank ist leer.«
Tina sah ihn lange an. »Du meinst, dahinter könnte etwas versteckt sein.«
»Jetzt vermutlich nicht mehr, da alle Hinweise aus dem Haus verschwunden sind … aber einen Versuch wäre es wert.«
»Und das sagst du erst jetzt?«, fuhr sie ihn an.
»Lieber ein Blatt vor dem Mund als ein Brett vor dem Kopf«, antwortete er.
»Ist das ein polnischer Kalenderspruch?«
»Nein, stammt aus einem Glückskeks.«
Seufzend legte sie ihre Weste wieder an, zog die Klettverschlüsse zu und lief aus der Küche. »Komm mit!« Krzysztof folgte ihr. Sie rannten an den Kollegen von der Spurensicherung vorbei und nahmen die Treppe in den Keller.
»Nichts anfassen!«, rief einer ihnen hinterher.
»Wie ich diese Klugscheißer hasse«, murmelte Tina. Unten im Keller stand neben einer alten Waschmaschine das wuchtige Möbelstück, das mit all seinen Schubladen, verzierten Goldgriffen und dünnen Beinchen aussah, als stammte es aus der Biedermeierzeit.
»Fass an!«, sagte Tina und bückte sich. »Nicht da, Trottel. Den Schrank!«
»Ach so.« Krzysztof nahm seine Hände von Tina und stemmte sich schnaufend gegen den Schrank.
Gemeinsam rückten sie ihn zur Seite, was leichter ging als gedacht, auch weil die Rillen im Betonboden schon ziemlich ausgeprägt waren. Und tatsächlich: In der Mauer dahinter verbarg sich eine kleine Holztür, gerade mal so hoch wie in alten Ritterburgen.
Tina griff nach ihrem Pick-Set, um das Vorhängeschloss zu öffnen, doch Krzysztof hatte bereits dagegen getreten.
»Bist du verrückt?«
»Was? Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss, und so leergeräumt, wie die Bude ist, wird ihr Besitzer nicht so schnell wiederkommen, um mich wegen dieser Holztür zu verklagen.« Krzysztof bog die gesplitterten Holzteile zur Seite und tastete die Wand dahinter ab, bis er einen Lichtschalter fand. Mattes Neonlicht sprang an, riss eine Treppe, die steil in die Tiefe führte, aus der Dunkelheit, verlosch aber im nächsten Moment wieder zuckend.
»Mist.« Tina holte ihre Waffe aus dem Holster, lud sie durch und nahm die Taschenlampe vom Gürtel. Dann zog sie den Kopf ein und stieg durch die Holztür. »Bleib dicht hinter mir«, flüsterte sie und ging die Treppe hinunter. »Mann, so dicht auch wieder nicht!«
»Entscheide dich mal«, murrte er hinter ihr.
Die Treppe führte in zwei engen Windungen etwa zwei weitere Meter tief unter die Erde, und wenn Tina sich richtig orientierte, dann befand sich dieser zweite Keller nicht unter dem Haus, sondern seitlich neben der Garage unter dem Garten, wo eine Reihe Hortensien wucherte.
»Sieht wie ein Atombunker oder ehemaliger Luftschutzkeller aus«, sagte Krzysztof.
»Kennst du noch aus dem Zweiten Weltkrieg, stimmt’s?« Tina hatte die letzte Stufe erreicht und trat zur Seite, damit Krzysztof ebenfalls sehen konnte, was sich vor ihnen befand. »Du könntest recht haben … allerdings wurde er umfunktioniert.« Vor ihnen lagen mehrere geheime unterirdische Kammern, so groß wie Gefängniszellen. Die Türen standen offen.
»Das sind Oublietten«, entfuhr es Krzysztof.
»Du kannst Französisch?«
»Ich …«
»Keine blöden Wortspiele jetzt«, warnte Tina ihn. Sie kannte den Begriff – oublier hieß so viel wie vergessen –, und das hier waren fensterlose Verliese mit einer Belüftungsanlage, um jemanden für lange Zeit gefangen zu halten … oder ihn in Vergessenheit geraten zu lassen.
Langsam schritten sie an den Kammern vorbei, während Tina mit der Taschenlampe hineinleuchtete. Darin befanden sich Betten, Schränke und kleine Waschbecken. Alle Räume waren gefliest, nichts davon wirkte alt oder schäbig. Die Laken waren frisch bezogen, und es roch sogar noch nach Parfüm. Weiter hinten fanden sie einen großzügig ausgestatteten Duschraum mit Kosmetikartikeln und frischen Handtüchern. Tina fasste eines davon an. Es war weich und geschmeidig. Anscheinend hatte der Kuppler sogar einen Wäschetrockner verwendet. »Ich glaube, wir wissen jetzt, wo die Geschäfte stattgefunden haben und wo er die Mädchen untergebracht hat.«
»Aber er hat alles weggeräumt«, sagte Krzysztof, »inklusive der Mädchen.«
Tina lehnte sich an die Fliesen der Duschkabine, rutschte zu Boden und zog die Beine an. »Hier stimmt doch etwas nicht«, murmelte sie. Im Licht der Taschenlampe sah sie, wie Krzysztof sie mit seinen kleinen Luchsaugen verwirrt anstarrte. »Was meinst du?«
»Wie lange brauchst du, um – sagen wir mal – drei bis vier Mädchen samt ihren Klamotten von hier wegzuschaffen? Und danach alles wegzuräumen?«, fragte sie. »Alle Fingerabdrücke und Spuren abzuwischen, die Räume zu reinigen und alles belastende Material aus den oberen Räumen des Hauses zu schaffen? Und wenn das hier der zentrale Umschlagplatz war, reden wir von einer Menge Material.«
Krzysztof überlegte. »Einen Tag. Mindestens aber zwölf Stunden.«
»Der Richter hat den Durchsuchungsbeschluss gestern Nacht unterschrieben, und wir haben um sieben Uhr früh zugeschlagen.«
Nun schien Krzysztof zu begreifen. »Jemand muss dem Kuppler schon vorher einen Tipp gegeben haben.«
Tina nickte bitter. Wie sie wusste, häuften sich mittlerweile die Fälle, in denen die Ermittlungen des BKA ins Leere liefen. Wurden die Kriminellen tatsächlich cleverer? »Entweder kann unser Freund hellsehen, oder er hat gute Kontakte nach ganz oben.«
»Wann kam Sneijders Anfrage, dieses Haus abzuhören?«
»Am Sonntag … also vor drei Tagen.« Tinas Handy vibrierte in der Hosentasche, sie zog es heraus. Der Empfang hier unten war gar nicht einmal schlecht, drei Balken. Offenbar gab es einen Verstärker im Haus. Der Anruf kam aus Dirk van Nistelrooys Büro. Sogleich ging sie mit klopfendem Herzen ran, hörte, was seine Sekretärin ihr zu sagen hatte, und legte wieder auf. »Wir müssen los, zurück nach Wiesbaden. Um zehn haben wir einen Termin im Büro des Chefs.« Sie reichte Krzysztof die Hand, er zog sie hoch.
»Wir?«
»Ja, wir – du und ich. Die Schöne und das Biest. Da kannst du mal sehen, wie begehrt du mittlerweile geworden bist.«
»Es wird doch nicht um diese dämliche eingetretene Tür gehen?«
Tina verdrehte die Augen.
7. Kapitel
Sabine schaltete den Videobeamer aus und klappte ihren Laptop zu. Die Unterrichtsstunde war zu Ende, die Studenten verließen soeben den Hörsaal. Morgen würde noch eine letzte Stunde stattfinden, und nächste Woche folgte dann die Abschlussarbeit in diesem Modul.
Horowitz fuhr im Rollstuhl zu ihr. »Wie viele glauben Sie, werden die Prüfung bestehen?«
Sabine sah nicht auf. »Kommt drauf an, wie schwierig wir den Test anlegen.«
»Die Gruppe ist gut, alle sind auf zack«, sagte Horowitz. »Ich denke, wir können das Niveau ruhigen Gewissens heben.«
Sabine grinste. »Wir könnten das Niveau heben und die Anzahl der Fragen erhöhen, dann kommt auch noch der Zeitdruck dazu.«
»Sie sind gemein«, stellte er begeistert fest.
Sie hatte ja gewusst, dass ihr Vorschlag ganz nach seinem Geschmack sein würde. »Die Welt dort draußen ist gemein, unser Job ist nicht immer fair, und je härter wir sie rannehmen, umso mehr scheiden aus, die den echten Anforderungen sowieso nie gewachsen wären.« Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Horowitz nickte. Er kannte die Welt der Kriminellen besser als sie und hatte genau diese Erfahrung, von der sie soeben gesprochen hatte, vor acht Jahren am eigenen Leib gemacht. Als Sneijder und er damals in Bern einen Serienkiller gejagt hatten, war Horowitz angeschossen worden. Das Projektil hatte die Lendenwirbelsäule zerschmettert, seitdem war er querschnittgelähmt.
»Vor allem Miyu ist gut«, sagte Horowitz.
»Miyu ist ein Phänomen.« Nun sah sie nach hinten. Die beiden Männer, die sich den Rest der Stunde aus der letzten Reihe angehört hatten, waren verschwunden. Genauso leise und unauffällig, wie sie sich in den Hörsaal geschlichen hatten. »Kannten Sie die beiden Typen im Dreiteiler?«, fragte sie.
Horowitz schüttelte den Kopf. »Sie?«
»Nein.«
»Sahen nicht nach BKA aus.« Er verzog das Gesicht. »Ich tippe auf Militärischen Abschirmdienst oder Bundesamt für Verfassungsschutz.«
Gott bewahre uns! Warum interessieren sich die für unser Modul?
In diesem Moment summten gleichzeitig die Handys von Sabine und Horowitz. Eine SMS. Sie las die Nachricht, dann sah sie auf. »Haben Sie auch soeben eine Einladung in van Nistelrooys Büro erhalten?«
Horowitz nickte. »Zehn Uhr.« Er klopfte auf den Motor seines Stuhls. »Soll ich Sie ein Stück mitnehmen?«
8. Kapitel
Nachdem Sabine die Bürotür zu Dirk van Nistelrooys Sekretärin geöffnet hatte und Horowitz hineingefahren war, winkte sie die Sekretärin gleich durch. »Gehen Sie ruhig hinein, es sind schon alle da.«
Alle?
Sabine sah durch die offene Tür, dass van Nistelrooys Büro in der Tat ziemlich voll war. Er selbst stand beim Fenster und telefonierte. Vor seinem Schreibtisch saßen Sneijder und Marc, dicht daneben Tina und Krzysztof, beide ziemlich abgekämpft und noch in Einsatzkluft. Wenn man außer Acht ließ, dass Krzysztof ein bärbeißiger Pole und Tina eine temperamentvolle Sizilianerin war, wirkten sie fast ein wenig wie Vater und Tochter.
Was Sabine nur wenig überraschte, war, dass auch die beiden grau melierten Männer im dunklen Anzug an dieser Krisensitzung teilnahmen. Wie sie da neben van Nistelrooys Schreibtisch standen mit ihren Blanko-Besucherausweisen ohne Namen, sahen sie sich erstaunlich ähnlich mit ihren stoischen, unergründlichen Gesichtsausdrücken. Die Arme hinter dem Rücken verschränkt musterten sie den Halbkreis aus Stühlen vor ihnen, in dem noch drei Plätze frei waren.
Sabine nickte den anderen kurz zu, dann nahm sie Platz. Marc warf ihr einen stummen Blick zu und deutete mit den Augen kurz in Richtung der beiden Männer.
Horowitz positionierte sich neben Sabine. In dieser Konstellation waren sie im letzten Jahr schon öfter hierherzitiert worden. Oft hatte es einen Rüffel gegeben, selten Lob. Und das, obwohl sie durchaus knifflige Fälle gelöst hatten, an denen andere Gruppen gescheitert waren.
»Worum geht’s?«, presste Sabine mit halbgeschlossenen Lippen hervor.
»Keine Ahnung«, flüsterte Tina, die neben ihr saß. »Allerdings ist die Stimmung nicht gerade euphorisch.«
Sabine sah zu Sneijder. Der blickte genervt auf seine Armbanduhr. Eins seiner Beine hüpfte auf und ab. Kein gutes Zeichen, am liebsten wäre er jetzt vermutlich woanders – zum Beispiel mit einem Schwerverbrecher in einer Verhörzelle.
»In Ordnung … ja, Liebling …«, van Nistelrooy lächelte, »… und vergiss nicht, bis zum Ende der Woche die Orchideen zu wässern … Ich muss jetzt Schluss machen.« Endlich beendete er sein Telefonat, steckte das Handy in die Hosentasche und sah in die Runde. Schlagartig veränderte sich der Ausdruck in seinem scharfkantigen, pockennarbigen Gesicht. Er sah aus, als hätte er eine Kobra mit prallen Giftdrüsen verspeist, die er gerade mühsam verdaute.
»Also, wenn ich dann mal beginnen darf«, sagte einer der beiden fremden Männer, doch van Nistelrooy hob die Hand. »Wir sind noch nicht komplett.« Er blickte auf die Uhr. Es war eine Minute nach zehn.
»Falls es um die BKA-Sache geht, an der ich gerade dran bin, war der ganze Menschenauflauf umsonst«, sagte Sneijder übel gelaunt. »Darüber kann und werde ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts …«
»Maarten, darum geht es nicht«, unterbrach van Nistelrooy ihn.
Sneijder zog eine Augenbraue hoch, dann beugte er sich nach vorn und stützte die Ellenbogen auf die Knie. »Oude Schijtkerel«, fluchte er, und Sabine wollte gar nicht wissen, was das wieder bedeutete. Er holte sein Etui aus der Sakkotasche und stach sich lange Akupunkturnadeln in die tätowierten Markierungen auf seinem Handrücken. Während sie warteten, drehte er an den Nadeln.
Endlich öffnete sich die Tür und zwei Männer kamen herein, die Sabine bereits von zahlreichen Ansprachen und Empfängen im BKA kannte – außerdem hingen ihre Fotos für jedermann ersichtlich in der Eingangshalle neben dem van Nistelrooys: Friedrich Drohmeier, der Vizepräsident des BKA, und Jon Eisa, der dritte Präsident. Das traf Sabine jetzt doch völlig unerwartet.
Sie hatte erst einmal mit Drohmeier persönlich gesprochen, und dieses Gespräch vor zwei Monaten war ihr unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Er war fünfundsechzig Jahre alt, von großer Statur, hatte graue Haare, eine raue, vom Raucherhusten geprägte Stimme und eine tiefe hässliche Narbe quer über die Stirn, die von einer alten Schussverletzung stammte. Generell eine eher unheimliche Erscheinung. Zudem trug er den Beinamen Eisenfaust, und das nicht nur, weil er so unnachgiebig war. Er trug tatsächlich eine Prothese über dem rechten amputierten Handgelenk. Mit so einer körperlichen Einschränkung hätte man ihm normalerweise keinen repräsentativen Posten wie den des Vizepräsidenten des BKA anvertraut. Aber Drohmeier war ein brillanter Mann, der bereits viele Jahre lang bewiesen hatte, dass er alles fest im Griff hatte. Eisenfaust eben.
Jon Eisa hingegen war das genaue Gegenteil. Ein gut aussehender Karrierist, vierzig Jahre alt und eine Art Rockstar des BKA, nach dem sich so manch eine Kollegin auf den Fluren des Hauptgebäudes mit sehnsuchtsvollem Blick umdrehte. Und den höchstwahrscheinlich auch Sneijder nicht von der Bettkante gestoßen hätte.
Nachdem Drohmeier und Eisa auf den beiden letzten freien Stühlen Platz genommen hatten, setzte sich nun auch van Nistelrooy hinter seinen Schreibtisch. »Die beiden Herren sind vom Bundesnachrichtendienst. Für diese Besprechung werden sie namenlos bleiben.«
Und keinen Sitzplatz bekommen. Sabine schielte zu Horowitz. Der warf ihr einen bedeutungsvollen Blick zu. Vom BND also. Beinahe hatte er richtig geraten.
»Vorgestern, am Montag, dem 21. Mai, hat es am Nachmittag einen Anschlag auf die deutsche Botschaft in Oslo gegeben«, ergriff jetzt einer der beiden Geheimdienstmänner das Wort.
Schlagartig wurde es still im Raum, nur die Klimaanlage surrte. Sabine sah in erstaunte Gesichter. Sie hatte nichts davon in den Nachrichten gehört, die anderen anscheinend auch nicht. Offenbar hatten sich Norwegen und Deutschland dazu entschlossen, vorerst eine Nachrichtensperre zu verhängen.
»Dabei wurden die deutsche Botschafterin und ihr Sicherheitschef ermordet«, erklärte der Mann weiter. »Eine politisch motivierte Tat können wir ausschließen.«
»Wurde der Täter gefasst?«, fragte Horowitz.
»Nein, deswegen sind wir hier.«
Oh, das klingt übel. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte zwar unzählige Konsulate für deutsche Bürger in den verschiedensten Städten dieser Welt, aber nur jeweils eine Botschaft pro Land. Ein Mord an zwei so hochrangigen Deutschen auf fremdem Territorium war eine heikle Sache, zumal Norwegen gar nicht Mitglied der EU war.
»Nemez, hören Sie eigentlich zu?«, fragte van Nistelrooy.
»Ich bin ganz bei der Sache.« Sie sah auf. »Wenn ich mich recht erinnere, hieß unsere Botschafterin in Oslo Karin von Thun.«
»Katharina von Thun«, korrigierte van Nistelrooy sie.
»Streberin«, zischte Tina.
Normalerweise hätte Sabine ihr jetzt den Ellenbogen in die Seite gerammt, doch angesichts von van Nistelrooys, Eisas und Drohmeiers bitterernsten Mienen verkniff sie sich das lieber.
»Richtig«, nahm der Geheimdienstmann den Faden wieder auf. »Dr. Katharina von Thun hatte ein abgeschlossenes Wirtschafts- und Politikwissenschaftsstudium, die einjährige Ausbildung an der Akademie Berlin-Tegel absolviert und war Diplomatin im höheren Auswärtigen Dienst. Sie sprach vier Fremdsprachen, arbeitete im deutschen Konsulat in Göteborg in Schweden und hat Deutschland danach knapp zwei Jahre lang in Oslo perfekt repräsentiert. Nächstes Jahr hätte sie nach Berlin versetzt werden sollen.«
»Verheiratet?«, fragte Horowitz.
»Wegen des ständigen Arbeitsplatzwechsels ist die Scheidungsrate bei Diplomaten hoch. Diplomatenfamilien schlagen keine Wurzeln, nur wenige halten das durch«, erklärte der BND-Mann. »Nein, Katharina von Thun hatte keinen Mann, war fünfzig, kinderlos, lebte für ihren Job und …«
»Stopp!«, unterbrach Sneijder ihn. »Wir reden hier ständig nur über die Botschafterin und nicht über ihren Sicherheitschef. Wissen wir überhaupt, ob sie das Ziel des Mordanschlags war? Vielleicht war er es ja?«
Der BND-Mann spannte die Gesichtsmuskeln an. »Nein, wissen wir nicht.«
»Womöglich war ja einer der beiden nur ein Kollateralschaden«, sagte Sneijder, »oder möglicherweise waren sogar beide das Ziel.«
Der BND-Mann nickte. »Sehen wir uns die Aufnahmen der Überwachungskamera an.«
Der zweite Mann reichte van Nistelrooy einen Datenstick, und der schob ihn seitlich in seinen Monitor. Dann drehte er den Bildschirm zur Seite, sodass ihn alle sehen konnten, und startete das Video. Auf dem Monitor sah man von oben den Empfangsraum der Botschaft in grobkörnigen grauen Bildern. Die Kamera schwenkte ruckartig im Sekundentakt jeweils um ein paar weitere Grade durch den Raum.
»Schwarz-Weiß und diese Auflösung? Ist das Ihr Ernst?«, entfuhr es Sneijder. »Da haben ja die Handyfilme von Nemez’ kleinen Nichten eine bessere Qualität.«
»Schauen wir es uns doch einfach einmal an, Maarten«, knurrte van Nistelrooy. »Wir müssen ja nicht gleich einen Film-Oscar verleihen.«
Also beugten sie sich alle nach vorn und betrachteten schweigend die Aufnahme. Wenigstens war der Ton gut. Die Digitalanzeige am unteren Bildschirmrand zeigte 16:05:40 Uhr und raste im Sekundentakt weiter. Soeben betrat eine ältere grauhaarige Dame, die man nur von oben sah, den Eingang und stellte ihre Handtasche auf das Förderband des Scanners …
9. Kapitel
Die Tasche verschwand zwischen den Schlitzen des schwarzen Vorhangs im Scanner und tauchte eine halbe Minute später auf der anderen Seite wieder auf.
»Bitte gehen Sie hier durch«, sagte die Sicherheitsbeamtin an diesem Tag zum gefühlt hundertsten Mal auf Deutsch. Heute ist wieder einmal die Hölle los, dachte sie erschöpft.
Die Dame ging mit wackeligen Beinen durch den Personenscanner. Nichts piepste. Auf der anderen Seite nahm sie ihre Handtasche wieder an sich.
Der Beamte hinter dem Scanner deutete auf den Monitor. »Was haben Sie da drin?«
Die Dame holte eine Papiertüte hervor. »Münzen, ich wollte zur Bank, aber die hat schon zu«, sagte sie auf Englisch mit norwegischem Akzent.
»Das hier ist die Deutsche Botschaft«, sagte die Beamtin ebenfalls auf Englisch mit deutlicher und lauter werdender Stimme, »wir können kein Geld wechseln.«
»Ich weiß, ich möchte ja auch den Botschaftssekretär sprechen. Meine Tochter ist heute …«
»Gut, gehen Sie weiter und melden Sie sich am Schalter Nummer zwei an.«
Die Dame ging weiter, und der Mann hinter ihr legte seinen Koffer, die Armbanduhr und sein Handy auf das Förderband.
Orientierungslos stand die Dame in der Mitte des Raumes und sah sich um. Gerade kamen zwei Dutzend Kinder die Treppe aus dem Obergeschoss herunter. Sogleich stieg der Lärmpegel an, obwohl zwei Lehrer die zehnjährigen Schüler im Zaum zu halten versuchten. Eine zweite Schulklasse stand vor der historischen Wandtafel im Erdgeschoss und sah sich die wichtigsten Jahreszahlen aus der Geschichte der deutsch-norwegischen Beziehungen an.
Montag, der 21. Mai, war Tag der offenen Tür in der Botschaft, und viele Schulen nutzten ihn so kurz vor den Ferien für einen Ausflug und eine Führung durch das Gebäude. Zusätzlich waren noch zahlreiche andere Besucher hier, die mit alltäglicheren Anliegen vor den Schaltern warteten.