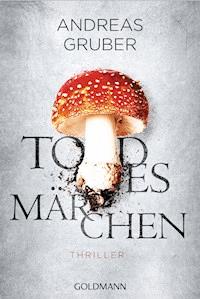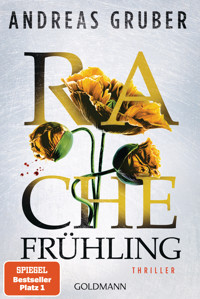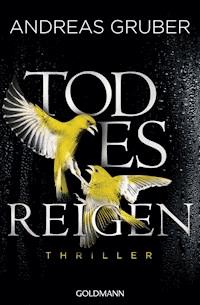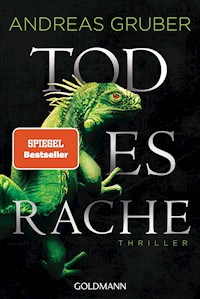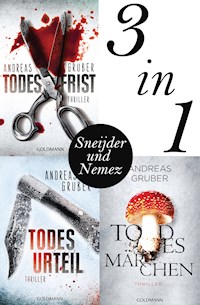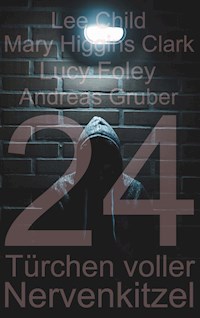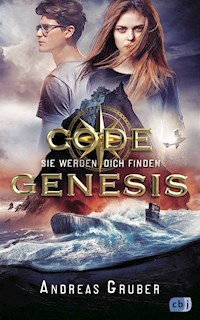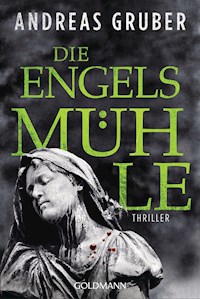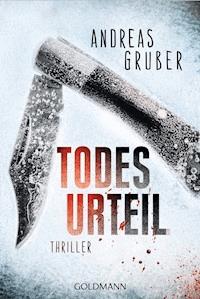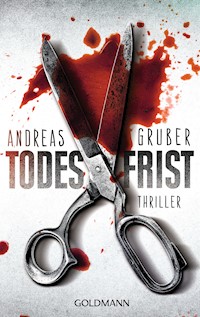
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Maarten S. Sneijder und Sabine Nemez
- Sprache: Deutsch
Ein Serienmörder treibt sein Unwesen – und ein altes Kinderbuch dient ihm als grausame Inspiration.
»Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden herausfinden, warum ich diese Frau entführt habe, bleibt sie am Leben. Falls nicht – stirbt sie.« Mit dieser Botschaft beginnt das perverse Spiel eines Serienmörders. Er lässt seine Opfer verhungern, ertränkt sie in Tinte oder umhüllt sie bei lebendigem Leib mit Beton. Verzweifelt sucht die Münchner Kommissarin Sabine Nemez nach einer Erklärung, einem Motiv. Erst als sie einen niederländischen Kollegen hinzuzieht, entdecken sie zumindest ein Muster: Ein altes Kinderbuch dient dem Täter als grausame Inspiration – und das birgt noch viele Ideen ...
Der Auftakt zur Erfolgsserie um die Ermittler Sneijder und Nemez.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Weh! Jetzt geht es klipp und klapp Mit der Scher’ die Daumen ab, Mit der großen scharfen Scher’! Hei! da schreit der Konrad sehr. (aus: Heinrich Hoffmann, Der Struwwelpeter)
In den Katakomben des Münchner, des Kölner und des Leipziger Doms wird jeweils eine weibliche Leiche gefunden. Alle drei Frauen wurden auf grausame Weise ermordet: die erste in Tinte ertränkt, die zweite von Hunden zerfleischt, die dritte in einer Blechwanne verbrannt. Wer steckt hinter dieser furchtbaren Mordserie? Und ist es ein Zufall, dass die Taten den düsteren Geschichten aus dem Kinderbuch Der Struwwelpeterähneln?
Die Ermittlungen übernimmt die junge Münchner Kriminalbeamtin Sabine Nemez. Mithilfe des forensischen Kripopsychologen Maarten Sneijder folgt sie der Spur des Täters bis nach Wien. Hier treibt der Killer sein heimtückisches Spiel mit der Psychotherapeutin Helen Berger. Doch diesmal hat er sich das falsche Opfer ausgesucht. Helen dreht den Spieß um und ist kurz davor, seine Identität aufzudecken. Doch dann verschwindet sie spurlos …
Inhaltsverzeichnis
FürHeidemarie, Veronika und Günter,vielen Dank, ihr Lieben
Prolog
Der Fahrstuhl fuhr mit einem gleichmäßig surrenden Geräusch in die Tiefe. Die Tür glitt auf, und blasses Neonlicht fiel in die Kabine.
Carmen lief durch die menschenleere Tiefgarage. Wie sie den grauen Beton und das sterile Licht hier unten hasste! Immer wenn ihre Nachtschicht am Montagmorgen um fünf Uhr endete, lag das zweite Untergeschoss in bedrückender Stille. Die Autos hockten wie lauernde Kreaturen im Schatten der Säulen, nur die Motorhauben ragten ins Licht. Kein Mensch weit und breit. Manchmal trieben sich im Keller des Instituts für Pathologie der Wiener Universität Verrückte herum. Sie fragte sich, ob sie eine siebenundvierzigjährige Frau überfallen würden. Stiegen ihre Chancen, in Ruhe gelassen zu werden, mit zunehmendem Alter, oder sanken sie?
Carmen fröstelte in der weißen Schwesterntracht, während sie zu ihrem Wagen lief. Stellplatz U2-P58. Seit drei Jahren dieselbe Nummer. Damenparkplätze. Die sonst flackernde Beleuchtung in dieser Ecke war komplett ausgefallen, und ein Müllsack von den Maler- und Renovierungsarbeiten verdeckte die Kamera wieder mal. Letzte Weihnachten hätten die Arbeiten fertig gestellt werden sollen – und jetzt war fast Ende März. Gingen dem Krankenhaus die Subventionen aus?
Carmen erreichte ihren VW Golf und betätigte den Knopf für die Zentralverriegelung. Die gelben Blinker zuckten zweimal auf. In diesem Moment bemerkte sie aus dem Augenwinkel den Schatten einer hoch gewachsenen Gestalt. Rasch trat der Kerl hinter der Säule hervor. Noch bevor sie sich wegdrehen und den Arm hochreißen konnte, spürte sie einen kurzen Einstich im Nacken.
Als Carmen die Augen aufschlug, umgab sie schwerfällige Dunkelheit. Sie war nicht in ihrem Schlafzimmer, ja nicht einmal in ihrer Wohnung. Sie vermisste das Ticken der Uhr, den Duft der frischen Bettwäsche und das rote Blinklicht des Videorekorders. Stattdessen roch es nach Feuchtigkeit, Holz und Zement.
Eine Baustelle?
Instinktiv wusste sie, dass sie nicht lag, sondern aufrecht stand. Woher? Sie hatte keine Ahnung. Vermutlich, weil ihr eine Träne über die Wange nach unten lief. Unwillkürlich wollte sie sie aus dem Gesicht wischen, doch ihre Arme hingen bleischwer und bewegungslos an ihr herunter. Augenblicklich wurde sie von Panik erfasst.
Was ist mit mir geschehen?
Sie wollte sich bewegen, den Kopf zur Seite drehen, doch sie war völlig erstarrt. Ihre Beine fühlten sich taub an. Sie konnte nicht einmal die große Zehe bewegen, als besäße sie keine Gliedmaßen mehr.
»Hallo?«, krächzte sie.
Ihre Stimme hallte von den Wänden wider. Es klang wie das Echo in einer Gruft. Trotzdem hörte sich der Ton merkwürdig gedämpft an und wurde vom Rauschen ihres Blutes überlagert. Wie im Urlaub am Strand von Kroatien, wo sie als junges Mädchen eine Muschel ans Ohr gepresst hatte, um der Brandung zu lauschen.
Sie schloss die Augen. Dieser merkwürdige Geruch! Zwischen dem steinigen und erdigen Mief lag eine Spur von Weihrauch. Verrückt!
Ihre Zunge tastete über die Lippen. Körniger Staub. Sie schluckte. Was für ein säuerlicher Geschmack! Plötzlich kam der Brechreiz. Sie musste würgen und spie bitteren Gallensaft aus, der ihr übers Kinn lief.
Was ist bloß passiert?
Sie konnte nicht richtig ausspucken und den Kopf weder drehen noch senken. Eine harte, scharfe Kante umrahmte ihr Gesicht. Auch das Atmen fiel ihr schwer, als schnürte ein eng anliegendes, eisernes Korsett ihre Brust ein.
»Hallo?«
Verdammt! Hoffentlich war es bloß ein Albtraum. Wie oft war sie nachts ans Bett ihrer Kinder gelaufen, um die beiden zu trösten, wenn sie schrien? Schlaf weiter, Kleines, es war nur ein böser Traum! Mami ist da. Mittlerweile lebte sie allein in ihrer Wohnung.
Aber das hier passierte wirklich. Zu real waren der Geschmack in ihrem Mund und das Kratzen in ihrer Kehle. Zu deutlich trommelten die pochenden Kopfschmerzen von innen an ihre Schädeldecke, immer heftiger, je mehr sie sich zu bewegen versuchte.
Welcher Tag ist heute?
Sie wollte ihre Schläfen massieren. Meistens half das beim Denken. Warum konnte sie die Hände nicht bewegen? Ihre Finger waren so taub, als hätte ihr jemand sämtliche Nerven durchtrennt.
Konzentrier dich! Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Plötzlich kam die Erkenntnis. Die Tiefgarage! Der Kerl hinter der Säule! Der Stich in den Nacken! Danach war ihre Erinnerung verblasst.
»Hilfe!« Mit rasendem Herzen bemerkte Carmen, dass sie nicht mehr bloß Hallo, sondern um Hilfe rief. Immer lauter, bis sie keine Puste mehr hatte und wegen des Drucks auf ihrer Brust nur noch flach atmen konnte.
Endlich hörte sie jemand.
In unmittelbarer Nähe tauchte ein Lichtstrahl unter einem Türschlitz auf. Allerdings war der Schein zu schwach, um in dem Raum etwas zu erkennen. Schritte kamen auf die Tür zu. Langsam und desinteressiert. Es klang, als stiege jemand eine Treppe herunter.
Instinktiv zählte Carmen mit. Sechzehn Stufen. Dieser Raum lag also ein Stockwerk tiefer.
Tiefer als was?
»Hilfe!«, rief sie erneut.
Da erklang das metallene Schaben eines Schlüssels im Schloss. Eine Kette rasselte.
War es eine gute Idee gewesen, ausgerechnet jetzt um Hilfe zu rufen? Sie hätte damit warten sollen, bis die Lähmung verflogen war. Dann hätte sie den Raum zuvor nach einer Fluchtmöglichkeit oder zumindest einer Waffe durchsuchen können. Carmens Herz raste. Bestimmt kam da der Mistkerl, der ihr die Injektion verpasst hatte!
Die massive Metalltür wurde aufgedrückt. Der Lichtstrahl tanzte in den Raum und blendete sie für einen Moment. Der Mann trug eine Stirnlampe. Carmen kniff die Augen zusammen, sah aber nur seinen schlanken Körper von der Hüfte an abwärts. Er trug eine graue Hose und Arbeitsschuhe. War es überhaupt ein Mann?
»Wer sind Sie?«, keuchte sie.
Was für eine blöde Frage, dachte sie im selben Moment. Der Mistkerl würde ihr keine Antwort geben. Er ging auf sie zu. Schutt und Kieselsteine knirschten unter seinen Schuhsohlen. Unwillkürlich musste Carmen an den Geruch nach Baustelle denken. Befand sie sich im Keller eines Rohbaus? Oder noch in der Tiefgarage der Pathologie? Nein, im Krankenhaus war sie definitiv nicht. Dort hatte sie noch nie den Geruch von Weihrauch bemerkt.
»Was wollen Sie von mir?«
Auch diesmal gab er keine Antwort. Bestimmt würde sie es früh genug erfahren. Allerdings konnte er sie nicht ewig hier festhalten. Bald würde sie Arme und Beine wieder bewegen können, und dann gnade ihm Gott. Was immer er mit ihr vorhatte – er würde sein Ziel nicht erreichen. Der Gedanke, dass er sie feige von hinten mit einer Spritze überwältigt hatte, machte sie so wütend, dass sie ihm den nächstbesten Gegenstand, den sie in die Finger kriegen würde, an den Schädel schlagen wollte.
Da öffnete der Kerl den Mund. Seine Stimme klang verzerrt, als hätte er einen defekten Kehlkopf oder einen Schnitt in der Luftröhre.
»Ich habe dir ein Anästhetikum injiziert …«
Bursche, du hast keine Ahnung, was ich mit dir anstelle, sobald du mir für einen Augenblick den Rücken zuwendest. Du hast dir die Falsche ausgesucht!
»… und ein Muskelrelaxans.«
Er verzichtete auf weitere Erklärungen. Sie waren nicht notwendig. Aufgrund ihrer Kleidung wusste er, dass sie Krankenschwester war. Der Ausweis an ihrer Bluse wies sie als Mitarbeiterin der Gynäkopathologie aus.
»Allerdings habe ich auf ein Analgetikum verzichtet.« Seine Stimme klang so emotionslos, als langweilte ihn die Erklärung. Die Stirnlampe blendete sie wieder. Diesmal länger. Offensichtlich beobachtete er ihre Reaktion.
Von den Dutzenden Fragen, die ihr gleichzeitig durch den Kopf schossen, beschäftigte sie eine am meisten: Warum verbarg er sein Gesicht vor ihr? Kannte sie ihn? Möglicherweise hatte er nicht vor, sie zu töten. Der Gedanke entspannte sie. Doch irgendetwas hatte er mir ihr vor. Was immer es war, sie würde die erste Möglichkeit nutzen, ihn zu töten, bevor er ihr etwas antun konnte. War sie dazu überhaupt in der Lage? Sie zweifelte keinen Moment daran. Ob sie nun ihrem Chefarzt beim Sezieren assistierte und das Skalpell beim Brustbein eines Toten ansetzte und bis zum Nabel hinunterzog oder diesem Kerl einen Nagel oder stumpfen Bleistift in die Niere oder Lunge stieß … wo lag da der Unterschied? Wenn er röchelnd vor ihr kauerte, würde sie nicht einmal ein schlechtes Gewissen plagen.
Du hast dir die Falsche ausgesucht! Besser wäre die junge Blondine aus dem Sekretariat gewesen.
»Hörst du mir zu?« Die blecherne Stimme klang herablassend, was Carmen noch mehr ärgerte.
Sie antwortete nicht. Natürlich hatte sie ihm zugehört. Jedes einzelne, verdammte Wort hatte sie mitbekommen. Anästhetikum, Muskelrelaxans und Analgetikum wurden normalerweise vor Operationen verwendet, um die Patienten bewusstlos, bewegungsunfähig und schmerzunempfindlich zu machen. Meist wurde das Analgetikum nachdosiert – doch darauf hatte dieser Mistkerl verzichtet, wie er behauptete. Allerdings hatte sie bis auf rasende Migräne keine Schmerzen. Was zum Teufel hatte er mit ihr vor?
Als hätte er ihre Frage erraten, trat er einen Schritt näher. Ein greller Lichtring blendete sie. »Brandopfer sterben meistens, weil die Zellatmung versagt, sobald mehr als zwei Drittel der Haut zerstört sind. Damit dir nicht das Gleiche passiert, sind deine Hände und Füße in Müllsäcke gewickelt. Du trägst einen Regenmantel und eine alte Seglerhose.«
In Carmens Kopf stoppten alle Gedanken. Schlagartig hatte der Unbekannte ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Die Kleider sind zwar nicht atmungsaktiv, aber zumindest Wasser abweisend. Das verhindert die Verätzung der Haut durch den scharfen Zement.« Er machte eine Pause. »Jedenfalls an den wichtigsten Stellen.«
Wovon zum Teufel sprach der Kerl? Carmen versuchte, die Finger zu bewegen, den Kopf zu drehen und in den Nacken zu legen, doch ohne Erfolg.
»Im Lauf der Zeit tritt allerdings ein gewisser Juckreiz auf, wenn sich Schweiß sammelt, Pilze und Parasiten bilden. Ich hoffe, du verfügst über ein gutes Immunsystem und benötigst kein regelmäßiges Medikament – denn das wirst du hier unten nicht bekommen. Du hast keinen freien Venenzugang mehr.«
Carmen nahm täglich Blutdrucktabletten, etwas anderes jedoch nicht. Sie schluckte den galligen Geschmack runter und merkte, wie ihr Brustkorb zusehends eingeengt wurde. »Was …?«, krächzte sie.
Seine Stimme klang gefühllos. »Habe ich endlich dein Interesse geweckt?«
Sie antwortete nicht. Das alles ergab keinen Sinn. Doch er ließ ihr keine Zeit, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Ich werde dafür sorgen, dass du nicht an einer Nierenintoxikation stirbst.«
Warum sollte sie an einer Nierenvergiftung sterben? Der Kerl nahm Begriffe in den Mund, die sonst nur Ärzte oder Krankenpfleger verwendeten. Kannte sie ihn aus der Pathologie oder einem anderen Institut? Es gab immer wieder Berührungspunkte mit anderen Abteilungen. Womöglich war er einer der knapp zehntausend Angestellten des Allgemeinen Krankenhauses Wien und ihr dort schon einmal über den Weg gelaufen.
Wie viel Zeit war verstrichen, seit er ihr das Anästhetikum injiziert hatte? Acht Stunden? Bestimmt wurde im Krankenhaus bereits nach ihr gesucht.
»Siehst du …« Er machte einen weiteren Schritt auf sie zu und senkte den Kopf. Das Licht fiel zu Boden. »Diese beiden Schläuche sorgen dafür, dass es zu keinem Rückstau kommt. Jeden zweiten Tag werde ich dir etwas zu essen und zu trinken bringen.«
Ihr Herz tat einen Satz. Sie wollte den Kopf senken, doch das ging nicht. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er einen dünnen Kunststoffschlauch aus den Fingern gleiten ließ, dessen Ende in einen Metalleimer plumpste.
»Einen Schmerz kann ich dir allerdings nicht nehmen.« Er atmete tief ein. Carmen bemerkte die Erregung in seiner verzerrten Stimme, als hätte er lange auf diesen Augenblick gewartet. »Ich weiß nicht, wann die Ankylose einsetzt, aber ich denke, schon bald werden sich deine Gelenke versteifen. Deine Wirbelsäule wird verknöchern, und deine Fingernägel werden in den Körper zurück wachsen. Doch davon wirst du nichts mehr mitbekommen.« Die Stimme klang, als lächelte er. »Platzangst und die psychische Belastung werden dich vorher in den Wahnsinn treiben.«
Sie brachte kein Wort heraus. Ihr Gedanke, ihn zu töten, war wie wegradiert. Er war gefährlich und verrückt. Langsam kroch Panik in ihr hoch. Vielleicht war doch alles nur ein Albtraum, dachte sie. Einer von der schlimmen Sorte, bei der man Gott dankt, dass er nicht real ist, sobald man erwacht.
»Ich brauche Wasser«, krächzte sie. Ihr Mund war vollkommen trocken.
»Morgen«, antwortete er.
»Was haben Sie mit mir vor?«
Er stand unmittelbar vor ihr und studierte ihre Gesichtszüge. Sie roch seinen Atem. »Hast du es noch nicht begriffen?«
Er trat einige Schritte zurück und langte nach oben. Sie sah nicht, was er herunterholte, hörte nur das Klirren einer Kette. Offensichtlich zog er an einem Flaschenzug.
»Der Mörtel war erst nach acht Stunden trocken. Danach habe ich den Block mit diesem Flaschenzug aufgestellt.«
Er ließ die Kette los und trat hinter Carmen. Das Licht seiner Stirnlampe fiel auf einen Spiegel, der am Ende der Kette baumelte. Der Schimmer wurde reflektiert und tanzte über die Wände. Rote Backsteinziegel. Kein Verputz. Das Gewölbe war leer und reichte nicht weit nach hinten – wie ein kleiner Weinkeller. Carmen glaubte Haken an der Steindecke zu erkennen.
»Ich hoffe, du gerätst bei deinem Anblick nicht in Panik. Denk immer daran: Dein Brustkorb ist eingeengt. Du kannst nur flach atmen! Je ruhiger du reagierst, desto besser. Sobald du hyperventilierst, erstickst du.«
Der Spiegel drehte sich, sodass sie für einen Augenblick ihr Gesicht sehen konnte.
Und sie sah … nur ihr Gesicht!
Angst, Panik und Wahnsinn stiegen zugleich in ihr hoch.
»Nein!«, rief sie. »Nein, bitte nicht … Gott, nein …!«
Ihre Gedanken überschlugen sich. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Seine Erklärungen über die Haut, die Niere, die Wirbelsäule, die Platzangst und den Venenzugang. Sie besaß tatsächlich keinen freien Venenzugang mehr.
In dem vor ihr baumelnden Spiegel sah sie eine zwei Meter hohe und etwa sechzig Zentimeter breite Betonsäule in einer zur Hälfte abgeschlagenen Holzverschalung. Nur ihr Gesicht, von der Stirn bis zum Kinn, ragte aus der grauen Oberfläche … und zwei Schläuche in Hüfthöhe.
»Nein!«, rief sie. »Nein, bitte nicht!«
Sie begann zu weinen. Unwillkürlich spannten sich ihre Muskeln an, als könnte sie damit den Beton sprengen, doch je mehr sie versuchte, sich zu bewegen, desto weniger Luft bekam sie. Sie konnte ihren Brustkorb nicht heben.
Bitte, helft mir!
Jemand musste kommen und den Betonblock mit einem Hammer zerschlagen, bevor sie wahnsinnig wurde.
»Hilfe!«, kreischte sie, so laut sie konnte, und japste nach Luft. »Bitte lassen Sie mich frei«, bettelte sie. »Bitte!«
Sie würde ihm nichts tun. Sie versprach, wenn er sie jetzt aus dem Beton befreite, würde sie nicht einmal Anzeige gegen ihn erstatten. Sie würde alles verzeihen und vergessen.
»Bitte!«
Er trat wieder nach vorne. An der Stirnlampe merkte sie, wie er unmerklich den Kopf schüttelte.
»Ich habe dir vorsorglich ein Breitband-Antibiotikum injiziert. Außerdem werde ich dich gelegentlich mit Vitamintabletten versorgen, aber du wirst dennoch an Rachitis erkranken.« Er leuchtete ihr ins Gesicht. »Und deine Augen werden unter Fotophobie zu leiden beginnen.«
Zunächst begriff sie nicht, worauf er hinauswollte, da sie nur ihr Keuchen hörte und in Gedanken immer noch ihr entsetztes Gesicht sah. Doch er wiederholte seine Worte.
Vitaminmangel und Lichtempfindlichkeit? Diese Effekte würden sich erst nach Wochen einstellen. Wie lange wollte er sie in diesem Block gefangen halten?
Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie spürte den salzigen Geschmack auf den Lippen. »Wann lassen Sie mich hier raus?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich werde beobachten, wie du die nächsten Monate überlebst.«
Monate? Sechzig oder neunzig Tage? Ein halbes Jahr vielleicht! Sie war wie paralysiert. Dennoch blieb ein winziges Detail in ihrem Bewusstsein hängen.
Er hatte nicht gesagt, ob sie die nächsten Monate überlebte, sondern wie.
Wie?
In Angst und Wahnsinn!
»Bitte nicht! Sie müssen das nicht tun!«
»Oh!« Er neigte den Kopf. »Ich habe es schon getan.«
»Warum ausgerechnet ich?«
»Vielleicht kommst du von selbst drauf.«
»Warum, um Himmels willen?«
Plötzlich veränderte sich seine Stimme. Sie wurde heller, wie die eines Mädchens, das einen Kinderreim aufsagte.
Nein, das konnte alles nicht wahr sein. Carmen schloss die Augen und betete in Gedanken, endlich aufzuwachen, flehte immer intensiver, um die Stimme dieses Mannes nicht mehr hören zu müssen.
Bitte, lieber Gott. Mach, dass dieser Block umfällt und zerspringt! Mach, dass ich in meinem Bett aufwache und am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen darf. Bitte!
Doch Gott erhörte sie nicht.
Stattdessen nahm sie wahr, wie der Mann sich von ihr entfernte, die Metalltür schloss, die Kette durch den Griff zog und die Treppe hochstieg.
Der Kinderreim begleitete ihn, Stufe um Stufe …
Ob der Philipp heute still,wohl bei Tische sitzen will?Also sprach in ernstem Ton,der Papa zu seinem Sohn.
Doch der Philipp hörte nicht,was zu ihm der Vater spricht.Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt,auf dem Stuhle hin und her,Philipp, das missfällt mir sehr!
Und plötzlich wusste sie, wer sie entführt hatte.
1. Teil
Zwei Monate später
Sonntag, 22. Mai, bis Montag, 23. Mai
»Die Welt ist genau genommenein ziemlich riskanter Ort.Jede Menge schlimmer Dinge könneneinem da draußen zustoßen,und oft tun sie das auch.«
ANNA SALTER
1
Kerstin, Connie und Fiona richteten sich gleichzeitig im Bett auf. Die Kopfkissen und Teddybären flogen zur Seite.
»Was erzählst du uns morgen für eine Geschichte, Tante Bine?«, rief Kerstin aufgeregt.
Sabine hasste es, »Tante« genannt zu werden. Das machte sie alt, und mit sechsundzwanzig Jahren war sie das bei Gott nicht. »Morgen habe ich keinen Nachtdienst. Da bin ich zu Hause und erhole mich von euch Gören«, antwortete sie.
»Übermorgen!«, riefen die drei wie aus einem Mund.
Die Töchter ihrer Schwester – vier, fünf und sieben Jahre – sahen mit den blonden Mähnen nicht nur wie drei Orgelpfeifen aus, sondern konnten auch richtige Nervensägen sein.
»Übermorgen, Tante Bine, was erzählst du uns da?«, ließen sie nicht locker.
Sabine ging zum Fenster. Der Horizont lag bereits im orange-blauen Dämmerlicht. Bald würde ihr Dienst beginnen. Die Münchner Frauenkirche war beleuchtet. Die Hauben der beiden kraftvollen Türme ragten in weiter Ferne über die Hausdächer. Plötzlich erfasste sie ein dumpfes Gefühl im Magen, als stürbe ein Teil von ihr ab. Sabine schluckte den bitteren Geschmack runter. Sie wusste nicht, warum, aber der Anblick der Kirche erinnerte sie an den Tod. Rasch zog sie den gelben Spongebob-Vorhang zu. »Nächstes Mal bekommen wir einen Auftrag vom Vatikan.«
»Vom Papst?«, rief Fiona, die Älteste. »Warum?«
Sabine wusste nicht, was mit ihr los war. Sie versuchte sich selbst aufzuheitern. »Bald ist Pfingsten. Der Papst reist viel herum und braucht unser Team für einen besonders schwierigen Security-Auftrag.«
»Wo fahren wir hin?«
»Fahren?« Sabine hob die Augenbrauen. »Wir fliegen! Und zwar mit den schnellsten Helikoptern, die wir haben. Neu entwickelt, in unserem Geheimlabor.«
»Ist ja krass! Warum hat der Papst gerade uns gefragt?«
Fiona stieß ihrer Schwester den Ellenbogen in die Seite. »Weil wir die beste Ausrüstung haben!«
»Genau«, bestätigte Sabine. »Nachtsichtgeräte, Schutzwesten, Mikro-Funkgeräte.«
»Wow!«, rief Fiona. Kerstin machte große Augen. Connies Mund stand offen.
Es klopfte an der Tür, und Sabines Schwester lugte ins Kinderzimmer. »Schlafenszeit. Sagt gute Nacht zu Sabine.«
»Übermorgen arbeiten wir für den Sabst!«, rief Connie, die Kleinste, aufgeregt.
»Psst!« Sabine schüttelte unmerklich den Kopf. »Ein Geheimauftrag«, flüsterte sie. »Kein Wort zu eurer Mutter, sonst ist sie in Gefahr.«
»Oh, krass!«, riefen die Mädchen.
Sabine umarmte ihre Nichten und gab jeder einen Kuss. Dann schaltete sie das Licht aus, ließ die Tür einen Spaltbreit offen und ging zu ihrer Schwester in den Vorraum.
Monika schüttelte mit gespielter Empörung den Kopf. »Was erzählst du denen nur immer für Geschichten?«
»Sie lieben solche Storys.«
»Ich weiß«, seufzte Monika. »Mit meinen Feen-, Elfen- und Prinzessinnen-Geschichten kann ich einpacken. Aber übertreib es nicht!«
Obwohl Sabines um drei Jahre ältere Schwester schief am Türstock lehnte, war sie immer noch einen halben Kopf größer als sie. Kaum zu glauben, dass sie Schwestern waren. Sabine war zwar nur einen Meter sechzig groß, aber zum Glück hatte Gott sie mit einem trainierten, drahtigen Körper gesegnet. Sie nannte es ausgleichende Gerechtigkeit. Während ihre Schwester die Lehre als Verkäuferin abgebrochen hatte und nun halbtags Audioguide-Kopfhörer an die Besucher des Stadtmuseums verteilte, war Sabine in ein Sportgymnasium gegangen und hatte bis heute nicht aufgehört zu trainieren. Joggen, Pilates und Mountainbiken. Einige Kollegen neckten sie – ob sie damit ihre Größe kompensieren wolle. Pfeif drauf! Sie musste in ihrem Job fit bleiben.
Monika strich Sabine über die dunkelbraunen Haare und ließ eine gefärbte Strähne durch die Finger fließen. »Der silberne Streifen steht dir gut.«
»Ich weiß, danke. Aus Marokko, von unserem letzten Einsatz mit dem Security-Team. Kerstin will auch eine.«
»Oh Gott.« Als Monikas Blick auf das goldene Herz-Medaillon an Sabines Hals fiel, wurde sie ernst.
Vaters Geschenk. Sabine trug es seit der Trennung ihrer Eltern vor zehn Jahren, als sie mit Mutter von Köln zurück nach München gezogen waren. Sie wusste, was in ihrer Schwester vorging. Seit der Scheidung ihrer Eltern hatte Monika kein gutes Haar an Vater gelassen und alles aus ihrem Leben verbannt, was sie an ihn erinnerte. Sie wollte einfach nicht verstehen, dass Sabine noch an ihrem Vater hing. Dabei war es so einfach: An einer Trennung trug nie einer allein die Schuld. Gerade Monika hätte das am besten begreifen müssen.
»Hast du den Unterhalt für diesen Monat schon bekommen?«, fragte Sabine.
Monika ließ ihr Haar los. »Er ist drei Monate im Rückstand.«
»Kuhscheiße!«, fluchte Sabine. Ihr Exschwager war ein Arschloch.
»Leise!« Monika schmunzelte und deutete zur angelehnten Kinderzimmertür. »Die Gören sagen das auch schon.«
»Uh …« Sabine verzog das Gesicht. Dann wurde sie wieder ernst. »Soll ich was unternehmen?«
»Nein, Gabriel wird schon zahlen.«
Sabine nickte. Sie nahm ihre Dienstwaffe von der Kommode und steckte sie ins Holster. Am liebsten würde sie Gabriel einen Besuch abstatten. Ihre Schwester kämpfte sich als alleinerziehende Mutter mit den drei Mädchen gerade mal so durchs Leben – mit einem Teilzeitjob im Museum und einer fünfzig Quadratmeter großen Wohnung. Sie schlief auf der Wohnzimmercouch, während sich die Mädchen das Schlafzimmer teilten. Aber der Herr Anwalt rückte keinen Cent raus.
Sabine stopfte ihren Geldbeutel in die Jackentasche und schnürte die Schuhe zu. »Wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an – ich habe Nachtdienst und bin auf dem Revier zu erreichen.« Sie steckte die Dienstmarke an den Hosenbund und zog die Jacke zu. Der Saum verbarg die Walther und das Reservemagazin am Hosengürtel.
»Ich weiß, Kleine.« Monika umarmte sie und drückte sie länger als sonst. »Danke. Ohne dich würde ich wahnsinnig werden.«
»Es wird schon. Morgen kommt Mutter zu Besuch und passt auf die Mädchen auf, nicht wahr?«
Monika nickte. »Wie geht’s Mutter übrigens? Du warst doch Freitagabend mit ihr wieder bei diesem komischen Kurs?«
Der Pilateskurs war nicht komisch, bloß die Vortragende. Eine fünfzigjährige Bohnenstange. Da spürte Sabine erneut dieses merkwürdige Gefühl im Magen. »Ich musste absagen. Hatte viel um die Ohren und fühlte mich nicht besonders.«
»Ups.« Monika hob die Augenbrauen. »Wie hat der alte Drachen reagiert? Ist er allein hingegangen?«
»Du weißt doch, wie Mutter ist. Wahrscheinlich nicht. Ich habe ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass ich eine Parkemedtablette nehme und mich im Bett verkrieche. Seither habe ich nichts von ihr gehört.«
»Sie hat dich nicht mal zurückgerufen? Untypisch für Mutter.«
Wie wahr! Seit Tagen plagte Sabine das schlechte Gewissen, weil sie im Pyjama auf der Couch eine Doppelfolge der Tricks der großen Magier gesehen hatte und eingepennt war, statt zum Turnen zu gehen. Andererseits war ihre Mutter eine selbstständige Frau, um die sie sich nicht kümmern musste. »Wenn sie morgen kommt, gib ihr einen Kuss von mir. Wir holen Pilates diesen Freitag nach.«
»Okay, mach ich – und jetzt Abmarsch!« Monika gab ihr einen Klaps auf den Po. »Nimm die Schurken fest … im Polizeigriff!« Monika schnitt eine böse Grimasse und krümmte die Finger zu Krallen.
Sabine fuhr mit dem Fahrstuhl hinunter und verließ das Mietshaus, in dem ihre Schwester wohnte. Abends war die Gegend um den Ostbahnhof nicht so prickelnd. Ihr Wagen stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite unter einer flackernden Straßenlaterne. Als sie die Autotür öffnen wollte, stürzte aus dem Schatten der Bäume ein Mann auf sie zu.
»Eichhörnchen!«
Sabine nahm die Hand von der Dienstwaffe. »Vater?« Was machte er in München?
Ihr Vater sah schrecklich aus. Der Schatten eines Dreitagebarts verdunkelte sein Gesicht. Seine Augen lagen in tiefen Höhlen, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen.
»Ich bin zu deiner Wohnung gefahren, aber du warst nicht da. Auf dem Revier haben sie gesagt, dass dein Dienst bald beginnt – ich dachte mir, dass du bei Monika bist.«
Sabine blickte auf die Uhr. Es war kurz nach acht. Sie musste auf ihre Dienststelle. »Warum bist du nicht in mein Büro gekommen?«
Tränen liefen ihm über die Wangen.
»Vater, um Himmels willen, was ist passiert?«
Er schloss sie in die Arme und drückte sie an sich. »Es tut mir leid, Eichhörnchen!«
Seit ihrem dritten Lebensjahr nannte er sie wegen ihrer vollen braunen Haare und großen braunen Augen »Eichhörnchen«. Als Teenager war ihr das peinlich gewesen, heute, als einer erwachsenen Frau, noch viel mehr.
»Die Silbersträhne steht dir gut«, krächzte er, dann liefen ihm wieder Tränen übers Gesicht.
»Danke.« Sie strich ihm über die Schulter. »Beruhige dich, was kann so schlimm sein, dass du …?«
»Deine Mutter wurde vor zwei Tagen entführt.«
»Was?« Sie befreite sich aus seiner Umarmung. »Woher weißt du das?«
Er wischte sich über die Bartstoppeln. Seine Hände zitterten. Er hatte nichts mehr mit dem rüstigen Sechzigjährigen zu tun, der in seiner Freizeit immer noch an alten Zügen herumschraubte, sondern wirkte um Jahre gealtert.
Entführt? Wer zum Teufel sollte Mutter entführen?
Die Situation kam ihr bizarr vor. Vor zwei Tagen hatte sie mit ihrer Mutter zum Pilateskurs gehen wollen und ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und plötzlich stand ihr Vater, der fünfhundert Kilometer entfernt in Köln wohnte, vor ihr.
Sabine zog das Diensthandy aus der Tasche und wählte die Nummer ihrer Mutter. Die Mobilbox sprang an. Sie wählte die nächste Nummer. Auf dem Festnetzanschluss aktivierte sich nach dem achten Klingelton der Anrufbeantworter.
»Seit wann weißt du, dass Mutter entführt worden ist?«
»Er hat mich vor achtundvierzig Stunden angerufen.«
Er? Ungläubig sah sie ihren Vater an. »Du hattest Kontakt zu dem Entführer?« Sie steckte das Handy weg. »Hast du die Kölner Kripo informiert?«
»Ich habe mit niemandem darüber gesprochen.«
»Bist du wahnsinnig?«, entfuhr es Sabine. Sie durfte jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Von ihrem Job beim Kriminaldauerdienst wusste sie, dass Zeugen die einfachsten Fakten durcheinanderbrachten, sobald eine Flut von Fragen auf sie einprasselte. Trotzdem musste sie sich zusammenreißen, um nicht wild draufloszufragen.
»Du steigst jetzt in den Wagen und erzählst mir alles der Reihe nach. Wir fahren auf meine Dienststelle.«
»Nein! Er hat gesagt, er tötet sie, falls ich die Polizei einschalte.«
Töten? Sabine sah sich auf der Straße um. Einige Autos fuhren an ihnen vorbei, nur wenige Passanten gingen auf dem Bürgersteig. Sie senkte die Stimme. »Glaubst du, dass er uns beobachtet?«
»Ich weiß nicht … wahrscheinlich nicht mehr.«
Nicht mehr!
»Vater, bitte! Steig jetzt in den Wagen. Auf der Fahrt zum Revier erzählst du mir alles.«
Widerwillig stieg er ein. Als sie losfuhr, schaltete sich automatisch der CD-Player ein. Eine sonore Erzählstimme drang aus den Boxen. Ein Hörbuch von David Safier, Jesus liebt mich. Sabine knipste das Gerät aus.
Sie befanden sich schon auf der Rosenheimer Straße Richtung Isar, als sie kurz zu ihrem Vater rüberblickte. »Schnall dich bitte an.«
Mit zittrigen Fingern zog er den Gurt aus der Rolle. »Der Mann hat mich vor zwei Tagen zu Hause angerufen. Er hat seine Stimme irgendwie elektronisch verstellt und gesagt: Herr Nemez, wenn Sie innerhalb von achtundvierzig Stunden herausfinden, warum Ihre Exfrau entführt wurde, bleibt sie am Leben. Wenn nicht, stirbt sie.«
»Das waren seine Worte?« Es musste sich um ein Missverständnis handeln.
Vater nickte. »Als einzigen Hinweis habe ich eine Schachtel vor meiner Wohnungstür gefunden. Darin lag ein kleines, schwarzes Tintenfässchen.«
»Du hast es doch nicht angefasst?«
»Natürlich schon. Ich habe es geöffnet. Es ist schwarze Tinte drin.«
»Du hättest nichts berühren dürfen und mich sofort anrufen müssen. Wir hätten eine umfangreiche Suche eingeleitet.«
Hätte, hätte, hätte …
»Er hat gesagt, er tötet sie!«
»Vielleicht stimmt das gar nicht, und jemand …«
»Sabine!«, unterbrach er sie. »Ich habe ihre Stimme am Telefon gehört. Sie hat um Hilfe gefleht. Dann hat er sie weggezerrt.«
Sabine schnürte es die Kehle zusammen. Das sah nicht gut aus. Mutter hätte Vater nie um Hilfe gebeten. »Versuch, dich zu erinnern. Wann genau laufen die achtundvierzig Stunden ab?«
»Sie sind schon abgelaufen«, antwortete er leise.
Sabine sah, dass er die Digitaluhr im Armaturenbrett suchte. »Er hat mich vor knapp fünfzig Minuten wieder angerufen und mir noch mal dieselbe Frage gestellt. Dann sagte er, die Frist wäre abgelaufen, und hat aufgelegt.«
Sabine fuhr auf der Ludwigsbrücke über die Isar. Der Sonntagabendverkehr war nicht so zäh wie sonst, trotzdem nervten sie die langsam dahinzuckelnden Autos. Sie griff zum Walkie-Talkie und funkte ihr Revier an. Kolonowicz, der Nachtschichtleiter vom Kriminaldauerdienst, meldete sich mit sonorer Stimme.
»Hallo Walter, Sabine Nemez hier«, unterbrach sie ihn. »Vor knapp neunundvierzig Stunden wurde eine Frau entführt. Hanna Nemez, sechsundfünfzig Jahre alt, wohnte bis vor zehn Jahren in Köln, seither wohnhaft in der Winzererstraße, Schwabing-West, ehemalige Grundschuldirektorin, jetzt im Ruhestand. Wir müssen sofort nach ihr fahnden.«
Der Mann am anderen Ende sagte einen Moment lang nichts. Offensichtlich notierte er die Daten. Dann räusperte er sich. »Bine, sprichst du von deiner Mutter?«
»Ja. Ich bin auf dem Weg ins Dezernat.«
Er räusperte sich wieder, als überlegte er. »Ich will dich nicht beunruhigen, aber vor einigen Minuten kam eine Meldung herein. Der Priester des Doms und sein Mesner haben die Leiche einer älteren Frau im Hauptschiff gefunden.«
»Oh nein!« Ihr Vater presste die Hände auf den Mund. Wieder liefen ihm Tränen übers Gesicht.
Der erzbischöfliche Dom war Münchens Wahrzeichen. Das Polizeipräsidium, die Dezernate und Sabines Dienststelle lagen in der Ettstraße, gerade mal ein paar Gehminuten von der Frauenkirche entfernt. Sie kannte eine Abkürzung dorthin. Abrupt trat sie auf die Bremse und fuhr quer über den Ring in die nächste Seitengasse Richtung Altstadt. Reifen quietschten, und hinter ihr hupten Autos. Ihr Vater klammerte sich an den Haltegriff. Zwischen den Dächern der Häuserschlucht lugten bereits die beleuchteten Türme des Doms mit ihren gewaltigen Hauben hervor.
»Wir wissen noch nicht, wer sie ist«, fügte Kolonowicz rasch hinzu.
Aber Sabine ahnte es.
2
Jung blieb man dann, wenn man an der Zukunft zumindest genauso viel Freude hatte wie an der Vergangenheit – dieser Spruch traf auf Sabines Vater mehr zu als auf jeden anderen Menschen, den sie kannte. Doch nun sah sie in seinen verquollenen Augen die Schmerzen der letzten Tage. Ihre Eltern hatten sich nach einem hitzigen Geld- und Sorgerechtsstreit scheiden lassen. Seither hatte Sabine gedacht, ihr Vater wäre über die Trennung hinweggekommen, hätte seine Exfrau vergessen können – doch in diesen Minuten merkte sie, dass er sie maßlos vermisste.
Sabine parkte in zweiter Reihe am Beginn der Fußgängerzone und legte die grüne Plastikhülle mit dem Ausweis des Kriminaldauerdienstes auf die Armaturenablage.
»Warte hier«, sagte sie und stieg aus.
»Darfst du da überhaupt rein, Eichhörnchen?«, rief er ihr nach.
»Papa, ich bin Kommissarin.« Mit sechsundzwanzig Jahren war sie die jüngste Kommissarin vom Münchner Kriminaldauerdienst. Als Bindeglied zur Kripo wurden sie oft »die Feuerwehr der Polizei« genannt. Noch bevor ein Kripobeamter zum Tatort kam, hatten sie bereits sämtliche Spuren gesichert, die Todesursache festgestellt und die Zeugen befragt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!