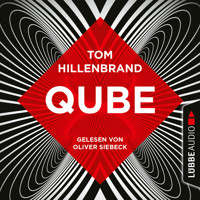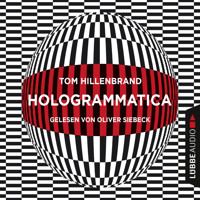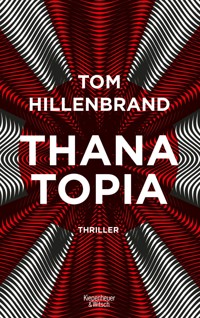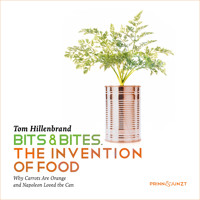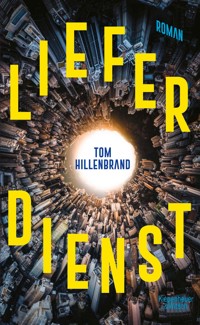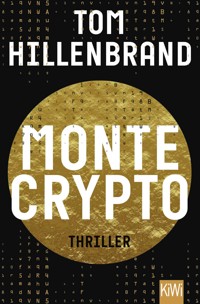9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Xavier-Kieffer-Krimis
- Sprache: Deutsch
»Schlitzohr in Kochschürze – Xavier Kieffer hat es faustdick unter der Kochmütze.« Saarländischer Rundfunk Einmal im Jahr gönnt sich der Koch und Gourmet Xavier Kieffer einen Ausflug nach Italien. Gemeinsam mit seinem Schulfreund, dem Wein- und Ölhändler Alessandro Colao, fährt er in die Toskana, unternimmt Weinproben und fährt einige Tage darauf mit einem Laster voller Wein und Öl zurück nach Luxemburg. Diesmal geht der Trip allerdings gehörig schief. Sein Freund versetzt ihn und Kieffer findet heraus, dass Alessandro bereits Tage zuvor ohne ihn nach Italien aufgebrochen ist – und seither hat niemand etwas von ihm gehört. Der Koch macht sich auf die Suche. Aber statt Alessandro findet er eine verlassene Mühle, Tanks voll seltsam riechenden Olivenöls und bewaffnete Männer, die gerade Öl in einen Lastwagen pumpen. Hat der Ölhändler krumme Geschäfte getätigt? Kann Kieffer seinen Freund finden, bevor es zu spät ist? Entdecken Sie die versteckten Geheimnisse der Olivenhaine und erfahren Sie mehr über die faszinierende Welt des Kochens und Genießens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Tödliche Oliven
Ein kulinarischer KrimiXavier Kieffer ermittelt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, geb. 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE. Seine Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet, sind in viele Sprachen übersetzt und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Einmal im Jahr gönnt sich der Koch und Gourmet Xavier Kieffer einen Ausflug nach Italien. Gemeinsam mit seinem Schulfreund, dem Wein- und Ölhändler Alessandro Colao, fährt er in die Toskana, besucht Weingüter und Ölmühlen – und kehrt einige Tage später mit einem Laster voller Wein und Öl zurück nach Luxemburg. Diesmal geht der Trip allerdings gehörig schief. Sein Freund versetzt ihn und Kieffer findet heraus, dass Alessandro bereits Tage zuvor ohne ihn nach Italien aufgebrochen ist – und seither hat niemand etwas von ihm gehört. Der Koch macht sich auf die Suche. Aber statt Alessandro findet er eine verlassene Mühle, Tanks voll seltsam riechenden Olivenöls und bewaffnete Männer, die Öl in einen Lastwagen pumpen. Hat Alessandro krumme Geschäfte getätigt? Kann Kieffer seinen Freund finden, bevor es zu spät ist?
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Epilog
Glossar: Küchenlatein
Dank
Leseprobe zu Tom Hillenbrand - Gefährliche Empfehlungen
Für Klaus & Sabine
Prolog
Donnernd brach sich die riesige Welle auf dem Vorderdeck. Das Geräusch übertönte für einen Moment alles andere: das Fauchen des Windes, das Prasseln des Regens, das Stampfen der Dieselmotoren. Erst als es abebbte, konnte Cesare Olbi wieder den Rest des Sturmorchesters hören, in das sich nun jedoch noch ein weiterer Ton hineinmischte, ein metallischer Ton, der ihn an einen menschlichen Seufzer erinnerte. Sie singt, dachte Olbi. Sie singt eine Arie, und der Sturm begleitet sie.
Katzakis, Olbis Erster Offizier, legte den Kopf schief und lauschte ebenfalls. Dann blickte er von der Brücke hinaus in die Dunkelheit. Als er sich Olbi wieder zuwandte, waren seine Augen vor Furcht geweitet. »Ich bin mir nicht sicher, ob sie das lange aushält, Käptn.«
»Ach, das ist nichts. Sie strengt sich an, deshalb keucht sie ein bisschen. Sturmmusik.«
Katzakis war ein Hasenfuß, das hatte Olbi schon gewusst, als sie in Izmir abgelegt hatten. Außerdem besaß der Grieche zu wenig Erfahrung. Sein Patent war quasi druckfrisch; bevor er auf der Grazia II angeheuert hatte, war Katzakis die meiste Zeit auf irgendwelchen Ausflugsdampfern die Kykladen rauf- und runtergeschippert. Er hatte keine Ahnung, wie es auf hoher See zuging, auf einem richtigen Frachtschiff. Olbi hingegen fuhr seit fast dreißig Jahren Ladungen zwischen Izmir und Bari hin und her, er kannte sich aus. Ihr Schiff mochte mehr als 40 Jahre auf dem Buckel haben, und es musste zugegebenermaßen dringend in die Werft. Aber die Grazia II war für die Weltmeere konstruiert worden, sie konnte viel mehr wegstecken als dieses Stürmchen. Das Mittelmeer war letztlich eine große Badewanne, in der es ziemlich betulich zuging. Es war viel Pech und noch mehr Dummheit nötig, um hier in Seenot zu geraten.
Eine weitere, mindestens zehn Meter hohe Welle baute sich vor ihnen auf. Die Grazia II neigte sich nach vorne, dann traf der Brecher das Vorschiff. Während das Wasser über das Deck schoss, ging erneut ein lang gezogener Seufzer durch den Frachter. Olbi beobachtete seinen Ersten Offizier. Katzakis gefiel der Sturmgesang der Grazia überhaupt nicht, er hatte die Hosen gestrichen voll, das war offensichtlich. Aber zumindest versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen und machte weiter seinen Job. Furchtlos ist er nicht, mein kleiner Grieche, dachte Olbi. Aber er hat Schneid und Schneid ist in diesem Job die halbe Miete. Pinne gerade, Bug im rechten Winkel zur Welle halten, den Rest erledigen der liebe Gott und das Schiff.
Katzakis zeigte mit dem Finger Richtung Backbord. In der Ferne war ein schwaches Licht zu erkennen. »Ist er das?«, fragte er.
Olbi schaute auf das Radar und brummte zustimmend. »Ja, das ist Demir. Sieht aus, als ob er auch nicht besser vorankommt als wir.«
Er griff nach dem Funkgerät und drückte den Sprechknopf. »Grazia I, hier Grazia II, bitte kommen.«
»Hier … zzz … razia I … Zzz. Meine Jungs … itzen auf dem … zzz Sonnendeck … deine auch, Cesare?«
Olbi lachte dröhnend. Katzakis rang sich immerhin ein Lächeln ab. »Siehst du, Nikos? Kapitän Demir hat auch keine Angst vor diesem kleinen Orkan.«
Der Kapitän ihres Schwesterschiffs fuhr die Route schon fast so lange wie Olbi. Schade, dass Demir bald aufhören würde. Zwar war er erst 50, aber er wollte sich demnächst zur Ruhe setzen, irgendwo in Antalya, das hatte er Olbi erzählt. Der Türke hatte geerbt, ein kleines Vermögen stand vor der Auszahlung – so viel Glück hätte er auch gerne gehabt. Stattdessen würde er wohl bis zur Pensionierung zwischen Apulien und Anatolien hin- und herfahren müssen. Nun, es gab Schlimmeres.
»Hallo, Yüksel! Fürs Sonnenbaden ist es uns zu nass. Aber ich habe den Jungs gesagt, sie sollen ihre Ruten raushängen – in dieser Gegend gibt es noch Thunfische, und bei dem Regen beißen sie gut.«
Aus dem Funkgerät kam ein knirschendes Geräusch, vermutlich Demirs Lachen. »Aber … nsthaft, … Cesa … zzz … etterdienst gesehen? … zzz … och schlimmer. Medicane.«
Olbi schüttelte den Kopf. Jetzt fing Demir auch schon mit diesem Unsinn an. In den vergangenen Jahren waren die Frühlingsstürme im Mittelmeer heftiger geworden, aber es waren immer noch gewöhnliche Stürme. Irgendein bescheuerter Meteorologe hatte sich dafür jedoch ein neues Wort ausgedacht: Medicane, kurz für Mediterraner Hurricane. Es klang, als wirbelten neuerdings riesige Windhosen über das Mittelmeer.
»Ach was, Yüksel. Ist nur ein ganz normaler Sturm. Geht vorbei. Pass auf, wir wetten.«
»Was … zzz … wett …?«
»Wer zuletzt in Bari ankommt, muss nicht nur das Essen im ›Al Castello Svevo‹ zahlen, wie üblich. Sondern außerdem eine Flasche richtig guten Barolo. Bist du dabei?«
»Zw … ich … zzz … ich …arte.«
»Was sagst du, Yüksel?«
»Roger. Aber, … zzzz um zwei Flaschen.«
»Warum zwei?«
»Damit ich genug … zzz … trinken hab …, während … zzz … auf dich warte.«
Olbi lachte. »Roger that!« Dann kappte er die Verbindung. »Yüksel Demir ist ein feiner Kerl und ziemlich komisch. Du kommst mit ins ›Svevo‹, Nikos, dann stelle ich ihn dir vor. In zwei, drei Stunden flaut der Sturm ab, du wirst schon sehen. Spätestens morgen Abend sind wir in Bari.«
Katzakis antwortete nicht. Stattdessen betrachtete er das Display mit den Wetterdaten.
»Was sagt der Ticker?«
»Demir hat recht, Käptn. Meteo AM hat den Sturm gerade hochgestuft. Das Zentrum liegt vor uns, sechs Kilometer, Nordnordwest. Vielleicht sollten wir versuchen, es zu umfahren.«
»Leichter gesagt als getan. Bei diesen Brechern können wir unseren Kurs schlecht ändern. Wenn uns einer von der Seite trifft …«
»Ich weiß, Käptn. Aber sobald Wolfgang etwas nachlässt, sollten wir …«
»Wolfgang? Ist das der Name des Sturms?«
»Ja, Käptn.«
Stürmen Männernamen zu verpassen, das war auch so eine dämliche Meteorologenidee. Jahrzehntelang waren sie weiblich gewesen und das zu Recht. Man konnte jeden Seemann fragen, der einmal tagelang durch schweres Wetter gefahren war, ob Stürme eher einem wütenden Mann oder einer wütenden Frau glichen – die Antwort war klar. Aber diese Typen, die Stürme nur aus den Ausdrucken ihrer Messstationen kannten, hatten eben keine Ahnung. Ein Medicane namens Wolfgang, Herrgott. Als Nächstes würde irgendein Idiot auf die Idee kommen, zu behaupten, Schiffe seien ebenfalls männlich.
Eine weitere Welle donnerte auf die Grazia II hernieder. Olbi fiel auf, dass sie sich nicht auf dem Vorder-, sondern erst auf dem Mittschiff brach. Sie war ganz eindeutig höher als die vorherigen. Wieder ächzte der Tanker, doch diesmal schien der Ton höher und länger anhaltend zu sein.
»Ganz ruhig, mein Mädchen«, murmelte Olbi, »bald ist das Schlimmste vorbei.«
Er holte sich eine Umgebungskarte auf den Schirm und überprüfte ihre genaue Position. Zwar gab es keinen wirklichen Grund zur Besorgnis, aber es wäre fahrlässig gewesen, sich nicht auf das Schlimmste vorzubereiten. Ihr Schiff stieß gerade vom Ionischen Meer in die südliche Adria vor. Östlich von ihnen lag die albanische Küste, im Westen die Apuliens. Wegen des starken Nordwinds kamen sie seit Stunden kaum von der Stelle. Der nächste Hafen, den sie von hier aus ansteuern konnten, war Durrës. Dazu hätten sie die Grazia II jedoch wenden müssen, um etwa 45 Grad, um auf einen Ostnordost-Kurs zu kommen. Das war es, was Olbis Erster Offizier vorgeschlagen hatte. Das Schiff bei diesem Seegang parallel zu den Wellen zu stellen, war jedoch mehr als riskant. Ein Brecher wie jener, der gerade über sie niedergegangen war, konnte es zum Kentern bringen.
Die Alternative bestand darin, die Grazia II auf Kurs zu halten. Olbi sah sich erneut ihre Position an. Eigentlich hätten sie sich weiter westlich befinden müssen, näher an der italienischen Küste, aber der Sturm verhinderte nicht nur ihr Vorwärtskommen, er trieb sie gleichzeitig auch nach Osten ab, und zwar erheblich.
Katzakis beobachtete ihn. »Was haben Sie vor, Käptn?«
»Wir halten Kurs. Der Sturm drückt uns nach Osten, in Richtung albanischer Küste. Wenn er nachlässt, geht es weiter wie nach Plan. Wenn er anhält, bewegen wir uns allmählich in Richtung Durrës. Das wäre ohnehin der Hafen, den wir im Notfall anlaufen würden.«
Er musterte Katzakis. Der Junge sah bleich aus.
»Aber wir haben keinen Notfall«, sagte Olbi und schaute seinem Offizier dabei in die Augen. »Und wir kriegen auch keinen.«
Dann wandte er sich ab und konzentrierte sich auf die See vor ihnen. Er bildete sich ein, dass die Wellen, die auf das Vorderdeck herniederstürzten, wieder kleiner wurden. Das Seufzen und Ächzen des Schiffes hielt unverändert an. Olbi dachte an sein Stammrestaurant in der Altstadt von Bari. Er würde die Meerbrasse bestellen. Der Koch grillte sie mit Fenchelsamen und Thymian. Davor würde er die Panzanella in Agrodolce essen, wie jedes Mal, wenn er im ›Al Castello Svevo‹ einkehrte. Er lächelte. Mit etwas Glück würde er für dieses Festmahl nicht einen Cent zahlen. Er beugte sich über den Radar.
»Siehst du Demir, Nikos? Haben wir ihn schon abgehängt?«
Statt zu antworten, zeigte der Erste Offizier mit dem Zeigefinger in Richtung Bug.
Olbi blickte hinaus, sah vor ihnen aber nichts. Er schüttelte den Kopf und suchte auf dem Radar nach ihrem Schwesterschiff, konnte es jedoch nirgendwo erkennen.
»Kann nicht sein. Wie soll er denn in so kurzer Zeit an uns vorbei …«
Aus dem Augenwinkel fiel ihm auf, dass Katzakis einige Schritt zurückgewichen war und immer noch nach vorn zeigte.
»Nikos, was zum Teufel …«
Kapitän Cesare Olbi schaute in Richtung Bug und suchte den Himmel erneut nach den Positionsleuchten des anderen Schiffs ab. Er fand keine. Erst jetzt bemerkte er, dass es daran lag, dass der Himmel verschwunden war. Dann sah er den Kamm der riesigen Welle. Instinktiv warf er seinen rechten Arm vors Gesicht. Olbi hörte ein ohrenbetäubendes Donnern, gefolgt von einem lauten Kreischen. Er war sich nicht sicher, ob es von Katzakis stammte oder von der Grazia II, die ein letztes Mal aufschrie.
1
Xavier Kieffer entnahm dem Kühlschrank etwas, das wie eine in Plastik eingeschweißte Wurst aussah. Als er die Verpackung öffnete, kam ein längliches, hellgelbes Ding zum Vorschein. Der Koch legte es auf ein Schneidebrett und griff nach seinem Chefmesser.
Der neben ihm am Pass stehende Pekka Vatanen betrachtete ihn voller Argwohn.
»Sieht aus wie Moltofill.« Der Finne drückte seinen Zeigefinger in die Substanz. Eine kleine Delle bildete sich. »Und fühlt sich auch genauso an.«
»Schmeckt hervorragend, du wirst schon sehen«, erwiderte Kieffer.
»Sicherlich eine kulinarische Offenbarung. Aber könnte ich nicht doch lieber ein Stück von deiner Rieslingspaschtéit …«
»Oh nein, Pekka. So haben wir nicht gewettet.«
Gewettet hatten sie in der Tat. Es war Freitag vor zwei Wochen gewesen, als er und Vatanen wie so oft in der Laube von Kieffers Haus in Grund gesessen und das eine oder andere Glas Wein getrunken hatten. Der Finne hatte dem Koch von seiner neuesten Eroberung erzählt, einer Südfranzösin, die wie er beim Europäischen Parlament arbeitete. Vatanen hatte ihm versichert, er sei in lauterer Liebe entbrannt, dies sei die Frau seines Lebens. Ähnliches hört der Koch von seinem Freund jedoch alle paar Monate. Und so hatte er gewettet, dass der Finne die Französin bald in den Wind schießen würde, was dieser natürlich empört von sich gewiesen hatte.
Kieffer war sich seiner Sache sicher gewesen, denn Vatanen war ein Schwerenöter. Aber dass er seine Wettschulden nicht einmal vierzehn Tage später eintreiben konnte, hatte ihn dann doch überrascht.
Er stellte einen kleinen kupfernen Topf auf die Platte und goss etwas Wasser hinein. »Ich darf dich an unsere Abmachung erinnern, Pekka. Hätte ich verloren, hätte ich diesen verrotteten finnischen Fisch probieren müssen, wie heißt der noch gleich?«
»Hapansilakka.«
Kieffer schauderte schon bei der Vorstellung. Vatanen hatte ihm erzählt, es handele sich bei Hapansilakka um vergammelten Hering. Verschlossen in der Dose fermentiere dieser so lange vor sich hin, bis sich das Blech blähe. Manchen, so hatte der Finne ihm fröhlich erklärt, fiel wegen des strengen Fäulnisgeruchs das Frühstück bereits aus dem Gesicht, wenn sie die Dose nur öffneten.
»Ich finde, mit dem Kachkéis kommst du deutlich besser weg.«
Kieffer schnitt die gelbliche Masse in kleine Stücke und warf sie in das bereits dampfende Wasser. Dann fügte er noch etwas Butter hinzu und begann zu rühren.
Vatanen betrachtete die Sache unglücklich. »Gekochter Glibberkäse, pfui Deibel. Und den muss ich dann löffeln? Wie eine Suppe?«
»Nein. Das hier«, Kieffer zeigte mit dem Holzlöffel auf die zähe, blubbernde Masse in dem Töpfchen, »lassen wir gleich abkühlen. Und dann schmiert man den Kachkéis aufs Brot, mit Senf.«
»Käse mit Senf? Ihr Luxemburger seid ein bizarres Völkchen.«
»Ist ja wohl lange nicht so bizarr wie verrotteter Fisch.«
»Er ist lediglich ein bisschen vergoren.«
Vatanen begann, unruhig in der Küche auf und ab zu laufen. Es war fünf Uhr nachmittags, ein Vorbereitungskoch war damit beschäftigt, Gemüse zu schneiden und Soßen anzusetzen. Ansonsten war die Küche des »Deux Eglises« verwaist.
»Apropos vergoren – hast du diesen Rivaner reinbekommen, von dem wir neulich gesprochen haben, Xavier? Coteaux de Remich?«
»Ja, die Kisten sind vorhin angeliefert worden.«
»Gut.« Er fuhr sich mit der Hand durch die schütteren, semmelblonden Haare. »Wenn du mich schon zwingst, euren Gummikäse zu essen, dann möchte ich mir vorher wenigstens einen antrinken.«
»Normalerweise macht man es umgekehrt«, erwiderte Kieffer. »Erst der Kachkéis, weil er Satz gibt. Dann der Alkohol.«
»Wenn’s die Tradition erfordert, verspreche ich dir, danach auch noch was zu trinken. Aber jetzt komm, ich brauche einen Schluck.«
Kieffer goss den Kochkäse in eine kleine Auflaufform und stellte diese in den Kühlraum. Dann stiegen sie die gewundene steinerne Treppe hinab, in den Schankraum. Das Restaurant »Deux Eglises«, dessen Koch und Besitzer Kieffer war, lag in Clausen, einem der Luxemburger Unterstadtviertel. Das alte Garnisonsgebäude, das sein Spezialitätenlokal beherbergte, war nicht sehr groß, und so befand sich die Küche im ersten Stock. Als sie unten ankamen, fanden sie den Schankraum ebenfalls verlassen vor. Der Finne setzte sich auf seinen Stammplatz an der Bar. Kieffer ging hinter die Theke, nahm eine Flasche von Vatanens präferiertem Rivaner aus dem Kühler und schenkte ihnen beiden ein, bevor er ebenfalls Platz nahm.
Schlürfend sog sein Freund den Weißwein ein. »Ein ganz hervorragendes Tröpfchen. Kannst du mir davon beizeiten mal eine Kiste oder zwei mitbestellen, für meinen Hausvorrat?«
Kieffer klopfte sich eine Ducal aus der Schachtel und nickte. Wenn sein Freund dies wünschte, würde er ihm so viel Rivaner bestellen, wie er wollte – allerdings war ihm nicht ganz klar, wofür Vatanen einen Hausvorrat brauchte. Soweit er sich entsinnen konnte, war der Finne in den vergangenen zwei Wochen jeden Abend im »Deux Eglises« gewesen, hatte an seinem Lieblingsplatz an der Bar gesessen und eine Flasche Wein getrunken, als »Betthupferl«, wie er zu sagen pflegte. Gegen elf Uhr verließ Vatanen das Restaurant für gewöhnlich, mitunter wankend. Trank er danach zu Hause allein weiter? Kieffer war sich nicht sicher, ob er die Antwort auf diese Frage wissen wollte.
Er legte die Zigarette vor sich auf den Tresen. »Geht klar. Wenn du noch etwas anderes brauchst – Rotwein oder Olivenöl – dann ist jetzt die Gelegenheit.«
»Wieso? Bestellst du was?«
»Viel besser, Pekka. Ich fahre morgen an die Quelle.«
»Provence?«
»Toskana.«
Seit Jahren fuhr Kieffer einmal im Jahr nach Pistoia in der Nähe von Florenz. Dort besaß einer seiner Bekannten eine Ölmühle sowie ein paar Weinberge. Er würde gut essen, einen Haufen Weine und Öle probieren, um dann einige Tage später mit vollem Bauch und vollem Auto zurückzukehren.
Vatanen bedeutete Kieffer, ihm Rivaner nachzuschenken. »Klingt nett. Aber auch aufwendig. Ich dachte, du lässt dir fast alles liefern. Und wozu braucht ein Luxemburger Spezialitätenlokal eigentlich Olivenöl?«
Vatanen hatte nicht ganz Unrecht. Es war in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, sich die Tage für diesen Trip freizuschaufeln. In seinem Restaurant war einfach zu viel zu tun. Und das Öl benötigte Kieffer für die Gerichte im »Zwou Kierchen«, wie die Einheimischen sein Lokal nannten, in der Tat kaum. Luxemburger Spezialitäten schwammen eher in Butter als in Olivenöl.
»Das Olivenöl ist für mich privat. Mein verstorbener Lehrmeister Paul Boudier, der hat mich damit angefixt.«
»Inwiefern?«
»Er war aus Südfrankreich, aus Arles. Paul hat immer gesagt, dass er es seltsam findet, dass viele Nordeuropäer sich zwar enorme Mühe mit der Auswahl ihrer Hausweine machen – selbst zum Winzer fahren und so weiter – aber ihr Olivenöl im Supermarkt kaufen. Er hatte seine speziellen Lieferanten, in seiner Küche standen bestimmt zehn verschiedene Olivenöle. Ich bring dir ein paar Flaschen mit, zum Probieren.«
»Warum nicht. Fährst du mit deinem klapprigen Lieferwagen da runter? Das dauert doch ewig.«
Kieffer schüttelte den Kopf. »Ich fahre nicht alleine, sondern mit einem alten Schulfreund, Alessandro. Er hat einen großen Mercedes-Van.«
»Ist der auch Koch?«, fragte Vatanen.
»Nein, Weinhändler. Er beliefert halb Luxemburg. Ihm gehören da unten Weinberge, außerdem die Ölmühle. Er fährt alle paar Wochen runter, um nach dem Rechten zu sehen. Und morgen nimmt er mich mit.«
Kieffer erhob sich von seinem Barhocker. »So, ich glaube, der Kachkéis wäre jetzt gut.«
»Ich hatte irgendwie gehofft, du hättest das vergessen.«
»Träum weiter, Pekka.«
Als Kieffer einige Minuten später mit zwei Tellern aus der Küche zurückkam, war Vatanen gerade dabei, sein Weinglas neu zu füllen. Der Koch stellte einen der Teller vor seinen Freund auf die Bar. Er hatte den Kachkéis auf eine Scheibe dunkles Landbrot gestrichen und etwas Dijon-Senf danebengekleckst.
»Guten Appetit, Pekka.«
Kieffer stellte den zweiten Teller ab und biss in sein eigenes Kachkéis-Brot.
Missmutig strich der Finne Senf auf seine Scheibe und führte sie zum Mund. Mit verkniffenem Gesicht biss er ab.
»Und?«
»Es sieht nicht nur aus wie Moltofill, es kaut sich auch so«, sagte Vatanen, »verklebt einem total die Beißleiste. Aber mit dem Senf geht’s.«
Er setzte das Weinglas an und trank es halb leer. Dann senfte er nochmals nach und aß weiter.
»Ist aber nicht gerade Haute Cuisine, Xavier.«
Kieffer nickte. »Das ist gar keine Cuisine. Das ist was, das du dir abends machst, mit einem Bier dazu, wenn du in der Jogginghose Fußball guckst.«
Der Koch vertilgte den Rest seines Brotes. »Luxemburgischer geht’s auf jeden Fall kaum, und jemand, der seit über zehn Jahren hier wohnt, sollte das mal probiert haben. Und jetzt gib’s schon zu. Besser als euer Hapansilakka schmeckt unser Kachkéis ja wohl allemal.«
»Kann ich nicht sagen.«
»Wieso? Aber ich dachte …«
»… dass ich verfaulten Fisch esse? Freiwillig?«
Vatanen schüttelte den Kopf und biss erneut von seinem Kachkéis-Brot ab.
»Ich bin doch nicht bescheuert.«
2
Als Kieffer am nächsten Morgen aufwachte, hatte es gerade zu dämmern begonnen. Er drehte sich auf die Seite und schaute aus seinem Schlafzimmerfenster. Die kahlen Bäume in seinem kleinen Garten sahen so aus, als frören sie. Dahinter floss die Alzette entlang, schwarz und eisig, erst vor drei Wochen waren die letzten Schneereste am Ufer verschwunden. Ihn fröstelte. Er stand auf, zog sich eine abgetragene Strickjacke über und tapste die Treppe hinab, in die Küche. Als er den Kippschalter der Vibiemme umlegte, ging ein Zittern durch die riesige Espressomaschine. Kieffer hatte das Monstrum bei einer Restaurantauflösung zu einem Spottpreis erstanden, es machte viel besseren Kaffee als diese modernen Vollautomaten. Der Nachteil war, dass die Vibiemme zunächst warmlaufen musste, und das dauerte. Er kannte alte Diesel-Lkw, die schneller in Gang kamen. Kieffer setzte sich auf die Holzbank in der Essecke und schloss die Augen. Die Schulter an den warmen Heizkörper gelehnt, begann er, wieder wegzudämmern. Bevor er jedoch wieder einnicken konnte, teilte ihm die Vibiemme mit einem giftigen Fauchen und mehreren metallisch klingenden Schlägen mit, sie sei nun so weit. Der Koch stemmte sich hoch und ging zur Anrichte. Er arretierte den Siebträger, legte den Hebel um, und beobachtete, wie der Kaffee unter Dröhnen und Rasseln in die Tasse tröpfelte. Müde rieb er sich die Sandkörner aus den Augen. Ein Espresso würde an diesem Morgen nicht reichen. Deshalb wechselte er den Siebträger und wiederholte die Prozedur.
Alessandro hatte darauf bestanden, spätestens um 7.30 Uhr loszufahren. Nur so, hatte sein Freund ihm erklärt, würden sie es bis zum Abendessen nach Pistoia schaffen. »Wenn wir erst um zehn fahren, geraten wir bei Como in den Feierabendverkehr«, hatte er gesagt. Soweit Kieffer sich erinnerte, waren sie im vergangenen Jahr ebenfalls um 7.30 Uhr losgefahren und hatten dennoch drei Stunden im Stau gestanden. Aber Alessandro war der Fahrer, also bestimmte er.
Sein Schulfreund war stets sehr entschieden in diesen Dingen. Hatte Alessandro Colao sich einen Plan zurechtgelegt, war es in der Regel kaum möglich, ihn noch davon abzubringen. So war es auch dieses Mal gewesen. Der Koch erinnerte sich, wie sie vor zwei Wochen in Alessandros Weinhandlung in Esch gesessen und ihre Reise besprochen hatten.
»Erst fahren wir nach Pistoia, in mein Apartment. Und am Abend gehen wir dann zu dieser neuen Osteria nahe dem Palazzo dei Vescovi. Habe ich bei meinem letzten Besuch entdeckt. Ich wette, du hast noch nie bistecca alla fiorentina gegessen, Xavier.«
»Wie bitte? Natürlich.«
»Wenn du das Steak in dieser Osteria probiert hast, das schwöre ich dir, dann wirst du mir zustimmen, dass du vorher vielleicht irgendwas anderes gegessen hast, aber kein bistecca alla fiorentina.«
Alessandro strich sich durch den kurzgetrimmten Vollbart, danach durch seine Meckifrisur. Seine Haare waren voll und tiefschwarz, es sah aus, als trüge der Weinhändler eine Sturmhaube, die nur einen kleinen Teil seines Gesichts freiließ.
Kieffer nippte an seinem Wein. Sie standen seit Längerem an der Theke des Verkaufsraums und tranken sich durch Alessandros beachtliche Sammlung von Chiantis und Montepulcianos, um, wie sein Freund es ausdrückte, »gedanklich ins Thema reinzukommen«.
»Und dann weiter, nach La Spezia.«
»Was machen wir da?«, fragte Kieffer.
Statt zu antworten, goss Alessandro ihnen zunächst nach und suchte dann im Regal nach einer weiteren Flasche.
»Diesen Brunello di Montalcino müssen wir gleich noch probieren. Aber zu deiner Frage: Nahe La Spezia gibt es einen Typ, der hat die angeblich besten Moraiolo, und außerdem sehr gute Taggiasca.«
»Olivensorten?«
»Ja. Moment, ich hab was davon da.«
Alessandro lief an den Weinregalen vorbei, bis zur anderen Seite des Ladens. Kurz darauf kam er mit zwei Flaschen Olivenöl zurück. Er stellte sie vor Kieffer ab.
»Erst mal das hier.«
Alessandro goss etwas von dem goldfarbenen Öl in ein Schnapsgläschen. Kieffer nahm es und nippte daran. Wie sein Freund es ihm beigebracht hatte, zog er die Mundwinkel nach außen und presste die Lippen in der Mitte aufeinander. Auf Beobachter musste diese Grimasse wie ein sehr gequältes Lächeln wirken. Laut Alessandro war diese strippagio genannte Methode jedoch die einzig korrekte Art und Weise, Olivenöl zu verkosten. Mit dem Öl auf der Zunge sog der Koch durch die Mundwinkel Luft ein, wodurch sich Tröpfchen des Olivensafts in seinem ganzen Mund verteilten. Der Geruch von frisch gemähtem Gras stieg ihm in die Nase, gleichzeitig begann sein Rachen zu brennen. Er musste husten.
»Ganz schön pfeffrig, das Zeug.«
»Das sind die Moraiolo-Oliven. Wenn ihr Öl dir keine Tränen in die Augen treibt, ist es Mist. Und jetzt das Taggiasca.«
Wieder goss Alessandro einen Daumenbreit Öl in ein Gläschen. Dieses besaß eine andere Farbe, zu dem goldenen Schimmer gesellte sich ein rötlicher Ton, der das Öl kupferfarben schimmern ließ, als Kieffer das Glas gegen das Licht hielt. Erneut schlürfte er geräuschvoll. Dieses Mal musste er nicht husten. Der Geschmack des Taggiasca war völlig anders, mildsüß, mit einer fruchtigen Note.
»Ziemlich gutes Zeug. Und das kriegst du von dem Typen?«
»Das Taggiasca kommt aus Ligurien, das muss zu einer anderen Ölmühle. Man sollte die Oliven nach der Ernte nicht lang durch die Gegend fahren, dann werden sie schlecht. Aber das Moraiolo – ich will, dass er es in unserem Oleificio pressen lässt. Dann wäre es noch besser, ich könnte da mehr rausholen. Deshalb will ich mit ihm sprechen. Aber keine Sorge, du wirst dich nicht langweilen. Er betreibt einen großen Agriturismo, mit angeschlossener Käserei und anderem Zeug. Da habe ich uns einquartiert, das wird nett.«
Kieffer betrachtete Alessandro, während dieser an seinem Wein nippte. In seiner Jugend war der Italo-Luxemburger ein rappeldürrer Junge mit zu schmalen Schultern und zu großen Ohren gewesen. Mit Mitte dreißig war er dann plötzlich aufgegangen wie ein Hefezopf, neben ihm kam sich der auch nicht gerade schmächtige Koch geradezu schlank vor. Selbst die perfekt gebügelten, farbenfrohen Hemden, die Alessandro stets über der Hose trug, konnten seine Leibesfülle inzwischen nicht mehr kaschieren.
»Ich hätte jetzt Lust auf eine Zigarette«, verkündete Alessandro.
»Kein Problem.« Kieffer zog die Ducal-Schachtel aus der Tasche seiner Cordhose. »Aber hattest du Maria nicht versprochen aufzuhören?«
»Habe ich auch. Aber wenn ich mit meinem alten Kumpel Chianti trinke, darf ich doch wohl mal eine Ausnahme machen?«
Kieffer hielt ihm die Packung hin. Alessandro schüttelte den Kopf.
»So verzweifelt, dass ich diese widerlichen Dinger rauche, bin ich dann auch nicht.«
Er verschwand hinter der Bar. Neben Weinflaschen, Espressotassen, Camparigläsern und anderen Utensilien stand im Regal dahinter ein Ölkanister aus Weißblech, nach dem Alessandro nun griff. Er kniff ein Auge zu und grinste.
»Das Geheimversteck für meine Zigaretten und andere Dinge, die Maria nichts angehen.«
Die obere Metallplatte des Kanisters fehlte, stattdessen war er mit einem Plastikdeckel verschlossen. Alessandro hielt die Dose so, dass Kieffer sie sehen konnte und entfernte den Deckel. Der Behälter war voller kleiner Gummibärchenpackungen. Alessandro verschloss ihn wieder, stellte die Büchse auf den Kopf und machte sich an deren Boden zu schaffen. Mit einer theatralischen Geste entfernte er die Bodenplatte, wie ein Zauberer, der sogleich ein Kaninchen aus dem Hut ziehen will. Statt eines Nagers kam jedoch ein Marlboro-Bigpack zum Vorschein.
Der Weinhändler zündete sich eine Zigarette an und paffte zufrieden. »Was ist mit deiner Französin? Hat sie dir das Rauchen schon auszutreiben versucht?«
»Valérie raucht selber. Und wir haben auch gar keine Geheimnisse voreinander.«
Alessandro lachte. »Das liebe ich so an dir, Xavier. Deinen trockenen nordeuropäischen Humor!«
Er trank den letzten Schluck Chianti und entfernte den Stopper, der auf der Brunello-Flasche steckte.
»Aber jetzt noch mal zu unserem Trip, solange ich mich noch daran erinnern kann. Also: Pistoia, La Spezia. Dann weiter nach Monterosso al Mare. Da gibt es dieses Fischrestaurant, wo …«
Kieffer schaute aus dem Fenster, über die Alzette hinweg, auf die Häuser der anderen Flussseite. Er hatte noch genug Zeit. Es musste in etwa halb sechs sein, bis zu Alessandros Geschäft in Esch-sur-Alzette würde er vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs höchstens eine halbe Stunde brauchen. Eigentlich solltest du noch im Bett liegen, dachte er, während er an seinem Kaffee nippte. Der Wecker hatte noch gar nicht geklingelt, aber wie so oft in letzter Zeit war er bereits davor wach geworden. Ich werde allmählich alt, sinnierte er. Bald werde ich bereits morgens um fünf auf den Beinen sein, wie meine Mutter.
Kieffer trank den letzten Schluck Espresso. Ihm fiel nun auf, dass die Fenster der Häuser auf der gegenüberliegenden Flussseite bereits erleuchtet waren – noch mehr Menschen, die unter präseniler Bettflucht litten. Dann dämmerte ihm etwas. Das erste Mal an diesem Morgen schaute er auf die Küchenuhr, die hinter ihm über der Essecke hing.
Es war schon nach sieben. Fluchend sprang Kieffer auf und rannte die Treppe hinauf, ins Schlafzimmer.
3
Fünf Minuten später warf er seine Tasche in den Kofferraum des klapprigen Peugeot-Lieferwagens, der unweit seines Hauses an der Ulrichbrücke parkte. Kieffer stieg ein. Während er den Motor anließ, erhaschte er im Rückspiegel einen Blick auf einen müde wirkenden Mittvierziger. Die halblangen, ungekämmten Haare hingen dem Mann ins Gesicht, und eine Rasur hätte ihm gutgetan. Kieffer setzte den Wagen zurück und drückte das Gaspedal durch. Der Peugeot jaulte, als der Koch ihn die Montée de la Petrusse hinaufjagte.
Als er in der Oberstadt angekommen war, nahm er zunächst den Boulevard, der dem Flusslauf folgend am Rand der Schlucht entlangführte und fädelte sich dann auf die A4 Richtung Esch ein. Er war nicht der Einzige. Die meisten von Kieffers Landsleuten wären nie im Traum auf die Idee gekommen, für eine Fahrt von A nach B die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, wenn man die Strecke auch mit dem Auto absolvieren konnte. Luxemburger liebten Autos, im Vergleich zu ihnen waren die Deutschen in dieser Beziehung geradezu harmlos. Dummerweise besaßen sie jedoch keine sechsspurigen Autobahnen wie die Deutschen, weswegen das Großherzogtum stets am Rande des Verkehrskollapses stand. Ein schwerer Unfall genügte, schon steckte das halbe Land fest.
Heute schaffte es Kieffer immerhin bis Steebrécken, bevor Schluss war. Vor sich konnte er Blaulicht erkennen. Es ging nun nicht einmal mehr im Stop-and-Go voran. Dem Koch entfuhr ein Fluch. Nachdem er sich eine Ducal angezündet hatte, rief er Alessandro an. Es klingelte fünfmal, bevor er die Stimme seines Freundes vernahm.
»Pronto!«
»Morgen, hier ist Xavier«, sagte Kieffer. »Hör zu, ich …«
»Reingefallen! Dies ist nur die Mobilbox von Alessandro Colao. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ciao!«
»Alessandro, hier ist Xavier. Hör zu, ich hab verpennt und steck noch im Stau. Ich bin gleich bei dir, ja?«
Kieffer legte auf. Ihm entfuhr ein weiterer Fluch. Er konnte nur hoffen, dass Alessandro ihn irgendwann zurückrief. Der Weinhändler war in diesen Dingen etwas eigen, neigte zu Kurzschlusshandlungen. Seine Wutanfälle waren schon auf der Schule legendär gewesen. Wenn Alessandro sich ärgerte, zum Beispiel über einen zu spät kommenden Beifahrer, konnte es durchaus sein, dass er einfach allein losfuhr, um dann vermutlich von Luxemburg bis Lucca wütend vor sich hinzuschimpfen, wie man ihm das nur antun konnte.
Etliche Ducal und über eine Stunde später verließ Kieffer die Autobahn. Alessandro hatte sich immer noch nicht gemeldet. Als er endlich vor dem weißgestrichenen Lagerhaus mit den italienischen Flaggen und dem Schriftzug »Weindepot Colao« ankam, war es bereits halb neun. Kieffer parkte, stieg aus und schaute sich um. Das Lagertor war heruntergelassen, Alessandros azurblauer Van war nirgendwo zu sehen.
»Krëtjeftnomol, tu mir das nicht an!«
Er rannte zum Eingang des kleinen Ladengeschäfts, das sich neben der Lagerhalle befand. Es war noch verschlossen. Kieffer kniete sich vor der Tür hin. Links unten fand er, was er suchte. Dort war ein Aufkleber angebracht, auf dem eine Handynummer sowie eine E-Mail-Adresse angegeben waren. Er nahm sein Telefon aus der Tasche, rief Alessandros Handynummer auf und verglich sie mit der auf dem Sticker. Wie er gehofft hatte, war es nicht dieselbe. Während sein Freund für die Auswahl und Beschaffung der Weine und Öle zuständig war, wurde das Organisatorische von seiner Frau Maria gemanagt. Er vermutete, dass es sich bei der Handynummer auf dem Aufkleber um ihre handelte. Einen Versuch war es wert. Er wählte.
»Guten Morgen, Maria Colao.«
»Morgen, hier ist Xavier. Xavier Kieffer.«
»Oh hallo, Xavier? Was gibt’s?«
»Ich stehe gerade vor eurem Laden. Alessandro und ich wollten heute zusammen runterfahren, aber er ist nicht da. Allerdings bin ich auch eine Stunde zu …«
»Oh mein Gott.«
»Maria, was ist los?«
»Ich wusste nicht, dass er mit dir … aber dann wäre er doch nie alleine … ich hab’ solche Angst.« Kieffer konnte hören, wie sie zu schluchzen begann.
»Wann ist er denn weg? Heute Morgen?«
»Nein, schon vor zwei Tagen.« Inzwischen konnte er Maria kaum noch verstehen.
»Ganz ruhig, Maria. Es gibt bestimmt eine einfache Erklärung dafür. Hör zu, ich komme vorbei, bin in zehn Minuten da.«
Sie schniefte. »Okay.« Dann legte sie auf.
Esch-sur-Alzette lag im Süden Luxemburgs, direkt an der Grenze zu Frankreich. Das Haus der Colaos befand sich auf der anderen Seite, in einem unscheinbaren Örtchen namens Audun-le-Tiche. Als Kieffer vor dem geklinkerten Reihenhaus hielt, wartete Maria bereits an der Haustür. Der Koch ging durch den kleinen Vorgarten, vorbei an einer Sandkiste voller Plastikschäufelchen und Eimer.
Ohne etwas zu sagen, bat sie ihn herein und führte ihn ins Wohnzimmer. Dort bedeutete sie Kieffer, sich zu setzen. Er nahm auf einer mauvefarbenen Sofagarnitur Platz. Maria setzte sich ihm gegenüber in einen Sessel, faltete die Hände in ihrem Schoß, stand dann wieder auf.
»Es tut mir leid, ich bin so eine schlechte Gastgeberin – willst du Kaffee?«
»Später. Erzähl mir lieber, was hier los ist.«
Erneut ließ sie sich in den Sessel fallen. »Kann ich … du rauchst, oder?«
Kieffer hielt Maria Ducal und Feuerzeug hin. Mit fahrigen Bewegungen zog sie eine Zigarette aus der Schachtel und zündete sie an.
»Er ist Sonntagnachmittag verschwunden, aus heiterem Himmel. Hat gesagt, er müsse dringend nach Pistoia, geschäftlich. Normalerweise sagt er mir so was eine Woche vorher.«
»Aber diesmal nicht.«
»Nein. Er rief mich an, vorgestern, und sagte, er müsse sofort los. Wir haben uns dann am Telefon gestritten. Aber er ließ sich nicht davon abbringen.«
Kieffer nickte nur und musterte sie. Maria war Ende dreißig, haferbleich, mit tiefschwarzem Haar und einer großen, aber interessanten Nase.
»Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.«
»Hast du ihn angerufen?«
»Natürlich. Aber bei seinem Handy geht keiner ran. Und in der Ölmühle auch nicht. Ich hab auch alle möglichen Bekannten angerufen, Geschäftspartner, Verwandte … nichts.«
Kieffer sah, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten. Ihn hatte Maria nicht angerufen, aber das überraschte den Koch nicht. Erstens schien sie nicht gewusst zu haben, dass Alessandro ihn bei dieser Tour mitnehmen wollte. Und zweitens hatten Maria und er nie viel miteinander zu tun gehabt. Alessandro kannte Kieffer seit seiner Kindheit. Sie sahen sich nicht allzu häufig, aber das war auch nicht notwendig – ihre Freundschaft bestand seit über dreißig Jahren und war stark genug. Maria hingegen kannte Kieffer erst seit acht oder neun Jahren. In dieser Zeit hatte er sie höchstens vier- oder fünfmal gesehen.
»Ich habe ihn vorhin auch angerufen«, sagte er.
»Was? Du hast mit ihm gesprochen?«
»Nein, es ging nur der Anrufbeantworter dran.«
Maria konnte ihre Tränen nun nicht mehr zurückhalten. Schluchzer schüttelten ihren ganzen Körper. Kieffer wusste nicht, was er tun sollte. Er war nicht sehr gut in diesen Dingen. In seinem Kopf meinte er Vatanens Stimme zu hören: »Einfach, du Tölpel. Wenn eine Frau weint, nimmst du sie in den Arm.«
Der Koch stand auf, setzte sich auf die Kante des Sessels und legte seinen Arm um Maria. Sie wich nicht zurück, aber viel zu helfen schien es auch nicht.
»Warst du schon bei der Polizei?«, fragte er.
»Ja, aber die haben mich wieder weggeschickt.«
»Wieso?«
»Weil es erst zwei Tage sind.«
Sie räusperte sich. »Kein Verdacht auf hilflose Lage oder Straftat, haben sie gesagt.«
»Wahrscheinlich ist ja auch nichts, vielleicht hat er nur Stress.«
Sie schaute ihn an. »Da ist noch was.«
»Ja?«
»Er war irgendwie anders. Schroff, geheimnistuerisch, so kenne ich ihn überhaupt nicht. Trotz all seiner Wutausbrüche und Macken ist er doch eigentlich der liebste Mensch der Welt.«
»Hat er dir denn gesagt, warum er so dringend in die Toskana muss? Die Olivenernte ist doch schon lange vorbei, oder?«
»Er hat gesagt, er hat einen neuen Kunden in Aussicht. Und wir wären bald alle unsere Sorgen los.«
»Habt ihr Sorgen?«
Sie nickte stumm.
»Geld?«, fragte er.
»Eulenberger.«
Eulenberger war ein neuer Weinhändler, drüben im Saarland. Aus Verbundenheit zu Alessandro hatte Kieffer dort noch nie bestellt. Aber befreundete Gastronomen berichteten immer wieder, das Eulenberger-Depot in Mettlach sei dabei, allen anderen Lieferanten in der Großregion den Rang abzulaufen. Angeblich war der Laden von zwei ehemaligen Unternehmensberatern gegründet worden. Eulenberger besaß nicht nur ein größeres Sortiment als Colao, Müller oder Bruckner. Er war auch billiger und verfügte über ein supermodernes computergestütztes Lagersystem mit selbstfahrenden Gabelstaplern und automatisierten Laufbändern. Dadurch lieferte Eulenberger angeblich schneller als alle anderen. Man konnte seine Weine sogar dauerhaft in Mettlach einlagern und am Abend benötigte Tropfen kurzfristig per Smartphone ordern und liefern lassen. Mit Kieffers uraltem Nokia ging das natürlich nicht, aber er verstand, warum die anderen Weinhändler in der Gegend bei der Erwähnung des Namen stöhnten.
»Nehmen die euch viele Kunden weg?«
Sie zog an ihrer Zigarette. »Fast ein Drittel. Wenn nicht ein Wunder geschieht, sind wir Ende des Jahres pleite.«
»Und Alessandro glaubte, sein neuer Kunde sei dieses Wunder? Hat er mehr darüber erzählt?«
»Nein, nichts. Er hat mich am Telefon richtiggehend abgewürgt.«
Sie kramte ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche und schnäuzte geräuschvoll. »Wenn jemand anders sein Handy hat, dann muss ich noch mal zur Polizei. Oder bei den Carabinieri anrufen.«
»Hör zu, Maria …«
»Ja?«
»Ich könnte ihm nachfahren.«
»Das würdest du tun? Ich wäre schon selbst gefahren. Aber die Kinder …«
»Ich wollte ja ohnehin fahren. Und du hast ja keine Ahnung, wie vielen Leuten ich versprochen habe, ihnen von eurem guten Wein und Öl mitzubringen.«
Sie bemühte sich zu lächeln.
»Ich wäre dir ewig dankbar, wenn du nach ihm schaust. Vermutlich ist es nur wieder eine seiner irren Phasen, aber ich kann nicht mehr schlafen. Und ich habe kein gutes Gefühl.«
Sie stand auf und wandte sich ab, vermutlich, damit er nicht sah, dass ihr erneut die Tränen in die Augen schossen. Dann ging sie in den Flur und kam kurz darauf mit einem Schlüsselbund zurück. »Das hier sind die Schlüssel für die Ölmühle. Und die hier gehören zu unserer Wohnung in Pistoia.«
»Gut. Ich mache mich gleich auf den Weg. Mit meiner alten Klapperkiste wird das etwas dauern, aber ich sage dir Bescheid, sobald ich was weiß.«
»Du musst nicht mit deinem Auto fahren. Einen Moment.«
Sie verschwand erneut und kam mit einem Autoschlüssel zurück. »Hier. Nimm unseren. Auch nicht gerade neu, aber gut in Schuss. Die Papiere klemmen unter der Sonnenblende.«
»Maria, du musst nicht …«
»Je schneller du in Pistoia bist, umso besser für meine Nerven. Warte, ich helfe dir noch mit den Kindersitzen.«
»Lass nur, Maria. Ich stelle sie einfach in den Vorgarten.«
Maria umarmte ihn etwas unbeholfen, dann brachte sie ihn zur Tür. Kieffer ging den Weg entlang bis zur Pforte und drehte sich dort noch einmal um. Maria war bereits im Haus verschwunden. Er betrachtete den Schlüssel in seiner Hand. Das Logo verriet ihm, dass er nach einem Mercedes suchen musste. Er kannte den Wagen. Es handelte sich um eine E-Klasse, ein ausrangiertes Trierer Taxi. Alessandro fuhr den Wagen bereits seit Ewigkeiten.
Der cremefarbene Benz stand gegenüber dem Haus. Kieffer wuchtete die beiden Kindersitze aus dem Fond und stellte sie in den Vorgarten. Dann stieg er ein. Innen bestand alles aus Nussholz und Leder, Letzteres so abgewetzt, dass seine Lederjacke dagegen neu wirkte. Als Kieffer den Zündschlüssel im Schloss drehte, begann der Dieselmotor zu nageln. Das Tachometer zeigte einen Kilometerstand von 377283.
»Ein alter Diesel von Daimler ist für die Ewigkeit«, pflegte Alessandro zu sagen. Kieffer hoffte, dass sein Freund recht hatte. Vorsichtig tippte er das Gaspedal an und rollte die Straße entlang, Richtung Route Nationale.
4
Nahe Luzern beschloss Kieffer, eine Pause zu machen. Er kam nicht so schnell voran, wie er gehofft hatte. Zwar war das Extaxi tadellos in Schuss. Aber er quälte sich mehr durch den dichten Verkehr, als dass er fuhr. In diesem Tempo hätte er die Strecke auch mit seinem klapprigen Lieferwagen bewältigen können. An der nächsten Raststätte fuhr Kieffer ab. Nachdem er sich im SB-Restaurant einen Kaffee besorgt hatte, kaufte er eine Straßenkarte. Der Mercedes besaß zwar ein relativ neues Navigationssystem, das in einer Halterung an der Windschutzscheibe klebte, aber es war Kieffer nicht gelungen, die Adresse einzugeben. Deshalb setzte er sich mit dem Kaffee nun an einen der Plastiktische und studierte die Karte.
Pistoia lag im Norden der Toskana, etwa 30 Kilometer von Florenz entfernt. Mit dem Zeigefinger fuhr Kieffer die Route entlang, die er ab Mailand nehmen würde. Schon beim Anblick der Namen setzte sein Speichelfluss ein: Parma. Modena. Bologna. Dann weiter gen Süden, bis zu seinem Ziel. Alessandro Colaos Eltern stammten, wenn sich Kieffer richtig entsann, nicht aus der Toskana, sondern aus Süditalien. Seine Frau hingegen kam aus Pistoia. Von ihrer Familie hatte das Ehepaar einen Olivenhain und Weinberge geerbt, die in den Hügeln außerhalb der Stadt lagen. Eine nennenswerte Menge Öl oder Wein gab das Anwesen allerdings nicht her. Das Areal, hatte Alessandro ihm einmal erzählt, sei zu klein und damit zu unwirtschaftlich: »Das wäre gerade genug Saft für uns, unsere Familie und unsere besten Freunde.« Deshalb hatte Alessandro das meiste Land an einen Nachbarn verpachtet.
Ihr Geld machten die Colaos in Pistoia, soweit Kieffer wusste, vor allem mit der Ölmühle. Es gab in der Gegend viele kleinere Olivenhaine, und die meisten Bauern hatten ihre Früchte bis vor wenigen Jahren noch mit Maschinen aus der Nachkriegszeit gepresst. Erst dank Alessandro war das anders geworden. Sein Freund hatte in eine moderne Zentrifuge investiert, die das Öl schneller und sanfter aus den Früchten zog. »Niemand wollte mir seine Oliven bringen«, hatte er Kieffer grinsend erzählt, »bis sie das fertige Öl aus unserer Mühle das erste Mal probierten.«
Inzwischen lieferten viele Bauern aus der Region ihre Früchte an Alessandros Betrieb, dem Oleificio di Pistoia. Die Colaos stellten daraus sortenreine Öle her und vertrieben sie an Gourmets. Viele davon hatten Preise gewonnen, alle waren extra vergine, alle schmeckten köstlich.
Der Koch bemerkte, dass sein Magen heftig knurrte. Bevor er zu seinem Auto zurückging, kaufte er sich ein etwas traurig aussehendes Ciabatta und eine Banane – kein Mittagessen nach seinem Geschmack, aber mit etwas Glück würde er seinen Bauch später mit einem toskanischen Festmahl entschädigen können.
Es war bereits dunkel, als Kieffer in Pistoia eintraf. Während der Fahrt hatte er noch ein paarmal auf Alessandros Handy angerufen, doch niemand hatte abgenommen. In der Nähe der Piazza del Duomo hielt er an und aktivierte den Warnblinker. Er versuchte sich zu orientieren. Die kleine Wohnung der Colaos befand sich irgendwo im Stadtzentrum. Kieffer war zwar schon zweimal dort gewesen, hatte sich seinerzeit aber völlig auf Alessandros Ortskenntnisse verlassen. In der Dunkelheit war es schwierig, die Straße wiederzufinden, über eine halbe Stunde lang kurvte er durch die Sträßchen, bevor er aufgab und den Mercedes in einem Parkhaus abstellte. Zu Fuß lief er über den Domplatz, Richtung Norden. An der nächsten Kreuzung blieb er vor einer kleinen Osteria stehen und betrachtete die Kreidetafel, die davor aufgestellt war. Es gab toskanische ribollita, eine deftige Suppe. Noch mehr interessierte ihn die polenta col cavolo nero. Wenn er diese als Vorspeise bestellte, dann könnte er als Hauptgericht vielleicht das coniglio arrosto nehmen oder einfach ein bistecca alla fiorentina. Möglicherweise war dies sogar jene Osteria, von der Alessandro ihm vorgeschwärmt hatte.
Wieder lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Kieffer widerstand jedoch der Versuchung, in das Restaurant hineinzugehen. Stattdessen kaufte er an einem Kiosk gegenüber einen Stadtplan und suchte darin die Via Paccini.
Zehn Minuten später stand er vor der Haustür. Die Wohnung der Colaos befand sich in einem buttergelben, zweistöckigen Haus mit dunkelgrünen Fensterläden. Sie war nicht sehr groß, das wusste er von früheren Besuchen. Es gab zwei Schlafsofas im Wohnzimmer, außerdem eine winzige Küche und ein noch winzigeres Bad.