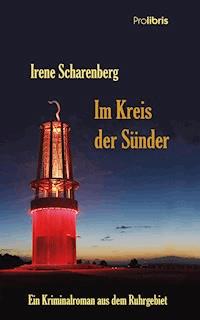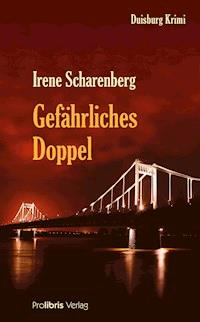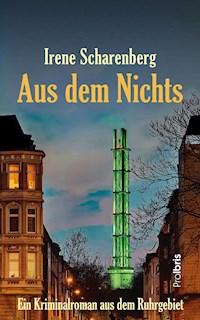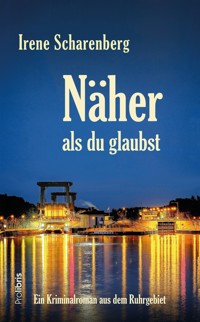Inhalte
Titelangaben
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Danksagung
Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Phantasie des Autors. Ebenso
die Verquickung mit tatsächlichen Ereignissen. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt. Nicht erfunden sind bekannte Persönlichkeiten, Personen der Zeitgeschichte sowie Institutionen, Straßen und Schauplätze auf Norderney, in Norden und in Duisburg. Die Norderneyer Kur- und
Rehabilitationsklinik am Deich allerdings entstammt der Phantasie der Autorin.
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2017
Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29
Titelfoto:
© grobima – Fotolia
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN E-Book: 978-3-95475-175-4
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 978-3-95475-167-9
www.prolibris-verlag.de
Die Autorin
Irene Scharenberg ist in Duisburg aufgewachsen und hat hier Chemie und Theologie
für das Lehramt studiert. Vor einigen Jahren hat sie die Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt. Seit 2004 sind zahlreiche ihrer Kurzgeschichten in
Anthologien und Zeitschriften erschienen und in Wettbewerben ausgezeichnet
worden. 2009 gehörte die Autorin zu den Gewinnern des Buchjournal-Schreibwettbewerbs, zu dem mehr
als 750 Geschichten eingereicht wurden.
Irene Scharenberg ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sie lebt am Rande des Ruhrgebiets in Moers. In ihrer alten Heimat
Duisburg spielen sechs Kriminalromane mit den beiden Ermittlern Pielkötter und Barnowski. In ihrem ersten Norderney-Krimi hat sie ihre Liebe zu der
Insel mit der Leidenschaft fürs Schreiben verbunden.
PROLOG
Ebbe und Flut würde es für ihn nie mehr geben. Dabei hat er das Spiel der sich nähernden oder sich langsam zurückziehenden Wellen, das lustige Hüpfen der Schaumkronen auf der Oberfläche so gemocht, oft auch bestaunt. Die regelmäßige Wiederkehr, diese Beständigkeit und vor allem die Ruhe auf der Insel. Nur das Rauschen des Meeres, das
Kreischen der Möwen, beides Musik in seinen Ohren, er könnte ihr ewig lauschen, während sich seine Fußsohlen in den hellen Sand drücken oder in den Norderneyer Schlick.
Genieße es, ein letztes Mal!
So oft schon hast du die untergehende Sonne bestaunt, die den Strand in warme
Farben taucht, bevor sie als Feuerball am Horizont versinkt. Einige dieser
Naturschauspiele hast du auf der Terrasse der Giftbude, manche auch an der
legendären Milchbar genossen, bei einem Wein. Roten Wein, kräftiger als die Farbe am abendlichen Himmel. Am nächsten Morgen hast du gern auf der Georgshöhe gestanden, um nach Osten über den Nordstrand zu schauen und an die ertrunkenen Seefahrer zu denken, die
niemals nach Norderney zurückgekehrt sind. Auch für dich ist es der letzte Aufenthalt auf der Insel. Du wirst nicht auf das
Festland zurückkehren.
Willst du noch einmal zu dem Leuchtturm in der Mitte der Insel fahren, dich oben
auf die weiße Düne stellen, um auf die herrliche Hügellandschaft und das Meer hinunterzuschauen, auf unzählige Windräder am greifbar nahen Festland? Nur einmal noch die salzige Luft einatmen, die
frische Brise auf der nackten Haut spüren, bevor es zu spät ist. Jeden einzelnen Atemzug auf dieser Insel hättest du auskosten sollen, statt zielstrebig deinen Plan zu verfolgen. Du warst
erfolgreich, aber den Preis, den du dafür zahlen musst, kennst du noch nicht. Du wirst alles verlieren. Norderney
wiedersehen und hier sterben, das hat das Schicksal dir bestimmt. Das
Schicksal? Nein, dein Mörder.
1
Mitternacht war schon lange vorbei, als Professor Doktor Alexander Schwarzenberg
Hand in Hand mit seiner Geliebten die breiten bequemen Stufen zur Georgshöhe hinauflief. Oben machte sie sich von ihm los und schwankte zu dem Stockanker
aus einem vorigen Jahrhundert hin, der an die vielen ertrunkenen Seeleute
erinnerte. Sie ließ sich lachend darauf nieder, beugte den Oberkörper nach hinten und streckte die Arme nach Schwarzenberg aus. Offensichtlich
hatte sie etwas zu viel von dem Champagner getrunken, den er zu ihrem leider
viel zu seltenen Besuch geöffnet hatte. »Nicht doch«, mahnte Alexander Schwarzenberg. »Das bringt Unglück. Nachher werden wir dafür bestraft, dass wir uns über die toten Seefahrer lustig machen.«
»Komm schon«, neckte sie ihn. »Seit wann bist du so spießig? So kenne ich dich gar nicht. Du zierst dich doch auch nicht, mit einer
verheirateten Frau ins Bett zu steigen. Aber dieser alte Anker ist tabu, was?«
»Weil er an den Tod erinnert«, entgegnete er nachdenklich. »Und ich habe schon zu viele Tote gesehen, um ihm ohne Respekt zu begegnen.« Er machte einen Schritt auf sie zu, zog sie hoch und sah ihr direkt in die
Augen. »Wenn es nach mir ginge, wärst du längst meine Frau. Du bist diejenige, die sich nicht scheiden lassen will.«
»Von Wollen kann wohl keine Rede sein.« Auf einen Schlag wirkte sie wieder total nüchtern. »Du weißt doch genau, wie mein Mann reagieren würde. Gut, du hast ihn nur einmal flüchtig gesehen, aber du kennst doch meine Lage.«
»Die Situation ist unerträglich! Ich möchte mich mit dir in der Öffentlichkeit zeigen. Jetzt stehen wir mitten in der Nacht auf dieser Düne. Und warum? Nicht um den Sternenhimmel besser beobachten zu können, die Aussicht über die Insel und das Meer zu genießen oder weil wir die Einsamkeit lieben. Nein, damit uns niemand sieht, womöglich erkennt. Ich muss um meinen guten Ruf fürchten und du ...«
»Entspann dich«, gurrte sie und legte ihren Kopf an seine Schulter. »Wir sollten nicht streiten und uns damit die wenigen gemeinsamen Stunden
vermiesen. Irgendwann wird sich unser Problem von selbst lösen, du wirst schon sehen.«
»Ich habe noch niemals erlebt, dass eines meiner Probleme von selbst
verschwindet. Immer war das mit Anstrengung verbunden.« Er nahm sanft ihren Kopf und schaute sie an, dann küsste er ihren Mund. »In einem Punkt aber hast du vollkommen Recht. Wir sollten jetzt nicht daran
denken und uns damit unsere gemeinsame Zeit vermiesen. Komm, ich will dir etwas
zeigen!« Er führte sie einige Schritte bis zum Rand der Anhöhe und blickte mit ihr nach Osten. »Siehst du dahinten die Klinik in den Dünen?«
»Ja, dein ganzer Stolz.« Ihrer Stimme war nicht anzumerken, ob sie das nicht vielleicht ironisch meinte.
»Der neue Gebäudekomplex wird von hier aus hinter dem Altbau liegen. Ein Traum aus Glas. Wenn
der Anbau nur halb so gut ausschaut wie auf den Plänen, wird das ein echter Anziehungspunkt. Leider steht die Finanzierung noch
nicht.«
»Leider«, pflichtete sie ihm bei.
»Aber ich arbeite hart daran. Die Klinik ist eben mein Leben, solange du nicht zu
mir auf die Insel ziehst. Viel zu selten habe ich dich bei mir. Lass uns gehen.
Uns bleibt nicht viel Zeit, wenn du morgen schon die erste Fähre nach Norddeich nehmen willst.«
Sie legte ihren Arm um seine Hüfte und schmiegte sich an ihn.
»Warum bleibst du nicht einfach? Dein Mann ist in den nächsten Tagen doch sowieso nicht zu Hause.«
»Auch ich habe meine Termine. Das habe ich dir doch gesagt. Und du musst sowieso
arbeiten. Aber am Wochenende sehen wir uns ja schon wieder.«
Im Licht des Mondes setzten sie sich in Bewegung. Er zauberte ein fast überirdisches Glitzern auf die Oberfläche des Meeres und ließ Schwarzenberg seine Probleme für einen Moment vergessen.
2
Mitten in der Nacht schreckte Natascha Gruschenko hoch. Sie wusste selbst nicht
warum. Hatte ein Geräusch sie geweckt? Sie blinzelte in das fast dunkle Zimmer. Irgendwie hatte sie
sich immer noch nicht richtig daran gewöhnt, dass der schöne große Raum ihr gehörte. Ein eigenes kleines Reich in Vincents Villa im Duisburger Süden. Vielleicht weil sie befürchtete, Vincent könnte ihrer überdrüssig werden und dann würde er nicht zögern, sie vor die Tür zu setzen. Vincent, der Name drückte Macht aus, fand sie. Und Vincent war mächtig.
Die Vorhänge hatte sie nicht zugezogen, sie liebte es, wenn sie gerade noch die Konturen
der Möbel erkennen konnte. Sie mochte keine totale Dunkelheit. Sie warf einen Blick
aus dem Fenster, das zum Garten hinausging, und sah den Schein des Mondes, der
jetzt langsam hinter einer Wolke hervorkam. Müde ließ sie ihren Oberkörper wieder auf das Kissen gleiten und schloss die Augen. Sie wollte jetzt nicht
über ihre Situation nachdenken, sondern schlafen.
Tatsächlich nickte sie kurz ein, schreckte dann aber wieder hoch. Natascha hielt den
Atem an und lauschte. Da, eindeutig ein Geräusch! Es kam von unten. Ihr Gefühl riet ihr, es einfach zu ignorieren und weiterzuschlafen, aber sie hatte noch
nie auf solche inneren Ermahnungen gehört, auch wenn sie sich dadurch schon manchen Ärger eingehandelt hatte. Neugierig stand sie auf und schlich zur Tür, öffnete sie vorsichtig und hörte Stimmen, wütende Stimmen. Eine davon gehörte Vincent. Aber er wollte erst morgen von seiner Geschäftsreise aus Mailand zurück sein. Doch der Mann, der jetzt unten mit dem sonoren Bariton und dem leichten
Akzent sprach, das war ihr ... Ihr was? Sie wusste immer noch nicht, wie sie
ihre Beziehung zu ihm benennen sollte.
Für einen Moment hielt sie inne, schaute an ihrem dünnen Nachthemd hinunter, dann trippelte sie auf nackten Füßen zu dem Schaukelstuhl, auf dem ihre Jeans und das giftgrüne T-Shirt mit dem Aufdruck eines bunten Fallschirms lagen. Eilig hob sie die
Arme hoch, streifte das Nachthemd über die schwarzen langen Haare und schlüpfte in die Kleidung, die sie abends abgelegt hatte. Da der Boden kalt war, zog
sie die Ballerinas an, die neben dem Korbsessel standen. Ihre hochhackigen
Pumps konnte sie nicht gebrauchen. Die würden auf der Treppe klappern, und sie wollte sich die Option offenhalten,
unbemerkt in ihr Zimmer zurückzuschleichen.
Sie zögerte kurz, dann verließ sie den Raum. Im Eingangsbereich brannte Licht. Lauschend schlich sie die
Treppenstufen hinunter. Alles blieb still. Kurz bevor sie das Erdgeschoss
erreicht hatte, hörte sie ein gedämpftes Geräusch. Sie konnte es nicht genau definieren. Eine Art Plopp, als ob ein
Sektkorken in die Luft gegangen wäre. Anschließend herrschte wieder Totenstille. Für einige Sekunden geriet sie in Versuchung, einfach die breite Holztreppe wieder
hochzulaufen und sich ins Bett zu legen, aber dann gewann die Neugier die
Oberhand. Sie musste wissen, ob Vincent tatsächlich früher zurückgekehrt war. Er würde sich wundern, wenn sie seine Ankunft trotz des Lärms einfach ignorierte. Vincent liebte Aufmerksamkeit. Und sie hatte allen
Grund, ihren Gönner gnädig zu stimmen.
Mit flinken Schritten wandte sie sich nach links zu dem Wohnbereich, aus dem sie
das Geräusch vernommen hatte. Sie klopfte kurz an die wuchtige Doppeltür, dann drückte sie die Klinke hinunter. Stumm vor Schreck blieb sie auf der Schwelle
stehen. Sie brauchte eine Sekunde, um zu realisieren, was sie da sah. Blut,
viel Blut, und starre Augen. »Flieh!«, schrie plötzlich eine Stimme in ihr, riss sie aus ihrer Erstarrung. In wilder Panik drehte
sie sich um, dann rannte sie los.
»Bleib stehen!«, hallte Vincents wütende Stimme durch den Eingangsbereich. »Hast du nicht gehört, du sollst stehen bleiben, du Miststück!« Und dann brüllte er das, was sie befürchtet hatte. »Antonio, wo steckst du? Antonio, mach schnell!«
Als sie die Haustür erreicht hatte, hörte sie Vincent in der Diele. Sie riss an der Klinke, aber die Tür war verschlossen. Verzweifelt versuchte sie, den Sicherheitsriegel zurückzuschieben. Er klemmte, und sie musste alle Kraft aufbringen, ihn zu bewegen.
Währenddessen kam Vincent ihr bedrohlich nahe. Er streckte den Arm nach ihr aus,
aber ehe er sie fassen konnte, gab der Riegel nach, und sie stürmte hinaus. Sie sprintete etliche Stufen hinunter, schließlich die lange Auffahrt entlang in Richtung Straße. Dabei zwang sie sich, nicht nach hinten zu sehen. Das Tor zum Grundstück war ebenfalls verschlossen. Zum Glück kannte sie den Code, den sie auf der kleinen Schalttafel an dem rechten
Pfosten eintippen musste. Ihr Zeigefinger zitterte so stark, dass sie kaum in
der Lage war, die richtigen Tasten zu treffen. Bitte hilf mir, hier rauszukommen, flehte sie stumm, obwohl sie eigentlich nicht an einen Gott glaubte, der ihr
beistehen würde. »Fünf, zwei, sieben, eins«, zählte sie nun laut. »Komm schon, öffne dich endlich!«
Während das schwere Stahltor langsam zur Seite glitt, spähte sie kurz nach hinten. Vincent hatte sie trotz seines leichten Gehfehlers
fast eingeholt. Was ihr aber weitaus mehr das Blut in den Adern gefrieren ließ, war die massige Gestalt, die kaum hundert Meter hinter ihm auftauchte.
Antonio, sein Mann fürs Grobe. Der Schreck schien sie zunächst zu lähmen, doch dann war sie mit einem Mal Natascha Gruschenko, die schnellste Läuferin ihres Jahrgangs in der Schule. Sie versuchte, nur an ihre Siege zu
denken, und rannte. Ihre Füße berührten kaum den Boden. Das Blut pochte in ihren Schläfen. Sie keuchte. Durchhalten, nur durchhalten, schwirrte es durch ihren Kopf.
Sobald sich der Abstand zwischen Antonio und ihr vergrößert hatte, wollte sie nachdenken. Erst musste sie fort aus seiner Nähe
Inzwischen hatte sie den Anfang der Sackgasse mit den riesigen Grundstücken erreicht. Als sie in Richtung City abbog, erkannte sie Antonio. Er folgte
ihr, hatte aber zum Glück nicht aufgeholt. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, dass sie einen Plan fassen
musste. Sie konnte nicht einfach nur wegrennen, sie musste entscheiden, wohin
sie eigentlich wollte. Das Wichtigste war jedoch nach wie vor, aus Antonios
Sichtfeld zu verschwinden.
Nataschas Lungen brannten, ihre Füße schmerzten, aber sie lebte und sie hatte ein Ziel. Sie wollte zum Duisburger
Hauptbahnhof und den hatte sie fast erreicht. Mit gehetztem Blick sah sie zum
Haupteingang gegenüber der Innenstadt. Verwirrt registrierte sie, dass sich auf dem Vorplatz und in
seiner Umgebung einiges verändert hatte. Die neuen Hotels kannte sie nicht. Wie lange war sie nicht mehr
hier gewesen? Ihr wurde bewusst, dass Vincent sie in gewisser Weise gefangen
gehalten hatte, wenn auch mit sehr vielen Annehmlichkeiten. Für einen kurzen Moment sehnte sie sich zurück in den trauten Käfig, dann aber erschien es ihr wie eine Fügung, dass sie gezwungen worden war, das süße Gefängnis zu verlassen. Freiwillig wäre sie niemals dazu imstande gewesen. Sie war sicher, dass diese positive
Einstellung bald kippen würde, aber ihr fehlte die Zeit, sich darüber weitere Gedanken zu machen.
Die Bahnhofsuhr zeigte zwanzig nach vier Uhr. Sie würde den nächsten Zug nehmen, egal wohin. Nur fort von hier. Zum ersten Mal dachte sie darüber nach, dass sie kein Geld bei sich hatte. Nun, das war ihr geringstes
Problem. Sie konnte sich in der Toilette einschließen, dem Schaffner schöne Augen machen oder vielleicht konnte sie einen Mitreisenden umgarnen, der ihr
helfen würde. Selbst wenn man sie erwischte und auf irgendeine Polizeistation schaffte, würde das allemal besser sein, als Vincent oder Antonio in die Hände zu fallen. Obwohl sie lieber nicht von den Bullen aufgegriffen werden
wollte, ohne Papiere, ohne Fürsprecher. Wer konnte schon wissen, ob es hier wirklich so ganz anders zuging
als in ihrer Heimat? Und was war, wenn sie bei der Polizei Vincents Kontaktmann
begegnete, den er mal erwähnt hatte?
Mit gemischten Gefühlen legte Natascha das letzte Stück zum Bahnhof zurück. Dabei sah sie sich immer wieder nach allen Seiten um. Einige Meter neben dem Haupteingang hatte ein Penner sein
Nachtlager aufgeschlagen. Bevor sie die Eingangshalle betrat, spähte sie vorsichtig ins Innere. Um diese Zeit war kaum etwas los. Drei
Jugendliche mit Punkerfrisuren standen vor einer Apotheke, ein Mann zog einen
großen schwarzen Koffer hinter sich her. Anscheinend war die Luft rein.
Natascha betrat das Gebäude und eilte auf die große Anzeigentafel zu. Nur wenige Züge fuhren um diese Zeit. Der nächste ging in einer guten Viertelstunde, heute ausnahmsweise ab Gleis vier. Eine
Regionalbahn nach Dortmund. Wenn sie dort ankam, wäre vielleicht schon jemand in so einem kleinen Häuschen auf einem Bahnsteig, der ihr weiterhelfen würde. Über eine solche Einrichtung hatte sie mal etwas im Fernsehen gesehen. Sie würde gern nach Bremen oder Hamburg. Eine Stadt im Norden wäre schön, sie hatte noch nie gehört, dass Vincent dorthin fuhr. Und sie hatte eine Cousine, die auf einer Insel
in der Nordsee lebte. Sie würde irgendwie ihre Adresse herausfinden. Sobald sie in Sicherheit war, der
Gefahr entkommen, jemandem in die Arme zu laufen, der sie in Vincents Auftrag töten wollte, sogar töten musste, um nicht seinen schrecklichen Zorn auf sich zu laden.
Ängstlich blickte sie nach hinten, dann verließ sie die Eingangshalle. Wenn doch bloß mehr Menschen unterwegs wären, zwischen denen sie sich verstecken könnte. Sie passierte die Passage mit den Aufgängen zu den Gleisen. Gleis eins und zwei, las sie und lief weiter. Bei drei und
vier blieb sie stehen und schaute die Treppe hinauf. Oben stand ein Mann mit
Hut, dessen Gesicht sie nicht erkennen konnte. Natascha schreckte zusammen.
Erst im zweiten Moment fiel ihr auf, dass seine Größe nicht zu Antonio passte. Trotzdem fühlte sie sich gewarnt.
Wenn Vincents Mann fürs Grobe ihr wirklich hier auflauerte, würde er genau den Bahnsteig kontrollieren, von dem der nächste Zug abfuhr. Um die Gefahr zu minimieren, durfte sie erst im letzten Moment
vor der Abfahrt dort auftauchen. Seufzend lief sie zu dem ersten Aufgang zurück und stieg die Treppe hoch. Alle paar Stufen spähte sie zurück in die Passage. Plötzlich erkannte sie Antonios kantigen Kopf mit der breiten Stirn, seinen
energischen Gang, den entschlossenen Blick, der sie suchte.
Er hatte tatsächlich geahnt, dass er sie hier am Bahnhof finden würde. In den ersten Sekunden fühlte sie sich vor Schreck wie gelähmt, dann durchflutete Adrenalin ihre Adern und sie hastete weiter nach oben.
Endlich hatte sie die letzte Stufe erreicht. Sie rannte, bis Antonio sie von
unten ganz sicher nicht mehr erkennen konnte. Was sollte sie nur tun? Sich
hinter dem Wartehäuschen verbergen oder auf dem Bahnsteig weiterhetzen und darauf hoffen, dass es
hinten ein Versteck geben würde? Sie würde laufen, darin bestand ihre einzige Chance. Nur damit hatte sie es den
anderen gezeigt, ansonsten war sie immer nur die erfolglose, naive Natascha gewesen.
Während ihre Füße den harten Steinboden kaum berührten, schaute sie mehrmals nach hinten. Niemand verfolgte sie. Trotzdem musste
sie jeden Moment damit rechnen, dass Antonio hier auftauchen würde oder auf dem benachbarten Bahnsteig, von dem aus er sie auch sehen konnte.
Keuchend rannte sie weiter. Plötzlich hielt sie inne und bekreuzigte sich. Ein Ritual aus ihrer Heimat. Es
half! Tränen der Erleichterung rannen über ihre Wangen. Vor ihr tat sich ein Fluchtweg auf, mit dem sie nicht gerechnet
hatte. Eine weitere Treppe führte vom Bahnsteig hinab in die Freiheit.
Natascha hetzte die Stufen hinunter. Sie endeten gegenüber einer Mauer, davor eine Straße. Als sie das Ende der Treppe erreichte, erkannte sie, dass sie in einer Unterführung gelandet war. Atemlos blieb sie stehen und spähte nach rechts und links. Dann überquerte sie mit schnellen Schritten die Fahrbahn, um zu der Haltestelle auf
der anderen Straßenseite zu gelangen. Dabei blickte sie immer wieder nach hinten. Während sie registrierte, dass auch die anderen Bahnsteige einen direkten Zugang
nach unten zur Straße hatten, beschleunigte sich ihr Herzschlag noch einmal. Sie musste so schnell
wie möglich von hier fort. Plötzlich näherte sich ein Bus. Er hielt an! Die vordere Tür glitt auf, die hintere blieb verschlossen. Natascha stieg ein. Der Fahrer
musterte sie eindringlich.
»Ihren Fahrschein bitte!«, hörte sie seine Stimme wie aus der Ferne.
Ruckartig drehte sie sich um und hetzte aus dem Bus. Von Antonio war zum Glück nichts zu sehen, aber auch von Fahrgästen fehlte jede Spur. Musste denn niemand zur Frühschicht fahren? In etwa hundert Metern Entfernung tauchten nun einige
jugendliche Nachtschwärmer auf. Dahinter zwei Männer mittleren Alters, von denen sie eher annahm, sie würden zur Arbeit fahren. Ratlos blieb sie stehen. Doch mit einem Mal kam ihr eine
Idee, wohin sie sich wenden konnte. Um nicht aufzufallen, lief sie nicht,
sondern ging zügig die Straße entlang, hin zum Ende der Unterführung, immer mit bangem Blick zu den Treppenaufgängen zu den Gleisen. Jeden Moment konnte dort eine Gestalt mit breitem Schädel auftauchen.
Als sie wieder den fast sternenklaren Himmel sehen konnte, erkannte sie die Mülheimer Straße und atmete kurz auf. Ganz sicher war sie nicht, aber sie glaubte doch, auf dem
richtigen Weg zu sein. Wie lange hatte sie Anastasija nicht gesehen?
Anastasija, ihre ehemalige Zimmernachbarin aus dem Hochfelder Nachtclub »Zum eisernen Anker«, die ihr nun als Rettungsanker erschien. Vorausgesetzt Anastasija wohnte immer
noch in diesem biederen Haus in guter Wohngegend, dessen Hausnummer sie
vergessen hatte, das sie jedoch wiedererkennen würde. Hoffte sie. Und vorausgesetzt, Antonio hatte wirklich nicht ihre Spur
aufgenommen. Sie schaute sich um.
3
Unruhig wälzte sich Hauptkommissar Willibald Pielkötter in seinem Bett hin und her. Bisher hatte er kein Auge zugemacht, dabei war
die Nacht so gut wie vorbei. Er schaltete das Licht des Weckers ein, den er auf
halb vier Uhr gestellt hatte. Das hieß, ihm blieben knapp zwanzig Minuten. Jetzt noch einzuschlafen, lohnte sich
nicht. Er plante ohnehin lieber ausreichend Zeit ein, zumal mit seiner lädierten Schulter fast jeder Handgriff mehr Zeit erforderte als früher. Punkt fünf würde Jan Hendrik auf der Matte stehen. Sein Sohn hatte sich den Tag freigehalten,
um ihn zum Antritt seiner Reha nach Norderney zu kutschieren. Sofern alles
planmäßig lief, konnten sie die Fähre um zehn Uhr dreißig erreichen.
Draußen war es noch dunkel und Pielkötter knipste die Nachttischlampe an. Anschließend setzte er sich seufzend auf. Was wäre, wenn alle Mühe umsonst war und er nie wieder in seinen Beruf zurückkehren konnte? Hastig wischte er mit dem Handrücken über seine Stirn, als könne er diese schreckliche Vorstellung dadurch verscheuchen. Denken Sie positiv, hatte ihm der behandelnde Arzt aus dem Duisburger Krankenhaus bei der
Abschiedsvisite ans Herz gelegt, visualisieren Sie im Geiste, dass Sie wieder an Ihrem Schreibtisch sitzen. Das
ist die beste Voraussetzung dafür, dass es genauso kommen wird.
Pah, am Schreibtisch sitzen. Was glaubte der denn? Als ob es bei einem Kommissar
nur darauf ankäme, einen Bleistift richtig zu halten oder die Tasten des Computers zu bedienen.
Im Notfall musste er einen Gegner überwältigen können. Er musste darauf vertrauen, dass all seine Gelenke, Muskeln und Sehnen im
richtigen Moment funktionierten. »Genau dafür trittst du ja diese Reha an«, stöhnte er laut. Mit dem rechten Fuß angelte er nach einem Hausschuh, der gestern Abend offensichtlich unter dem
Bett gelandet war. Nach einigen erfolglosen Versuchen, das Ding hervorzuholen,
tauchte der von einem dicken Staubflocken umgebene Pantoffel wieder auf.
Pielkötter erhob sich und wankte ins Bad. Während er unter der Dusche stand, dachte er an Marianne. Zum ersten Mal lächelte er kurz. Seine Frau, die seit einiger Zeit getrennt von ihm lebte,
beabsichtigte, ihn auf Norderney zu besuchen. Von diesem gemeinsamen Wochenende
hing unendlich viel ab. Okay, direkt nach seiner Operation hatte sie
versprochen, zu ihm zu halten, aber hatte sie das wirklich als seine Frau gemeint? Oder eher als eine Art gute Bekannte, Krankenschwester oder Trösterin? Pielkötter stellte gedankenverloren das Wasser ab, dabei war sein Körper noch halb voller Seifenschaum. Er drehte den Hahn wieder auf und platzierte
sich mitten unter den Strahl. Die Wärme tat gut.
Auf dem Weg zur Treppe ins Erdgeschoss wäre er beinahe über den fast fertig gepackten Koffer gestolpert. Nur der Kulturbeutel fehlte,
denn er wollte die Zahnbürste nach dem Frühstück noch einmal benutzen. Ohne den Koffer lief er hinunter. Jan Hendrik würde ihn später ins Erdgeschoss bringen. So schwer es Pielkötter auch fiel, er musste lernen, Hilfe anzunehmen.
Zwei Brote hatte er schon gestern Abend mit Käse belegt, nur der Kaffee musste frisch zubereitet werden. Während die Maschine Laute von sich gab, als hätte sich jemand gründlich den Magen verdorben, ging er noch einmal die Merkliste der Klinik durch,
die auf dem Küchentisch lag. Anscheinend hatte er nichts vergessen, aber galt das auch für das Haus? Hatte er wirklich die Stecker für Fernseher, Musikanlage und den Router herausgezogen? Zum Glück blieb ihm noch genügend Zeit, in allen Räumen ein letztes Mal nach dem Rechten zu sehen.
Pielkötter hatte seinen Rundgang gerade beendet, da klingelte es an der Tür. Automatisch schielte er zu seiner Armbanduhr. Die zeigte fünf vor fünf. Sein Junge war pünktlich. Ein mildes Lächeln huschte über sein Gesicht, dann wurde er wieder ernst. Schließlich holte Jan Hendrik ihn nicht ab, um einen freien Tag mit ihm zu genießen. Seufzend lief er zur Tür und ließ seinen Sohn herein.
»Wenn du die kaputte Schulter nicht hättest, würde ich glatt mit dir tauschen«, erklärte Jan Hendrik statt einer Begrüßung. »Ein paar Wochen auf Norderney, da hast du wirklich Dussel gehabt. Du hättest genauso gut irgendwo anders landen können, in einem kleinen Kaff im tiefsten Hinterland. Stattdessen darfst du auf
die angesagte Szene-Insel.«
Pielkötter bereitete es Mühe, die Begeisterung seines Sohnes zu teilen, auch wenn er inzwischen einiges über Norderney gehört und gelesen hatte, was auf einen angenehmen Aufenthalt schließen ließ.
»Und welche Kneipe du unbedingt mal besuchen musst, ist der Kings Club von Tante
Jens«, fuhr sein Sohn fort. »Da gibt es nicht nur Plüsch und Pomp, sondern auch nette musikalische Einlagen vom Besitzer. Ich hoffe
jedenfalls, den urigen Club gibt es noch. Ist ja schon bald drei Jahre her,
seit ich mit Sebastian dort war.« Er stockte. Offensichtlich ließ die Trauer über den Tod seines Lebenspartners vor wenigen Wochen ihn verstummen. »Vielleicht ist die Kneipe ja auch nichts für dich«, versuchte er, das Gefühl von Verlust zu überspielen.
»Mal sehen«, erwiderte Pielkötter nachdenklich und klopfte seinem Sohn mit der linken Hand auf die Schulter. »Es kann ja sein, dass ich gar nicht so viel Freizeit habe. Oder schon in der
Klinik sein muss, wenn es bei dieser Tante Jens erst richtig losgeht. Aber
jetzt sollten wir aufbrechen. Oben steht noch mein Koffer.«
4
Anastasija hatte ihr Hilfe angeboten, sollte Natascha jemals nicht mehr bereit
sein, sich für einen Hungerlohn in dem Nachtclub von ekeligen Händen begrapschen zu lassen. Warum Anastasija sie gemocht hatte? Vielleicht weil
ihre Mutter aus der Gegend stammte, in der Natascha geboren worden war,
vielleicht aus einem ganz anderen Grund. Im Augenblick sollte sie darüber nicht nachdenken, es gab Wichtigeres. Hauptsache, sie wohnte noch in dem
Viertel südlich der Bundesstraße mit diesem seltsamen Namen. Mondbuschweg, Sternbuschweg oder Sonnenbuschweg,
irgendetwas mit Gestirnen. Und sie meinte sich genau zu erinnern, dass der Weg
rechts ab führte. Während sie forteilte, sah sich Natascha immer wieder um. Obwohl sie keinen
Verfolger erkennen konnte, pochte ihr Herz nicht nur wegen der Anstrengung.
Nach einer guten Viertelstunde erreichte sie die Häuserzeile, in der Anastasija hoffentlich noch diese Wohnung in der ersten Etage
besaß. Ängstlich schaute Natascha ein letztes Mal nach hinten, dann verlangsamte sie den
Schritt. Sie schaute in allen Hauseingängen auf die Klingelschilder und ihre Hoffnung sank mit jedem Misserfolg. Doch
endlich stand sie vor der richtigen Tür, sie las: Fröhlich, Erlenmeier und dann in der zweiten Reihe Ryschikow. Vor Erleichterung hätte sie fast geweint. Anastasija wohnte tatsächlich noch hier.
Nataschas Finger presste sich auf den Klingelknopf, einmal, zweimal, dreimal,
jedes Mal ein wenig fester und länger, doch nichts rührte sich. Ob Anastasija nicht zu Hause war? Vielleicht hatte sie auch Besuch
von einem Freier, bei dem niemand stören durfte. Unwahrscheinlich, überlegte Natascha. Zumindest hatte sie ihr bei der letzten Begegnung erzählt, dass sie ihre Kunden nur in deren Domizil oder einem Hotel empfangen und
ihre Wohnung reinhalten wolle. Egal, wo Anastasija sich befand, Natascha musste
warten, bis sie aufwachte oder zurückkehrte.
Plötzlich fiel ihr ein, dass ihre frühere Zimmernachbarin, seitdem sie sich einmal ausgesperrt hatte, einen Schlüssel auf dem Dachboden verwahrte. »Ich könnte mich ohrfeigen«, hatte sie am Telefon getönt. »Wie kann man nur so blöd sein? Der Schlüsseldienst musste kommen. Bei den Preisen verkaufe ich mich geradezu billig.
Aber jetzt habe ich einen Ersatzschlüssel auf dem Söller versteckt. Da hat jeder seinen eigenen Bereich mit Hocker für den Wäschekorb. Leine und Klammerbeutel.« Ja, so ähnlich hatte sie es erzählt.
Ob der Schlüssel wohl immer noch dort oben lag? Aber selbst wenn, nützte Natascha das im Moment herzlich wenig. Um dorthin zu gelangen musste sie
erst einmal ins Treppenhaus. Sie lief auf die andere Straßenseite und schaute zurück. Alle Fenster waren dunkel, nirgendwo brannte Licht. Und sofern sie um diese
Zeit einen Nachbarn rausklingeln würde, selbst wenn er nicht schliefe, würde sie sich sehr verdächtig machen. Es half alles nichts, sie musste sich gedulden. Natascha sah an
ihren Armen hinunter. Sie hatte Gänsehaut. Dabei spürte sie überhaupt keine Kälte. Seufzend drehte sie sich einmal um die eigene Achse, dann setzte sie sich
auf den Bordstein zwischen zwei parkende Wagen. Der Platz bot Schutz, aber
eigentlich rechnete sie nicht damit, dass Antonio hier auftauchen würde. Wenn er ihr vom Bahnhof gefolgt wäre, hätte er sie längst gepackt. Und eine andere Spur, ihr zu folgen, gab es nicht, hoffte sie.
Während die Nacht der Morgendämmerung zu weichen begann, döste Natascha vor sich hin und schreckte hoch, als sie plötzlich ein Geräusch hörte. Zwar konnte sie es nicht orten, aber dafür sah sie, dass in Anastasijas Haus in der unteren Etage das Licht angegangen
war. Sie erhob sich vom Bordstein, um einen besseren Beobachtungspunkt zu
finden. Der Rücken und etliche Glieder taten ihr weh. Sie ignorierte den Schmerz und ging
weiter, bis sie einen guten Blick in das beleuchtete Zimmer werfen konnte. Ein
Mann mittleren Alters hantierte in einer Küche herum. Zumindest glaubte Natascha eine Dunstabzugshaube auf der rechten
Seite erkennen zu können. Sie schüttelte ihre Beine, rieb mit den Händen an den kalten Armen entlang. Während der Mann Schränke öffnete, den Wasserkocher füllte, gelegentlich an der Arbeitsplatte verweilte und zwischendurch immer wieder
herzhaft gähnte, rotierten ihre Gedanken. Mit etwas Glück würde der Typ bald zur Arbeit gehen und das Haus verlassen. Das hieß, dass er die Tür öffnen würde. Genau in diesem Moment musste sie dort auftauchen und ihm eine Erklärung dafür liefern, dass es okay war, sie einfach hineinhuschen zu lassen.
Das Licht in der Küche erlosch. Inzwischen wusste sie, was sie sagen würde: Ich hole Anastasija ab. Eilig überquerte Natascha die Straße und positionierte sich direkt vor der Tür aus dunklem Holz. Sie strich sich zwei vorwitzige Haarsträhnen aus der Stirn und atmete mehrmals tief durch. Als sich die Flurbeleuchtung
einschaltete, rauschten noch einmal die Worte durch ihren Kopf, die sie gleich
hervorsprudeln wollte. Nun hörte sie eilige Schritte. Unmittelbar darauf wurde die Tür aufgerissen.
Natascha stürmte nach vorn, drückte ihren rechten Arm gegen das Holz. Sie wollte gerade zu der wohlüberlegten Erklärung ansetzen, da hastete der Mann mit einem kurzen »Morgen« an ihr vorbei auf die Straße. Die kleine Aktentasche in seiner Hand schwankte hin und her. Offensichtlich
hatte er es sehr eilig. Ihr war das nur recht. Während sie ins Treppenhaus lief, ging die Beleuchtung aus, aber es fiel trotzdem
genug Licht durch ein kleines Fenster, um sich zurechtzufinden. Natascha
schlich die Treppe bis zum Dachboden hoch. Als sie die Tür öffnete, knarrte sie leise, deshalb ließ Natascha sie offen.
Zunächst konnte Natascha nur Konturen erkennen, aber dann erkannte sie hinten links
einen dreibeinigen Schemel, den Anastasija schon in Hochfeld besessen hatte.
Seitlich darüber hing ein Wäschesack auf einer Leine. Nataschas Herz pochte. Lag die Lösung wirklich so nah? Sie durchquerte eilig den Dachboden und nahm den Beutel an sich. Hektisch suchten ihre Finger zwischen den Klammern herum, bis sie tatsächlich auf etwas Kaltes, Metallisches stieß. Sie lächelte. »Gute Anastasija«, flüsterte sie erleichtert, während sie den Schlüssel an sich nahm. Anschließend hängte sie den kleinen Sack wieder zurück und stieg in die erste Etage hinunter.
Bis auf ihre kaum wahrnehmbaren Tritte, hörte sie keinen Laut. Abgesehen von dem Mann, der vorhin hinausgeeilt war,
schienen alle Bewohner noch zu schlafen. Vor Anastasijas Wohnung hielt sie
inne. Mit angehaltenem Atem steckte sie den Schlüssel ins Schloss. Er passte. Als Natascha die Diele betrat, blähte sie die Nasenflügel. Die Luft roch abgestanden und nach einer Art Gewürz, das sie aus ihre Kindheit kannte. Nur den Namen hatte sie vergessen. Sie
schloss die Tür hinter sich und tastete sich langsam an der Wand entlang bis zum gegenüberliegenden Zimmer. Von dort drang diffuses Grau in die Diele.
Als sie den Raum erreicht hatte, ließ sie ihren Blick über das Mobiliar schweifen. Offensichtlich hatte sich seit ihrem Besuch nicht
viel geändert. Gegenüber stand der moderne Schrank mit etlichen offenen Fächern. Linker Hand erkannte sie dieses altmodische Sofa, dessen roter Bezug bei
dem schwachen Licht noch nicht richtig zur Geltung kam. Natascha geriet in
Versuchung, sich darauf niederzulassen, die Augen zu schließen und einfach einzuschlafen. Zuerst jedoch musste sie den Rest der Wohnung
inspizieren, auch wenn die abgestandene Luft darauf hindeutete, dass Anastasija
die letzten Tage woanders verbracht hatte.
Ein Prospekt auf dem Küchentisch mit Ferienhäusern in Spanien ließ darauf schließen, dass Anastasija dort Urlaub machte oder eine Weile ihr Geld verdiente.
Schade, Natascha sehnte sich nach der Nähe eines Menschen, der es gut mit ihr meinte. Plötzlich überfiel sie ein Gefühl von Trauer. Sie kauerte sich auf das Sofa und wimmerte leise vor sich hin.
Ihre mageren Arme umklammerten die fast ebenso dünnen Beine, die sie dicht an den Körper gezogen hatte. Die anfängliche Erleichterung über den passenden Schlüssel wich unaufhörlich einer Mischung aus Angst und Leere.