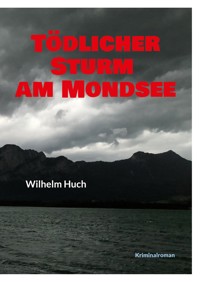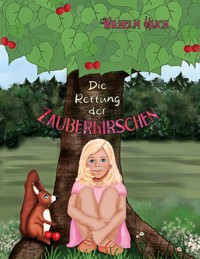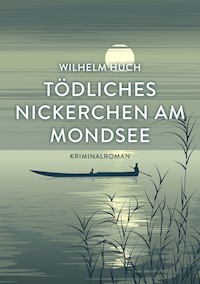
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Marco Island Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Linz treffen sich in regelmäßigen Abständen der Arzt Fabregas, der Anwalt Finda und der Frühpensionist Blassnig zu einem gepflegten Bierchen. Konnten sie dabei früher unbeschwert über Gott und die Welt schwadronieren, so hat sich in letzter Zeit eine graue Gewitterwolke über ihren Köpfen zusammengebraut. Diese Gewitterwolke hat einen Namen: Wolfgang W. Dieser ist ein erfolgreicher Autoverkäufer, der leider das Pech hatte, von Fabregas nicht hundertprozentig erfolgreich operiert worden zu sein und von Finda ein Haus überteuert gekauft zu haben. Beides will Wolfgang W. nicht auf sich beruhen lassen, weshalb er bereits die ersten Schritte gegen Fabregas und Finda eingeleitet hat. Wenn diese Schritte erfolgreich sind, könnten die bisher glänzenden Karrieren des Herzspezialisten Fabregas und des auf Sachwalterschaften spezialisierten Anwaltes bald zu Ende sein. Und da Wolfgang W. auch noch Blassnig dessen letzte Freundin ausgespannt hat, freunden sich Fabregas, Finda und Blassnig langsam, aber sicher mit dem Gedanken eines Auftragsmordes an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Huch
Tödliches Nickerchen am Mondsee
Kriminalroman
© 2020 Marco Islands Books
Alle Rechte vorbehalten
2. Auflage 2020
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhalt
Nackte Tatsachen
Zum Silbernen Halbmond
Ein Sommer wie damals
Das prunkvolle Stiegenhaus,
die Gestalt am See und ein unsichtbarer Liebhaber
Der Hauskauf
Der Kampf mit der Krimi-Materie
Die Goldene Gans
Die Inbesitznahme des Hauses
Intermezzo
Aus dem Leben eines Autoverkäufers
Diamonds are a girl’s best friend
Das Plädoyer
Eine Hausführung der besonderen (langatmigen) Art
Im Zaunwissa
Das Ende eines schönen Traums
Der Fußballtraum
Krimi oder Wirklichkeit?
Die Teufelsgasse wird ihrem Namen gerecht
Ein Festnetztelefonat
Der letzte Traum
Kommissar Maigret betritt die Szene
Auf dem Land
Ein Handy-Telefonat
Verehrt sei Marlene Dietrich in alle Ewigkeit
Mittagessen bei Waagners
Ein Sonnenuntergang am Mondsee – Epilog
Charaktere
Nackte Tatsachen
Ich nannte mich Wolfgang W., oder es wäre korrekter zu sagen, meine Eltern hatten mich so genannt, hatten mir diesen Namen aufoktroyiert, auf dass ich fortan mit diesem Namen durch das Leben gehen musste. Wolfgang W., W. wie Oscar Wilde oder Winston Churchill. Es lag aber nicht an meinem Namen, dass mein Leben in der Folge nicht immer so verlief, wie ich mir dies vielleicht erträumt hätte. Denn anfangs hatte ich mir gar nichts erträumt. Ich lebte vielmehr so vor mich hin, verbrachte eine an besonderen Ereignissen sehr karge Kindheit, eine Jugend, deren Höhepunkt ein dritter Platz bei einem Oberklassenfußballturnier gewesen war, und schlitterte über den Umweg eines mir sicher nicht auf den Leib geschneiderten Studiums in meinen jetzigen Beruf eines Autoverkäufers. Eigentlich verkaufe ich eher Träume, denn wenn sich ein Österreicher mit all seinen Ersparnissen einen japanischen Sportwagen kauft, ist damit meist der Traum verbunden, dass sein neues Automobil in Wahrheit ein Porsche sei. Deshalb passieren auch immer so viele Unfälle mit japanischen Sportwagen: Deren Fahrer schließen beim Anblick des Fahrzeugemblems auf dem Lenkrad die Augen und bilden sich ein, sie lenkten das deutsche, für sie leider unerschwingliche Luxusfahrzeug.
Mein Job im Verkaufen von Autoträumen mag zwar helfen, die Träume vieler finanziell nicht so gut situierter Menschen zu verwirklichen – bis eben zu jenem Moment, wo sie auf der Autobahn die Augen schließen und in eine Leitplanke fahren –, mir hilft er lediglich, ein sorgenfreies, aber deshalb nicht unbedingt zufriedenes Leben zu führen. Warum ich vom Stadium der Zufriedenheit trotz einer reizenden Frau und zwei braven Kindern so weit entfernt bin, dürfte auch daran liegen, dass ich Autos im Grunde hasse. Am liebsten gehe ich zu Fuß, manchmal fahre ich auch mit dem Fahrrad. Um ein Auto mache ich außerhalb meines Jobs aber beständig einen großen Bogen. Es ist mir bewusst, dass es absurd klingt, dass ausgerechnet ich Autoverkäufer wurde. Aber man weiß ja, wie das läuft. Man ist zur falschen Zeit am falschen Ort, trifft dort die falschen Leute und schon hat man einen gut bezahlten, aber äußerst widerwärtigen Job. Es kommt immer wieder vor, dass ich auf dem Weg von der Teeküche, wo ich mir ein Glas Wasser hole, in mein Büro denke, ich müsste jetzt das Wasserglas an die Wand schleudern, um meine Frustration und Aggression gegenüber meinen Kollegen und potentiellen Kunden abzubauen. Dass ein Wechsel meines Arbeitsplatzes nur sehr selten in Erwägung gezogen wird, hängt mit meiner schon sprichwörtlichen Beharrlichkeit und jeglichen Änderungen abgeneigten Persönlichkeit zusammen. Wäre ich im antiken Griechenland geboren und hätte dort die Gelegenheit gehabt, mit Heraklit zu sprechen, ich hätte ihn gewiss davon abgehalten, das Leben als einen ständigen Fluss – von Überdrüssigkeiten? – zu brandmarken. Ich hätte alles dafür gegeben, dass es statt „Panta rhei“ „Vita est institio“ hieße oder wie es Heraklit eben auf Altgriechisch ausgedrückt haben würde.
Interessant und für mich im Nachhinein doch verwunderlich an jenem Ereignis, das ich kurz schildern möchte, war, dass es zu keinerlei Ängsten oder Unsicherheiten über die Zukunft führte. Obwohl es immerhin der Paradefall des Panta rhei war und mein stillstandgeprägtes Leben hätte erschüttern müssen, war es mir sehr willkommen, dass man bei einer Routineuntersuchung als sogenannten Zufallsbefund einige nicht sehr hoheitsvoll aussehende Veränderungen in meinem Gehirn und daran anschließend eine kleine Öffnung in meinem Herzen feststellte, die an einem Ort war, an dem sie nichts zu suchen hatte. Die damit verbundenen Krankenhausaufenthalte empfand ich sonderbarerweise als etwas überaus Glückhaftes. Im Besonderen die Möglichkeit, Thomas Manns Zauberberg in eben jener waagrechten Lage zu lesen, die für Castorps Leben offenbar auch die bevorzugtere Daseinsform zu sein schien, erfüllte mich mit einer gewissen Dankbarkeit. Dass ich dem Zustand der Zufriedenheit näher gekommen wäre, möchte ich in diesem Zusammenhang aber nicht behaupten.
Nach der Konfrontation mit dem Befund des ungehörig seit meiner Geburt nicht zugewachsenen Loches schien für mich klar zu sein, dass dieses Loch zu verschließen sei, so dies medizinisch durchführbar war. Da mir dies von vielen Seiten bestätigt wurde, die Folgen eines solchen Eingriffes darüber hinaus als überaus minimal vor Augen geführt wurden, galt mein weiteres Bestreben nur mehr dem Ziel, den Lochverschluss so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Über Freunde von Bekannten meiner Eltern stellte ich den virtuellen Kontakt zu dem den Eingriff vornehmenden Arzt her, ein persönlicher Termin ging sich vor der Operation nicht mehr aus. So lernte ich Dr. Fabregas nur telefonisch kennen, seine Stimme schien nichts Böses zu verheißen und auch der von ihm vorgeschlagene Termin „11. September“ – oder, wie er zu sagen pflegte, Nine Eleven – hatte für mich nichts Unbehagliches oder gar Abschreckendes an sich. Mir war nur wichtig, dass ich bald unter das Messer kam. Dabei zerstörte Dr. Fabregas aber gleich meine Vorstellungen von einer ernsthaft famosen Herzoperation, indem er erklärte, dass das Messer nur dazu diente, einen kleinen Schnitt zu setzen, um danach ein dünnes Schläuchchen in eine meiner Venen einzuführen, durch das man ein winziges Schirmchen in mein Herz einführen wollte, das dort für die Herstellung des von der Natur grundsätzlich vorgesehenen lochfreien Zustandes meines Herzens sorgen sollte. Wie der Eingriff im Einzelnen vonstattengehen würde, interessierte mich im Grunde nicht. Dennoch konnte ich die Details den seitenlangen Erklärungen, die ich später im Spital zu lesen bekam, entnehmen, um an deren Ende mit meiner Unterschrift auch noch zu bestätigen, dass ich letztlich damit einverstanden wäre, zu sterben, wenn die Operation oder der Eingriff nicht den geplanten und allgemein voraussehbaren Verlauf nehmen sollte.
Als ich einen Tag vor dem 11. September ins Krankenhaus einrückte, traf ich dort Olga Flor, die einen Freund besuchen wollte. Obwohl wir seit den gemeinsamen Schultagen, die auch ein paar gemeinsame Stunden auf einem Skilager und in einem schon seit Jahren der Vergangenheit angehörenden „Lion’s Pub“ einschlossen und gut zwanzig Jahre zurücklagen, kein Wort mehr miteinander gewechselt hatten, entwickelte sich ein angeregtes Gespräch. Gespräch mag vielleicht nicht der treffendste Ausdruck sein, denn tatsächlich erzählte sie mir eine Geschichte nach der anderen, ohne dass ich auch nur einmal zu Wort kam. Ich wusste daher auch nicht, ob sie mir Begebenheiten aus ihrem Leben oder aus einem ihrer bereits geschriebenen oder noch der Niederschrift harrenden Bücher erzählte. Natürlich war ich geschmeichelt, dass sie mich nach all den Jahren überhaupt noch erkannt und eines Wortwechsels für würdig befunden hatte. Schließlich hatte sie es zu etwas gebracht, nicht nur zu einem abgeschlossenen Physikstudium, sondern auch zu drei vollendeten Romanen, einem Platz auf der Longlist für den deutschen Buchpreis 2008 und zu regelmäßiger Erwähnung in den österreichischen Tageszeitungen. Wenn gelegentlich ein japanischer Sportwagen in einen Unfall verwickelt war, dessen Fahrer ein Opfer meiner „Traumverkäufe“ gewesen war, so hielten es die Zeitungen zum Glück nie der Rede wert zu erwähnen, von wem das Unfallauto verkauft worden war.
Ich war unleugbar beglückt, den Erzählungen einer echten Schriftstellerin lauschen zu dürfen, auch wenn der Redeschwall nach einer Weile im gesteigerten Ausmaß ermüdend wurde und ich darob außerdem meinen Termin für die Voruntersuchung versäumte. Sollte meine Operation nicht so erfolgreich verlaufen, wie mir dies Dr. Fabregas in Aussicht gestellt hatte, sondern eher eine solche Wendung nehmen, wie es die von mir unterschriebene Einverständniserklärung für durchaus möglich erscheinen ließ, so würde ich jedenfalls die Erzählungen einer jungen, aufstrebenden Dichterin mit ins Jenseits genommen haben.
Als es schließlich ernst wurde und ich nur mit einem Spitalsnachthemd bekleidet im Vorzimmer zum Operationssaal auf meinem Bett lag, wurde mein Denken von einem einzigen Gedanken geprägt: Was würde geschehen, wenn ich während der Operation plötzlich den Drang verspüren sollte, auf die Toilette zu müssen? Da ich sehr lange warten musste, bis ich endlich in den OP geschoben wurde, schien es nicht so abwegig zu sein, dass das von mir Befürchtete auch tatsächlich eintrat. Dass die Gabe einer hinreichend großen Dosis eines Narkotikums das Entstehen des mir so bedrohlich erscheinenden Dranges allenfalls verhindern würde, kam mir nicht in den Sinn. Auch jetzt würde ich nicht ausschließen, dass die mir damals noch bevorstehende, jetzt schon lange zurückliegende Narkose mein Problem doch nicht gelöst haben würde. Was verwunderlich war: Ich dachte nicht an den Erfolg oder Misserfolg der anstehenden Reparatur meines Herzens, sondern nur an das zuvor Erwähnte. Wahrscheinlich machte dies aber die langsam verrinnenden Minuten im Vorzimmer genauso schwer erträglich wie die in dieser Situation viel näher liegende Angst vor dem als möglich dargestellten Ergebnis der Operation.
Nach einer allenfalls durch technische Gebrechen verursachten und mir als Unendlichkeit erscheinenden Wartezeit schob man mich in den OP, wodurch meine Gedanken naturgemäß etwas abgelenkt waren, die Situation insgesamt sich jedoch leider nicht entspannte. Nun trat das unvermeidliche Ereignis immer näher an mich heran, man beraubte mich meines ohnehin schon sehr dürftigen Nachthemdes und begann, die der Tunnelöffnung für mein Schirmchen entgegenstehenden Schamhaare abzurasieren. Meinem Ersuchen nach ein wenig wärmenden Textilien – den Schwestern und dem später herantretenden Ärzteteam mochte es angesichts der anstehenden Arbeit warm gewesen sein, ich hingegen fror, nicht zuletzt wegen der mir verordneten Bewegungslosigkeit – kam man zwar nach, dennoch fühlte ich mich sehr nackt auf dem OP-Tisch. Und ich war es ja wohl. Dabei verließ mein Bewusstsein im Laufe der nächsten Vorbereitungshandlungen allmählich den Ort des Geschehens, man ließ die Wohltat der Narkose durch eine Leitung in mich fließen, bevor man das berühmte Schirmchen durch das fachgerecht verlegte Kanalrohr in mein Herz einführte. Dr. Fabregas dürfte den OP erst betreten haben, als ich mich schon teilweise in meine Traumwelt verabschiedet hatte. Dunkel tauchte in späteren Jahren sein von einem riesigen Mundschutz verhängtes Gesicht vor meinen Augen auf. Da ich ihn weder davor noch später je persönlich in wachem Zustande getroffen hatte, beruhten meine diesbezüglichen Erinnerungen wohl nur auf der Annahme, dass es Dr. Fabregas gewesen sein musste. Denn anders als bei traditionellen Fahrzeugkontrollen durch die Polizei wies sich Dr. Fabregas mir gegenüber nicht durch einen Lichtbildausweis aus. Selbst wenn er dies getan hätte, wäre ein Vergleich des Ausweisbildes mit der Wirklichkeit durch die Operationsverkleidung des Arztes nur schwer möglich gewesen. Damals hatte ich aber keinen Grund, an seiner Identität zu zweifeln. Auch an seinen Fähigkeiten, die man zuvor schon vielfach gelobt hatte, hatte ich keinen Zweifel. Ich ergab mich ohne erlebnisstarke Gefühle dem da Kommenden und war bloß dadurch peinlich berührt, dass der Gedanke an den plötzlich notwendigen Toilettenbesuch die schönen Geschichten Olga Flors zu überlagern drohte.
Als mein Geist den OP verlassen hatte, wurde ich dadurch entschädigt, dass ich davon träumte, in einem der Spitalsgänge lustzuwandeln. Es war ein beinahe schwereloses Hinweggleiten über den kalten Boden. Mein Blick streifte die Patienten, die in ihren Betten auf den Gängen ihrer weiteren Bearbeitung harrten, und die zwischen ihnen emsig umherschwirrenden Krankenschwestern und Ärzte. Da ich meinen Spaziergang dazu nutzen wollte, ein mir verschriebenes Medikament zu nehmen, vertiefte ich mich in die Lektüre des Beipackzettels. Dieser legte mir nahe, das Medikament, das ein einer Zahnpaste nicht unähnliches Gel war, auf dem Beipackzettel selbst, und zwar entlang des aus zwei Worten bestehenden Namens des Medikamentes aufzutragen. Ich bestrich den Beipackzettel daher mit dem Gel, konnte danach aber die weiteren Anwendungsvorschriften nicht mehr lesen. Ich fragte eine mir entgegenkommende, wohl nicht unattraktive Patientin oder Krankenschwester, wie ich das Medikament nun zu mir nehmen solle. Sie fuhr mit ihren Fingern über den Beipackzettel und wischte das Gel davon ab, sodass es sich auf ihren Fingern befand. Diese steckte sie mir in den Mund. Ich schleckte sie – genussvoll? – ab. Dies wiederholte sich mehrmals, bis das ganze auf dem Beipackzettel befindliche Medikament in meinen Körper eingedrungen war. Ob zu diesem Zeitpunkt das Schirmchen mein Loch im Herzen in der Realität bereits verschlossen hatte, konnte ich nachträglich nicht mehr eruieren.
Zum Silbernen Halbmond
Finda, Fabregas und Blassnig saßen wie immer am Donnerstag im Silbernen Halbmond und tranken ihr Bier. Finda war ein leidlich erfolgreicher Anwalt in Linz, hatte stets einen grünen Trachtenanzug an und fuhr einen farblich darauf abgestimmten Puch G. Er war nicht allzu groß, für sein Alter aber noch mit ziemlich vielen Haaren gesegnet, sodass man ihn zumeist jünger schätzte, als er tatsächlich war. Dafür war es schon des Öfteren vorgekommen, dass man ihn ob seiner hohen Fistelstimme am Telefon für eine Frau gehalten hatte, was seinem sehr stark ausgebildeten Selbstbewusstsein für ein paar Augenblicke einen kleinen Dämpfer versetzte. Sein herausragendes Merkmal war eine ausgesuchte Höflichkeit, die in krassem Gegensatz zu seinen verschlagenen Gesichtszügen stand und nichts Gutes verhieß. Vielleicht war es diese wie aufgesetzt wirkende Höflichkeit, die jeden, der ihn zum ersten Mal traf, misstrauisch werden ließ. Und dieses Misstrauen ließ in der Regel auch später nicht nach, wenn man Finda länger kannte, denn die Diskrepanz zwischen seinen einschmeichelnden Worten und seinen tatsächlichen Handlungen bewies Findas wahren unlauteren Charakter. So kam es auch, dass er trotz seiner Redegewandtheit und einer für Rechtsanwälte überdurchschnittlichen Kenntnis der diversen Rechtsgebiete letztlich vor Gericht in den meisten Fällen den Kürzeren zog. Denn die Richter vermuteten hinter seinen salbungsvollen Worten stets etwas anderes, als diese ausdrückten. Und in den meisten Fällen hatten sie auch Recht, Findas Mandanten bekamen Unrecht und Finda sein Honorar. Da er es aber auch nach verlorenen Prozessen verstand, seine Mandanten durch seine Höflichkeitsfloskeln von der Realität abzulenken, kamen einige immer wieder zu ihm zurück, um auch im nächsten Prozess zu verlieren.
Seit Kindheitstagen war er mit dem dickbäuchigen Blassnig befreundet, einem seit Kurzem in Frühpension befindlichen Mittfünfziger, der es in seiner aktiven Zeit vom Sportwagenfahrer zum massierenden Besitzer eines physiotherapeutischen Ambulatoriums gebracht hatte. Da er von seiner Jugend an stets auf zu großem Fuße, welcher in der Regel in genagelten handgefertigten Schuhen steckte, gelebt hatte, war der Konkurs seines Unternehmens unvermeidlich gewesen. Dies minderte Blassnigs Lebensfreude aber nicht sonderlich, als er sich kurzerhand in den keineswegs wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht wäre dies naturgemäß nicht möglich gewesen. Aber eine der drei Lebensgefährtinnen, die er zur damaligen Zeit sein eigen nannte, machte es ihm möglich. Sie versprach ihm, als Sekretärin in einem oberösterreichischen Leitbetrieb noch mehr zu arbeiten und noch weniger für sich selbst auszugeben. Auf diese Weise konnte Blassnig weiterhin Maßanzüge beim alten Schneider Baseltov in der Bergschlösselgasse kaufen, teure, wenngleich geleaste Autos fahren und dicke Zigarren rauchen. Dass Blassnig in jungen Jahren ein Gigolo der besonderen Art gewesen sein mag, war angesichts seiner jetzigen Beleibtheit nicht leicht vorstellbar, zumindest war seine leicht angegraute, auf eineinhalb Zentimeter gestutzte Haarpracht von solcher Art, dass man versucht war, wie bei kleinen Kindern mit der Hand darüber zu streichen und leise „Mein Bärli!“ zu flüstern. Ein weiteres Charakteristikum Blassnigs war sein unorthodoxer Gebrauch des Besteckes, den er auch seinen Kindern teils erfolgreich weitergegeben hatte. Als sich ein Bekannter Blassnigs über die Ursache und den Zweck dieser Eigenheit Klarheit zu verschaffen versuchte, fand er eine der Wahrheit sehr nahe kommende Erklärung bei Thomas Bernhard: „Der Emporkömmling hatte sich eine aristokratische Eßweise angewöhnen wollen und ist in einem grotesk-komischen Besteckgebrauch steckengeblieben.“ (Holzfällen)
Der Dritte des donnerstäglichen Stammtisches im Silbernen Halbmond war Dr. Fabregas, ein auf Herzkathederuntersuchungen und Herzeingriffe mittels Katheder spezialisierter Oberarzt im Krankenhaus der Elisabethinen. Er hatte schütteres Haar, eine Brille, die stets schief auf seiner Nase saß, und eine sehr attraktive Frau. Seine Heirat mit Marla Tannhäuser, einer über die Grenzen von Linz hinaus nicht allzu weit bekannten Film- und Literaturkritikerin, hatte ihm nicht nur zwei Kinder, sondern auch einen Nebenjob im Ambulatorium seines Schwiegervaters, des Primarius Tannhäuser, gebracht. Die Ironie des Schicksals hatte es mit sich gebracht, dass das Tannhäuserische Herzambulatorium in jenen Räumlichkeiten untergebracht war, in welchen Blassnig seine große Karriere als Heilmasseur begonnen und sein „Ambulatorium an der Donau“ untergebracht hatte. Fabregas konnte es sich ob seines zweiten Jobs und der damit verbundenen Aussicht auf Nachfolge in der Leitung des Herzambulatoriums leisten, seine Tätigkeit bei den „Liesl’n“, wie das Krankenhaus der Elisabethinen landläufig genannt wird, mehr als Hobby denn als ernsthafte Beschäftigung mit der Materie zu betrachten. Konsequenterweise zeigte sich dies insbesondere im Umgang mit den Patienten, die er als notwendiges Übel ansah und nur insofern duldete, als sie ihm jene Herzen zur Verfügung stellten, in welche er so gerne – von Ultraschallbildern begleitet – mit seinen Schirmchen und sonstigen medizinischen Heilbehelfen eindrang. Wenn die Patienten ihr Herz am Eingang des OP abgegeben hätten und während der Kathedereingriffe draußen im Wartezimmer geblieben wären, während er mit den diversen Unzulänglichkeiten seines Lieblingsorgans spielte, wäre ihm dies wohl Erfüllung all seiner Träume gewesen. Abgesehen von seiner insofern unkonventionellen Patientenbehandlung wurde er unter seinen Kollegen als sehr kenntnisreicher Spezialist auf seinem Schirmchen-Gebiet respektiert, wegen seiner Penetranz in anderen Bereichen und vor allem seiner Unfähigkeit, Terminpläne einzuhalten und mit den computerunterstützten Informationssystemen umzugehen, allerdings mit großen Vorbehalten betrachtet und als Kollege alles andere als geschätzt. Dies war auch einer der Gründe, weshalb ausgerechnet er ein guter Freund von Finda und Blassnig geworden war. Mit Finda hatte er bereits bei ihrem ersten Treffen anlässlich einer Ausfahrt der Puch-G-Freunde zu den Mostheurigen im Alpenvorland die chemische Übereinstimmung ihrer beider Unaufrichtigkeiten festgestellt. Und als er vor zwanzig Jahren das erste Mal auf Blassnigs Massagetisch gelegen war, stellte sich mit diesem eine fast unzeitgemäße Übereinstimmung ihrer Ess- und Trinkgewohnheiten heraus. Zu Fabregas‘ Vorteil führten bei ihm die zahlreichen gemeinsamen Ess- und Trinkgelage mit Blassnig nicht zu solchen körperlichen Verformungen wie bei Blassnig. Fabregas konnte essen und trinken, was und so viel er wollte, er nahm kein Kilogramm zu.
Die drei hatten an diesem Abend bereits jeder sechs Krügerl hinter sich und starrten ein wenig stier auf die Tischplatte vor sich.
„Darf es noch eine Runde für die drei Peter sein?“, fragte der Wirt und wollte sich daran machen, drei weitere Krügerl mit Bier zu füllen. Blassnig rülpste und meinte, dass sie nun genug Bier getrunken hätten und dass es an der Zeit für etwas Erfrischendes sei, zum Beispiel sechs vierfache Heidelbeerschnäpschen. Der Wirt brachte das Gewünschte, die drei hoben die Gläser und stürzten sie in ihre Schlünder. Sie holten kurz Luft und setzten jeder das zweite Glas nach.
„Wie wäre es, wenn jeder von uns vor der nächsten Schnäpschen-Runde eine heitere Anekdote aus seinem Leben erzählt?“, fragte Finda die beiden.
„Gute Idee, ich fange gleich an, denn dieser Heidelbeerschnaps hat mir gerade wieder mein Gedächtnis zurückgegeben, das ich schon im Bier verloren zu haben glaubte“, sagte Fabregas.
„Ihr wisst ja, dass ich mich in den letzten Jahren auf diese Schirmchenoperation spezialisiert habe, diesen Verschluss des Loches zwischen den beiden Vorhofkammern im Herz, das bei manchen Menschen nach der Geburt nicht zusammenwächst. Ich glaube, dass ich in den letzten drei Jahren ungefähr hundertfünfzig solche Eingriffe durchgeführt habe, die alle vollkommene Erfolge waren.“
„Das heißt, hundertfünfzig nackte Patienten auf dem OP-Tisch, hoffentlich mehr Patienten als Patientinnen! Herz, was willst du mehr?“, unterbrach Blassnig den Fabregas in dessen Erzählung.
„Sehr witzig. Jedenfalls letzten Herbst, ausgerechnet zu Nine Eleven, ist mir ein kleiner Patzer passiert. Wahrscheinlich war ich von unserem Donnerstagstammtisch davor leichtgradig ermüdet. Denn beim Einführen des Schirmchens zitterte meine Hand und das Schirmchen fiel mir mitten im Katheder von der Greifzange. Das kommt zwar zuweilen vor und ist im Grund auch kein gravierendes Problem. Wir holen das Schirmchen wieder aus dem Katheder – Kollege Xaver ist darauf schon spezialisiert, weil er schon etliche meiner Schirmchen wieder herausholen musste – setzen es noch einmal auf die Greifzange und wiederholen die ganze Prozedur. Da es aber auch beim zweiten Versuch herunterfiel, gesellte sich zu meinem kleinen Kater vom Vortag doch eine gewisse Nervosität. Ich nahm mir vor, das Schirmchen beim dritten Versuch unbedingt in einem Zug an den vorgesehenen Ort zu bringen. Das gelang mir auch, aber ich konnte es nicht so hundertprozentig platzieren. Das Schirmchen verschloss das Loch zwar größtenteils, aber nicht zur Gänze. Da wir bereits drei Versuche hinter uns hatten, wollte ich nicht noch einen weiteren riskieren. Außerdem war es bereits um die Mittagszeit und ich hatte einen riesigen Hunger. Wir beendeten den Eingriff, weil er ja zumindest zu 7/8 erfolgreich war, und ich gönnte mir einen Riesenteller gebratener Calamari im Klosterhof.“
„Und was ist an der Geschichte so Außergewöhnliches, dass du uns damit langweilst?“, fragte Finda.
„Warte! Stellt euch vor, einige Monate später ruft mich dieser Patient an und meint, er habe von seinem Internisten erfahren, dass mein Eingriff nicht „first class“ gewesen sei. Stellt euch das vor, nicht „first class“? Ich musste mich zusammenreißen, um nicht schallend zu lachen. Denn so eine nette Verharmlosung für einen reichlich vermurksten Eingriff habe ich noch nie gehört. Natürlich musste ich versuchen, ihn irgendwie wieder loszuwerden. Ich sagte ihm daher, dass ich das nicht glauben könne, da der Eingriff meiner Erinnerung nach optimal verlaufen sei. Ich vertröstete ihn damit, dass ich erst die Bilder vom Eingriffstag mit jenen seiner Nachuntersuchung, bei der man auf den nicht vollständigen Verschluss des Loches gestoßen war, vergleichen wollte, bevor ich eine Aussage dazu treffen könne. Der idiotische Patient hat mich inzwischen zwar bereits mehrfach angerufen bzw. anzurufen versucht. Aber bisher konnte ich ihn damit hinhalten, dass ich die Bilder wegen Serverproblemen noch nicht gefunden habe. Bei meinem letzten Telefonat habe ich angedeutet, dass ich die Bilder vielleicht gar nicht mehr finden werde, weil sie im virtuellen Nirwana der IT verschwunden sein könnten. Aber was sagt ihr zu dem Ausdruck „nicht first class“, ist der nicht sensationell?“
„Meinst du, dass dies der neue juristische Ausdruck für einen Kunstfehler werden könnte?“, fragte Finda, der dem Wirt das Zeichen für die nächste Heidelbeerschnäpschen-Runde gab.
„Apropos Juristerei“, warf Blassnig ein, „ich habe zurzeit wieder einmal einen unerquicklichen Prozess anhängig.“
„Wie bitte? Und ich weiß davon gar nichts?“, unterbrach ihn Finda mit gespielter Entrüstung. „Ich dachte, dass ich dein Haus- und Hofanwalt bin?“
„Aber Peter, beruhige dich! Es ist ja bloß ein außerstreitiges Verfahren, bei dem man als Anwalt ohnehin nichts Ordentliches verdienen kann. Das habe ich dem Oberfettinger angehängt, der war mir noch einen Gefallen schuldig. Und da er sich ja nicht nur bei Scheidungen auszukennen scheint, dachte ich mir, wird er mir da auch helfen können“, fuhr Blassnig fort.
„Worum geht es denn in deinem Verfahren?“, fragte Fabregas neugierig.
„Ich habe schon wieder einen Unterhaltsprozess am Hals.“
„Was, in deinem Alter? Schau mir einer an!“ Finda schüttelte lachend den Kopf und leerte den dritten vierfachen Heidelbeerschnaps.
„Ja, schön wäre es, wenn es ein aktueller Fall wäre, will heißen, ein Kind beträfe, das ich vor Kurzem in die Welt zu setzen geholfen hätte. Aber leider hat es mein zwanzigjähriger Sohn Karl für notwendig empfunden, mich auf Alimente zu verklagen. Ihr wisst schon, das ist dieses undankbare Kind von Gerti, die vor zehn Jahren diesen Autoverkäufer geheiratet hat. Ich habe in den letzten zehn Jahren überhaupt keinen Kontakt zu dem Buben gehabt und jetzt kommt er und will von mir plötzlich ein Geld. Aber eines muss ich sagen: Der Oberfettinger ist wirklich genial! Der hat zu mir gesagt: ‚Kein Problem, wir bestreiten einfach die Vaterschaft.‘ Habe ich ihn gefragt, ob das nicht schwierig ist, wenn ich vor zwanzig Jahren ein Vaterschaftsanerkenntnis abgegeben habe. Sagt der Oberfettinger: ‚Kein Problem, wir behaupten einfach, dass die Gerti das Anerkenntnis damals erschlichen hat.‘“
„Aber Peter, das wird doch nicht so einfach sein, zwanzig Jahre nach dem Anerkenntnis plötzlich zu sagen, dass du nicht der Vater bist. Hast du denn jemals Zweifel gehabt, dass du nicht der Vater bist?“, fragte Finda seinen Freund.
„Aber geh, Peter! Natürlich bin ich der Vater, sonst hätte ich doch nie das Anerkenntnis abgegeben. Du kennst die Gerti zwar nicht, aber ich kann dir sagen, die ist damals so auf mich abgefahren, da gab es nicht den geringsten Verdacht, dass sie etwas mit einem anderen Mann gehabt hätte. Du darfst da nicht von mir auf meine Freundinnen schließen. Das waren zwar alles mehrseitige Verhältnisse, aber immer nur von meiner Seite aus gesehen. Die Mädchen und Frauen, die ich mir angelacht habe, die glaubten immer ganz fest an mich und waren so wahnsinnig in mich verliebt, dass da kein Gedanke je für einen anderen Mann blieb. Erst nach ein paar Jahren, meist, wenn sie allmählich dahinterkamen, dass sie mich mit anderen Frauen teilen mussten, kühlte ihre bedingungslose Liebe leise ab. Aber auch nicht bei allen. Rosi und Laetitia zum Beispiel haben mir bis heute die Treue gehalten. Na, jedenfalls hat der Oberfettinger gemeint, es genügt, wenn wir dem Gericht sagen, dass ich den Karl in der Verhandlung über die Unterhaltszahlung zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder gesehen habe und mir dabei aufgefallen ist, dass er mir überhaupt nicht ähnlich sieht. Und als weiteres schlagendes Argument werde ich darauf hinweisen, dass die Gerti kurz nach ihrer Trennung von mir sofort diesen Autoverkäufer geheiratet hat. Das ist doch ein sehr starkes Indiz dafür, dass sie es mit der Treue nicht so genau nimmt.“
„Aber die Heirat mit diesem anderen Mann fand immerhin zehn Jahre nach der Geburt deines Kindes statt, oder nicht?“, warf Finda ein.
„Ja, eigentlich schon. Aber der Oberfettinger hat behauptet, dass er schon einige Vaterschaftsanerkenntnisse mit dieser Masche aus der Welt geräumt hat.“
„Und was ist mit den medizinischen Vaterschaftstests, sind die vor Gericht nicht mehr relevant?“, wollte Fabregas wissen und orderte beim Wirt eine weitere Heidelbeerschnäpschen-Runde.
„Grundsätzlich schon. Dem werden wir uns aber dadurch entziehen, dass ich einen Antrag auf Verfahrenshilfe wegen Vermögenslosigkeit stellen werde. Wenn dieser genehmigt wird, werde ich keinen Kostenvorschuss für den medizinischen Test zahlen müssen. Die sollen nämlich ziemlich teuer sein. Und wie ich Gerti kenne, wird sie sicher nicht gewillt sein, den gesamten Kostenvorschuss alleine zu berappen.“
Finda schüttelte den Kopf und murmelte: „Wenn du dich da nur nicht täuschst, mein lieber Freund. Ich habe ja schon viel Unglaubliches vom Oberfettinger gehört. Aber das war stets im Zusammenhang mit seinen Auftritten im Straflandesgericht. Dort hat er sicher schon einige grausame Mörder und unmanierliche Triebtäter vor dem Gefängnis bewahrt. Aber so richtig überzeugt bin ich von eurer Strategie nicht.“
Die Hitze lag schwer auf Peter Waagners Schultern, der gemeinsam mit seinem Freund Robert Wullner seine morgendliche Runde um den Mondsee lief. Zwei Schwäne schwammen stolz im See, für die Waagner aber kein Auge hatte. Denn er kämpfte mit der Luft und gab diesen Kampf schließlich auf. Das letzte Drittel ging er mit Wullner zu Fuß.
„So oder so ähnlich könnte mein Krimi beginnen“, meinte Waagner zu seinem Freund, nachdem er ihn beim Gehen mit dem ersten Kapitel seines noch zu schreibenden Buches beglückt hatte. Wullner meinte nur lakonisch, ob da nicht bereits zu Beginn den Leser die Langeweile erdrücken könnte.
Ein Sommer wie damals
Merkwürdig war doch, dass man im wirklichen Leben, wenn man nicht gerade Polizist, Anwalt oder Richter war, gar nie mit Toten in Berührung kam. Natürlich, auch Ärzte, Totengräber und Versicherungsangestellte hatten gelegentlich mit Toten, Morden und Selbstmorden zu tun. Aber es wäre interessant zu wissen, dachte Peter Waagner, ob es in der Realität überhaupt so viele Morde gab wie in all den Krimis, die auf der ganzen Welt gerade geschrieben wurden. Die Mordstatistik für Österreich soll im Jahr 2014 von rund 150 Morden gesprochen haben. Darunter wären zwar gelegentlich Morde gewesen, die auch einem nicht unmittelbar mit der Unterwelt in Berührung Stehenden hätten passieren können. So zum Beispiel, wenn man spät abends von einem Discobesuch mit dem Taxi nach Hause fuhr, die letzten hundert Meter zu Fuß gehen wollte, um vor dem Einschlafen noch ein wenig Luft zu schnappen, und dann aus einem vorbeifahrenden Auto ohne jeglichen Grund erschossen wurde. Abgesehen davon, dass ein solcher Mord aus Jux und Tollerei für einen Krimi nicht sehr ergiebig gewesen wäre, hätte Waagner als normales kleinbürgerliches Mitglied der österreichischen Gesellschaft, der seinen Lebensunterhalt als überzeugend fabulierender und somit recht erfolgreicher Autoverkäufer verdiente, noch so oft einen Krimi lesen können, im wahren Leben wäre er nie über eine Leiche gestolpert. Denn die würden üblicherweise und in aller Regel in alten Weinpressen, in Häckselmaschinen, in alten Schlössern und in Kanalschächten, so diese in der Nähe von Freudenhäusern situiert waren, liegen. Und solche Orte lagen im Allgemeinen nicht auf Waagners Jogging-Runden.