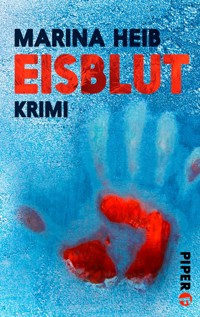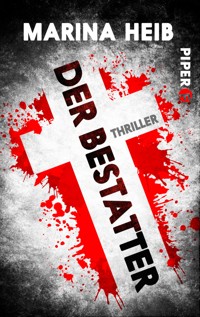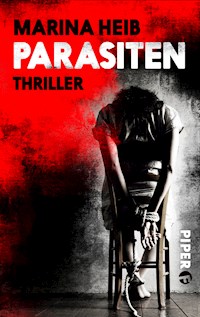4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die erste Frauenleiche liegt in den Anlagen des Botanischen Gartens, hingerichtet mit 30 Messerstichen. Die Tochter der Bürgermeisterin ist ein weiteres Opfer, erdrosselt und mit einem ausgelöffelten Auge. Der Göttinger Polizeichef Markus Lorenz ist der Grausamkeit dieses Falles nicht gewachsen. Und selbst der hinzugezogene Sonderermittler Christian Beyer tappt im Dunkeln. Erst die Intuition der Psychologin Anna Maybach führt zu einer Spur. Denn Anna erkennt ein System hinter den einzelnen Morden: Der Täter schlägt nur an keltischen Festtagen zu. Und der Höhepunkt steht noch aus: die Walpurgisnacht … Abgründig, packend, originell – auch der neue Roman von Marina Heib verspricht absolute Hochspannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
© für diese Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2014© Piper Verlag GmbH, München 2009Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: © Daniel Schweinert / shutterstock.comVollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe2. Auflage 2010
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
–
Samhain. Erstes Ritual.
1
2
3
4
Yule. Zweites Ritual.
1
2
3
4
5
Imbolc. Drittes Ritual.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ostara. Viertes Ritual.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Beltane. Letztes Ritual.
1
2
Danksagung
Textnachweis
Das Zimmer lag im Halbdunkel, die Dämmerung sickerte schwach durch die zugezogenen Baumwollvorhänge. Aus den Boxen, die sich im Regal zwischen Büchern versteckten, klang leise Jazzmusik. Ein Tenorsaxofonist improvisierte mit rauchigem Timbre über das Thema von »Lush Life«. Die CD-Hülle lag geöffnet neben einer zusammengeknüllten Wolldecke auf dem Kanapee, das ein wenig abgewetzt war, aber die frühere Qualität noch erahnen ließ. Vor dem Kanapee, auf einem Berberteppich, stand ein niedriger Sofatisch aus dunkler Eiche. Mit seinen gedrechselten Füßen sah er altmodisch aus, fügte sich aber gerade deswegen gut in das gediegene Ambiente des Zimmers, das eher an die mit Möbelpolitur sorgsam konservierte Variation eines wertigen Wohnzimmers aus den Fünfzigern erinnerte als an eine wahllos beim Sperrmüll zusammengesuchte Hommage daran. Auch der Duft nach Bratkartoffeln und Zwiebeln, den der halb abgegessene Teller auf dem Couchtisch im Zimmer verströmte, passte gut. Neben dem Teller lag ein in Leder gebundenes Notizbuch, das mit kleinen Zeichnungen und handschriftlichen Eintragungen vollgekritzelt war. Eine Tür wurde geöffnet, sodass Durchzug entstand und sich die zerschlissenen Vorhänge am Fenster aufblähten. Der Wind blätterte in dem Buch ein paar Seiten zurück, während nackte Männerfüße übers Parkett tappten, eine weitere Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde und das Geräusch einer laufenden Dusche den Saxofonisten durch die »Bridge« begleitete. Es dauerte einige Minuten, dann wurde die Badezimmertür wieder geöffnet, die Füße tappten zurück, hinterließen nasse Spuren auf dem Parkett, die zweite Tür wurde geöffnet, und der Wind blätterte wieder durch das Buch, diesmal nach vorne, als hätte er sich absichtlich gedreht, um die neueste Eintragung zu lesen.
Heute war wieder eine da. Dieselbe wie beim letzten Mal. Ich war auf dem Kanapee eingeschlafen, mit einer Wolldecke zugedeckt, als sie kam. Die dunkle Wolke schob sich über mich, wurde größer und dichter und schwärzer, und dann nahm ich wieder diesen unangenehmen Geruch wahr, ein regelrechter Gestank, und ich bekam Angst im Schlaf und wälzte mich hin und her und versuchte aufzuwachen, aber die Wolke hatte mich schon fest umschlossen, sich über mich gestülpt und gab mich nicht mehr frei. Da war kein Licht mehr. Ich hörte mich stöhnen und wimmern vor Angst, und ich wehrte mich, weil ich ja schon wusste, was nun kommen würde. Ich wollte es nicht, ich will es nie, und trotzdem passiert es. Und dann schälte sie sich aus der Wolke, wuchs daraus hervor wie schnell wucherndes Fleisch, und als sie dann da war, in der Gänze ihrer Weibesfülle, da zog sie mir langsam und lasziv die Wolldecke von meinem Leib, lächelnd und üppig, sie war schön und von festem Fleisch, ihre Haut so weiß wie die Unschuld, verlogene Brut, und lockiges schwarzes Haar floss in Kaskaden an ihr herab und umspielte ihre Hüften, mit denen sie über mir kreiste. Wollust. Sie war nackt, immer sind sie nackt, vollkommen nackt, und sie streckte mir ihre wogenden, prallen Brüste ins Gesicht, vor die Augen, vor den Mund, vor die Nase, ganz dicht, die Brüste dufteten nach Amber, und ihre Brustwarzen waren unnatürlich rot, so rot wie frisches Blut, sie reckten sich mir entgegen, fordernd, ich wollte wegsehen, meinen Kopf wegdrehen, aber es ging nicht, sie machte, dass ich nach ihnen griff, mit meinen Augen und den Händen, ich fasste die Brüste an, vergaß den Gestank der Wolke, aus der sie geboren war, vergaß meine Angst, und noch mehr Wollust machte sich breit, ich war verloren, denn sie setzte sich auf meine Lenden, heiß war sie und nass, und schwer wie die Sünde wog sie, ich konnte nichts mehr tun, ich war wie Blei, auch der Geist stand still und hielt die Luft an, sie ritt mich, erst sanft, dann mit Gewalt, ich wurde schwitzend in die Polster gedrängt, stöhnend, war hilflos ausgeliefert, meine Männlichkeit schmerzte vor verderbter Lust, bis sie mir schließlich den Samen raubte, ihre Hand in den Schoß vergrub und roch und leckte und triumphierend ihre Haare in den Nacken warf, und sich bewegungslos zurückzog von mir, sie wurde zurückgezogen, langsam, in den Schatten, ihre Dimensionen lösten sich auf in konturlosem Äther, ich hörte nur noch ihr leises, vergiftetes Lachen, bevor sie wieder mit der schwarzen Wolke verschmolz, und der Duft von Amber wieder überlagert war von dem Gestank der Hölle.
Ich wurde wach, mein Unterleib schmerzte, und mein Bauch und meine heruntergezerrte Kleidung waren nass von meinem Samen. Ich weinte vor Verzweiflung.
Jetzt geht es mir besser. Ein wenig. Ich habe alles durchdacht. Ich weiß, welch große Gefahren lauern. Sie wollen mich auf ihre dunkle Seite ziehen. Ich bin ihr Spielzeug, denn ich verspüre Lust. Meine Lust ist das Einfallstor, das sie nutzen. Ich versuche jedes Mal, mich zu wehren. Aber es ist schwer. Die verderbte Frau, die mich im Schlaf besucht, bietet mir alles dar, und die Sünde macht mich schwach, denn sie ist verführerisch in der Leere meines Lebens.
Aber ich bin nicht dumm! Die verderbte Frau ist nur eine Versuchung, so wie man Jesus versucht hat in der Wüste. Ich bin nicht Jesus, ich bin nicht wie Jesus, aber ich lebe in einer Wüste. Ich muss aufpassen. Die Menschen um mich herum lächeln mich an wie Puppen. Sie sind aus Plastik, sie haben keinen Kontakt zu mir, wollen ihn nicht haben, können nicht. Ihr Fleisch und mein Fleisch bluten in unterschiedlichen Welten.
Ich blute in einer Welt, die unendlich fern ist von den Menschen um mich herum. Ich wohne am Nordpol der Unzugänglichkeit bei den Koordinaten 84° 3' N, 174° 51' W, im Packeis der Arktis. Ich kann mich häufig nicht mal selbst erreichen.
Aber sie haben mich ausgesucht. Es muss etwas an mir, es muss etwas in mir sein, was ihnen sagt, dass ich verderbt bin, ein leichtes Opfer. Sie glauben, dass sie mich auf ihre Seite ziehen können.
»Der Grund aber, warum sich die Dämonen zu Inkubi und Sukkubi machen, ist nicht die Verlockung, da Geister nicht Fleisch und Knochen haben, sondern vor allem, dass sie durch die Laster der Wollust die Natur der Menschen beiderseits, nämlich körperlich wie seelisch erregen, damit sich die Menschen allen Lastern umso willfähriger ausliefern.«
Sie haben recht. Es ist schön. Verführerisch. Geil. Wenn sie zu mir kommen, gebe ich sofort auf. Ich will ihnen zu Diensten sein. Weil sonst niemand den Nordpol der Unzugänglichkeit erreicht. Nur diese dunkle, nach Verderben stinkende Wolke, die mir die größte Lust verheißt.
Aber ich bin nicht nur gefährdet, ich bin auch vorbestimmt. Vorbestimmt vom Guten. Und sosehr ich ihnen ein offenes Einfallstor bin, sosehr bin ich auch die Falle, in die sie tappen werden.
Denn sie machen mich wütend mit ihrer Sicherheit, mich so leicht zu kriegen. Ich werde mich ihnen nicht weiter überlassen. Ich werde mich wehren. Heute werde ich damit anfangen.
»Für jetzt genügt der Grund, der früher angeführt worden ist, nämlich dass die Macht des Dämons in den Lenden des Menschen liegt, weil unter allen Kämpfen die Streitigkeiten am heftigsten sind, wo ein andauernder Kampf und selten ein Sieg ist.«
Ich werde es ihnen zeigen! Ich werde siegen! Heute Nacht. Heute ist die Nacht.
Samhain. Erstes Ritual.
Jedes Jahr, wenn der Sommer sich zurückzieht, bricht eine Nacht herein, in der sich die Grenze öffnet zwischen den Welten. Ein erster, noch harmlos scheinender Riss in der Membran zwischen dem Diesseits und dem Jenseits tut sich bei Sonnenuntergang auf mit einem leisen Geräusch, es entsteht ein Sog, ein unheilvoller Sturm naht und wird laut und gewalttätig, es bildet sich ein Korridor des Grauens, der sich in wildem Wirbeln verbreitert, bis um Mitternacht die Welten verschmelzen. Tote kehren zurück und wandeln unter den Lebenden, Geister und Schauergestalten treiben ihr Unwesen. Diese Nacht ist eine Nacht der Angst und der Gefahr. Aus Furcht vor den Wesen des Totenreichs zünden die Lebenden große Feuer an und verkleiden sich mit Gewändern und Masken, um die Dämonen abzuschrecken.
Die Hundertschaften von jungen Menschen, die in dieser Halloweennacht das Zentrale Hörsaalgebäude der Göttinger Universität Georgia Augusta in Grund und Boden feierten, hatten ihre Verkleidungen jedoch aus schlicht finanziellen Gründen angelegt. Mit Kostüm Eintritt frei, so einfach war das.
Es herrschte ein vergnügliches, fast schon hysterisches Durcheinander von Henkersknechten, Vampiren, Werwölfen, Hexen und Skeletten, die allesamt ihre schwitzenden Leiber aneinander vorbei und auch ineinander drängten, man glaubte zu schieben und wurde geschoben.
Der wilde Reigen durchmischte Ikonen des Grauens aus Literatur und Kino. Frankenstein und sein Monster waren mehrfach vertreten, auch Jack the Ripper hielt Hof zwischen jeder Menge Leatherfaces, Freddy Kruegers und Hannibal Lecters. In der Mehrzahl schienen die männlichen Partygäste lieber in die Haut eines bestimmten Serienkillers zu schlüpfen als die Rolle irgendeines nicht identifizierbaren Henkersknechtes oder Werwolfs zu übernehmen.
Auch bei den Frauen ließ sich eine deutliche Kostümtendenz ausmachen. Sie gaben sich stark, kämpferisch oder gar gefährlich – in jedem Fall sexy. Die Hexen zeigten sich als eine Mischung aus Rockerbraut in Lederkluft samt Arschgeweih oder Domina in Lederkluft samt Arschgeweih, das war nicht so genau zu unterscheiden. Ebenfalls häufig waren Gruftis und Gothicanhängerinnen. So unterschiedlich die Stile im Detail sein mochten, schwarz war die vorherrschende Unfarbe, bei Männern wie bei Frauen. Einig schienen sich all die vermummten Unterweltgestalten auch über ein anderes Diktum zu sein: Sex und Alkohol sind die Quintessenz einer jeden Party. Bier, Schlammbowle und Wodka-Bull flossen in Strömen, man trank, baggerte, trank, tanzte, trank, sortierte ein und aus, trank …
Kurz vor Mitternacht gingen im Saal plötzlich alle Lichter aus, protestierendes Stimmengewirr erhob sich. Doch schon nach wenigen Sekunden legte sich eine unheimliche Stille über den Raum. Aus den Lautsprechern erklang der schmerzhaft laute Ton einer Kirchenglocke, die zwölf Mal schlug. Dann ertönte eine fast sakral klingende Männerstimme: »Dies ist das Blut, welches das Böse für euch vergossen hat.«
Kurz darauf gellte ein Frauenschrei, der allerdings nicht aus den Lautsprechern kam, sondern überaus echt aus der Mitte des Raumes. Weitere Frauen stimmten hysterisch ein. Plötzlich ging das Licht wieder an, in der Mitte der Tanzfläche duckten, drängten und schubsten sich die Menschen in chaotischem Durcheinander. Ursache der Panik waren als Henkersknechte verkleidete »studentische Hilfskräfte«, die mit batteriebetriebenen Plastik-Pumpguns von den Treppen zu den oben liegenden Galerien literweise Kunstblut in die Menge jagten. Dabei erklang die markante Musik aus Carpenters »Halloween – Die Nacht des Grauens«. Die Schreie lösten sich in Gelächter auf, jeder wollte sich möglichst intensiv von den Kunstblutschwallen duschen lassen ohne Rücksicht auf gegelte Frisuren und aufwendige Kostümierungen. Die Musik Carpenters wurde in James Browns Partyklassiker »Sexmachine« überblendet, die Menge begann auf der Tanzfläche zu toben, das frische Blut sprühte und spritzte bei besonders wilden Drehungen und Verrenkungen meterweit.
Etwas erhöht auf einer der Treppen standen ein Michael Myers und ein Hannibal Lecter und ließen ihre Blicke schweifen. Beide saugten der Masken wegen die neonfarbenen Alcopops in ihren Händen mit Strohhalmen aus, was die Furcht einflößende Wirkung ihrer Verkleidungen erstaunlicherweise noch unterstrich.
Ohne den suchenden Blick von der Tanzfläche abzuwenden, sagte Michael zu Hannibal: »Na, was meinst du? Wollen wir noch etwas mit den Kindern spielen, oder sollen wir der Nacht langsam mal den Stempel aufdrücken?«
Hannibal nickte gleichmütig. »Stempel aufdrücken. Bin breit. Wenn ich breit bin, werde ich spitz.«
»Hast du schon was gesehen?«
Hannibal wies mit dem gebogenen Strohhalm in seinem Plastikbecher auf eine unrhythmisch tanzende Frau, die als eine der wenigen nicht verkleidet war.
»Was will die denn darstellen? Die Ausgeburt der Hölle, die man Sozialpädagogin nennt?«, fragte Michael verächtlich.
»Gute Titten hat sie. Aber du hast recht, sie studiert Soziologie. Hab sie mal auf einer Theologenparty getroffen.« Hannibal kicherte hinter seiner Maske.
»Alle Soziologinnen fallen durchs Raster, die rasieren sich nicht.«
»Alle?«
»Und wenn es nur zehn Prozent sind, stell dir vor, wir stoßen ausgerechnet auf eine von ihnen!«
»Auf was willst du denn … stoßen? Wie wär’s mit der scharfen Lederbraut da vorne bei dem Henker?«
Michael betrachtete die Frau aufmerksam und schüttelte den Kopf. »Weißt du, mir gehen die ganzen Tussen auf den Wecker, die hier einen auf verludert machen. Meistens sind das verklemmte Juristinnen, die sich einmal im Jahr aufpimpen, um sich zu beweisen, dass auch in ihnen eine befreite Schlampe wohnt.«
Hannibal lachte gedämpft hinter seiner Maske: »Komm, wir gehen in den Hades. Mein Glas ist leer.«
In dem verwinkelten Gebäude gab es mehrere Aufgänge zu der oberen Etage, die von einer großzügigen Galerie bestimmt war. Dort waren in den verschiedenen Ecken die Freiflächen zu Bars umdekoriert worden und hatten der Nacht entsprechend düstere Namen erhalten. Neben dem »Hades« gab es »Xibalba«, die Unterwelt der Maya, man konnte aber auch in »Psycho« oder »Elm Street« einkehren.
Hannibal und Michael zwängten sich Richtung Theke, über der ein riesiger, zottiger Stoffhund mit gebleckten Zähnen von der Decke hing, und besorgten sich neue Getränke. Hannibal sah sich um: »Schau mal, da drüben sind Katsche und Großfuß.« Er wollte erfreut die Hand heben, um zu winken, doch Martin hielt ihn fest: »Bist du noch ganz dicht? Die erkennen uns nicht, und das soll so bleiben. Klar?«
»Logn, Mann, reg dich ab.«
In der gegenüberliegenden Ecke standen drei Frauen, die aus Reagenzgläsern eine hellrote Flüssigkeit tranken und sich dabei lautstark und lachend unterhielten. Eine von ihnen trug ein hautenges, hochgeschlitztes Kleid, um die Hüften hatte sie mehrere Nietengürtel geschlungen. Ihr Make-up war dramatisch, der Schmuck auffallend martialisch. Die Haare fielen pechschwarz bis zur Taille herab, ganz offensichtlich eine billige Perücke, denn der Glanz dieser Haare wirkte überaus künstlich.
»Die da. Die nehmen wir«, sagte Michael zu Hannibal.
Die Frau kam auf die Theke zu, in der Hand drei leere Reagenzgläser, schwankend wie bei hohem Seegang, und das lag nicht nur an ihren Zehn-Zentimeter-Stilettos. Wenig bescheiden drängte sie sich zwischen die um Getränke bettelnden Gäste, rollte die Reagenzgläser Richtung Barmann und bestellte Nachschub.
»Was trinkt ihr denn da?«, eröffnete Hannibal reichlich uninspiriert die Konversation.
»Venöses Blut. Oder ist es alteri… arterielles? Was von beiden is ’n das helle?«, gab die Frau lallend zurück.
»Ist doch egal, Hauptsache, es schmeckt«, mischte sich Michael ein. »Du bist Morticia Addams, oder?«
Sie warf Michael einen abschätzigen Blick zu: »Nee, hast du keine Augen im Kopf? Ich bin Elvira, Mistress of the Dark!«
»Verstehe. Morticias laufen zuhauf herum. Das macht dich, zumindest hier und heute Abend einzigartig, Elvira.«
Elvira zahlte die drei gefüllten Reagenzgläser, legte den Kopf in den Nacken und lachte. »Kann man von euch nicht behaupten, Jungs. Michael Myers und Hannibal Lecter. Wie viele von euch gibt’s hier? Dutzende!«
Michael und Hannibal sahen sich an. Dann beugte sich Hannibal vor und flüsterte Elvira verschwörerisch ins Ohr: »Wenn du die Drinks bei deinen Freundinnen ablieferst und zu uns zurückkommst, verrate ich dir unser Geheimnis. Aber nur dir. Weil du Elvira bist, die Mistress of the Dark!«
Elvira lachte wieder, schwankte zu ihren Freundinnen, lieferte zwei Reagenzgläser ab, tuschelte kurz und kam zurück. »Also, was ist denn euer Geheimnis, Michael und Hannibal?«
Nun beugte sich Michael zu Elvira und flüsterte ihr ins Ohr: »Hier treiben sich viele von uns rum, das ist wahr. Aber wir … wir sind die echten! Du darfst jetzt ruhig Angst haben.« Nach einer oder zwei Sekunden, die Elvira zum Begreifen benötigte, brach sie in Gelächter aus. Von der anderen Seite näherte sich Hannibal, strich Elviras Plastikhaare nach hinten und beschnupperte und leckte begierig ihren Hals. »Ein wenig Walnussöl plus Balsamico, und ich glaube, du wirst mir ganz hervorragend schmecken«, sagte er.
Es dauerte knapp anderthalb Stunden, bis Hannibal und Michael Elvira so abgefüllt hatten, dass sie kaum noch auf den Beinen stehen konnte. Ihre beiden Freundinnen hatten sich schon vor geraumer Zeit aus dem »Hades« verzogen, verärgert darüber, dass Elvira zwei Typen an der Backe hatte und sie keinen. Elvira lachte und lachte, und dieses grundlose Lachen schien ihr ein prächtiges Indiz dafür, wie gut es ihr ging. Deswegen fand sie es auch bescheuert, als Hannibal und Michael eine Trinkpause einlegen und frische Luft schnappen wollten. Nichtsdestotrotz ging sie mit.
Die Luft draußen war kühl und feucht, inzwischen war die Temperatur unter zehn Grad gesunken, über den Himmel jagten dunkle Wolken, getrieben von heftigen Sturmböen. Elvira fand die Idee, in der Kälte herumzulaufen extrem ungemütlich und fing an zu maulen. Mit charmanten Komplimenten und seiner dicken Jacke, die er ihr umhängte, brachte Michael sie dazu, wenigstens eine kleine Runde um den Block zu traben. Die drei verschwanden in den Schatten der Nacht.
Etwa eine Stunde später kamen Michael und Hannibal alleine zurück. Kurz bevor sie wieder in das Partytreiben eintauchten, hielten sie inne. Michael zündete sich eine Zigarette an. »Na, wie war das, Brandon?«, fragte er mit zufriedener Miene, die kurz im Licht des Feuerzeuges aufflackerte.
»Äußerst befriedigend, Philip.«
Sie hatten Durst und gingen hinein.
Ich habe gesiegt! Nein, es war ein Teilsieg, nur ein Teilsieg! Ich war gut, ich war GUT, aber dann hat sie die Beine gespreizt, und ich war schlecht, sie hat mich in die dunkle Wolke gesogen, und ich bin in sie gestoßen, ich wollte es, unbedingt, kurz habe ich verloren, bin in sie gestoßen, mit dem Ding, immerhin, ich habe aufgepasst, nur mit dem Ding, ich wusste trotz ihrer gespreizten Beine, ich DARF sie nicht anfassen, nicht mit meiner Haut, nicht direkt, es war ein Teilsieg, ich habe sie überführt, ich habe sie erlegt, ich habe sie getötet, aus der Welt geschafft. Ihr weißer Schoß, rasiert, er war so … so weiß … ich wollte mich verlieren, sie küssen, aber ich habe es nicht getan, kein Kontakt, ich weiß jetzt, wo ich hingehöre, ich habe es geschafft, sie hat mich wütend gemacht, meine Lust zur Wut, ich bin gut … Ich bin GUT.
»Was anderes ist die Frau als Feindin der Freundschaft, eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Heimsuchung, ein wünschenswerter Verlust, eine häusliche Gefahr, ein ergötzlicher Schaden, ein Fehler der Natur, der mit schöner Farbe bemalt ist?«
Aber es war nicht schön. Ihr Blut spritzte in die Höhe, die Fontäne war eine Anklage, ich konnte das nur tun, weil ich es musste.
Sie war böse. Ich habe etwas Gutes getan. Keine dunkle Wolke mehr. Keine nassen Wolldecken. Keine Schmach.
»Ich fand die Frau bitterer als den Tod.«
Diese Nacht war nur eine von vielen, in denen Markus Lorenz glaubte, verrückt zu werden. Ihm war nicht klar gewesen, wie schlimm Halloween sein würde. Überall brannten Feuer, lodernde Kürbisfratzen schienen ihn zu verhöhnen, als er durch die Straßen lief. Heute würde er sich besonders ins Zeug legen müssen, um sich und seine Erinnerungen in Alkohol zu ertränken – ein hilfloses Unterfangen, denn er wusste genau, das Feuer, das in ihm flammte, war unauslöschlich.
Er verbrachte die Nacht in der Kneipe, die seinem Kumpel Norbert gehörte. Norberts Schenke, eher eine dunkle Kaschemme als eine freundliche Gaststube, war in einem der vielen mittelalterlichen Gewölbekeller Göttingens untergebracht, die teilweise von den Hausbesitzern eigenhändig ausgebuddelt und wieder in einen einigermaßen originalen Zustand versetzt worden waren. Norberts Keller war karg eingerichtet. Wenn man die enge Treppe herunterkam, stieß man im ersten Raum auf einen quer zum Eingang stehenden Tresen aus massiven, fein polierten Holzbalken, der von acht Barhockern gesäumt wurde. Von dort aus gelangte man in einen weiteren, noch einmal einige Stufen tiefer liegenden Keller, in dem vier alte, wurmstichige Tische mit dazu passenden Stühlen standen.
Markus Lorenz war längst der einzige Gast im Keller, Norbert hatte die Tür schon vor Stunden abgesperrt. Markus, ein dunkler, stets schlecht rasierter Typ von südländischem Aussehen, hatte seinen massigen Leib von über ein Meter neunzig gleich zu Beginn des Abends auf seinen Stammhocker gewuchtet, den er nur zum Pinkeln verließ. Norbert saß ihm gegenüber hinter dem Tresen. Die Beine waren ihm schwer geworden im Verlauf der Nacht. Norbert war ein großer, kräftiger Kerl in Jeans und Baumwollhemd, die langen, aber schon ausgedünnten, schwarz-grau melierten Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Fast sahen die beiden aus wie Brüder, und so etwas Ähnliches waren sie auch. Sie kannten sich schon aus Schulzeiten, hatten in den frühen Siebzigern zusammen Drogen genommen, Demos besucht, Steine geworfen, Lehrer zur Verzweiflung gebracht, verbotenerweise in der Kommune von Norberts älterer Schwester übernachtet und dort ihre ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt. Norbert hatte dann später Politik und Geschichte studiert, das Studium aber aus Langeweile abgebrochen. Das war zumindest die offizielle Variante. Markus war einer der wenigen, die wussten, dass Norbert im siebten Semester nach einem kleinen Skandal exmatrikuliert worden war: Er hatte dem damaligen Dekan der Uni auf den Schreibtisch gekackt, und das nicht im metaphorischen Sinne. An die genauen Gründe für diese renitente Operation konnte sich Norbert angeblich selbst nicht mehr erinnern. Er behauptete, es hätte irgendetwas mit Joseph Beuys zu tun gehabt. Norbert habe mit seiner »Sozialen Plastik« das Dekanat in ein »Büro für Direkte Demokratie« verwandeln wollen. Noch heute philosophierten Norbert und Markus in manchen Nächten bedauernd darüber, dass große Künstler wie Beuys von Jüngern wie Norbert oder große Künstler wie Norbert von Banausen wie dem Dekan stets missverstanden werden.
Heute Nacht jedoch fielen nur wenige, karge Sätze. Norbert und Markus spielten schweigend »17 und 4« und rauchten und tranken dabei. Gelegentlich warf Norbert einen prüfenden Blick auf Markus. Wenn ihm dieser zu sehr in Schieflage geriet, stellte er ihm Wasser oder einen Kaffee hin, und Markus trank ohne Widerrede alles aus. Um dann wieder auf Bier umzusteigen. Niemals hätte Norbert seinen Kumpel nach Hause geschickt. Niemals. In solchen Nächten hielt er zu Markus und bildete mit ihm ein brüderliches Bollwerk gegen die Angst, verrückt zu werden.
Gegen Viertel nach sieben kroch ein Schimmer von herannahendem Tageslicht die Treppe herunter. Schwerfällig erhob sich Norbert, ging nach oben, schloss die Tür auf, trat einen Schritt nach draußen und streckte seine Glieder. Er sah in den bedeckten Himmel, der der Herbstsonne nicht die geringste Chance auf Durchkommen ließ.
»Wird ein beschissener erster November«, meinte er, kam zurück zum Tresen und warf die Kaffeemaschine an. Die Tür hatte er offen gelassen, um zu lüften.
Kaum waren die beiden Espressi mit lautem Brodeln und Zischen durchgelaufen, kam ein mürrisch aussehender Mann Anfang fünfzig mit einem überaus hässlichen Hund die Treppe herunter.
»Schon auf? Krieg ich einen Kaffee?«, fragte er.
»Auf: Nein. Kaffee: Ja«, gab Norbert zur Antwort und machte sich erneut an der Maschine zu schaffen.
Der Mann setzte sich auf einen Hocker und hielt dabei zwei Meter Abstand zu Markus, der den Neuankömmling keines Blickes würdigte. Schon gar nicht den Hund, der sich neben seinem Besitzer zusammenrollte. Markus konnte Hunde nicht ausstehen. Er war damit beschäftigt, sehr, sehr langsam und konzentriert Unmengen von Zucker in seinen Espresso einzurühren.
Ohne Gespür für das Schweigen in diesem Raum, das ein sorgsam gezüchtetes war, begann der Gast sich lautstark zu echauffieren, ganz so als habe er mit seiner Kaffeebestellung auch unbeschränkte Redefreiheit eingekauft. Immerhin richtete er sich ausschließlich an Norbert, der als Wirt jeden Kummer gewöhnt war, und ließ mit einem letzten Rest von Instinkt Markus außen vor: »Sie können sich gar nicht vorstellen, was mir heute Morgen schon alles passiert ist.«
»Will ich mir das denn vorstellen?«, erwiderte Norbert, ohne auf Verständnis zu hoffen.
»Und ob. Sie können es natürlich auch in der Zeitung lesen. Aber ich hab’s immerhin aus erster Hand. Kronzeuge sozusagen. Also, ich lauf da mit Heiner, das ist mein Hund, bis rüber zum Alten Botanischen Garten, da fängt Heiner an zu ziehen wie bekloppt. Tut er sonst nicht, hab ihn nämlich streng erzogen. Hunden muss man von klein an zeigen, wo’s langgeht. Mein Heiner weiß, wer der Rudelführer ist. Nämlich ich und sonst keiner, schon gar nicht der Heiner.« Dabei kicherte der Mann über sich und seinen miesen Witz.
Norbert lehnte sich mit dem Rücken an den Tresenschrank und sinnierte, ob er den Typen nicht einfach wieder rauswerfen sollte. Das hatte man von seiner Gutmütigkeit.
»Der Heiner zerrt und zerrt, und ich hinterher, und dann, langer Rede kurzer Sinn: Da liegt ’ne junge Frau in den Rabatten am Großen Teich. Total nackig, ich konnte alles sehen. Mausetot. Und alles voller Blut. ’ne richtige Sauerei.«
Norbert warf einen kurzen Blick zu Markus, welcher zum ersten Mal von seinem Espresso hochsah. Er schwieg jedoch weiterhin.
»Ich die Polizei angerufen, von der nächsten Telefonzelle aus, ich halte ja nichts von diesen Mobildingern, immer erreichbar, soweit kommt’s noch, jedenfalls gibt’s kaum noch Telefonzellen. Weil die Japsen und Finnen einen zwingen wollen, ihre Handys zu kaufen … Egal, jedenfalls halte ich mit Heiner Wache, bis die Polizei kommt. Will ja meine Aussage zu Protokoll geben. Kenn doch meine Bürgerpflichten.« Wieder lachte der Mann, diesmal mit einer leicht verächtlichen Note. »Aber das ist denen egal! Da taucht irgendwann nach der Streife so ein junger Schnösel in Zivil auf, macht sich mopsig, schickt mich hinter eine Absperrung wie all die anderen Gaffer, die sich inzwischen versammelt haben. Und lässt mich warten. Mich! Ich bin Zeuge! Scheiß Bullen! Ich konnte die noch nie ausstehen. Von wegen Dienst am Volk. Sind doch allesamt korrupte Idioten. Und immer am Jammern. Zu viel Stress, zu grüne Uniformen … Na ja!, was hat man von denen schon zu erwarten? Dieser Schnösel jedenfalls lässt mich ’ne geschlagene halbe Stunde die Beine in den Bauch stehen. Und dann fragt er mich nicht mal selbst, was Sache ist, sondern schickt so ’ne unattraktive Mopsfrau, die um den Hintern einen riesigen Speckgürtel mit sich rumschleppt.«
Markus trank mit einem großen Schluck seinen Espresso aus und erhob sich. »Sag ihm, er soll die Fresse halten.«
Norbert wandte sich gleichmütig an den Gast. »Du sollst die Fresse halten.«
Schwankenden Schrittes nahm Markus seine Lederjacke von der Garderobe und ging hinaus. Der Mann sah ihm böse hinterher.
»Was war denn das für ein besoffenes Arschloch?«
»Das war der Oberoberoberfuzzi von der Göttinger Kripo. Also sei froh, dass du noch alle Zähne hast.«
»Und der lässt sich hier volllaufen, während draußen Frauen abgemurkst werden? Scheiß Bullen, sag ich doch.«
Norbert beugte sich über den Tresen, beide Hände auf das polierte Holz gestützt. »Mach dich vom Acker, aber zack! Ich kann dich nicht leiden.«
Der Alte Botanische Garten war um diese Uhrzeit noch geschlossen. Markus wunderte sich nicht, dass dennoch ein Passant zu dieser frühen Stunde dort spazieren ging und sich kurz nach dem Leichenfund Schaulustige an dem eigentlich gesperrten Ort versammelt hatten. Schließlich kannte fast jeder Göttinger die Schlupflöcher, durch die man auch des Nachts in den Garten kommen konnte, was vor allem Studenten häufig nutzten, um dort ihren Liebesspielen zu frönen oder einen Joint zu rauchen. Auch Markus nutzte keinen der offiziellen Eingänge, sondern stieg schlicht über den Zaun, wobei er sich aufgrund seines Alkoholpegels so ungeschickt anstellte, dass er sich die Hose im Schritt aufriss und seine blauschwarz karierte Boxershorts freilegte. Sein ohnehin schon lädiertes Äußeres glich nun dem eines Obdachlosen, der seit Tagen kein Bett und kein Bad mehr gesehen hatte. Torkelnd folgte er dem Pfad bis zum Großen Teich, der seinen Namen mitnichten verdiente, denn er war definitiv nur ein Tümpel mit geringem Durchmesser und einer Wassertiefe von nur etwa vierzig Zentimetern.
Der Tümpel war durch rot-weißes Polizeiband abgesperrt, hinter dem sich das Publikum zu langweilen begann. Ein Blick auf die Leiche war nicht zu erhaschen, die Polizei benahm sich abweisend, und auch die beiden Journalisten vom »Göttinger Morgenecho« verbreiteten schlechte Laune, weil sie nicht zum Fundort vorgelassen wurden, um ihre Fotos zu machen. Außerdem war das Wetter ungemütlich. Es regnete zwar nicht, aber die Luft war kalt und feucht, sodass einem die starken Windböen permanent einen nassen Waschlappen ins Gesicht zu werfen schienen.
Markus wurde von einem Streifenpolizisten am Absperrband von oben bis unten mit einem missbilligenden Blick bedacht, dennoch hob der Beamte betont höflich das Band und ließ ihn durch. Der Pressefotograf schoss ein Foto. Markus umrundete den Teich, bis er zu der großen Sumpfeiche kam, an der sich seine Kollegen tummelten. Das Gelände war weitgehend gesichert, zwei Bedienstete der Pathologie näherten sich mit einem Blechsarg, um die Leiche abzutransportieren. Mit einer schroffen Geste und noch schrofferen Worten gebot Markus ihnen zu warten.
Konrad Künzel, mit achtundzwanzig Jahren Göttingens jüngster Kriminalkommissar und damit Untergebener des Ersten Hauptkommissars Markus Lorenz, ließ von seinem Gespräch mit dem Polizeiarzt ab, als er die barsche Stimme seines Chefs hörte. Im Gegensatz zu dem Beamten am Absperrband ließ er sich keine Reaktion über Markus’ Aussehen anmerken.
»Wieso hat mich keiner angerufen?«, bellte Markus seinen jungen Kollegen an.
»Zu Hause hat niemand abgehoben. Und das Handy ist ausgeschaltet.« Künzel, ein auffallend kleiner Mann, wandte sich wieder dem Polizeiarzt zu, der Markus mit einem knappen Nicken begrüßte.
Mit kurzem Blick auf sein Handy sah Markus die Angabe Künzels bestätigt. Verärgert, weil er niemandem die Schuld für sein verspätetes Auftauchen geben konnte, schnippte er seine brennende Kippe in die Natur. Sofort kam grinsend einer der Beamten von der Spurensicherung und stellte ein Schild mit einer Nummer neben die neue »Spur«. Er wollte gerade ein Foto zur Dokumentation schießen, als Markus das Schild mit dem Fuß ein paar Meter weit wegkickte und die Kippe so gewalttätig austrat, dass sie in die feuchte Erde gebohrt wurde und darin verschwand. Hinter ihm wurde getuschelt. Er bemerkte es immer, wenn hinter seinem Rücken getuschelt wurde, was häufig vorkam. Manchmal fragte er sich, ob seine Kollegen wirklich über ihn tuschelten oder nur die Bundesliga-Ergebnisse diskutierten. Er fragte sich, ob er langsam paranoid wurde und bald weiße Mäuse sehen würde. Doch da es ausreichend Gründe gab, hinter seinem Rücken zu tuscheln, nahm er beruhigt an, dass es keine wahnhafte Vorstellung und mit seiner Wahrnehmung alles in Ordnung war. Noch.
»Chef, du siehst scheiße aus«, sagt eine kleine, in Zivil gekleidete Frau, die um die Hüften herum etwas füllig war. Und noch leiser fügte sie hinzu: »Und du benimmst dich auch so. Reiß dich zusammen, Chef!«
»Halt die Klappe, Elli. Wo liegt die Leiche?«
»Und stinken tust du auch. Nach Alk. Die Leiche liegt links von der Sumpfeiche in diesen großen grünen Dingern. Komm, ich zeig’s dir.«
Kriminalmeisterin Elfriede Schumann, genannt Elli, führte Markus zu einer Anpflanzung von üppigen, großblättrigen Pflanzen, die knapp einen Meter hoch waren und sehr dicht standen. Windböen fegten darüber hinweg. Vorsichtig bog Elli die dicken Stängel auseinander. Die Pflanzen waren an dieser Stelle von dunkelroten, noch nicht eingetrockneten Spritzern verklebt. Dazwischen auf dem feuchten, schwarzen Boden lag eine Frau, Anfang zwanzig, in ihrem Blut. Lange, lockige rote Haare voller nasser Erdklumpen. Die dunkelgrünen Augen weit aufgerissen, ein Ausdruck von Panik darin verewigt. Das Gesicht verzerrt, Lippenstift und Wimperntusche völlig verschmiert, Wangen und Stirn schmutzig. Ihr Körper von unterschiedlich tiefen Einstichen übersät. Ihr Unterleib eine offene Wunde. Nackt. Verdreht. Die Finger Halt suchend in die Erde gekrallt. Die Beine angezogen, als habe sie ihren Torso vor den Stichen schützen wollen. Kleine Tätowierung am rechten Fußgelenk, ein roter Habicht oder ein Bussard.
Markus wandte sich ab, sein bis auf den Alkohol leerer Magen rebellierte und schickte einen Schwall Säure nach oben. Zittrig fummelte er in seiner Jacke nach einem Eukalyptusbonbon und schob es sich in den Mund.
Aus nördlicher Richtung näherte sich die Oberbürgermeisterin mit ihrem Assistenten. Sie blieb kurz bei Konrad Künzel stehen, wechselte ein paar Worte, warf einen Blick herüber und kam dann auf Markus zu. Marlene Falck, die selbst zur Überraschung ihrer eigenen Fraktion bei der letzten Wahl den CDU-Oberbürgermeister abgelöst hatte, war eine große, hagere, aber nicht unattraktive Frau Anfang fünfzig, die es mit scharfer Intelligenz und an den richtigen Stellen eingesetzten Ellbogen geschafft hatte, sich in der männlichen Domäne der Stadtpolitik nach oben zu boxen. Markus hatte nichts für sie übrig, aber auch nichts gegen sie, sie war ihm egal. Seit ihrem Amtsantritt hatte sie ihn und seine Abteilung vollkommen in Ruhe gelassen. Markus fürchtete allerdings, dass sich dies genau jetzt ändern würde. Der erste Mord in ihrer Amtszeit, das war Grund genug für einen pressewirksamen Auftritt und eine Möglichkeit, sich zu profilieren. Jedenfalls war der Schritt, mit dem Frau Oberbürgermeisterin Falck auf ihren Ersten Hauptkommissar zustrebte, ein äußerst entschlossener.
Sie schüttelte ihm die Hand und begrüßte ihn. Als Markus ihren Gruß erwiderte, drehte sie intuitiv ihren Oberkörper weg von seiner übelriechenden Fahne. In den Augenwinkeln bemerkten beide, wie sich die Presse auf ihre Höhe arbeitete und Fotos machte. Frau Falck ging auf Abstand.
»Herr Lorenz, was können Sie mir über die Vorkommnisse hier sagen?«
»Noch nicht viel, bin selbst erst eingetroffen. Eine junge Frau wurde ermordet, ziemlich brutal. Liegt dort im Gebüsch, wollen Sie sie sehen?«
In der Oberbürgermeisterin arbeiteten die Synapsen auf Hochtouren. War sie für die Presse nun eher die sensitive Frau, die sich den Blick in die Abgründe der Gewalt ersparen will, oder war sie die knallharte Stadtlenkerin, die ihre Augen vor keiner noch so unliebsamen Realität verschließt? Frau Falck entschloss sich für Letzteres. Und gab nach der Besichtigung durch leichtes Taumeln eine Prise Ersteres hinzu. Dann hatte sie sich wieder gefasst. Mit gestrengem Blick wandte sie sich an Markus. »Ich hoffe, nein, ich erwarte, dass Sie den Täter schnellstmöglich fassen!«
»Wir tun unsere Arbeit.«
Marlene Falck betrachtete Markus von Kopf bis Fuß. »Davon gehe ich aus. Ich erwarte außerdem, dass Sie zu Ihrer Arbeit künftig präsentabler erscheinen. Auch Sie vertreten die Stadt Göttingen, und ich möchte, dass Ihre Außenwirkung konveniert.«
Markus schwankte leicht, ihm war flau, er brauchte dringend ein Frühstück. Grinsend blickt er auf seine zerrissene Hose. »Ich würde ja so gerne konvenieren, aber … Wie geschickt sind Sie eigentlich in Nähdingen, Gnädigste?«
Mit einer fast unmerklichen Bewegung richtete sich die Oberbürgermeisterin in ihrer aufrechten Haltung noch ein wenig mehr auf, sodass sie nun wie ein Respekt einflößendes Ausrufezeichen wirkte. »Werden Sie nicht frech, Lorenz! Ihr Auftritt ist absolut inakzeptabel. Sie sind hier nicht im Fernsehen, wo einem schäbigen und versoffenen Kommissar eine telegene Romantik des Verfalls zugesprochen wird. Sie müssen nicht glauben, dass Sie einen Freifahrschein haben, bloß weil lhre Frau …«
Weiter kam sie nicht. Markus hatte ohne zu überlegen ausgeholt und der Oberbürgermeisterin eine schallende Ohrfeige versetzt. Die Umstehenden erstarrten in entsetztem Schweigen. Nur die Presse freute sich, denn sie hatte ein fantastisches Foto im Kasten: im Vordergrund der total abgerissene Hauptkommissar im Clinch mit der piekfeinen Stadtobersten, im Hintergrund das grün-rot-fleckige Gebüsch, das just in diesem Moment von einer starken Windböe auseinandergebogen wurde und den Blick auf die blutüberströmte Frauenleiche freigab.
Yule. Zweites Ritual.
Es hat ihnen nicht gereicht. Ich habe ein Zeichen gesetzt, ein blutiges, grausames Zeichen, sie wollten wissen, auf welche Seite ich gehöre. Aber sie wollen es nicht akzeptieren, sie kommen wieder, sind weiterhin hinter mir her. Im Schlaf finden sie mich. Wehrlos. Ich erliege. Und hasse mich selbst, wenn ich beschmutzt aufwache. Sie wollen mich nicht in Ruhe lassen, also kann ich sie auch nicht ignorieren. Ich würde so gerne in Ruhe leben. Am Nordpol der Unzugänglichkeit. Aber sie lassen mich nicht. Weil sie mich immer wieder heimsuchen, muss ich das Unvermeidliche schließlich zulassen. Es ist meine Aufgabe. Ich habe sie mir nicht ausgesucht, ich habe sie nicht gewollt, ich glaube nicht einmal, dass ich sie gut erledige. Aber ich nehme sie an. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist meine Pflicht.
Es war der sehr frühe Morgen des 21. Dezember als Claudia loslief, um ihre übliche Runde um den Wall zu laufen. Heute wollte sie zwei laufen, als vorbeugende Maßnahme gegen die Pfunde von Gans, Plätzchen und Marzipan, die über Weihnachten bei den Eltern ihre Hüften bedrohten. Claudia lief gerne, und sie mochte die frühmorgendliche Stille, den Bodennebel, das feuchte Glitzern der Nässe auf dem Laub und das Rascheln der Blätter, wenn sie die von der Stadtgärtnerei schon zusammengekehrten Haufen mit ihren Laufschuhen mutwillig wie ein spielendes Kind wieder aufwirbelte. Einige Frauen in Göttingen liefen nicht gerne über den Wall, denn manchmal fanden sich dort Gruppen trinkender Jugendlicher oder Obdachloser, die den Joggerinnen schlüpfrige Bemerkungen hinterherriefen oder ihnen sogar, wenn sie sich besonders männlich vor ihren Kumpels zeigen wollten, den Weg verstellten und sie belästigten. Claudia jedoch hatte keine Angst vor derlei Situationen, sie war mit drei älteren Brüdern aufgewachsen und von Kindesbeinen an gewohnt, sich durchzusetzen, zur Not auch mit körperlichem Einsatz. Ihr ältester Bruder Harald, der sich in den achtziger Jahren als Mod regelmäßig Schlägereien mit den ortsansässigen Rockerbanden geliefert hatte, war selbst nicht sonderlich groß und stark gewesen, aber meist siegreich aus seinen Scharmützeln hervorgegangen. Er hatte ihr erklärt, dass es bei diesen zum Teil sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen nicht in erster Linie auf körperliche Stärke ankam, sondern auf Skrupellosigkeit. Nicht zögern, sondern als Erster zuschlagen, und das mit gnadenloser Härte. Claudia hatte sich diese Philosophie zu eigen gemacht und erfolgreich bei einer häufig am Abend auf dem Wall herumhängenden Gruppe angewandt. Nachdem sie dem Rädelsführer der pubertierenden Halbstarken einen Pferdekuss verpasst hatte, ließ man sie in Ruhe. Dennoch war Claudia dazu übergegangen, frühmorgens zu laufen. Morgens gefiel es ihr besser. Es war ruhiger und einsamer, und die Luft war unverbraucht. Heute Morgen hatte sie besonders gute Laune. Nach dem Laufen würde sie duschen, das Brötchen von gestern in ihren Milchkaffee stippen, ihre Reisetasche packen mit den wenigen Utensilien, die sie über die Feiertage brauchte, und den vielen Geschenken, die sie für ihre Brüder und die Eltern besorgt hatte. Dann würde sie nach Bielefeld fahren, ein paar Tage mit ihren Brüdern herumalbern, sich von Mama und Papa verwöhnen lassen und am Abend alte Schulfreunde in der früheren Stammkneipe treffen. Claudia schwelgte so in Vorfreude, dass sie sich nichts dabei dachte, als sich hinter ihr das Keuchen eines anderen Joggers näherte. Er würde sie überholen, denn Claudia lief stets langsam, um ihre Kräfte gut einzuteilen. Sie dachte sich auch nichts dabei, als das Keuchen eilig näher kam, dann aber hinter ihr blieb. Das war Claudias Fehler. Hätte sich Claudia auch nur wenige Sekunden früher umgedreht, hätte sie den Angreifer vielleicht abwehren können. Doch so legte sich plötzlich von hinten eine Schlinge um ihren Hals, wurde zugezogen, und alles Strampeln, Treten und Schlagen half Claudia nichts. Sie verlor das Bewusstsein. Als sie es wieder erlangte, war es zu spät. Die einzige Reaktion, die ihr blieb, war ein panischer Schrei, der nicht mehr gehört werden konnte, weil er in einem Gurgeln unterging.
Anna Maybach freute sich wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Weihnachten in Paris. Es war ihr immer noch ein Rätsel, wie sie ihren reiseunlustigen Lebensgefährten Christian zu zwei Wochen in der französischen Hauptstadt hatte überreden können. Christian war Weihnachten herzlich egal, die Franzosen waren ihm egal und Paris sowieso. Für Anna jedoch bedeutete die Reise nicht nur ein Ausweichen vor den eigenen familiären Verpflichtungen im Kreise der sentimentalen Mutter, des schwierigen Vaters und einer verhassten Forelle blau. Sie freute sich vor allem auf eine Zeit mit Christian außerhalb der gewohnten Hamburger Umgebung und seines aufreibenden Jobs als Chef eines Sonderkommandos für Serienmörder; und vor allem ganz weit weg von den Erinnerungen an den letzten Fall, der erst im November seinen grausamen Abschluss gefunden hatte.
Sie würde mit Christian nächtliche Spaziergänge an der Seine unternehmen, sie würde ihm Notre Dame und Sacre Cœur zeigen, das Quartier Latin und das Centre Georges Pompidou, den Louvre würde sie ihm ersparen, aber den Eiffelturm nicht. Und vielleicht würde er sich verlieben in Croissants zum Frühstück, Crêpe au Grand Marnier am Nachmittag und Bouillabaisse am Abend, in die Künstler am Seine-Ufer, die Musiker in der Metro und die kleinen Antiquitätenläden voller Ramsch und Kunst; genauso wie sie sich in all das verliebt hatte, als sie dort zwei Austauschsemester Psychologie an der Sorbonne studierte.
Mit ihren knapp sechzig Kilogramm kniete sich Anna auf den prall gefüllten Koffer, um ihn zu schließen. Da sie aufgrund von Christians Flugangst die lange Zugreise auf sich nahmen, wollte Anna so wenig Gepäckstücke schleppen wie möglich. Dass ein Koffer deswegen nun übervoll war, lag an den hohen Anforderungen, die eine Stadt wie Paris an eine Frau wie Anna stellte: bei jedem Wetter und an jedem Ort die passende Kleidung inklusive Schuhwerk zu tragen.