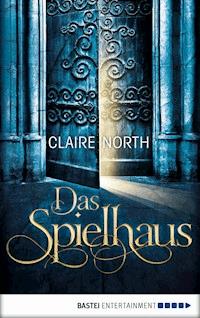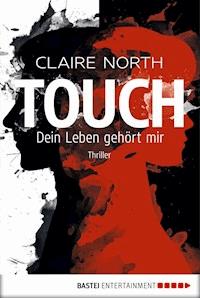
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
REICH MIR DEINE HAND - UND DEIN LEBEN GEHÖRT MIR ... Ihr könnt mich Kepler nennen. Der Name ist so gut wie jeder andere. Ich bin seit Jahrhunderten kein Mensch mehr, ich bin ein Geist. Ich kann durch eine Berührung - Haut an Haut - von einem Körper in den nächsten wechseln. Menschen sind für mich nur Hüllen. Gefäße, die ich mit einer Berührung in Besitz nehmen kann. Ich könnte dieser alte Mann dort sein oder die Frau mit dem Kinderwagen. Und eine Sekunde später das Kind, das ihre Hand hält.
Doch jemand kennt mein Geheimnis. Jemand hat einen Killer auf mich angesetzt, und ich werde herausfinden, wer dahintersteckt. Was wäre einfacher, als dies im Körper meines Mörders zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelImpressum123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687CLAIRE NORTH
TOUCH
DEIN LEBEN GEHÖRT MIR
Thriller
Übersetzung aus dem Englischen vonEva Bauche-Eppers
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»Touch«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Claire North
First published in Great Britain in 2015 by
Orbit, an imprint of Little, Brown Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Hanka Jobke, Berlin
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
Umschlagmotiv: © Shutterstock: Natalia Sheinkin
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3031-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1
Josephine Cebula starb, obgleich man es auf mich abgesehen hatte.
Zwei Kugeln in die Brust, eine ins Bein, das hätte genug sein müssen, Auftrag erledigt, aber der Schütze stieg über sein Opfer hinweg und hielt Ausschau nach mir.
Nach mir.
Ich verbarg mich im Körper einer Frau mit geschwollenen Knöcheln und speckigen Handgelenken und sah, wie das Leben aus Josephine entfloh. Ihre Lippen waren blau, ihre Haut fahl, die Blutlache unter ihr wuchs mit der Unaufhaltsamkeit eines Ölteppichs. Bei jedem Ausatmen zerplatzten hellrote Schaumblasen zwischen ihren Lippen, Anzeichen für einen Lungendurchschuss.
Ihr Mörder ging weiter, hielt die Pistole bereit, ließ den Blick schweifen, spähte nach dem Wechsel, dem Sprung, dem Kontakt, der Hülle, aber der Bahnhof glich einem Sardinenschwarm, in den ein Hai hineingeschwommen war.
Ich flüchtete im Sog der anderen, stolperte in meinen unpraktischen Schuhen, verlor das Gleichgewicht, fiel hin. Meine Hand stieß gegen das Bein eines bärtigen Mannes mit brauner Hose, grauem Haar, der möglicherweise an einem anderen Ort verwöhnte Enkelkinder auf seinen Knien reiten ließ. Jetzt aber war er in heller Panik und gebrauchte, obwohl in seinem bisherigen Leben bestimmt niemals gewalttätig gewesen, Ellenbogen und Fäuste, um sich in dem Gedränge zu behaupten.
In Situationen wie dieser darf man nicht wählerisch sein, und er erschien mir akzeptabel.
Meine Finger schlossen sich um sein Fußgelenk und ich
sprang,
schlüpfte geräuschlos in seine Haut.
Ein Augenblick der Verwirrung. Eben noch eine Frau, jetzt ein Mann, alt und erschrocken. Aber meine Beine trugen mich, meine Lunge war frei; ohne dessen gewiss zu sein, hätte ich den Wechsel auch nicht riskiert. Hinter mir ein Aufschrei der Frau mit den geschwollenen Knöcheln. Der Mann mit der Pistole fuhr herum, zielte auf sie.
Was sah er?
Eine Frau war auf der Treppe gestürzt, ein älterer Herr hatte Mitleid und beeilte sich, ihr aufzuhelfen. Ich trug die weiße Kappe der Hadsch, zweifellos war ich ein braver Familienvater und in meinen Augen wohnte eine Herzensgüte, die stärker war als die Angst vor dem Tod.
Ich zog die Frau vom Boden hoch, bugsierte sie zum Ausgang, und der Mörder sah nur den Körper, nicht mich, und wandte sich ab.
Die Frau, die vor einer Sekunde noch ich gewesen war, kam so weit zur Besinnung, dass sie mich anschaute – aber nichts sah als einen völlig Fremden. Wer war dieser Mann? Wie kam er dazu, ihr zu helfen? Sie fand keine Antwort und verstört, verängstigt, setzte sie sich unter wolfsähnlichem Geheul zur Wehr, fuhr mir mit den Fingernägeln ins Gesicht. Ich ließ los, und sie ergriff die Flucht.
Oben an der Treppe, in dem rechteckigen Tor zum Licht: Polizei, heller Tag, Rettung.
Unten: ein Mann mit einer Pistole, dunkelbraunem Haar und schwarzer Synthetikjacke, ein Fixpunkt im Chaos, der nicht rannte, nicht schoss, sondern schaute, äugte, suchte, nach der Hülle.
Auf den Stufen das lautlose Verrinnen von Josephines Blut. Wenn sie atmete, knisterte es in ihrer Kehle wie Brausepulver, ein leises Geräusch, kaum hörbar in dem Tumult.
Mein Körper wollte sich in Sicherheit bringen, die dünnen Wände meines alten Herzens pumpten fahrig gegen meine knochige Brust. Josephines Blick traf diese Augen, aber sie erkannte mich nicht darin.
Ich machte kehrt. Ging zu ihr zurück. Kniete mich neben sie, drückte ihre Hand auf die Wunde bei ihrem Herzen und flüsterte: »Hab keine Angst. Alles wird gut.«
Ein Zug fuhr ein, niemand hatte die Strecke gesperrt. Der erste Schuss war vor nicht einmal einer halben Minute abgefeuert worden, und bis jemand der Leitstelle Meldung machte, bis man dort die Situation erfasste und entsprechende Maßnahmen einleitete, verging wohl einiges an Zeit.
»Du wirst wieder gesund«, log ich sie mit zarter Stimme an. »Ich liebe dich.«
Vielleicht sah der Zugführer das Blut auf der Treppe nicht, nicht die Mütter, die mit ihren Kindern hinter grauen Pfeilern und leuchtenden Verkaufsautomaten Deckung gesucht hatten. Oder er sah das alles, doch war er gleich dem Igel vor einem nahenden Dreißigtonner dermaßen überfordert von dem Geschehen, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte und folglich, der Macht der Gewohnheit gehorchend, abbremste.
Konfrontiert mit Sirenen von oben und der haltenden U-Bahn unten, ließ der Mann mit der Pistole ein letztes Mal den Blick durch die Station wandern, fand nicht, was er suchte, drehte sich um und lief zum Bahnsteig.
Die Wagentüren öffneten sich, er sprang hinein und würde entkommen.
Josephine Cebula war tot.
Ich folgte ihrem Mörder in den Zug.
2
Dreieinhalb Monate vor ihrem Tod sagte Josephine Cebula zu dem Fremden, dessen Hand auf ihrer lag: »Fünfzig Euro für eine Stunde.«
Ich saß am Fußende des Hotelbetts und erinnerte mich an die Gründe für meine Abneigung gegen Frankfurt, das am Main. Nach Kriegsende waren unter der Ägide eines lokalpatriotisch gesinnten Bürgermeisters einige wenige schöne Straßenzüge restauriert worden, aber bald nahm das Wirtschaftswunder Fahrt auf und die Bedürfnisse der Stadt wuchsen nicht – sie explodierten. Es blieb bei knapp fünfhundert Metern teutonischem Kitsch als Erinnerung an ein Damals ohne Wiederkehr, der Rest war ungeschöntes Fünfzigerjahre-Einerlei, eine Architektur der geraden Linie und der rechten Winkel, konzipiert und aus der Erde gestampft von Menschen, die zu beschäftigt waren, um sich etwas Schöneres auszudenken.
Ergo saßen in Main-Manhattan betongraue Angestellte hinter betongrauen Mauern und diskutierten höchstwahrscheinlich über Beton, gab es in der Stadt doch wenig anderes, worüber man sich begeistern konnte. Sie tranken einige der schlechtesten Biere von ganz Deutschland in einigen der langweiligsten Kneipen Westeuropas, fuhren in zwanghaft pünktlichen Bussen, berappten das Dreifache des üblichen Fahrpreises für ein Taxi zum Flughafen, waren müde, wenn sie ankamen, und heilfroh, wenn sie wieder abreisten.
Und in all dem gab es eine Josephine Cebula, die sagte: »Fünfzig Euro. Nicht verhandelbar.«
Ich fragte: »Wie alt bist du?«
»Neunzehn.«
»Und wie alt bist du wirklich?«
»Wie alt willst du mich denn haben?«
Ich betrachtete ihr Kleid, das nicht ganz billig gewesen sein konnte, denn das bewusste Tragen von so wenig Textil legte nahe, dass es sich um das Produkt eines namhaften Designers handelte.
Ein seitlicher Reißverschluss presste sich an ihre Rippenbögen und den Bauch. Die Beine steckten in zu engen Stiefeln, wodurch sich zwischen Schaftrand und Knie ein unvorteilhafter Wulst aus verdrängtem Fleisch bildete, außerdem verriet ihre Haltung, dass sie Mühe hatte, auf den absurd hohen Stilettoabsätzen das Gleichgewicht zu bewahren. Ich befreite sie gedanklich von diesen schlecht gewählten Accessoires, hob ihr Kinn an, wusch ihr in meiner Vorstellung die billige Farbe aus dem Haar und kam zu dem Schluss, dass sie schön war.
»Wo kommst du her?«, fragte ich.
»Wieso?«
»Dein Akzent. Polen?«
»Warum die vielen Fragen?«
»Antworte und du bekommst dreihundert Euro, jetzt sofort, bar auf die Hand.«
»Zeig her.«
Ich legte die Banknoten eine nach der anderen fächerförmig zwischen uns auf den Fußboden, sechs druckfrische Fünfzigeuroscheine.
»Mein Anteil beträgt vierzig Prozent.«
»Miserabler Deal.«
»Bist du Polizist?«
»Nein.«
»Geistlicher?«
»Alles andere als das.«
Ihr Blick wurde von dem Geld magnetisch angezogen, sie fragte sich wohl, wie viel mehr ich dabeihatte, aber sie blieb standhaft und schaute weiter mich an. »Was dann?«
Ich überlegte. »Ein Reisender«, gab ich schließlich zur Antwort. »Einer, der die Welt einmal mit anderen Augen sehen möchte. Deine Arme – Einstichstellen von Spritzen?«
»Nein. Ich habe Blut gespendet.«
Eine so transparente Lüge, dass ich kommentarlos darüber hinwegging. »Kann ich mal sehen?«
Jetzt huschte ihr Blick doch zu den Geldscheinen auf dem Fußboden. Sie streckte mir die Innenseiten der Arme hin. Ich untersuchte die blutunterlaufene Stelle in der Ellenbogenbeuge, betastete die Haut, die so dünn war, dass ich fürchtete, sie könne unter meiner Berührung zerreißen, doch entdeckte keine Hinweise auf einen exzessiven Drogenmissbrauch.
»Ich bin clean.« Sie schaute mir wieder ins Gesicht. »Clean.« Ich ließ ihre Hände los, sie schlang die Arme um den Oberkörper. »Ich mache keine Dummheiten.«
»Was meinst du mit Dummheiten?«
»Herumstehen und reden. Du bist geschäftlich hier, ich bin geschäftlich hier, also kommen wir zum Geschäft.«
»In Ordnung. Ich möchte deinen Körper.«
Ein Schulterzucken – das war ihr nichts Neues. »Für dreihundert kann ich die ganze Nacht bleiben, aber ich muss meinen Jungs Bescheid sagen.«
»Nein. Nicht für die Nacht.«
»Was dann? Dauerhafte Beziehungen habe ich nicht im Angebot.«
»Drei Monate.«
Ein Schnauben, das ein Lachen sein sollte; sie hatte wohl vergessen, wie echte Belustigung klang. »Du spinnst.«
»Drei Monate«, wiederholte ich. »Zehntausend nach Ablauf, plus neuem Reisepass, neuer Identität und einem neuen Anfang in jeder Stadt deiner Wahl.«
»Und was verlangst du dafür?«
»Wie gesagt: Ich möchte deinen Körper.«
Sie wandte den Kopf zur Seite, damit ich die Furcht nicht sah, die ihre Kehle verengte. Einen Moment lang zögerte sie. Da war das Geld, dort der seltsame Fremde am Fußende ihres Bettes. Dann: »Ich will mehr wissen. Erklär mir, was genau du meinst, und ich denke darüber nach.«
Ich streckte ihr die Hand hin, die Innenfläche nach oben. »Nimm meine Hand«, sagte ich. »Ich zeig’s dir.«
3
Drei Monate war das her.
Und jetzt war Josephine tot.
Die Metrostation Taksim hat wenig Erbauliches zu bieten.
Morgens, auf der Strecke am Bosporus entlang, erdulden Pendler glasigen Blicks den in der drangvollen Enge des Wagens aufgezwungenen Körperkontakt mit ihren Leidensgefährten, die Kleidung bereits verschwitzt von der Fahrt in den ebenfalls überfüllten Zubringern nach Yeniköy und Levent. Studenten männlichen wie weiblichen Geschlechts – in T-Shirts mit dem Logo von Punkbands respektive Minirock und buntem Kopftuch – hasten durch den Bahnhof, nach Galata hinauf oder hin zu den Coffeeshops in Beyoğlu oder dem iPhone-Laden oder zu den fettigen Pide-Buden im Sıraselviler Caddesi, wo in den Türen nie das Geschlossen-Schild hängt und die Lichter in den Schaufenstern nie erlöschen. Abends bevölkern den Bahnhof eilige Mütter, die ihre Kinder einsammeln, nicht selten zwei in einem Wagen, und gravitätisch einherschreitende Ehemänner mit schwingenden Aktentaschen und Touristen, die nicht verstanden haben, dass dies eine geschäftige Stadt ist. Ihr Interesse gilt ausschließlich der unterirdisch fahrenden Füniküler, und man sieht ihnen an, wie sie in dem Miasma freigiebig geteilter Achselhöhlenemissionen den Atem anhalten.
So schlägt das Herz einer prosperierenden Stadt, und deshalb konnte unter den Passagieren des Zugs, der jetzt die Station Taksim verließ, auch ein Mörder sein, mit einer Pistole unter einer schwarzen Baseballjacke, und er fiel niemandem auf, denn er hielt den Kopf gesenkt und seine Hände zitterten nicht.
Ich war ein freundlich wirkender alter Herr mit weißer Scheitelkappe und sauber gestutztem Bart; meine Hose hatte Blutflecken, weil ich neben einer Frau gekniet hatte, die ermordet wurde, aber die Flecken waren klein und auf dem braunen Stoff fast nicht zu sehen. Nichts an mir deutete darauf hin, dass ich vor kaum einer Minute noch um mein Leben gerannt war, außer vielleicht die hervortretenden Adern an meinem Hals und mein schweißglänzendes Gesicht.
Einige wenige Meter von mir entfernt und doch sehr weit weg, bemessen an der Anzahl der Körper zwischen uns, stand der Mann mit der Pistole im Halfter unter der Jacke, und nichts an ihm deutete darauf hin, dass er soeben kaltblütig eine Frau erschossen hatte. Die Baseballkappe, tief ins Gesicht gezogen, wies ihn als Anhänger von Güngörenspor aus, einer Fußballmannschaft, die von jeher größere Erwartungen weckte, als sie erfüllen konnte. Er hatte helle Haut, deren kürzlich unter einer südlichen Sonne erworbene Bräune bereits verblasste. Geschätzte dreißig Personen füllten den Raum zwischen uns, schwankten von einer Seite zur anderen, so wie der Zug sich neigte. Jeden Moment würde die Polizei die Strecke nach Sanayii sperren. Jeden Moment würde jemand das Blut an meiner Kleidung bemerken, den rötlichen Sohlenabdruck, den ich bei jedem Schritt hinterließ.
Noch war fliehen möglich.
Ich ließ den Mann mit der Baseballkappe nicht aus den Augen.
Auch er war auf der Flucht, und sein Verhalten hatte Methode. Nicht auffallen, war sein Motto, und mit der in die Stirn gezogenen Kappe und den nach vorn gebogenen Schultern sah er tatsächlich aus wie irgendein harmloser Mensch auf dem Weg von A nach B, und niemand hätte in ihm einen Mörder vermutet.
Ich drängte mich im Wagen nach vorn, platzierte meine Schuhe sorgsam in die Lücken zwischen den Füßen der anderen, ein Balanceakt auf schwankendem Boden, in einer Atmosphäre dornigen Schweigens zusammengepferchter, einander fremder Menschen, die krampfhaft Blickkontakt vermieden.
In Osmanbey wurde der Zug noch voller, bevor er sich wieder in Bewegung setzte. Der Mörder sah aus dem Fenster in die Schwärze des Tunnels, eine Hand an der Haltestange über seinem Kopf, die andere unter der Jacke verborgen, den Zeigefinger möglicherweise am Abzug der Waffe. Irgendwann im Lauf seines Lebens war seine Nase gebrochen und wieder gerichtet worden. Vom Körperbau her war er groß, ohne ein Riese zu sein, und er hielt sich leicht gebückt, um nicht allzu sehr aus der Menge herauszuragen. Er war schlank, aber nicht mager, muskulös, aber nicht massig, sprungbereit wie ein wilder Tiger und träge wie eine fette Hauskatze.
Ein Junge mit einem Tennisschläger unter dem Arm rempelte ihn versehentlich an, und der Kopf des Mörders flog hoch, und in der Jacke krümmte sich sicher der Finger um den Abzugsbügel. Der Junge schaute rasch zur Seite.
Ich schob mich behutsam an einer Ärztin vorbei, die wohl für diesen Tag ihren Dienst an der Menschheit abgeleistet hatte und nach Hause fuhr. Die Ausweiskarte hüpfte am Revers ihrer Jacke, das Foto starrte mit der Miene einer Kassandra in die Welt, bestens dafür geeignet, jeden Funken Hoffnung in der Brust eines Patienten im Keim zu ersticken.
Der Abstand zu dem Mann mit der Baseballkappe betrug noch knapp einen Meter, und ich hielt den Blick unverwandt auf seinen Nacken gerichtet, sein kurz geschnittenes dunkles Haar endete in waagerechter Linie oberhalb des ersten Halswirbels.
Der Zug wurde langsamer, erneut hob der Mann den Kopf und musterte die Umstehenden. Sein Blick traf mich und blieb haften. Erst ein steinernes Nichts, das ausdruckslose Starren von Fremden in einem Zug. Dann ein höfliches Lächeln, das dem netten alten Mann galt, dessen gefurchte Züge von einem Leben voll Mühe und Arbeit kündeten. Indem er lächelte, hoffte er, der Alte würde sich entfernen, nun da dem Anstand Genüge getan war. Abschließend wanderte sein Blick zu meinen Händen, die sich seinem Gesicht näherten, und sein Lächeln erlosch, weil er das Blut von Josephine Cebula in breiten braunen Streifen an meinen Fingerspitzen trocknen sah.
Er öffnete den Mund und machte Anstalten, die Pistole aus dem Schulterhalfter zu ziehen, aber ich beugte mich vor, legte die Handfläche an seinen Hals und wechselte.
Es gab eine kurze Konfusion, als der bärtige Mann mit den blutigen Händen vor mir plötzlich das Gleichgewicht verlor und gegen den Jungen mit dem Tennisschläger taumelte, sich an der Wagenwand abstützte, aufblickte und mich ansah. Wir fuhren in die Station Şişli Mecidiyeköy ein, und er – eine mutige Tat, in Anbetracht der Umstände – richtete sich auf, zeigte mit dem Finger auf mich und schrie laut: »Mörder! Mörder!«
Ich lächelte zivilisiert, ließ die Pistole, die ich schon in der Hand hatte, zurück ins Halfter gleiten und tauchte, als die Türen hinter mir sich öffneten, im Gewühl des Bahnhofs unter.
4
Şişli Mecidiyeköy ist ein den Göttern globaler Einfallslosigkeit geweihter Ort. Von den weißen Shopping-Arkaden, in denen Seite an Seite billiger Whisky und DVDs über das Leben des Propheten Mohammed verramscht werden, bis zu den klotzigen Wolkenkratzern mit Wohnungen für jene, die reich genug sind, um als bedeutend zu gelten, aber nicht reich genug für die Aufnahme in den Zirkel der oberen Zehntausend, ist Şişli ein Viertel aus Licht, Beton und Uniformität. Uniformer Reichtum, uniformer Ehrgeiz, uniformer Kommerz, uniforme Beziehungen und uniforme Parkgebühren.
Nach einem Ort gefragt, der geeignet wäre, um als Mörder dort unterzutauchen, hätte Şişli nicht unbedingt ganz oben auf meiner Liste gestanden, aber …
»Mörder, Mörder!«, hallte hinter mir die Stimme aus dem Zug.
Vor mir verdutzte Einkaufsbummler, die sich fragten, was die Unruhe zu bedeuten hatte und ob sie sich ihnen in den Weg stellen würde.
Mein Körper war mit sportlichem Schuhwerk versehen.
Ich lief los.
Die Cevahir Shopping Mall, sinnlich wie Kalkstein, romantisch wie Herpes, könnte überall auf der Welt stehen. Weiße Kacheln und Glasdach, hervortretende geometrische Formen als Variation der Themen Stockwerk und Balkon. Pseudogoldene Säulen wachsen auf dem Weg zum gläsernen Himmel durch die Etagen, auf denen sich Adidas und Selfridges, Mothercare und Debenhams ein Stelldichein geben, Starbucks und McDonald’s dürfen nicht fehlen. Die einzige Konzession an die regionale Kultur sind der Köfte-Burger und das Apfel-Zimt-Sorbet, Letzteres in einem Pappbecher gereicht.
Die Augen der an allen strategischen Punkten platzierten Überwachungskameras verfolgen suspekte Jugendliche mit in den Kniekehlen hängendem Hosenboden und gut situierte Mütter, die im Kinderwagen ihre Einkaufstüten spazieren fahren, nachdem sie den Sprössling vor Stunden samt Nanny beim Kinderschminken geparkt haben. Das gesamte Ambiente wirkt in etwa so islamisch wie Schweinsfüße in Sahnesoße, trotzdem finden sich auch die schwarz verschleierten Matronen aus Fener dort ein, mehrere Kinder an jeder behandschuhten Hand, um die Halalpizza von Pizza Hut zu probieren und zu entscheiden, ob die Familie vielleicht einen neuen, modernen Duschkopf braucht.
Doch unter mir sangen die Sirenen, deshalb verbarg ich mein Gesicht im Schatten der Schirmmütze, zog den Kopf zwischen die Schultern und ließ das menschliche Gewoge über mir zusammenschlagen.
5
Mein Körper.
Der ursprüngliche Eigentümer, wer immer er sein mochte, glaubte wahrscheinlich, die bei ihm ausgeprägte Verspannung der Schultermuskulatur sei normal, schließlich fehlten ihm die Vergleichsmöglichkeiten. Seine Mitmenschen, wenn er sie denn fragte, wie ihre Schultern sich anfühlten, gaben höchstwahrscheinlich die universelle Antwort: normal.
Ich fühle mich normal.
Ich fühle mich wie ich selbst.
Falls sich je die Gelegenheit ergab, mit dem Mann zu plaudern, dessen Körper ich usurpiert hatte, würde ich ihn mit Vergnügen über seinen diesbezüglichen Irrtum aufklären.
Ich steuerte auf die Toiletten zu, und aus alter Gewohnheit öffnete ich die Tür zu den Damen.
Die ersten paar Minuten sind immer die heikelsten.
Wenig später saß ich in einer verschlossenen Kabine der Herrentoilette und durchsuchte die Taschen eines Mörders.
Ganze vier Gegenstände kamen zum Vorschein. Ein Handy, ausgeschaltet, eine Pistole im Schulterhalfter, fünfhundert Lira und der Schlüssel eines Leihwagens. Nicht ein Bonbonpapierchen mehr.
Das Fehlen von Beweisen ist nicht zwangsläufig ein Beweis an sich, aber was soll man von einem Mann denken, der eine Pistole eingesteckt hat, aber keine Brieftasche? Die Schlussfolgerung, die sich aufdrängt, ist Folgende: Es handelt sich um einen Auftragsmörder.
Ich war ein Berufskiller.
Unzweifelhaft angeheuert, um mich ins Jenseits zu befördern.
Doch war es Josephine, die gestorben ist.
Ich saß da und erwog diverse Möglichkeiten, meinen Körper zu töten. Gift wäre praktischer als ein Messer. Die simple Überdosis einer entsprechend toxischen Substanz – und noch bevor die ersten Symptome auftraten, konnte ich entschlüpft sein, um mit den Augen eines Fremden seinen Todeskampf zu beobachten.
Ich schaltete das Handy ein.
Keine gespeicherten Kontakte, kein Hinweis darauf, dass es etwas anderes war als ein schneller Kauf im Billigladen. Gerade als ich es wieder ausschalten wollte, wurde eine Nachricht empfangen.
Die da lautete: Circe.
Ich ließ das Wort einen Moment auf mich wirken, drückte dann die Ausschalttaste, fummelte den Akku aus dem Gerät und versenkte beide Teile in der Hosentasche.
Fünfhundert Lira und der Schlüssel eines Leihwagens. Ich schloss die Hand um das flache, gezackte Stück Metall und drückte zu, bis die Kanten und Spitzen in mein Fleisch drangen. Sollte er bluten, dieser Körper. Ich nahm die Baseballkappe ab, zog die Jacke aus, und weil Waffe und Schulterhalfter nun allen Blicken preisgegeben waren, wickelte ich beides in die abgelegten Kleidungsstücke und warf das Bündel in den Mülleimer.
In einem weißen T-Shirt und Jeans verließ ich die Toilette und betrat mit einem freundlichen Lächeln für den Security-Mann an der Tür das nächste Herrenbekleidungsgeschäft. Ich erstand eine braune Jacke mit zwei Reißverschlüssen vorn, von denen der zweite keinen erkennbaren Zweck erfüllte, dazu einen grauen Wollschal mit passender Mütze für mein Inkognito.
Drei Polizisten standen an den großen Glastüren zwischen der Ladenzeile und der Metrostation.
Ich war ein Mörder.
Ich war ein Tourist.
Ich war ohne Bedeutung.
Ich ging an ihnen vorbei, ohne sie zu beachten.
Die Metro war geschlossen, verärgerte Menschen belagerten den entnervten Beamten, es sei unerhört, es sei ein Unding, haben Sie die geringste Ahnung, was Sie uns antun? Gut, eine Frau ist tot, aber was geht uns das an?
Ich nahm ein Taxi. Die Cevahir ist einer der wenigen Orte in Istanbul, wo man problemlos ein Taxi findet als logische Folge der Einstellung: Ich habe heute einen Haufen Geld ausgegeben, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Gut für die Taxifahrer.
Der Vertreter dieser Berufsgruppe, der mich im Rückspiegel musterte, während wir uns in den fließenden Verkehr einfädelten, registrierte hocherfreut, dass ihm das Glück gleich doppelt hold war, denn es hatte ihm nicht nur einen dieser Kaufwilligen als Fahrgast beschert, sondern sogar einen ausländischen Kaufwilligen. Er fragte, wohin ich wolle, und sein Herz hüpfte, als ich antwortete, nach Pera, dem Hügel exklusiver Hotels und großzügiger Trinkgelder von naiven Touristen, die vom Zauber des Bosporus trunken waren.
»Tourist, ja?«, fragte er in gebrochenem Englisch.
»Nein, Reisender«, antwortete ich in akzentfreiem Türkisch.
Er war sichtlich überrascht, seine Muttersprache aus dem Mund des Ausländers zu vernehmen. »Amerikaner?«
»Macht das einen Unterschied?«
Er ließ sich von meiner Wortkargheit nicht entmutigen. »Ich liebe Amerikaner«, verkündete er, während wir uns im Schneckentempo durch den von roten Ampeln dirigierten Feierabendverkehr quälten. »Die meisten Leute hassen sie – so laut, so fett, so dumm –, aber ich liebe sie. Nur weil ihre Herren sündhaft sind, tun sie so viel Böses. Ich denke, es ist wirklich gut, dass sie trotzdem nette Menschen sein wollen.«
»Wollen sie das?«
»Oh ja. Ich habe viele Amerikaner kennengelernt, und sie sind immer großzügig, wirklich großzügig, und so bemüht, Freundschaften zu schließen.«
Der Fahrer schwatzte weiter, eine Lira zusätzlich für je hundert heitere Worte. Ich ließ seinen Redeschwall an mir vorbeirauschen, studierte das Spiel der Sehnen auf meinem Handrücken, spürte die Haare, die aus der Haut an meinen Armen sprossen, die lange Neigung meines Nackens, den scharfen Winkel zum Unterkiefer. Mein Adamsapfel wanderte auf und ab, wenn ich schluckte, ein faszinierender Vorgang nach den Monaten mit meinem – mit Josephines – Hals.
Das Taxi schlängelte sich bald durch die kurvenreichen, engen Straßen Peras. »Ich kenne ganz in der Nähe ein großartiges Restaurant«, verkündete mein Fahrer. »Guter Fisch. Du sagst ihnen, dass ich dich schicke, und sie machen dir einen guten Preis. Ja, der Inhaber ist mein Vetter, aber ich schwöre – das beste Essen diesseits des Horns.«
Ich drückte ihm ein Trinkgeld in die Hand, als er mich an der Ecke vor dem Hotel aussteigen ließ.
Ich wollte nicht die Ausnahme von der Regel sein.
Zwei Herrschernamen dominieren das öffentliche Stadtbild Istanbuls, ersichtlich am Süleyman-Restaurant/-Hotel/-Festsaal und am Atatürk-Flughafen/-Bahnhof/-Einkaufszentrum. Das Konterfei besagten Atatürks ziert die Wand hinter jedem Bankschalter und Geldautomaten; und das Sultan-Süleyman-Hotel, mochte es neben der türkischen auch die EU-Fahne wehen lassen, bildete keine Ausnahme. Ein Kolossalbau im französischen Kolonialstil, wo die Cocktails teuer waren, die Bettwäsche gestärkt und jede Badewanne ein Swimmingpool. Ich hatte schon oft dort logiert, in der ein oder anderen Hülle.
Aktuell verkündete ein Reisepass, sicher verwahrt im Safe von Zimmer 418, dass hier Josephina Kozel wohnte, türkische Staatsbürgerin, Besitzerin von fünf Kleidern, drei Röcken, acht Blusen, vier Schlafanzügen, drei Paar Schuhen, einer Haar- und einer Zahnbürste sowie zehntausend Euro in gemischten Scheinen, akkurat gebündelt und vakuumiert. Glücklich der Hausmeister, der irgendwann diesen Safe aufbrechen und das kleine Vermögen einheimsen würde. Es war der mit Josephine Cebula vereinbarte Preis für die leihweise Überlassung ihres Körpers – sie ruhe in Frieden.
Ich hatte Josephine nicht getötet.
Dieser Körper hatte sie getötet.
Nichts hinderte mich daran, sein Fleisch dafür büßen zu lassen.
Noch war keine Polizei im Hotel. Josephine hatte nichts bei sich gehabt, das über ihre Identität Auskunft gab, doch früher oder später würde man herausfinden, zu welcher Tür der einzelne Schlüssel mit dem hölzernen Anhänger gehörte. Männer in weißen Plastikanzügen und mit transparenten Plastiktüten würden anrücken und die hübschen Nichtigkeiten finden, die ich gekauft hatte, um den Rundungen meines – ihres – Körpers zu schmeicheln, ein modisches Gedenkemein für den Augenblick unserer Trennung und unseres Lebewohls.
Die Zeit, bis es so weit war, gehörte mir.
Ich spielte mit dem Gedanken, ein letztes Mal in das besagte Zimmer zu gehen und das dort deponierte Geld zu holen – meine fünfhundert Lira schmolzen wie Butter in der Sonne –, aber der Verstand sagte Nein. Denn wo sollte ich meinen derzeitigen Korpus unterbringen, ohne dass er entwischte, während ich mir den eines Zimmermädchens borgte, um in den Raum 418 zu gelangen?
Stattdessen ging ich eine Betonrampe hinunter in eine Tiefgarage, die noch trostloser war als das Starbucks in der Cevahir. Ich zog den Autoschlüssel aus der Tasche und überprüfte auf dem Weg von einer Ebene zur nächsten Windschutzscheiben und Kennzeichen auf Leihwagennummern, drückte in der Nähe jedes infrage kommenden Fahrzeugs auf öffnen und wartete ohne viel Hoffnung auf das antwortende Blinken der Scheinwerfer.
Doch mein Mörder war faul gewesen.
Er hatte mich bis zu diesem Hotel verfolgt und die sich ihm bietende Parkmöglichkeit in Anspruch genommen.
Im dritten Parkdeck blinzelten mir zwei gelbe Lichter an einem silbergrauen Nissan ein Willkommen entgegen.
6
Der Wagen des Mannes, der versucht hatte, mich zu töten.
Ich öffnete den Kofferraum mit dem Schlüssel aus seiner – aus meiner – Jacke und schaute hinein.
Zwei schwarze Sporttaschen, eine groß, die andere kleiner.
Die Kleinere enthielt ein weißes Hemd, eine schwarze Hose, einen Regenmantel aus Plastik, eine frische Unterhose, zwei Paar graue Socken und Waschzeug. Unter dem herausnehmbaren Kunststoffboden lagen zudem zweitausend Euro, tausend türkische Lira, tausend US-Dollar und vier Reisepässe der Nationalitäten Deutsch, Britisch, Kanadisch und Türkisch. Das Gesicht neben den unterschiedlichen Namen gehörte mir.
In der zweiten, erheblich geräumigeren Tasche fand ich das Handwerkszeug eines berufsmäßigen Mörders. Ein aufgeräumter Kasten mit einem Sortiment kleiner Messer und gezähnter Nahkampfklingen, Seil, Malerkrepp, steife weiße Baumwollbandagen, zwei Paar Handschellen, eine Beretta vom Kaliber 9 Millimeter samt drei Ersatzmagazinen, ein Arztkoffer voller Chemikalien von toxisch bis sedierend. Wozu der Stretchanzug, die dicken Gummihandschuhe und der Gefahrenstoffhelm gut sein sollten, blieb mir ein Rätsel.
Beinahe hätte ich die Aktenmappe übersehen, die in einem Seitenfach steckte, aber eine Ecke war im Reißverschluss eingeklemmt und hob sich braun vom schwarzen Innenfutter ab. Ich schlug die Mappe auf und nach einem Blick hinein wieder zu.
Momentan fühlte ich mich nicht in der Lage, dem Inhalt die Aufmerksamkeit zu widmen, die er erforderte.
Ich schloss den Kofferraumdeckel, stieg in das Auto, registrierte die genau auf meine Körpermaße abgestimmte Einstellung des Fahrersitzes und der Spiegel, warf einen Blick ins Handschuhfach, fand nichts Aufregenderes als eine Straßenkarte der Nordtürkei und startete den Motor.
Ich bin, anders als man es von jemandem erwarten könnte, der so alt ist wie ich, überhaupt nicht altmodisch.
Ich bewohne Körper, die jung sind, gesund, spannend, vital.
Ich spiele mit ihren iWas-auch-immer, tanze mit ihren Freunden, höre ihre Platten, trage ihre Kleidung, esse, was ich in ihrem Kühlschrank finde.
Mein Leben ist ihr Leben, und wenn das rosenwangige junge Mädchen, in dessen Körper ich vorübergehend hause, mit aggressiven Lotionen gegen ihre Akne vorgeht, dann tue ich das ebenfalls, denn sie kennt die Bedürfnisse ihrer Problemhaut besser als ich und weiß, was ihr steht und was nicht, und so gehe ich in allen Dingen mit der Zeit.
Nichts davon taugt als Vorbereitung auf das Abenteuer, in der Türkei Auto zu fahren.
Die Türken sind keine schlechten Autofahrer.
Im Gegenteil, sie müssen exzellente Autofahrer sein, denn es braucht unfehlbaren Instinkt, blitzschnelle Reaktionen und eisernes Durchsetzungsvermögen, um auf der Otoyol-3 nach Edirne mehr oder weniger unbeschadet an sein Ziel zu gelangen. Es ist keine Frage der Intelligenz, man hat das Konzept getrennter Fahrbahnen durchaus begriffen, aber wenn die Stadt weiter und weiter hinter der Person am Steuer zurückbleibt und die flachen Hügel, die die Küste begleiten, breitschultrig gegen die Straße vorrücken, weckt der Duft der Weite und des Meeres einen animalischen Trieb und der Gasfuß senkt sich wie von selbst, das Fenster geht auf, um das Brausen des Fahrtwinds hereinzulassen, und die Mission lautet: schneller, vorbei und weiter.
Ich bevorzuge eine gemäßigtere Fahrweise.
Nicht, weil ich altmodisch wäre.
Sondern weil ich, selbst in den einsamsten Stunden auf den dunkelsten Straßen, immer einen Beifahrer habe.
7
Die schlimmste, wirklich schrecklichste Autofahrt meines Lebens.
Wir schrieben das Jahr 1958, sie hatte sich als Peacock vorgestellt, und als sie mir ins Ohr säuselte: »Was hältst du davon, wenn wir irgendwohin fahren, wo es ruhiger ist?«, hatte ich gesagt, das sei eine gute Idee. »Bin dabei.«
Fünfeinhalb Minuten später saß sie hinter dem Lenkrad eines Baby Lincoln Convertible, Dach auf, Vollgas, und wir schossen vom Fahrtwind umheult durch die Berge Sacramentos wie ein Adler in einem Tornado. Ich, am Armaturenbrett festgekrallt, sah mehr als einmal mindestens zwei unserer Räder über dem Abgrund neben der Straße schweben, während sie schmetterte: »Ich liebe dieses verdammte Kaff!«
Wäre ich imstande gewesen, etwas anderes zu empfinden als nackte Angst, hätte ich vielleicht einen geistreichen Kommentar dazu abgegeben.
»Ich liebe diese gottverdammten Leute!« Ein Chevy, der uns entgegenkam, musste eine Vollbremsung hinlegen, hupte wie verrückt, und wir rasten in unvermindertem Tempo den Lichtern eines Tunnels entgegen. »Sie sind alle so gottverdammt nett!« Die Haarnadeln lösten sich aus ihrer blonden Lockenfrisur. »Dauernd heißt es: ›Schätzchen, du bist so nett!‹ Und ich sage: ›Das ist so nett von dir.‹ Und sie dann: ›Aber wir können dir die Rolle nicht geben, weil du so nett bist, Schätzchen!‹ Und ich würde ihnen am liebsten mit MEINEMNETTENARSCHINSGESICHTSPRINGEN!«
Sie kreischte vor Entzücken über diese Aussage und trat in der Hitze der Tunnelröhre, die in den Fels gesprengt und von Neonröhren erhellt worden war, das Gaspedal bis zum Bodenblech durch.
»Fahrt zur Hölle, alle miteinander!«, überschrie sie den Motor, der brüllte wie ein Bär in der Schlagfalle. »Wo ist eure Galle, euer Gift, wo sind eure verdammten Eier, ihr Arschlöcher?!«
Vor uns zwei Scheinwerfer, und mir fiel auf, dass sie inzwischen auf der falschen Straßenseite fuhr.
»Fickt euch!«, röhrte sie. »Fickt euch!«
Die Scheinwerfer schwenkten zur Seite, sie folgte dem Ausweichmanöver, hielt auf den anderen Wagen zu wie ein Stier auf den Matador, die Scheinwerfer wichen erneut aus, Reifen quietschten, aber sie kurbelte synchron am Lenkrad, das Kinn vorgereckt, den Blick gesenkt, wild entschlossen. Und so gut mir der Körper gefiel, in dem ich derzeit wohnte – männlich, 22, fantastische Zähne –, hatte ich nicht die Absicht, darin zu sterben, weshalb ich mich zu ihr hinüberbeugte, die Hand in die unbedeckte Beuge ihres Ellenbogens legte und
wechselte.
Die Bremsen reagierten mit einem gequälten Aufschrei, die Hinterräder blockierten, das Heck des Wagens brach aus und kollidierte – schicksalhaft wie weiland die Titanic mit dem Eisberg – mit der Tunnelwand. Begleitet von einem Kometenschweif gelber Funken schrammten wir daran entlang, bis der schwere Wagen endlich zum Stillstand kam.
Ich wurde nach vorn geschleudert, meine Stirn schlug gegen das Lenkrad. Die Hand irgendeines höheren Wesens verknotete die Neuronen in meinem Gehirn und schuf lauter kleine Zentren weißen Rauschens, wo meine Gedanken hätten sein sollen. Ich hob den Kopf und sah Blut am Lenkrad, drückte einen pfauenblauen Handschuh an meinen Schädel und bemerkte den metallischen Blutgeschmack im Mund. Der überaus ansehnliche junge Körper neben mir, den ich aus Gründen der Selbsterhaltung verlassen hatte, regte sich, schlug die Augen auf, schüttelte sich wie ein Kätzchen und schaute zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder mit eigenen Augen um sich.
Verwirrung, dann Angst, dann Panik – die per se nur in Wut oder Entsetzen umschlagen kann. Er entschied sich für Letzteres und schrie: »O Gott, o Gott, o Gott, wer bist du, wer zum Teufel bist du, wo bin ich, wo bin ich, o Gott, o Gott …«
Oder so ähnlich.
Das andere Auto, einst dazu ausersehen, die entscheidende Rolle bei unserem weiträumigen Ableben zu spielen, war circa zwanzig Meter von uns entfernt zum Stehen gekommen. Die Fahrertür flog auf, und ein Mann sprang heraus; das von Aknenarben zerfurchte Gesicht war vor Wut zinnoberrot. Ich zwinkerte mir das Blut aus den Augen und sah, dass dieser seriös mit weißem Hemd und schwarzer Stoffhose bekleidete Herr in einer Hand einen kleinen silberfarbenen Revolver hielt und in der anderen eine Polizeimarke. Er brüllte etwas, spie mit überschnappender Stimme unzusammenhängende Satzbrocken aus wie: »Meine Familie, mein Auto, Polizeikommissar, ihr werdet brennen, ihr werdet verdammt noch mal brennen …«
Nachdem ich ihm nicht geneigt erschien, sachdienliche Aussagen zu machen, wedelte er mir mit der Waffe vor dem Gesicht herum und schnauzte den Jungen an, er solle ihm meine Handtasche zuwerfen. Auch diese war – wie alles andere, das mit mir zu tun hatte – pfauenblau, mit grünen und schwarzen Pailletten bestickt. Die Tasche schillerte wie frische Schlangenhaut, als sie durch die Luft flog. Der Chevyfahrer fing sie ungeschickt auf, öffnete sie, warf einen Blick hinein und ließ sie mit einem unwillkürlichen Laut entsetzten Ekels fallen.
Stille, nur das Ticken des abkühlenden Automotors füllte das heiße Dämmerlicht des Tunnels. Ich beugte mich vor, um zu sehen, welchem Gegenstand ich die wohltuende Ruhe verdankte.
Der Tascheninhalt lag auf der Straße verstreut. Ein Führerschein informierte mich darüber, dass mein Name tatsächlich Peacock lautete, der Fluch von Eltern mit einem eingeschränkten Verständnis für ornithologische Zumutbarkeit. Ein Lippenstift, eine Damenbinde, ein Schlüsselbund, ein Portemonnaie. Eine kleine Plastiktüte mit einem unbekannten gelblichen Pulver. Ein menschlicher Finger, anscheinend frisch, halb eingewickelt in ein weißes Taschentuch und – der unsauberen Schnittkante nach zu urteilen – mit stumpfer Klinge abgesäbelt.
Ich hob den Blick von dem Malheur zu dem Chevyfahrer, der mich mit schockierter Miene anstarrte.
»Verdammt«, krächzte ich, zupfte an den Fingern der langen, blutgeschwärzten Seidenhandschuhe, zog sie aus, erst den einen, dann den anderen, und hielt ihm die nun entblößten Handgelenke hin. »Ich glaube, Sie sollten mich festnehmen.«
Das ist eines der Probleme beim Umsteigen in einen neuen Körper – man weiß nie, wo er vorher gewesen ist.
8
Als die Sonne sich dem Ende ihres Tageslaufs näherte, hatte ich ungefähr die halbe Strecke nach Edirne zurückgelegt. Man brauchte das Fenster nur eine Minute geschlossen zu halten, und der Leihwagengeruch meldete sich zurück: Lufterfrischer und chemische Sauberkeit. Das Radio sendete eine Dokumentation zum Thema »Wirtschaftliche Konsequenzen des Arabischen Frühlings«, gefolgt von Gedudel über Liebeslust, Liebesleid, gebrochene Herzen und die Heilung derselben. Autos, die von Westen kamen, hatten schon die Scheinwerfer eingeschaltet, und noch ehe die Sonne den Horizont berührte, wurde sie von schwarzen Wolken verschluckt.
Bevor es völlig dunkel wurde, lenkte ich meinen fahrbaren Untersatz auf den Parkplatz einer Raststätte und stellte ihn zwischen zwei großen Teichen weißen Halogenlichts ab. Man warb mit Fastfood, Benzin, Spielen und Unterhaltung. Ich erstand einen Kaffee, Pide und als Nachtisch einen Schokoriegel mit insgesamt drei Rosinen, suchte mir einen Fensterplatz und schaute hinaus. Mir gefiel das Gesicht nicht, das die Scheibe widerspiegelte. Es war das Gesicht eines Menschen ohne Skrupel.
Die O-3 ist zu den besten Zeiten eine viel befahrene Autobahn, und auch wenn die Schilder den Weg nach Edirne weisen, könnten sie ebenso gut Belgrad, Budapest oder Wien anzeigen. Sie ist eine Route für gelangweilte Fernfahrer, in deren Augen die gewaltige Brücke, die in schwindelnder Höhe über den Bosporus von Asien nach Europa führt, ein ärgerliches Nadelöhr ist, und der Anblick der Hagia Sophia am Gestade des Goldenen Horns nur eine mentale Koordinate, die ihnen sagt, wie viele Stunden es noch dauert, bis sie zu Hause sind.
Eine Familie, zuvor zu sechst in ein Auto für fünf Personen gepfercht, tollte durch die Raststätte wie Gefangene kurz nach ihrer Freilassung. Die Eltern und eine bedauernswerte Großmutter, die anscheinend darauf bestanden hatte, mitzukommen, beschossen sich gegenseitig mit verbalen Giftpfeilen, während die Kinder schrille Freudenschreie ausstießen, weil ihnen schlagartig klar geworden war, dass ihnen zum wunschlosen Glücklichsein nur genau diese Wasserpistole aus Plastik fehlte und natürlich das Fernglas mit Vergrößerungsfaktor zwei.
Ich musste das Auto loswerden, besser früher als später.
Wann hatte das Gesicht im Fenster diese Entscheidung getroffen?
Wahrscheinlich zeitgleich mit dem Entschluss, kein langsam wirkendes Gift zu schlucken.
Wahrscheinlich in der Sekunde, als es auf einem unbenutzten Handy eine Nachricht erhielt: Circe.
In der Sekunde, als es begriff, dass es nicht allein war.
Ein Mann sprach mich an und fragte, ob ich ihm sagen könne, wie spät es sei.
Nein, täte mir leid.
Ob ich nach Edirne wolle?
Nein, wolle ich nicht.
Ob mir unpässlich sei. Ich sähe … seltsam aus.
Alles bestens, nur ein paar persönliche Probleme, mit denen ich fertig werden müsse.
Jeder respektiert einen Mitmenschen, der mit persönlichen Problemen zu ringen hat.
Er ließ mich in Ruhe.
Auf dem halbdunklen Parkplatz stand ein Pärchen und schrie sich an, ihre junge Liebe scheiterte soeben an dem Vorhaben, bei unzulänglicher Beleuchtung eine Straßenkarte zu lesen. Ich stieg wieder ins Auto, stellte das Radio laut, ließ die Fenster hinunter, um die Abendkühle zu genießen, und setzte meinen Weg fort nach Edirne.
9
Ich war von jeher gern in Adrianopel, wie Edirne früher hieß. Ehedem die Residenz von Prinzen und Königen, war es in neuerer Zeit mehr und mehr heruntergekommen, vergleichbar einem alten Mann, für den die Mottenlöcher in seiner Jacke keine Schande waren, sondern ehrenvolle Abzeichen selbstbewusster Knickrigkeit. Im Winter lag grauer Schneematsch in den Gossen der schnurgeraden, zweispurigen Durchfahrtsstraßen; in der Sommerzeit trafen sich Männer und solche, die es werden wollten, beim alljährlichen Kırkpınar-Turnier, um ihre Kräfte zu messen: ölglänzende Leiber, die sich ineinander verkrallt und verknotet im Sand wälzten. Meine Wenigkeit fühlte sich nie versucht, an diesem Ringkampf teilzunehmen, nicht einmal in der Hülle eines Champions.
Der Stadt fehlten zugegebenermaßen die grandiosen Sehenswürdigkeiten, mit denen Istanbul aufwartete – bis auf eine Moschee mit silberner Kuppel, erbaut von einem Sultan Selim mit einer Leidenschaft für Marmor, sowie einem optisch ansprechenden Krankenhausgebäude, welches die Stadt Sultan Bayezit II. verdankt, der ebenso gern eroberte wie Buße tat. Es zeichnete sich durch eine stolze Integrität von Zweck und Ästhetik aus, die den Besucher daran erinnerte, dass Edirne nicht Pomp und Glamour brauchte, um groß zu sein.
Den Wagen parkte ich bei einem Springbrunnen, der mit Sonnenblumen aus Metall geschmückt war.
Ich nahm die Taschen aus dem Kofferraum, steckte einhundert Lira und einen der Reisepässe ein, legte die Spange von einem Paar Handschellen um mein rechtes Handgelenk, versenkte den Schlüssel in der Innentasche meiner Jacke, zog den Ärmel über den Stahlreif, warf mir die Taschen über die Schulter und machte mich in dem stillen, nächtlichen Edirne auf die Suche nach einer Unterkunft.
Kugelförmige Lampen an den Mauern beleuchteten die Straße, sie saßen in den antiken, schmiedeeisernen Fassungen, in denen einst Fackeln blakten. Pragmatische Wohnblocks klemmten zwischen Villen des 19. Jahrhunderts im Zuckerbäckerstil, die zu Wohnungen für aufstrebende Familien umgebaut worden waren. Hinter den Balkonen flackerte das graublaue Licht der Fernsehgeräte. Eine Katze saß unter einer Wäscheleine und fauchte mich an. Ein eiliger Bus hupte einen stur zockelnden Motorradfahrer aus dem Weg. Der Wirt eines Restaurants winkte seinen Stammgästen hinterher, die durch die Nacht heimwärts torkelten.
Ich lenkte den Schritt in die Richtung der in weißem Scheinwerferlicht badenden Selimiye-Moschee, denn in der Umgebung großartiger Monumente königlicher Verschwendungssucht fand man in der Regel auch gute Hotels.
Der Nachtportier döste vor dem Fernseher, in dem irgendein alter Film lief, die Geschichte eineiiger Zwillingsbrüder, beide von demselben Schauspieler in einer Doppelrolle dargestellt. In der letzten Szene standen sie beide auf einem Berg und schüttelten sich die Hände. Links war der Himmel grau und trostlos, rechts wolkenlos und heiter. Wo ihre Hände sich trafen, schied ein senkrechter Schnitt das eine vom anderen. Der Abspann begann, der Nachtportier regte sich.
Ich legte meinen kanadischen Pass auf den Tresen und fragte: »Einzelzimmer?«
Der Mann studierte den Namen im Pass und las ihn laut vor, sichtlich bemüht, ihn möglichst korrekt auszusprechen. »Nathan Coyle?«
»Eben dieser.«
Alle Welt liebt Kanadier.
Das Hotel hatte drei Stockwerke, war ursprünglich ganz aus Holz errichtet gewesen, jetzt aber ein Konglomerat aus Backstein und Bohlen. Von den zwölf Zimmern waren neun nicht belegt, und in den Fluren herrschte Grabesstille.
Ein Zimmermädchen mit dunklen Ringen unter den Augen, hüftlangem, glattem, schwarzem Haar und einem vorspringenden Kinn ging vor mir her und schloss die Tür auf.
Ein Doppelbett beanspruchte den größten Teil der kleinen Bodenfläche unter einer Dachschräge. Ein bodentiefes Fenster ging hinaus auf eine Handbreit Balkon. Auf einem hölzernen Wandregal stand ein kleines Fernsehgerät, an der Wand darunter befand sich ein Heizkörper. Das handtuchgroße Badezimmer roch schwach nach Zitrone und Toilettenartikeln, und wenn ich mich in die Mitte stellte, konnte ich mit ausgestreckten Armen die Wände berühren.
Das Mädchen wartete in der Tür und fragte auf Englisch, aber mit starkem Akzent: »Ist okay für Sie?«
»Perfekt«, erwiderte ich. »Können Sie mir rasch zeigen, wie das hier funktioniert?«
Ich hielt die Fernbedienung in die Höhe. Man sah ihr an, dass sie am liebsten die Augen verdreht hätte.
Ich grinste das jungenhafte Grinsen des vom Kulturschock gebeutelten Nordamerikaners. Sie griff nach der Fernbedienung, ich streckte den anderen Arm nach hinten und ließ die freie Spange der Handschellen um das Heizungsrohr an der Wand schnappen. Bei dem Klicken hob das Mädchen den Blick, ich legte meine linke Hand auf die ihre und
wechselte.
Mein Finger zuckte.
Der Fernseher ging an.
Ein Nachrichtensprecher lachte über einen Witz, der von mir ungehört im Äther verhallt war. Hinter ihm erschien die Wetterkarte, und als wollte er unterstreichen, dass nichts wundervoller sei als das Wetter von Morgen, lachte er nochmals über bedeckten Himmel und Nieselregen.
Der Mann vor mir – laut einem Viertel seiner Reisepässe Nathan Coyle, kanadischer Staatsbürger mit makellos weißer Weste – taumelte und fiel auf ein Knie. Er versuchte aufzustehen, hörte die Handschellen gegen den Heizkörper klappern, spürte den Ruck und richtete den verständnislosen Blick auf das Armband aus Stahl, das ihn daran hinderte, sich zu erheben.
Ich beobachtete ihn. Seine gehetzte Atmung, Folge des Schocks, der Verwirrung, wie er mit geblähten Nasenflügeln die Luft einsog, einmal, zweimal, dreimal, dann hatte er sich gefasst, war hellwach, gefährlich.
Ich sagte: »Hallo.«
Er presste die Lippen zusammen und schaute mich an, und ich hatte das Gefühl, er sah nicht das Zimmermädchen, sondern mich – mich selbst! – und mir stockte der Atem.
Er schaute schweigend aus der Hocke zu mir auf, der rechte, halb nach hinten gestreckten Arm zerrte an der Stahlfessel.
Ich achtete darauf, ihm nicht zu nahe zu kommen, und sagte: »Du wirst Gift schlucken.«
Kein Kommentar.
»Zwei Fragen sind der Grund, weshalb du noch lebst. Erstens: Für wen arbeitest du, und muss ich damit rechnen, dass noch mehr von deiner Sorte aus den Büschen springen? Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit euresgleichen pflegt es so zu sein. Zweitens: Warum hast du Josephine Cebula ermordet?«
Er machte schmale Augen und schwieg beharrlich.
Mein Leihkörper war schon seit vielen Stunden auf den Beinen, hatte von den Pausenzigaretten einen schalen Geschmack im Mund und die Last eines langen Tages drückte die Bandscheiben zusammen. Der BH war zu eng und zwickte, und in dem frisch gepiercten linken Ohrläppchen pochte eine beginnende Entzündung.
»Du wirst Gift fressen«, sagte ich zu einer Stelle über seinem Kopf. »Alles, was ich will, sind Antworten.«
Schweigen.
»Diese Beziehung entwickelt sich zu einem für uns beide zweifelhaften Vergnügen«, meinte ich. »Linke Tasche.«
Ein Zucken seiner Augenbrauen. Unwillkürlich fuhr seine linke Hand zur Jackentasche, zögerte, und bevor er sich besinnen konnte, hatte ich sie ergriffen.
Und wechselte.
Das Mädchen in dem hoffnungslos engen BH rutschte in sich zusammen. Ich zog die Schlüssel aus der Jackentasche, befreite mich, fing sie auf, bevor sie zu Boden fallen konnte, und erkundigte mich besorgt: »Alles in Ordnung mit Ihnen, junge Dame? Ich glaube, Sie sind für einen kurzen Moment ohnmächtig geworden.«
Unglaublich, diese Bereitschaft des menschlichen Verstandes, das zu glauben, was ihm keine Angst macht.
»Vielleicht sollten Sie sich einen Moment hinsetzen.«
10
Mein erster Wechsel.
Ich war dreiunddreißig Jahre alt.
Er war jünger, schätzungsweise Mitte zwanzig, aber sein Körper schon von Verfall gezeichnet. Wenn er sich kratzte, ein lautes, trockenes Scharren rissiger, gelber Nägel, rieselten weiße Schuppen von seiner Haut. Frühzeitig ergrauendes Haar, vereinzelte Bartinseln an einem zernarbten Kinn, und er wollte mich totschlagen, weil ich Geld hatte und er Hunger …
großen Hunger, wie ich feststellte, als ich gewechselt hatte.
Eigentlich widerstrebte es mir, ihn zu berühren, immerhin ermordete er mich gerade, aber ich wollte nicht allein sterben, deshalb streckte ich, während rote Schleier vor meinen Augen wogten und er mir die Geldbörse vom Gürtel schnitt, die Hand nach ihm aus, grub die Finger in seine Schulter – und wurde er. Just zur rechten Zeit, um Zeuge meines letzten Atemzugs zu sein.
11
Um drei Uhr morgens schlaflos in einem Hotelzimmer.
Das Licht brannte.
Nichts im Fernsehen.
Mein Körper brauchte Schlaf.
Ich brauchte Schlaf.
Es kam kein Schlaf.
Ein Gehirn, das keine Ruhe fand, Gedanken in endloser Prozession.
Um neun Uhr vierzig verließ eine Frau namens Josephine Cebula ein Hotelzimmer in Istanbul. Sie hatte die Absicht, zur Küste zu fahren. Vor drei Tagen hatte sie zwei neue Freunde kennengelernt, die zu ihr sagten: Komm mit, wir zeigen dir, wie man von der Galatabrücke aus Fische fängt.
Ich bin zu hübsch, um angeln zu gehen, sagte der Verstand, der den Körper von Josephine Cebula trug. Sollte ich mir nicht vielleicht jemand Passenderes überstreifen?
Angeln ist toll, verkündeten meine frischen roten Lippen. Ich wollte immer schon lernen, wie man das macht.
Mittags bemerkte ich jemanden im Augenwinkel, und um zwölf Uhr zwanzig rannte ich, dankbar für die Schuhe mit flachen Absätzen, durch die nahe gelegene Metrostation Taksim, der ideale Ort, um Verfolger abzuschütteln. Meine Fingerspitzen huschten von Haut zu Haut auf der Suche nach einem geeigneten Körper für die Flucht, und gerade als ich gegen eine Frau mit geschwollenen Fußgelenken und Kokosgeschmack im Mund prallte, schoss der Mann hinter mir. Ich spürte, wie das Projektil mein Bein durchschlug, Muskeln und Adern zerfetzte, sah mein eigenes Blut spritzen, und als ich vor Schmerz die Augen zusammenkniff und den Mund aufriss, um zu schreien, bekam meine fuchtelnde Hand eine andere zu fassen, und ich floh und überließ Josephine Cebula ihrem Schicksal.
Und dann,
rätselhafterweise,
tötete er Josephine.
Sie lag auf dem Boden, und ich war fort, doch er jagte ihr zwei Kugeln in die Brust, und sie starb, obgleich er es doch auf mich abgesehen hatte.
Weshalb hatte er das getan?
In einem Hotelzimmer, drei Uhr früh, schmerzte mein Bein ohne erkennbaren Grund.
Eine braune Aktenmappe aus Nathan Coyles mörderischer Reisetasche.
Ich hatte sie gefunden, als ich sein Auto stahl, und jetzt, in den bleiernen Stunden vor Tagesanbruch, breitete ich den Inhalt auf dem Bett aus und sah die Gesichter meines Lebens vor mir liegen. Ein einziger Name stand vorn auf dem Aktendeckel: Kepler.
Ein Name so gut wie jeder andere.
12
Um sieben Uhr morgens checkte ich aus dem Hotel in Edirne aus, frühstückte in einer Bäckerei um die Ecke, die heiße Croissants servierte, Kirschmarmelade und den besten Kaffee, den ich in diesem Körper bisher getrunken hatte.
Die Taschen auf dem Rücken und die Kappe tief in der Stirn, machte ich mich auf, um möglichst den ersten Bus zu erwischen, der nach Kapikule fuhr, dem Grenzübergang nach Bulgarien. Für einen Mörder war es höchste Zeit, den Staub dieses Landes von den Füßen zu schütteln.
Wie ungewohnt es sich anfühlte, selbst keines Verbrechens schuldig, meiner fleischlichen Hülle wegen verfolgt zu werden.
Bei dem Gedanken musste ich lächeln, den ganzen Weg bis zum Fahrkartenschalter.
Elf Personen gingen mit mir auf die kurze Reise nach Kapikule, und zum Glück waren es nicht mehr, handelte es sich bei dem Bus doch um einen umgebauten Minivan mit einem Pappschild hinter der Windschutzscheibe, auf dem zu lesen stand: Kapikule, Lev und Lira akzeptiert, kein Wechselgeld.
Ein älterer Mann und seine alte Mutter saßen hinter mir und stritten.
Sie sagte: »Ich will nicht.«
Er sagte: »Mutter …«
Sie sagte: »Ich will nicht und damit basta.«
Er sagte: »Tja, aber du musst, Mutter, es geht nicht anders. Wir haben das schon tausendmal besprochen und es geht nicht nur um deine Zukunft, sondern auch um meine, deshalb fahren wir hin und du musst mitkommen und damit hat sich’s.«
Sie sagte, und ihre Stimme hörte sich an, als wäre sie den Tränen nahe: »Aber ich will nicht!«
In diesem Tenor ging es weiter bis zum Zielort und wahrscheinlich darüber hinaus.
Kapikule war ein Nicht-Ort am Rande von Nicht-wirklich-Irgendwo. Vor Kurzem noch hätte ich auf einen Besuch dort dankend verzichtet und wäre in Edirne in einen durchgehenden Zug nach Bulgarien gestiegen, aber die Zeiten waren hart, unrentable Linien wurden stillgelegt und Bahnhöfe sanken in Dornröschenschlaf, weil eine zunehmende Arbeitslosigkeit die Scharen der Pendler ausdünnte.
Der Bahnhof in Kapikule plus Grenzübergang war ein zweistöckiges Gebäude mit dem ganzen Charme eines Schuhkartons, von weißem Neonlicht gnadenlos bloßgestellt. In einem anderen Land wäre es vielleicht ein trübseliges Einkaufszentrum gewesen, voller kleiner, am Rande der Pleite krebsender Geschäfte, oder aber ein mit den besten Absichten gestartetes soziales Wohnungsbauprojekt, ausgehebelt von gewissenlosen Grundbesitzern, die darauf lauerten, ihre Brache an MegaMart International zu verscherbeln. Doch so, wie es war, war es nichts dergleichen.
Der Fahrkartenverkäufer hockte hinter dem Schalter, als ich hereinkam, das Kinn in die Hand gestützt und den Mützenschirm über die Augen gezogen. Als das Geräusch von Geld auf dem Stahltresen ihn veranlasste, den Kopf zu heben, stellte ich interessiert fest, dass ich den letzten Menschen auf der ganzen Welt vor mir hatte, der glaubte, ein Hitler-Chaplin-Bärtchen wäre der letzte Schrei in puncto männlicher Gesichtsbehaarung.
Ich schob ihm mein Geld und meinen türkischen Reisepass hin. Er betrachtete beides wie ein Chirurg ein abgetrenntes Bein: Erst mal sehen, ob nicht doch noch der Körper dranhängt.
»Wohin?«, fragte er.
»Belgrad.«
Der Seufzer, mit dem er das Geld kassierte – und den Pass ignorierte –, war das gottergebene Eingeständnis eines Mannes, dass man ihn bei den Eiern hatte. Man hat ihn an den Eiern und er muss seine Pflicht tun, aber verdammt, ein rücksichtsvollerer Mensch wäre weggegangen und hätte ihn in Ruhe gelassen, statt ihn mit dieser unseligen Fahrkartenkauferei zu nerven.
»Abfahrt heute Abend«, brummte er und schob mir den dürftigen Zettel hin. »Sie müssen warten.«
»Gibt es in Kapikule irgendetwas zu besichtigen?«
Sein Blick hätte die Giftzähne einer Kobra ausfallen lassen.
Ich setzte mein gewinnendstes Lächeln auf, legte den Fahrschein in meinen Pass und sagte: »Dann werde ich so lange ein Nickerchen machen.«
»Aber nicht hier«, blaffte er. »Das Gelände ist Eigentum der Bahn.«
»Selbstverständlich ist es das. Wie dumm von mir.«
Ich wollte die Wartezeit nicht auf dem Präsentierteller absitzen. Womöglich hatte die Polizei mittlerweile die Fingerabdrücke meines Körpers gefunden, ein auf der Flucht verlorenes Haar von meinem Kopf oder irgendein anderes Indiz als Folge einer Unvorsichtigkeit meinerseits, von dem ich nichts wusste, und verfolgte meine Bewegungen. Möglicherweise hatten sie – das große anonyme sie – das Material der Videoüberwachung gesichtet, von dem Augenblick an, als Josephine Cebula auf der Treppe der Station Taksim zusammenbricht bis zurück zu dem Zeitpunkt, an dem ein Mietwagen in eine Tiefgarage unter einem Hotel fährt. Falls sie besonders tüchtig waren, hatten sie womöglich eine Fahndung nach besagtem Mietwagen veranlasst, der momentan im Schatten einer Zypresse parkte, gegenüber einem Springbrunnen, in dem eiserne Sonnenblumen wuchsen.
Vielleicht auch nicht.
Vielleicht stand die Polizei vor einem Rätsel.
Woher sollte ich das wissen?
Ich suchte Zuflucht in einer winzigen, aus rosafarbenen Steinen errichteten Kapelle am Flussufer. Ich befand mich auf türkischem Boden, aber die Äcker auf der anderen Seite, abgeerntet und für die Frühjahrsaussaat vorbereitet, lagen in Griechenland. Ein Katzensprung, und ich wäre drüben. Für einen Moment fühlte ich mich versucht – ein schneller Schnitt mit scharfer Klinge durch die Pulsadern und im Körper eines griechischen Bauern davongehen, umweht von Knoblauchduft, in mit Sand blank geschrubbten Schuhen.
Ein schwarzbärtiger Priester kam auf mich zu, während ich in der letzten Reihe saß, die gekreuzten Beine auf eine Steinbank gelegt. Er sprach mich zuerst auf Griechisch an, nicht meine Stärke. Als er meinen Akzent hörte, hob er erstaunt die Augenbrauen und versuchte es mit Türkisch.
»Dieses Gotteshaus wurde von Konstantin I. gegründet. Auf einer Reise durch sein Reich machte er Rast an diesem Ort und stillte seinen Durst mit dem Wasser des Flusses. In der darauffolgenden Nacht erschien ihm im Traum die Jungfrau Maria. Sie wusch seine Hände und Füße und netzte seine Lippen mit dem Flusswasser. Als er erwachte, war er so beeindruckt von diesem Traum, dass er befahl, an dieser Stelle ein Kloster zu bauen. Es zog Pilger in großer Zahl an, die im Fluss ihre Füße badeten und von der Madonna träumten. Später haben die Ottomanen alles niedergerissen bis auf diese kleine Kapelle, in der wir uns jetzt befinden. Selim der Grausame kam auf der Jagd hierher und legte sich am Ufer des Flusses zum Schlafen nieder und hatte dasselbe Traumgesicht wie sein Vorgänger Konstantin. Nach dem Erwachen wusch er seine Hände und Füße im Fluss und erklärte ihn für heilig und verkündete, es sei ein Verbrechen, das Zerstörungswerk an den Mauern dieser Stätte fortzusetzen. Er hinterließ dies hier.« Seine Hand strich über die Wand und die verblassten Reste eines meterbreiten goldenen Schnörkels dicht neben dem Altar. »Die Thugra des Sultans, sein herrschaftliches Siegel, damit wir jeden, der künftig unsere Mauern bedroht, hierher führen können und ihm das Dekret seines Herrn zeigen. Er hat unsere Kapelle gerettet, wenn auch die Pilger nicht wiedergekommen sind.«
Ich nickte das bedächtige Nicken des religiös Toleranten, ließ den Blick von der Signatur des Sultans zu den traurigen Augen der darüber dargestellten Jungfrau Maria wandern und fragte, ob ich zum Fluss hinuntergehen und sehen könne, ob er mich von meinen Sünden reinwäscht.
Die Augen des Priesters weiteten sich entsetzt.
»Auf keinen Fall!«, rief er aus. »Der Fluss ist heilig!«
13
Der Körper von Nathan Coyle.
Bei genauerer Betrachtung war er nicht mein Typ. Seine Arm- und Rückenmuskulatur verdankte er eindeutig dem Stemmen von Gewichten ohne irgendeinen praktischen Nutzen. Jahrelanges Joggen hatte mein Herz-Kreislauf-System gestärkt, dafür schmerzte mein Knie, wenn ich länger still saß, und der Schmerz nahm stetig zu, bis ich das Bein streckte. Dann verschwand er. Ich war etwas weitsichtig, was recht nützlich war, wenn es darum ging, in größerer Entfernung etwas zu erkennen, beim Nahsehen aber neigte ich dazu, die Augen zusammenzukneifen. In der Reisetasche war nichts, das auf den Gebrauch von Kontaktlinsen oder den Besitz einer Brille hindeutete. Vielleicht hatte ich mir bereits vorgenommen, einen Augenoptiker aufzusuchen, aber meine Vermutung ging dahin, dass er das Blinzeln für völlig normal hielt, weil er nicht wusste, wie andere Menschen sehen.
Auf meinem Schoß die Akte mit der Aufschrift Kepler.
Die Bank auf dem Bahnsteig in Kapikule war kalt, hart, aus Metall. Der Wind kam aus Osten, die Luft roch nach Regen, der Zug hatte zwanzig Minuten Verspätung.
Eigentlich hatte ich kein Interesse daran, nach Belgrad zu fahren. Mir war einzig daran gelegen, die Türkei zu verlassen, bevor ich die schwere Hand des Gesetzes auf der Schulter spürte. Doch Coyles Reisepässe wiesen nach Nordamerika, nicht nach Europa, und in meinem Handy gärte eine SMS mit nur einem einzigen Wort – Circe – und meine Reisetasche barg das Handwerkszeug eines Meuchelmörders, und obzwar es einfacher gewesen wäre, diesen Körper zu töten und weiterzuwandern, erinnerte ich mich an das Gefühl der Kugel in meinem Bein und daran, dass ich floh und Josephine starb.
Und dass ich es war, den er töten wollte.
Der Inhalt der Akte auf meinem Schoß war chronologisch geordnet, Bildmaterial, Dokumente, Abschriften. Ein Vorbinder bedauerte, dass über das Geistwesen Kepler nicht mehr Informationen verfügbar seien als diese dünnen Blätter gestohlener Leben, verlorener Zeit. Keine Fußnote, kein Anhang, kein Wasserzeichen verriet den Verfasser.
Ich wendete Blatt um Blatt, Berichte, Notizen, steife Hochglanzfotos, Gesichter und Namen, fast vergessen, bis zu dem neusten Foto. Meinem Foto. Josephine Cebula.
Eine Kopie ihres polnischen Reisepasses, gefunden bei ihrem Frankfurter Zuhälter. Ihr Gesicht, ungeschminkt und verschlossen, war das Gesicht, das mich morgens im Spiegel begrüßt hatte.
Ein Schnappschuss an einer Straßenecke, wahrscheinlich aus einem vorbeifahrenden Auto heraus gemacht, der Kopf halb abgewendet, als der Fotografierende auf den Auslöser drückte. Ein eingefangener Augenblick, konserviert und abgeheftet.
Der Polizeibericht von ihrer ersten Festnahme, bei welcher sie neun Stunden später wieder aus der Haft entlassen worden war. Das zugehörige Foto zeigte sie mit einer kurzen Lederjacke, die den Bauchnabel frei ließ, einem Minirock, der kaum das Gesäß bedeckte, und einer Schwellung unter dem linken Auge, das wie das rechte trotzig in die Kamera starrte.
Die Bordkarte meines Flugs von Frankfurt nach Kiew, Beginn einer erholsamen Urlaubsreise auf die Krim. Ich war Businessclass geflogen, von Kopf bis Fuß neu und farbenfroh eingekleidet, und als die Stewardess mir einen Whisky kredenzte, verspürte ich ein Gelüst, das mir verriet, dass Josephine Raucherin war und ich verabsäumt hatte, dem Rechnung zu tragen. Nach der Landung hatte ich innerlich fluchend eine Packung Nikotinpflaster erstanden und mir geschworen, ihr ihren Körper dieser Sucht entwöhnt und gesund zurückzugeben.
Eine Aufnahme von mir beim Verlassen des Hotels in Pera, die Sonne im Gesicht, das Handy am Ohr, denn ich war jung und reich und schön und folgerichtig Mitglied einer leichtlebigen, oberflächlichen Freundesclique. Ich erinnerte mich an diesen Tag, diesen Sonnenschein, dieses Kleid. Drei Tage später starb ich auf der Treppe der Metrostation Taksim an den Kugeln eines Fremden. Drei Tage lang hatten sie beobachtet, wie ich mein Leben lebte, bis sie beschlossen, nun sei die Zeit gekommen, es zu beenden.
Meine Fingernägel gruben sich in die Handflächen und ich ließ es geschehen. Ein kleines Blutopfer, dachte ich, war in diesem Moment das Mindeste.
Ich überflog die Angaben zu Josephine Cebula. Eine prügelnde Mutter, die beteuerte, dass sie ihre Tochter liebte, und bei jeder Entlassung aus dem Gefängnis an Josephines Schulter Krokodilstränen vergoss. Ein Freund, der ihr versicherte, er fühle sich nicht betrogen, wenn sie mit seinen Freunden ins Bett ginge, und ehrlich gesagt, brauche er das Geld, um all die schönen Dinge zu bezahlen, die er ihr geschenkt hatte. Flucht nach Frankfurt am Main mit zweiunddreißig Euro Barvermögen, und der Verfasser der Akte bezweifelte nicht, dass sie entschlossen war, ihr Leben in geordnete Bahnen zu lenken, etwas daraus zu machen. Scheinbar gelang es ihr jedoch nur mit Mühe und Not, sich halbwegs über Wasser zu halten, bis das Geistwesen namens Kepler auftauchte und ihr Geld bot, wenn sie für ihn mordete.
Ich stutzte.
Eine Liste ihrer Opfer. Dr. Torsten Ulk, in seiner eigenen Kloschüssel ertränkt. Magda Müller, von einem Unbekannten in ihrer Küche erstochen, während ihre Töchter oben schliefen. James Richter und Elsbet Horn, in einer Umarmung aufgefunden, ihre Augen ausgestochen und ihre Eingeweide auf dem Boden der Kabine des Schiffchens verteilt, mit dem sie zu einem Segeltörn rheinaufwärts aufgebrochen waren. Auch wenn die Polizei diese Morde nicht miteinander in Verbindung brachte, monierte der Verfasser, hätten sie den Zusammenhang erkannt, denn diese Ermordeten gehörten zu ihnen und es geschah durch Josephines Hand und auf Keplers Befehl, dass sie aus ihrer Mitte gerissen worden waren.
Ich las die Worte, und weil ich glaubte, ich hätte die Bedeutung nicht richtig verstanden, las ich sie ein zweites Mal.
Sie waren beim zweiten Lesen nicht anders und nicht weniger unwahr.