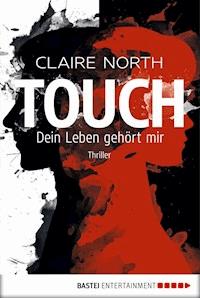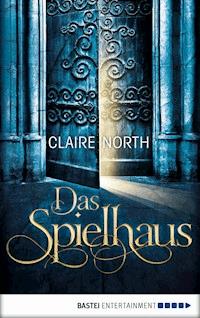
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Haus sieht aus wie jedes andere, doch lass dich nicht täuschen! Hier kannst du mehr gewinnen als Gold oder Juwelen — im legendären Spielhaus. Und wenn du raffiniert genug bist, darfst du gegen die Besten der Besten antreten: die Spieler der Oberen Gemächer. Der Gewinn kann alles sein, was du dir je gewünscht hast: Macht über ganze Königreiche, ewige Jugend, immerwährendes Glück, Lebensjahre, um die Jahrhunderte zu überdauern. Doch je höher der Einsatz, desto tödlicher sind die Regeln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumDie Intrige von VenedigKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Die Treibjagd von SiamKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Das Duell der SpielmeisterinKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Über dieses Buch
Das Haus sieht aus wie jedes andere, doch lass dich nicht täuschen! Hier kannst du mehr gewinnen als Gold oder Juwelen — im legendären Spielhaus. Und wenn du raffiniert genug bist, darfst du gegen die Besten der Besten antreten: die Spieler der Oberen Gemächer. Der Gewinn kann alles sein, was du dir je gewünscht hast: Macht über ganze Königreiche, ewige Jugend, immerwährendes Glück, Lebensjahre, um die Jahrhunderte zu überdauern. Doch je höher der Einsatz, desto tödlicher sind die Regeln ...
Über die Autorin
Claire North, geboren 1986, ist das Pseudonym der britischen Autorin Catherine Webb, die bereits entdeckt wurde, als sie vierzehn Jahre alt war. Seitdem hat sie diverse Romane veröffentlicht und wurde mit namhaften Buchpreisen ausgezeichnet. Für DER TAG, AN DEM HOPE VERSCHWAND gewann sie den World Fantasy Award 2017 in der Kategorie „Bestes Buch“. Ihr Roman DIE VIELEN LEBEN DES HARRY AUGUST erhielt den John W. Campbell Memorial Award 2015 und stand auf der Shortlist des Arthur C. Clarke Awards.
Claire North
Drei Novellen
Aus dem Englischen von Eva Bauche-Eppers
BASTEI ENTERTAINMENT
Deutsche Erstausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015 by Claire North
Titel der englischen Originalausgaben: »The Serpent«/»The Thief«/»The Master«
Originalverlag: First published in Great Britain in 2015 by Orbit,
an imprint of Little, Brown Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Frank Weinreich, Bochum
Titelillustration: © Arcangel/Benjamin Harte; © Thinkstock/Anegada
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
E-Book-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6343-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die Intrige von Venedig
Kapitel 1
Fort ist sie, sie ist fortgegangen.
Die Münze dreht sich im Fluge, dreht sich um und um, und sie, die ich liebte, ist fort.
Kapitel 2
Kommt. Wir wollen hineingehen und zuschauen, gemeinsam, ihr und ich.
Wir teilen den Vorhang von Zeit und Raum und treten ein, treten auf, inszenieren unser Erscheinen: Sehet, wir sind da, wir sind gekommen. Möge die Musik verstummen, mögen die Wissenden das Gesicht abwenden bei unserem Nahen. Wir sind die Schlichterinnen dieses kleinen Kreises, wir haben das letzte Wort, sind nicht Spieler und doch Teil des Spiels, gefangen vom Weg der Figuren auf dem Brett, dem Flüstern der Karten, dem Rollen der Würfel. Wähntet ihr euch darüber erhaben? Dünkt ihr euch, mehr zu sein im Auge des Spielers? Schmeichelt ihr euch, nicht der zu sein, der gelenkt wird, sondern der, der lenkt?
Wie einfältig wir geworden sind.
N
Nehmen wir einen Ort und nennen ihn Venedig. Nehmen wir eine Zeit und sagen, es ist 1610 AD, sechs Jahre nachdem der Papst wieder einmal die Signorissima der Unbotmäßigkeit geziehen und von allen Segnungen der Heiligen Mutter Kirche ausgeschlossen hat. Und was bedeutete es den Einwohnern der Stadt, dieses päpstliche Interdikt? Nun, es war ihnen nicht mehr als ein Stück Pergament mit einem wächsernen Siegel daran. Kein Bischof in Rom konnte diese nicht auf Sand, sondern auf festem Holz erbaute Stadt erschüttern. Doch über ein Weilchen werden die schwarzen Ratten kommen, sie kommen mit Flöhen und der Pest und dann wird die Stadt ihren Hochmut bereuen.
N
Aber wir greifen vor. Für uns im Spielhaus zieht sich die Zeit wie Teig beim Kneten, Stränge entstehen und reißen ab, aber wir bleiben und das Spiel geht weiter.
Sie soll Thene heißen.
Zum Ende des 16. Jahrhunderts kam sie als Tochter eines Tuchhändlers zur Welt. Ihr Vater kaufte von den Ägyptern und verkaufte an die Holländer und war darüber ein vermögender Mann geworden. Ihre Mutter war eine Jüdin, die aus Liebe geheiratet hatte, und von Kindesbeinen an gab der Vater seinem Töchterchen Schweinefleisch zu essen und ließ sie schwören, dieses Verderben bringende Geheimnis unter keinen Umständen jemals den Mächtigen der Stadt zu offenbaren.
»Was werde ich sein, wenn ich alt bin?«, fragte sie ihren Vater. »Kann ich dann die Tochter meiner Mutter sein und deine?«
Worauf ihr Vater erwiderte: »Weder noch. Ich weiß nicht, was dir bestimmt ist, aber du wirst ganz du selber sein und das ist genug.«
Später, nachdem die Mutter gestorben war, erinnert ihr Vater sich dieser Worte und er weint. Sein Bruder, welcher die Ehe mit der Jüdin von Anfang an missbilligte und dem das Kind als Symbol der Familienschande verhasst ist, wandert gereizt auf und ab und fährt ihn an:
»Hör auf zu flennen! Sei ein Mann! Ich schäme mich deiner, wenn ich dich ansehe!«
N
Sie, die Tochter, acht Jahre alt, beobachtet diese Szene durch einen Türspalt und schwört sich mit geballten Fäusten und brennenden Augen, dass man sie niemals wieder weinen sehen wird.
Einige Jahre später verkündet man Thene, gekleidet in Blau und Grau, mit Handschuhen aus feinem Leder und um den Hals ein silbernes Kruzifix, dass sie heiraten wird.
Ihr Vater sitzt stumm und beschämt daneben, während ihr Oheim die Bedingungen des Ehevertrags herunterrasselt.
Ihre Mitgift ist größer als ihr Name und hat ihr Don Jacamo di Orcelo gekauft, aus alter Familie, jüngst verarmt.
»Er ist angemessen, eine exzellente Partie, bedenkt man deine unrühmliche Abkunft«, erklärt der Oheim. Thenes Hände ruhen locker geöffnet in ihrem Schoß. Dass sie bloß so bleiben; nicht zu dulden, dass sich die Finger ineinanderkrallen, erfordert all ihre Willenskraft. Thene, nunmehr fünfzehn Jahre alt, hat seit sieben Jahren nicht mehr geweint und wird es auch jetzt nicht tun.
»Ist das Euer Wunsch?«, fragt sie ihren Vater. Er wendet das Gesicht ab.
Am Abend vor ihrem Hochzeitstag setzt sie sich mit ihm vor den Kamin, ergreift seine Hand und spricht zu ihm: »Ihr bedürft meiner Vergebung nicht, denn Ihr habt nichts Unrechtes getan. Da Ihr sie aber ersehnt, wisset, ich vergebe Euch, von ganzem Herzen, und wenn ich fort bin, werde ich stets nur mit Liebe an Euch denken, mit nichts als großer Liebe.«
Zum ersten Mal seit ihre Mutter gestorben ist, weint er wieder, doch ihre Augen bleiben trocken.
Jacamo di Orcelo war kein guter Ehemann.
Um der erklecklichen Mitgift willen gelobte der achtunddreißig Jahre alte Spross einer Familie mit klingendem Namen, doch ohne klingende Münze, dass er den Spott seiner Standesgenossen ertragen würde, die über seine weniger als halb so alte Braut lachten, sich über die Kaufmannstochter mokierten und munkelten, unter ihren Röcken sei nur Stoff und nochmals Stoff zu finden und nichts von den geheimen Stätten des Weibes, an welchen ein Mann sein Wohlgefallen hat.
In ihrer ersten gemeinsamen Nacht hielt sie seine Hände, wie sie es als Kind bei ihrer Mutter gesehen hatte, und strich ihm das Haar aus dem Gesicht, doch er sagte, das wäre weibische Torheit, und drückte sie nieder.
Von seiner betagten Mutter erfuhr sie, sein Lieblingsessen seien frische Garnelen, über dem offenen Feuer gegart, akkurat so und so gewürzt; eine Prise von diesem, eine Messerspitze von jenem. Sie lernte die Geheimnisse dieses Gerichts und bereitete es für ihn zu. Er verzehrte die Speise ohne Dank und ohne zu bemerken, wie viel Mühe sie sich gegeben hatte.
»Hat es Euch gemundet?«, fragte sie.
»Als Knabe hat man es mir besser vorgesetzt«, erwiderte er.
N
In der ersten Zeit in seinem Haus pflegte sie zu singen, doch er behauptete, ihre Stimme verursache ihm Kopfschmerzen. Eines Abends, sie ging allein umher, sang sie eines der Lieder ihrer Mutter, und er kam die Treppe herunter und schlug sie und schrie: »Jüdin! Jüdin! Hure und Jüdin!«, und sie sang nie wieder.
Ihr Reichtum verringerte seine Schuldenlast, Geld jedoch schwindet, der Spott blieb. War das der Grund, so fragen wir uns, für die Kälte in ihrer Ehe? Oder waren es die plumpen Zudringlichkeiten des viel älteren Mannes unter der Decke der ehelichen Lagerstatt, seine Liebe zum Wein und zu den Karten und, als der Acker auf dem er säte, keine Frucht bringen wollte, seine Hinwendung zu Kurtisanen? Was davon, sollen wir sagen, verdüsterte die Atmosphäre ihres Heims?
N
Wir betrachten ihr Haus, stolz und hochgebaut im Herzen von San Polo, hören die Dienstboten hinter vorgehaltener Hand flüstern, sehen die Hausfrau sich auf ihre Pflichten zurückziehen, sind Zeuge, wie der Ehemann das Geld sinnlos zum Fenster hinauswirft und die Truhen sich leeren. Während die Jahre vorüberziehen und Jacamo immer rückhaltloser seine Selbstzerstörung betreibt, was erkennen wir in der Frau? Nun, gar nichts, hat es doch den Anschein, dass sie in den Stürmen des Schicksals steht wie ein Marmorbild, die gemeißelten Züge makellos weiß und ausdruckslos.
Thene, wunderschön und nun zur Frau erblüht, verwaltet in Abwesenheit ihres Gatten die Bücher, arbeitet mit dem Gesinde und hortet in den Falten ihrer Röcke, was sie an Dukaten in Sicherheit bringen kann, bevor er sie findet und für eine seiner Grillen verschwendet, welche immer es heute sein mag. Und je lauter er wird, umso stiller ist sie, bis sogar das gehässige Gerede hinter ihrem Rücken verstummt, weil den Klatschweibern Venedigs scheinen will, dass da nichts ist, gegen das sie ihr Gift verspritzen können, keine Kaufmannstochter oder betrogene Gattin eines zügellosen Spielers, keine Frau, kein Judenbalg, nicht einmal Thene selbst, nur Eis; und wer mag sich schon daran die Zunge wetzen?
So könnte es weitergehen. Andererseits, dies ist Venedig – geliebt von der Pest, gehasst von den Päpsten, das Herz des Handels in Europa –, und sogar hier kann nichts bleiben, wie es immer war.
Kapitel 3
Da ist ein Haus.
Ihr würdet es heute nicht finden – nein, auch nicht das Tor mit dem grimmigen Löwenhaupt aus Messing als Türklopfer, nicht die mit Tapisserien behängten Innenhöfe oder die dampfenden Küchen. Nein, keine Spur davon ist geblieben, kein Stein. Damals aber stand es in einer dieser engen, namenlosen Gassen nahe San Pantaleone, nördlich einer kurzen gemauerten Brücke, die von drei Brüdern bewacht wird, denn es gibt nur zwei Dinge, die den Bewohnern Venedigs wichtiger sind als die Familie, und das sind ihre Brücken und ihre Brunnen.
Wie kommt es, dass wir hier sind?
Je nun, ihr seid mit Thene hergekommen, ihr habt Jacamo begleitet, der auf seiner unermüdlichen Suche nach neuen Möglichkeiten, arm zu werden, von einem Ort reden hörte, an dem sich dies auf besonders unterhaltsame Weise bewerkstelligen ließe. Ihr steht mit beiden vor dieser Tür, weil Jacamo seine Gemahlin bestrafen will. Sie hat ihn zur Weißglut gereizt mit ihrer Unnahbarkeit, ihrem unerschütterlichen Gleichmut, ihrer untadeligen Höflichkeit, ihrem klaglosen Dulden. Deshalb hat er sie heute gezwungen, ihn zu begleiten. Sie soll sehen, was er tut, und durch ihn leiden. Folgt ihnen also, da sie eintreten, in ein Vestibül mit Wandbehängen aus Seide und Samt; die Luft ist mit Wohlgerüchen geschwängert und leiser Musik. Sie gehen an zwei ganz in Weiß gekleideten Frauen vorbei, deren Gesichter mit einem Nonnenschleier verhüllt sind, obgleich sie keinem christlichen Orden angehören. Durch diese Schleier weht es, willkommen, tretet ein und seid willkommen.
N
Folgt ihnen ins Peristyl, wo an den Säulen der Wandelgänge Fackeln brennen, während aus den Nischen über den Türen die nach byzantinischer Sitte als Mosaik ausgeführten Gesichter heiliger Märtyrer betrübt auf das Geschehen im Hof schauen. Genau wie Jacamo erspäht ihr vielleicht die Kurtisanen mit ihrem hochgesteckten Haar und den bis über das Knie hinaufgeschürzten Röcken, die im Halbdunkel girren und gurren und ihre Freier locken. Die süßen Klänge der Instrumente, der Bratenduft, das an- und abschwellende Stimmengemurmel, das Klappern der Würfel, das Wispern der Karten – es zieht ihn magisch an, ist ihm Nektar und Ambrosia zugleich.
Es gibt noch mehr.
Wie Thene bemerkt ihr vielleicht auch die Knaben und Männer, welche um die Gunst der anwesenden reichen Damen buhlen, die sich hinter langnasigen Masken oder mit Silberfäden durchwirkten Schleiern verbergen. Ihrem Auge folgend, wandert euer Blick zu den Türen zu anderen Räumen, aus denen andere Stimmen und weitere Gerüche wabern wie reflektierter Kerzenschein, und darüber hinaus in die Runde. Auch wir werden nunmehr der Tatsache inne, dass bei all den Spielen, denen man in diesem Innenhof frönt, nicht allein das Glück maßgeblich ist, das aus einem Würfelbecher rollt. Wir sehen Schach, Dame, Mühle und andere Spiele, welche nur wir zu benennen wissen: Tavli, Toguz Kumalak, Go, Shōgi, Mahjong, Sugoruko und Schatrandsch – Spiele aus allen Weltengegenden scheinen hier vertreten zu sein und auch alle Völkerschaften. Sitzt dort nicht ein Wesir aus dem Reich der Moguln, am Turban einen faustgroßen Diamanten, der gerade den Läufer des jüdischen Arztes schlägt, jener dort mit dem gelben Hut? Ist die Dame in Rot, die ihren Rosenkranz um das Handgelenk geschlungen trägt, nicht eine französische Aristokratin, die gegen einen Piraten aus Ragusa spielt, den das Gold seines letzten Raubzugs juckt? Und mehr – noch mehr Fremdländisches. Will uns doch scheinen, dass es ein moskowitischer Fürst ist, der, während er über die Verderbtheit dieser Stadt räsoniert, eine Karte umwendet, die von der eines Bantu-Prinzen übertrumpft wird, der mit feinem Lächeln fragt: »Noch ein Versuch?« Und ist das nicht chinesische Seide am Ärmel der verschleierten Frau, die Getränke serviert? Und blinkt nicht das Gold der Maya an der Fibel des Wächters vor einer silbernen Tür, die in einen Teil des Hauses führt, den wir noch nicht kennen?
Thene sieht dies alles, und auch wenn sie nicht weiß – nicht wissen kann –, was wir wissen, ist sie klug genug, aus dem Gesehenen ihre Schlüsse zu ziehen.
Kapitel 4
Jacamo spielt.
Und verliert.
Er ist einer, mit dem andere Spieler ihr Spiel treiben, und es bedarf dazu nicht einmal der Besten dieser Zunft. Wir werden uns nur so viel wie nötig mit ihm befassen, und schon bald wird er aus unserer Geschichte verschwunden sein, ohne eine Lücke zu hinterlassen.
Thenes Rolle ist die der Zuschauerin. Auf seinen Befehl muss sie neben ihm Platz nehmen, weil sie sehen soll, wie er zwanzig, dreißig, hundert Dukaten verliert. Als ihre Miene unbewegt bleibt, legt er einen Arm um ihre Taille und zieht sie dichter zu sich heran, damit ihr ja nicht entgeht, dass er mit dem nächsten Blatt den Ring seines Vaters verspielt, das Landgut nahe Forli.
Weil auch das sie scheinbar nicht berührt, packt er den Schenkel der nächsten Dirne, küsst sie auf den Hals.
Thene fragt: »Soll ich Wein bringen?«
Und erhebt sich und geht. Sie hält die Hände sittsam, eine über die andere gelegt, vor dem Leib. Jacamo, anders als andere, die es sehen, weiß diese Gebärde zu deuten und ist’s zufrieden.
Er beschließt, dass sie morgen wieder herkommen werden.
Kapitel 5
Wir sind nicht die einzigen Beobachter.
Ebenso aufmerksam sind die Schlichterinnen, wie wir sie nennen wollen. Sie sind nicht die Mägde, die erlesene Speisen und süße Getränke aus einer unsichtbaren Küche herbeischaffen. Sie studieren hinter ihren Masken das Treiben, und sie bewachen die silberne Tür.
»Wohin führt diese Tür?«, fragen wir.
»Zu den oberen Gemächern.«
Was sind die oberen Gemächer?
»Ein Ort, an welchem man spielt.«
»Das sind die Räume hier unten auch, wie dieses ganze Haus. Worin besteht der Unterschied zu den oberen Gemächern?«
»Die Spiele sind andere.«
»Kann ich mitspielen?«
»Hat man Euch eingeladen?«
»Nein.«
»Dann ist Euch der Zutritt verwehrt.«
»Wie kann ich eine Einladung bekommen?«
»Ihr spielt. Wir schauen zu.«
Die Tür bleibt verschlossen. Einstweilen.
N
Auch Thene studiert das Spiel und die Spieler.
Sie mustert ihren Gemahl, der nicht verhindern kann, dass Gegner von geringem Talent und Witz ihn ausziehen bis aufs Hemd. Sie mustert die Glücklichen und die Glücklosen, die Abwägenden und die Tollkühnen, wie sie von Tisch zu Tisch wandern und sich zu immer gewagteren Einsätzen versteigen. Sie entdeckt ein Mitglied des Rats der Sieben und zwei Nobili, die dem Rat der Zehn angehören. Sie sieht Richter und Händler, Fürsten und Priester, und vor allem sieht sie – Frauen. Matronen und Töchter, Mütter und Kurtisanen. Einige spielen, andere nicht, und für ein paar öffnet sich wie von selbst die silberne Tür. Das Gesicht hinter den Masken des Karnevals verborgen, schauen sie die an, die sie anschaut.
Seht, da ist der Mann.
Silver wollen wir ihn nennen, wegen der Borte mit dem Muster einer silbernen Dornenranke am Ärmelbund seines Gewandes. Schon eine geraume Weile ruht sein Blick auf ihr, und dass sie seine Annäherung nicht bemerkt, beweist, wie überaus unauffällig er sich zu geben weiß. Als sie sich umschaut, weil sie einen Atemhauch im Nacken spürt, fragt er:
»Spielt Ihr?«
»Nein.«
Er lächelt und schüttelt über sich selbst den Kopf.
»Vergebt mir«, sagt er. »Ich habe mich falsch ausgedrückt. Würdet Ihr gerne spielen?«
Sie richtet den Blick auf den Rücken ihres Mannes, auf die leeren Gläser neben seinem Ellenbogen und fühlt Zorn in sich aufsteigen, einen Sturm in ihrer Brust, und ihre Hände schmerzen. Sie brennen davon, dass sie stillhalten müssen, und fast unhörbar entflieht ihr ein Ja.
N
Sie spielen Schach.
Er gewinnt die erste Partie.
Sie die zweite.
Sie wechseln nur wenige Worte, während sie spielen. Der Einsatz, denn es muss einen Einsatz geben, ist die Verpflichtung, eine Frage zu beantworten, die der Gegner stellt.
»Reicht es nicht, dass man zum Vergnügen spielt?«, fragt sie.
Ein Ausdruck des Entsetzens huscht über seine Züge. »Ihr würdet Eure irdische Glückseligkeit aufs Spiel setzen? Ihr würdet riskieren, Eure Selbstachtung zu verlieren? Guter Gott, spielt nicht zum Vergnügen, noch nicht, nicht, wenn es so viele geringere Dinge gibt, die Ihr einsetzen könnt!«
So rätselhaft seine Worte ihr erscheinen, sie umhüllen sie so natürlich wie das Altartuch den kalten Stein. »Dann spielen wir um Fragen«, sagt sie, »und um Antworten.«
So geschieht es, und seine Frage, nachdem er die erste Partie gewonnen hat, lautet: »Empfindet Ihr Liebe für Euren Gemahl?«
»Nein«, erwidert sie und ist erstaunt über ihren Freimut.
Nach ihrer Revanche überlegt sie lange und fragt endlich: »Was wollt Ihr von mir?«
Worauf er versetzt: »Eines Tages werde ich eine Person um eine Gefälligkeit bitten müssen, und ich möchte herausfinden, ob möglicherweise Ihr diese Person seid.«
Dann hat Jacamo sich erhoben. Er ist betrunken, und sie führt ihn nach Hause.
Am nächsten Tag entlässt sie einen weiteren Diener, dem sie keinen Lohn mehr zahlen können, und zwei Abende darauf begeben sie sich erneut zu dem uns nun bekannten Haus.
Und wieder Jacamo, die Karten, der Wein, das Verlieren.
Wir sind taktvolle Beobachter, wir kommen nicht jeden Abend, um Maulaffen feilzuhalten, aber doch regelmäßig. Dabei haben wir ihn schon oft in diesem Zustand gesehen, daher glauben wir mit einigem Recht, annehmen zu können, dass es an den Abenden, die wir nicht zugegen waren, nicht anders gewesen ist.
Wir heben die Brauen, und vielleicht schütteln wir den Kopf, doch enthalten uns jeder tadelnden Äußerung. Wer sind wir, den Stab über andere zu brechen?
An diesem Abend jedoch werden wir Zeuge einer Änderung des gewohnten Ablaufs. Heute Abend fallen ihm nach drei Partien die Augen zu, sein Kopf sinkt auf den Tisch, und aus dem Mundwinkel rinnt Speichel auf die Karten unter seiner Wange. Thene würde sich des würdelosen Anblicks schämen, den ihr Gemahl abgibt, aber solche Regungen sind, wie die Lieder ihrer Mutter, längst in ihr erstorben. Dann steht Silver neben ihr und fragt: »Ein Spiel?«
Sie spielen.
Bei der ersten Partie zieht sie überhastet, schaut kaum auf das Brett und verliert. Er stellt seine Frage, die lautet: »Was fürchtet Ihr?«
Sie überlegt lange.
»Die Dinge, die zu tun ich fähig wäre«, antwortet sie. »Die Frau, zu der ich geworden bin.«
Die zweite Partie dauert länger. Der Kampf ist härter, und drei Züge vor seinem unabwendbaren Schachmatt sagt er: »Wahrscheinlich sollte ich aufgeben, aber es wäre schade um die glanzvolle Vollendung eines meisterlich erkämpften Sieges.«
Also spielt er zu Ende, und sie gewinnt und fragt, da sie seinen König umstößt: »Habt Ihr heute Abend meinen Gemahl vergiftet?«
»Ja«, erwidert er. »Wie kommt Ihr darauf?«
»Ich sah Euch neben ihm stehen und zuschauen, wie er spielt. Das habt Ihr vorher nie getan, zu keiner Zeit Interesse an seinem Spiel gezeigt, weil es so erbärmlich ist. Ihr habt gelächelt und gelacht und Euch gebärdet wie einer von ihnen, den Männern mit ihren Karten, obwohl Ihr nicht von ihrer Art seid. Ich kann nur annehmen, dass Ihr eine bestimmte Absicht verfolgt, und nun schläft er, und nichts vermag ihn zu wecken.«
»Er wird leben, fürchte ich. Ich habe einst mit einem Alexandriner gespielt und meine Kenntnis der Herstellung von Schießpulver gegen sein Wissen auf dem Gebiet der Alchemie gesetzt. Dank eines ungeschickten Manövers seiner Pikeniere gelang es mir, die Burg zu erobern.«
»Ihr sprecht in Rätseln.«
»Dann solltet Ihr meine Sprache lernen.«
»Oder Ihr die meine.«
»Aber Ihr begehrt etwas, das ich habe.«
»Und was ist das?«
»Ihr möchtet wissen, was sich hinter der silbernen Tür befindet.«
»Vielleicht will ich das.«
»Seien wir offen miteinander.«
»Dann ja. Ich will es wissen.«
»Gut. Lasst uns spielen.«
Sie spielen.
Kapitel 6
Am nämlichen Tag, an dem die Not sie zwingt, einen Geldverleiher im Getto aufzusuchen, der ihre Mutter kannte und ihr zuflüstert, dass er, weil sie es ist, ihr den Betrag um einen günstigeren Zins als üblich lassen wird, treten die Schlichterinnen des Spielhauses an Thene heran.
An diesem Abend, wie an vielen anderen zuvor, ist der Mann, den wir Silver nennen, nicht anwesend, aber mit neuem Selbstvertrauen wandert sie allein durch den Saal. Sie tritt gegen viele an, verliert auch manchmal, aber weit häufiger verlässt sie den Tisch als Siegerin. Jacamo hat nach seiner Gewohnheit reichlich dem Trunk zugesprochen und schenkt ihr keine Beachtung, so nutzt sie die Gunst der Stunde und hortet, was sie gewinnt; ein Notpfennig für den nicht mehr fernen Tag, an dem er sich und den gesamten Hausstand in einem Fass Malvasia ertränkt.
Anfangs haben sich die anderen aus Mitleid auf ein Spiel mit ihr eingelassen. Und verloren. Danach war es Neugier auf die Gemahlin des Signore Orcelo, die sich um so viel besser auf das Spielen versteht als der Mann, der rechtmäßig ihr Herr und Meister sein sollte. Jetzt aber spielen sie aus dem einzig wahren Grund und auf die einzig wahre Art, denn der Geist des Spielhauses wirkt in ihnen und sie spielen um das Einzige, was zählt – den Sieg. Wir erleben, es gibt welche, die Thene schlagen können, in diesem Spiel, an jenem Tag. Zahlreicher jedoch sind die, die passen müssen und es dessen ungeachtet nicht lassen können, wieder und wieder Revanche zu fordern.
Dann erscheinen die Schlichterinnen.
»Komm mit mir«, sagt eine von ihnen. »Wir haben gesehen, wie du spielst.«
»Wohin gehen wir?«, fragt Thene.
»Du willst die Herrin des Spielhauses kennenlernen.«
Es ist eine Feststellung, keine Frage. Zu fragen ist auch nicht notwendig.
Thene folgt der einladenden Armbewegung zu der Tür von Silver. Wie vielleicht auch sie verhalten wir kurz den Schritt, um die in das Metall getriebenen Bilder zu betrachten. Dargestellt ist der Fall mächtiger Reiche. Das stolze Rom, überrannt von Barbaren aus dem Norden. Das prächtige Konstantinopel, dessen wehklagende Bevölkerung der Osmane von den Mauern stürzt. Die beiden anderen Städte kennt sie nicht, und als die Tür aufgeht, kommt ihr der Gedanke, dass andere Augen in den Motiven vielleicht nicht die Tragik eines Untergangs erkennen, sondern den triumphalen Wechsel der Macht, die Ablösung des Alten durch das Neue.
Die Tür fällt zu, und wir sind allein mit Thene in einem langen Korridor, schier endlos und verhangen mit Seidentüchern wie alte Spinngewebe. Gedämpfte Musik, der Duft von Bienenwachs und weicher Kerzenschein umschmeicheln unsere Sinne.
Einen Augenblick ist ihr bang zumute, aber ein Zurück gibt es nicht. Also geht sie weiter, immer weiter, bis eine zweiflüglige Holztür sich in ein neues Gemach öffnet, einen Saal leiser Stimmen, breiter Diwane und praller Weintrauben in kupfernen Schalen, der Alten, der Jungen, der Schönen und der Fremden. Im unteren Saal hatte sie geglaubt, Menschen aus aller Herren Länder gesehen zu haben, doch wenn sie sich hier umschaut, begegnen ihr Gestalten, die aussehen wie nicht vom Weibe geboren.
Wir könnten ihr verraten, jener dort ist der oberste Geschichtsschreiber am Hofe von Nanjing und diese Frau mit dem eng gebundenen Obi die Witwe eines in der Schlacht gefallenen Samurai. Er, der mit zornigem Blick die in Pelze gekleidete Reiterin aus der mongolischen Steppe misst, ist ein Häuptling der Maori, und ist dies alles, dieses bunte Völkergemisch, nicht ein Hinweis auf die Bestimmung des Hauses? Denn selbst Thene, die nichts von den Kamelhirten des hinteren Orients weiß und nichts von den Kanubauern der südlichen Hemisphäre, muss begreifen, dass diese Menschen in ihrer Welt Fremdlinge sind. Schon ihre Art, sich zu kleiden, ist in Venedig ohne Beispiel. Undenkbar, dass sie durch die Straßen gehen könnten, ohne dass sich die Kunde in Windeseile in der ganzen Stadt verbreitet, und davon abgesehen würde allein die Witterung ihnen zu schaffen machen. Sie, mit dem Kragen aus weißem Pelz, würde in der herbstlichen Schwüle vergehen, wohingegen er, der nur einen Schurz aus Leder um die Leibesmitte trägt – errötend wendet sie den Blick ab –, schutzlos Venedigs kalten Nächten ausgeliefert wäre.
Wie aber, muss Thene sich fragen, sind alle diese Menschen hierhergelangt? Türen in beträchtlicher Anzahl führen herein und hinaus, eine jede von anderer Art. Ist diejenige, durch welche sie eintrat, von klassisch-römischem Stil, so befinden sich gegenüber mit Papier bespannte Rahmen, die hin- und hergeschoben werden, während man ein Stück weiter ein massives Eisengatter sieht, das mit einer Winde zur Seite gezogen werden muss, damit jemand aus dem dunklen Schlund dahinter in das Gemach eintreten kann.
Das alles nimmt sie in sich auf, und Furcht greift nach ihrem Herzen, namenlos und umso größer, weil sie aus der Unkenntnis erwächst. Dann ist eine Schlichterin neben ihr und sagt: »Komm, komm mit mir.«
Sie gehorcht.
Eine kleine schwarze Pforte, winzig im Verhältnis zu den Ausmaßen des Saals, führt zu einer schmalen Treppe in das nächsthöhere Stockwerk.
Am Kopf der Treppe ein fensterloses Gelass.
Sitzpolster liegen auf dem Boden verstreut, und drei Männer warten dort bereits. Zwei von ihnen tragen Masken, den dritten erkennt sie wieder. Er ist ein Spieler aus dem Peristyl wie sie selbst, ihr in etwa ebenbürtig.
Vor ihnen allen saß mit untergeschlagenen Beinen auf einem großen Berg von Kissen eine von Kopf bis Fuß weiß verschleierte Frau, neben ihr stand ein silberner Becher. Wie bei den Schlichterinnen verbarg der Seidenflor das Gesicht, doch der Stoff ihres Gewands war voluminöser und länger geschnitten als die aller anderen, verhüllte es sie doch ganz und gar. Nur an den schmalen Händen, die aus den bauschig herabfallenden Ärmeln lugten, ließ sich ein feingliedriger Bau erahnen, und allein die Stimme verriet ihr Geschlecht, sobald sie zu sprechen anhob.
Lange herrschte Schweigen in dem Raum, bis endlich die verschleierte Frau aus einer Art von Versenkung zu erwachen schien und, indem sie den Kopf hob, folgendermaßen zu ihnen sprach:
»Ihr alle seid auserwählt.«
Sie lässt eine kleine Pause entstehen und scheint diesen Satz zu überdenken, der ihr so leicht über die Lippen kam. Wie oft hat sie die Worte schon gesagt, und wie viele Spieler haben zu ihren Füßen gesessen und sie vernommen? Zu oft, zu viele.
»In diesem Haus gibt es zwei den Fähigkeiten der Spieler entsprechende Ebenen. Die untere Ebene kennt ihr bereits, und für all jene, die damit zufrieden sind, gibt es dort Ruhm und Reichtum zu Genüge zu gewinnen. Doch euch möchte ich einladen, die zweite Stufe zu erklimmen. Hier geht es nicht allein um weltliche Güter. Ihr könnt um Diamanten spielen, falls deren Funkeln euch ergötzt, oder um Rubine oder Fleisch oder Gold oder Sklaven – alles Dinge, nach deren Besitz andere Menschen verlangt. Hier, in den oberen Gemächern, seid ihr jedoch aufgefordert, mehr zu wagen. Hier seid ihr angehalten, etwas von euch selbst einzusetzen.
Eure Redegewandtheit zum Beispiel. Die Liebe zu Farben. Eure Begabung für Mathematik. Eure Scharfsichtigkeit. Euer gutes Gehör. Lebensjahre – auch die könnt ihr einsetzen, wenn es euch beliebt, und jene, die leichtfertig mit ihrem Einsatz sind und das Spiel verlieren, werden vor der Zeit altern. Jene hingegen, die klug sind und gewinnen, können tausend Jahre auf Erden wandeln und werden von Spiel zu Spiel mehr, als sie waren. Da die Einsätze derart hoch sind, überlassen wir die Entscheidung über Gewinn oder Verlust auch nicht dem Glück oder vergeuden sie bei kindischen Geplänkeln um symbolische Figuren. Wenn ihr einen König schlagen wollt, werden wir diesen König benennen und ihr werdet an seinen Hof reisen und ihn bezwingen. Steht euch der Sinn danach, um den Besitz einer Fahne oder eines anderen Siegeszeichens zu wetteifern, wie unsere Knaben es tun, dann seid versichert, es wird die Fahne des mächtigsten Generals im Lande sein. Mit einem Heer, das nach Tausenden zählt, und mit Pulver und Kanonen werdet ihr gegen ihn zu Felde ziehen, um die Beute zu erringen. Wir spielen zum Vergnügen und zur Schulung unseres Verstandes, aber ich sage euch, wir spielen mit lebendigen Menschen und dem Elend und dem Schmerz wie alle anderen Mächtigen auf der Welt.
Ihr mögt einwenden, solches sei unmöglich oder Hexenwerk, aber mitnichten, es ist weder das eine noch das andere, und wärt ihr von derart beschränkter Denkungsart, dass ihr an der Wahrhaftigkeit meiner Worte zweifelt, so hätte man euch nicht hierhergeführt. Sehr viele Menschen haben Kunde von unserem Zirkel und von unserem Haus erhalten, und in dem Bemühen, sich Zutritt zu verschaffen, wurde eine Menge Blut vergossen und viel Vertrauen missbraucht. Erwählt zu werden ist eine Auszeichnung, aber wenn das, was ihr jetzt erfahren habt, euch Angst einflößt, dann geht hin in Frieden und alles bleibt wie es war. Seid euch aber bewusst, dass es keine zweite Einladung geben wird und dass euch verboten ist, mit einem anderen Menschen über das zu sprechen, was ihr gesehen und gehört habt. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme.«
Sie verstummt und wartet.
Niemand erhebt sich, niemand verlässt den Raum.
»Sehr gut«, sagt sie, »ich akzeptiere eure Entscheidung. Doch weil dies das Spielhaus ist, könnt ihr keinen Zugang zu den oberen Gemächern erlangen, ohne eine Bewährungsprobe bestanden zu haben. Ihr seid Kandidaten, die für geeignet befunden wurden, doch nur einer erhält einen Platz in unserem Kreis. Die übrigen werden diesen Ort verlassen und niemals wiederkehren. Ein Spiel wird über den Sieger entscheiden. Bitte, nehmt diese Schatullen.«
Wir schauen zu, als die Schlichterinnen vier silberne Kästchen bringen, eines für jeden der Spieler. Alle vier können es kaum erwarten hineinzuschauen, aber sie halten still und rühren kein Glied, möglicherweise aus Furcht vor ihr, die vor ihnen sitzt.
»Bei dem Spiel«, fährt sie fort, »geht es um Könige. In diesen Kästen befinden sich Spielkarten, von denen ihr nach eurem Belieben Gebrauch machen könnt. Jede Karte steht für eine Person, irgendwo in unserer Stadt, die durch leichtfertige Geschäfte, eine verlorene Wette, hohe Kredite oder fehlgeleiteten Ehrgeiz bei unserem Haus in der Schuld steht. Diese Schuld übertragen wir nun an euch, damit ihr Nutzen daraus zieht. Außerdem findet ihr in den Schatullen das Signalement eures Königs. In nächster Zeit wird im Rat der Zehn der Sitz eines der drei Tribunen vakant. Vier in etwa gleich aussichtsreiche Kandidaten bewerben sich um das Amt. Jedem von euch ist einer dieser Kandidaten zugeteilt worden – euer König. Gewinner ist, wem es gelingt, seinen König auf den Thron zu heben. Auch die Regeln des Spiels findet ihr in dem Kästchen. Jeder, der dagegen verstößt, wird von den Schlichterinnen aufs Härteste bestraft werden, und, Freunde, wiegt euch nicht in der Hoffnung, dass man es nicht bemerken wird. Sie werden es wissen, glaubt mir.«
Damit endet sie, und damit erhebt sie sich und die Spieler tuen desgleichen, und für einen Augenblick stehen alle vier da, still und stumm und warten auf – ja, was?
Stellen wir uns vor, dass sie lächelt, hinter ihrem Schleier, die Herrin des Spielhauses? Glauben wir, einen Unterton von Belustigung in ihrer Stimme zu vernehmen?
Wir wagen nicht zu spekulieren, nicht heute Abend, nicht mit einem Kästchen von Silber in der Hand und der Angst vor dem Unbekannten im Herzen.
Sie geht hinaus und wir ebenfalls, der Raum verblasst wie eine Erinnerung.
Kapitel 7
Wir befinden uns an einem streng gehüteten Rückzugsort.
Thene und ihr Gemahl teilen kein gemeinsames Schlafgemach, und er, der vieles wagt, wagt nicht, diese Kammer zu betreten. Es ist ihre Kammer, unter dem Dach gelegen, wo gewöhnlich die Dienerschaft wohnt, aber sie haben ja kaum noch Dienerschaft. Sie ist nur aufs Notdürftigste eingerichtet, diese Kammer, denn nur unbedeutende Dinge will Thene um sich haben. Wenn diese gestohlen werden, zerstört oder ihr genommen, ist der materielle Verlust gering, und was die Gefühle angeht, die Geschichte und die Zeit, die sie dafür aufgewendet hat … nun ja, lass fahren dahin.
Wir sind kühn, ihr und ich, hier zu sein, unsichtbare Zuschauer. Doch wir mussten kommen, Voyeure der Geschichte eines anderen Menschen, denn hier legt Thene ihr Mieder ab sowie den versteiften Oberrock, löst ihr Haar, entzündet eine neue Kerze am Stummel der niedergebrannten, stellt sie neben ihr Bett und, im Schneidersitz auf den Kissen sitzend wie ein Kind mit einem verbotenen, spannenden Buch, öffnet sie das silberne Kästchen.
Draußen dämmert es, graues Morgenlicht kriecht über die Inseln der Lagune, durch die schlummernden Werkstätten von Murano, über die menschenleere Piazza San Marco, diesen zur Verhöhnung byzantinischen Hochmuts gebauten stolzen Platz, und die stillen Wasser des Canal Grande in Richtung San Polo, wo Thene ihre Schätze betrachtet.
Ein Blatt Papier, worauf die Regeln geschrieben stehen.
Füge den anderen Spielern keinen Schaden zu.
Sieger ist der Spieler, dessen König gekrönt wird.
Das ist alles.
Sie wendet das Blatt einige Male hin und her, dann lacht sie laut, aber die Furcht, man könnte es im Haus hören, lässt sie sogleich wieder verstummen.
Sie schaut in ihren Kasten.
Eine silberne Figur, die Statuette eines Mannes mit bodenlangem Gewand und randloser Kappe. Sein Name ist Angelo Seluda, und das hätte sie auch gewusst, ohne die Gravur am Sockel zu lesen. Jeder kennt die Familie Seluda, die seit fünfundzwanzig Jahren mit den ebenfalls im Viertel Cannaregio ansässigen Bellignos im Zwist liegt.
Die Seludas trugen Blau, die Bellignos trugen Grün. Die Seludas handelten mit Glas, die Bellignos handelten mit Fisch. Genauso wusste jeder, was Auslöser der Fehde gewesen war, allerdings wusste jeder etwas anderes. Einige flüsterten, eine Frau, andere wisperten, ein Schiff. Man munkelte, der Lieblingssohn der Bellignos wäre von einem Kapitän der Seludas an einen Konkurrenten aus Mailand verraten worden. Der Jüngling liebte eine Frau – so gut ein Fant von siebzehn Jahren zu lieben versteht, mit hitziger Leidenschaft, die so schnell erlischt wie eine Kerze im Regen. Aber diese Frau hatte einen Bruder, und der Bruder war eifersüchtig, und vor zwei Jahren verschwand der Jüngling.
Belligno ist zu mächtig, als dass eines der anderen Häuser es wagen könnte, in aller Offenheit ein Mitglied seiner Familie zu ermorden, aber, so scheint es, nicht mächtig genug, um die außerhalb Venedigs weilenden Verwandten zu schützen. Andererseits, wer kann sagen, was sich wirklich zuträgt auf dem Meer und im Krieg? Wir vertrauen nur den Männern im Schatten, denn sie sind diejenigen, die alles hören und nichts glauben, die Gerüchte als Gerüchte weitergeben, und in ihrer Skepsis stolpern sie über eine Wahrheit, und die Wahrheit ist, dass niemand nichts weiß und die Menschen es lieben, eine lange Stunde oder zwei in der Sonne zu stehen und zu schwatzen.
In drei Stunden wird die Kunde sich in der Stadt verbreiten, dass Stephano Barbaro gestorben ist, man wird Wahlen für seinen Nachfolger im Amt des Tribunen anberaumen, und beide, Angelo Seruda und sein Erzrivale Marco Belligno, werden aus dem Bett springen, um sich als Bewerber zu präsentieren.
Woher, fragen wir uns, wusste die Herrin des Spielhauses, dass Barbaro sterben würde? Aber wir fragen uns nicht lange. Hinter den Vorhang schauen zu wollen erscheint uns unklug. Es bringt uns nicht ans Ziel.
Thenes König ist folglich das sechzig Jahre alte Oberhaupt einer Kaufmannsfamilie, Angehöriger des Rates der Zehn. Ihr Bewerber um den Thron. Sie wüsste gern, wen die anderen Spieler als König bekommen haben.
Venedig ist eine Republik, eine Demokratie sogar, sofern man darunter versteht, dass eine große Anzahl reicher und bevorrechtigter Bürger der Stadt den Dogen wählt. Und das wie folgt: Aus dem Großen Rat werden durch das Los dreißig Männer ausgewählt, aus diesen, ebenfalls durch Losentscheid, neun. Diese neun wählen vierzig aus den Reihen des Großen Rates, und diese vierzig werden durch das Los wiederum auf zwölf vermindert. Diese zwölf wählen fünfundzwanzig, von denen neun ausgelost werden, und diese neun wählen sodann fünfundvierzig. Erneut werden Lose gezogen, und übrig bleiben elf, welche die einundvierzig wählen, die schließlich den Dogen küren.
Ist das Demokratie?
Gewiss, natürlich ist es Demokratie. Eine Demokratie der Machenschaften einer kleinen Handvoll großer und mächtiger Männer, die durch Bestechung und Heiratspolitik alle anderen beherrschen. Das Walten des Zufalls ist nicht erwünscht in Venedig, wenn die Lose gezogen werden; Wahlen sind nur sinnvoll, wenn die Wählenden wissen, dass die Stimmen den Richtlinien gemäß abgegeben werden. Aber wer will Doge sein? Eine wertlose, rein repräsentative Stellung, ein Mann mit einem Hut, der in einem goldenen Käfig lebt. Das Tribunale supremo, dort liegt die Macht! Das weiß jeder Venezianer. Auch die Stillen, auch die Frauen.
Ein Brief, unversiegelt. Ein Band mit einem Ring daran fordert sie auf, das Schreiben zu lesen und dann das Siegel aufzudrücken, so es ihr angebracht erscheint.
Sie faltet ihn auf.
Egregio Signore, die Überbringerin dieser Note wird Euch bei Euren Unternehmungen unterstützen. Bitte empfangt sie mit jeder gebotenen Höflichkeit. Eure Freundin.
Sie studiert den Ring, mit dem der Brief gesiegelt werden soll. Er trägt den Kopf eines Löwen mit aufgerissenem Maul, ähnlich dem an der Tür des Spielhauses. Sie siegelt den Brief mit Wachs und legt ihn zur Seite.
Das Kästchen enthält noch weitere Gegenstände. Eine weiße Maske, die im Gegensatz zu vielen für Frauen bestimmte Masken nicht mit einem Knopf zwischen den Zähnen festgehalten werden muss, sodass die Trägerin zum Stillschweigen verurteilt ist. Sie kann sprechen, frei und unbefangen, denn niemand kennt sie hinter der Maske.
Tarotkarten. Der Narr. Die Drei der Münzen. Der Ritter der Schwerter. Die Königin der Kelche. Die Sieben der Stäbe. Der Turm. Die Hohepriesterin. Der König der Münzen. Auf der Rückseite jeder Karte stehen ein Name und eine Wohnstatt.
Ein Schuldschein über fünftausend Dukaten.
Eine einzelne Goldmünze. Das aufgeprägte Gesicht ist ihr unbekannt, die Beschriftung Latein. Wir erkennen – und ob wir sie erkennen! – eine Münze des alten Rom, ohne begleitende Notiz, ohne Erklärung. Was ist ihr Sinn und Zweck? Vielleicht wird es sich im Verlauf des Spiels herausstellen? Spiele haben, anders als das Leben, eine Struktur, ein Muster, eine Ordnung, die entschlüsselt werden kann. Beginne das Spiel, und alle Geheimnisse werden offenbar.
Sie legt die Münze zurück in das Kästchen, schließt den Deckel, bläst die Kerze aus und schläft.
Kapitel 8
Sie legte eintausend Dukaten auf den Tisch.
Jacamo di Orcelo starrt auf den geöffneten Beutel, in dem es golden glänzt. Welche Bilder ziehen an seinem inneren Auge vorüber? Schiffe? Truhen voller Tuche, Tonnen mit Fisch, kostbare Gewürze aus dem Osten, Sklaven, Getreide? Oder sieht er nur Weinfässer in seine Vorratskammer rollen?
Eine Weile stehen sie dort, Ehemann und Ehefrau, zwischen ihnen das Gold, und allein ihre Gesichter sprechen. Auf ihnen malen sich die Anklagen, die Vorwürfe, die Wut und der Schmerz, all das, was ihre Stimmen nicht den Mut haben auszusprechen, bis zu guter Letzt Thene das Schweigen bricht:
»Ich werde mich drei Monate in ein Kloster zurückziehen, um zu beten. Du wirst alle Dinge des Haushalts geordnet finden. Leb wohl.«
Da schreit er, Hure, Dirne, Luder, wo hast du das Gold her, wo gibt es mehr davon, und will ihre Haare packen, aber sie schlägt ihn. Es ist nicht die Ohrfeige einer Dame des Hauses Orcelo, nein, sie selbst ist es, der Jüdin Tochter, die da zuschlägt, ihm mitten ins Gesicht, und als er zurückprallt, mit blutiger Nase, fasst sie sich und sagt, wenn du mehr Gold willst, musst du bis zu meiner Rückkehr warten.
Er sitzt mit gespreizten Beinen auf dem Boden und ist einen Moment lang zu erschüttert, um sich zu bewegen. Dann bricht sich der kleine Junge in ihm Bahn, und er weint und kriecht auf dem Bauch zu ihr hin und küsst ihren Schuh und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, geh nicht, ich liebe dich, wo ist das Geld, ich liebe dich.
Sie wendet sich ab.
Kapitel 9
Das Haus von Angelo Seluda liegt an einem Kanal. Das Erdgeschoss ist der traditionellen Bauweise entsprechend Warenlager und Kontor. Im mittleren Stockwerk befinden sich die Wohn- und Gesellschaftsräume, und unter dem Dach hausen die Dienstboten und Arbeiter, sich demütig der Ehre bewusst, für einen derart bedeutenden Handelsherrn arbeiten zu dürfen. Das Haus hat seinen eigenen Brunnen, das sicherste Zeichen für die herausragende Stellung seines Besitzers, und die Ornamente über den Fenstern, die fein ausgeführten Mauerfriese, muten byzantinisch an, was für den Stammsitz eines alten Geschlechts spricht.
Thene betrachtet es vom städtischen Ende seiner privaten Brücke aus und sieht die Karyatiden, die den Eingang bewachen; in dem Bogenfeld über dem Portal stehen Venus und Ares Hand in Hand. Sie fühlt eine Katze um ihre Beine streichen – die Neugier des Menschen hat die Neugier des Tieres erregt –, hört das Plätschern eines Ruders im Wasser und denkt an einen weiteren Bittsteller, der den Kanal heraufkommt, um vor Angelo Seluda einen Kotau zu machen.
Sie hat Angst, aber sie hat sich schon zu weit vorgewagt.
Sie biegt und streckt die verkrampften Finger in den grauen Handschuhen und ertappt sich dabei, dass sie eine Melodie summt, eine alte Weise, von der sie glaubte, sie vergessen zu haben. Sie trägt die Maske aus dem Silberkästchen, und am Eingang des Hauses hält man sie an und fragt nach ihrem Begehr. Sie gibt Auskunft, was dazu führt, dass sich der Ausdruck von Verwunderung und Misstrauen auf den Gesichtern der mit Knüppeln bewaffneten Burschen, die ihr den Weg verstellen, noch vertieft.
»Mein Empfehlungsschreiben«, sagt sie und reicht ihnen das gesiegelte Dokument. »Ich kann warten.«
Sie wartet vor dem Portal. Fünf, zehn, zwanzig Minuten, und während sie dort steht, sehen wir nicht ein einziges Mal, dass sie die Füße bewegt, den Rücken beugt, an den Handschuhen nestelt. Ares und Venus schwitzen im Angesicht ihrer gesammelten Ruhe.
Einer der Halbwüchsigen kommt wieder, respektvoller jetzt, und sagt zu ihr: »Bitte tretet ein.«
Sie folgt ihm ins Innere des Hauses.
Die sich hinter ihr schließende Tür entzieht sich unseren Blicken.
Kapitel 10
Bruchstücke einer Unterhaltung aus einem offenen Fenster im ersten Stock.
Er ist Angelo Seluda und wir haben ihn bereits früher in den Straßen Venedigs beobachtet: auf dem Weg zur Messe, bei Verhandlungen mit Kaufleuten, deren Schiff mit Handelsware eben am Zollkai festgemacht hatte, wie er Bauholz und für den Export bestimmtes Glas inspiziert, sahen ihn im Bussolo im Dogenpalast Beschwerden einreichen und durch einen Türspalt seine Konkurrenten belauschen.
Seine Familie hat vor langer Zeit einen speziellen Sand entdeckt oder einen geheimen Farbstoff oder eine mystische Tinktur – wie alles in Venedig, sind die Einzelheiten unklar – und machte Glas zu ihrem hauptsächlichen Geschäftszweig. Kriegszeiten waren in der Regel magere Zeiten für das Haus Seluda, doch jedem Krieg folgt das große Aufatmen des Friedens, und, viel wichtiger, zahlreiche zerbrochene Fenster müssen ersetzt werden. Auf Murano ist sein Wort mehr wert als Gold, und auf den kleinen Inseln, die sich am Rand der Lagune entlangziehen, wo zwanzig, höchstens dreißig Männer wohnen und arbeiten, ist Angelo Seluda Heilsbringer und ungekrönter König. Allzu lange schon betätigt er sich im Senat und strebt danach, in höhere Ämter aufzusteigen, doch zu seinem Leidwesen bisher vergebens. Er war stets ein wenig zu reich, als dass sich keine Neider gefunden hätten, die ihm Steine in den Weg legten, aber wiederum nie reich genug, um sich den Weg aus diesem Dilemma zu erkaufen.
Sein Haupthaar ist grau, der Bart lang, und er trägt, wie alle anderen, die hoch an Jahren und mächtig sind, selbst im Sommer ein bis zu den Knöcheln reichendes Gewand, eine goldene Kette um den Hals und auf dem Kopf eine purpurne Mütze. Sein wertvollster Besitz ist eine nach dem Vorbild des goldenen Vlieses gestaltete Brosche, die ihm, so heißt es, für geleistete Dienste in einem lange zurückliegenden, längst vergessenen Krieg gegen die Türken von einem spanischen König verliehen wurde.
Oder er hat sie einfach aus zweiter Hand erworben. Zuzutrauen wäre es einem Mann wie Seluda.
»Ich habe keine Frau erwartet«, sagt er.
»Gleichwohl …«
»Beherrscht Ihr das Spiel?«
»Man hätte mich nicht geschickt, wenn es anders wäre.«
»Die Vorstellung, mein Schicksal in die Hand einer Frau zu legen, behagt mir nicht. Das Spielhaus hat mir Unterstützung zugesichert, als Entschädigung für einige … Gefälligkeiten. Als ich den Bedingungen zustimmte, habe ich mehr erwartet.«
»Ihr werdet feststellen, dass ich der Aufgabe durchaus gewachsen bin.«
»Würdet Ihr mir wenigstens Euer Gesicht zeigen?«
»Nein.«
»Oder Euren Namen nennen?«
»Auch das nicht.«
»Ich kämpfe darum, in das Tribunale Supremo gewählt zu werden. Falls mir das gelingt, gebiete ich über den Rat der Vierzig, wenn auch nicht dem Namen nach, aber was ist ein Name, wenn ich so viel Macht in meiner Hand vereine? Mit dem Rat der Vierzig als willfährigem Werkzeug gebiete ich über eine größere Machtfülle als jeder Doge. Ich weiß, welcher Lohn mir winkt und was ich unter Umständen verliere. Wie steht es bei Euch?«
»Ich gewinne das Spiel.«
»Dies ist kein Spiel.«
»Glaubt Ihr? Es gibt Regeln, Grenzen, Einschränkungen, nach denen Ihr Euch bei Euren Handlungen richten müsst. Klar umrissene Ziele, Mittel und Wege, um diese zu erreichen. Der einzige Unterschied zwischen den Ereignissen, die jetzt ihren Lauf nehmen, und irgendeinem anderen Spiel ist die Größe des Bretts.«
»Spiele sollten der Kurzweil dienen.«
»Kurzweil und Ernsthaftigkeit müssen keine unvereinbaren Gegensätze sein. Schach zu spielen bereitet uns Vergnügen, und doch betreiben wir es mit Überlegung und dem Bestreben zu gewinnen. Ihr wagt einen hohen Einsatz: Eure Ehre, Euren Ruf, Euer Vermögen, das Wohl Eurer Familie, Euer Geschäft, Eure Dienerschaft, Eure Zukunft. Das ist eine Belastung, die das Denken beeinflusst und dazu führen kann, dass man nicht immer die klügste Entscheidung trifft. Ich möchte behaupten, dass die Unterstützung und die Möglichkeiten einer außenstehenden Person, wie ich es bin, Euch von Nutzen sein werden.«
Seluda schweigt für die Dauer einiger Atemzüge. Dann:
»Was benötigt Ihr?«
Kapitel 11
Sie zieht in eine Kammer unter dem Dach des Hauses Seluda.
Die Maske nimmt sie nicht mehr ab, außer in den seltenen, sehr seltenen Momenten, wenn sie sich dort allein weiß, hoch über den Wassern der Stadt.
Von Seluda verlangt sie Tinte, Feder und Papier.
Für alles andere sorgt sie selbst.
Ein Diener Seludas wird zum Palazzo Ducale geschickt, er soll sich umhören und nicht wiederkommen, ehe er nicht in Erfahrung gebracht hat, wer sich sonst noch zur Wahl stellen will. Mit insgesamt sieben Namen kehrt der Mann zurück.
Thene studiert sie und durchforscht ihr Gedächtnis nach Erinnerungen, nach Gesichtern. Alle Kandidaten sind Abkömmlinge alter Familien, man sieht sie zur Messe schreiten, kennt die Geschichten, die Halbwahrheiten, die Gerüchte, die über sie im Umlauf sind. Welche von diesen sieben sind ernst zu nehmende Rivalen, haben etwas zu gewinnen? Um vier Namen, Seludas eingeschlossen, zeichnet sie einen Kreis, aber noch ist alles unbestimmt, unentschieden. Über jede Partei gilt es Informationen zu sammeln, um ihre Absichten und Möglichkeiten einschätzen zu können, denn auch ein schwacher Kandidat, der kaum Chancen zu haben scheint, kann durch seine Umtriebe ihre Kreise stören.
Sie nimmt als selbstverständlich an, dass Belligno sich zur Wahl stellen wird, und tatsächlich dringt sein Name als erster an ihr Ohr. Ob er wirklich daran interessiert ist, die Nachfolge Barbaros anzutreten oder nur aus dem Grund kandidiert, da auch Seluda es tut, weiß sie nicht. Aber sie bezahlt einen Bettler und dessen Tochter, damit sie Belligno bespitzeln und berichten, mit wem er sich trifft und was in der Stadt über ihn geredet wird. Zwei Tage lang folgen die beiden ihm auf Schritt und Tritt, und am Ende des zweiten Tages gibt es immer noch keinen Hinweis darauf, dass Belligno von der Hand eines Spielers gelenkt wird.
Sie wendet sich Faliere zu. Ein Mann, jovial, stets heiter, von dem es heißt, er habe mit eigener Hand das Gift gemischt, das bei einem Fest vor sieben Jahren drei seiner Gäste tötete, auch wenn es natürlich auch an verdorbenem Fisch gelegen haben könnte oder einem nicht mehr ganz frischen Ei. Soll man glauben, dass ein Mann mit derart strahlendem Lächeln, der all seinen Mitmenschen mit solch überschäumender Herzlichkeit begegnet, ein Giftmischer ist? Andererseits … Vielleicht hat er gelacht, als er den Trunk bereitete? Vielleicht hat er, wie ein Kind, das Sandkuchen backt, vergnügt gegluckst, als er Belladonna in den Wein seiner Feinde träufelte und sich an der Vorstellung ergötzt, wie ihre Augen groß werden, ihr Herz rast, ihr Verstand sich trübt und sie beginnen, wirr daherzureden. Vielleicht belustigten ihn diese Bilder, während er ihnen die Becher reichte, sodass er sich vor Entzücken kaum zu halten wusste. Seine Gäste aber glauben, das Strahlen läge an ihnen, und dass ihre Gesellschaft und munteres Geplauder ihm solche Freude bereiten, und so preisen sie ihn als den besten aller Gastgeber.
Oder er hat nie jemanden vergiftet, weiß aber, dass es von Vorteil ist, sowohl geliebt als auch gefürchtet zu werden. Deshalb lacht er und zeigt sich großzügig gegenüber seinen Freunden und duldet, dass man ihm nachsagt, seine Feinde neigten dazu, eines unterwarteten Todes zu sterben.
Paolo Tiapolo und Andrea Contarini sind nicht nur beides starke Kandidaten, sondern dreist genug, gemeinsam die Messe zu besuchen. Thene sitzt auf einer der hinteren Bänke im Kirchenraum und beobachtet die beiden Männer, der eine links, der andere rechts des Mittelgangs. Sie begrüßen einander lächelnd, umarmen sich als alte Freunde. »Paolo, Paolo, wie schön, dich zu sehen.« »Andrea, deine Frau ist eine Augenweide, und wie ich höre, geht es euch gut?« Und kaum hat der andere den Rücken gekehrt, beugt man sich zu seiner eigenen Gemahlin und den heimlichen Helfern herab und flüstert: »Da geht er hin, der Hundsfott, behaltet ihn im Auge, er ist eine Natter …«
Tiapolo hat drei Töchter, die er entgegen den Gepflogenheiten über das heiratsfähige Alter hinaus jungfräulich und ledig bei sich im Haus behält. Die älteste nähert sich ihrem vierundzwanzigsten Geburtstag, und die Leute beginnen sich zu fragen, ob der Schoß der alten Jungfer überhaupt noch fruchtbar ist. Aber jetzt! Oh, jetzt, Tiapolo, schlau, sehr schlau, jetzt verstehen wir. Du hast darauf gewartet, dass Barbaro stirbt und auf den Zeitpunkt, an dem du mit deinen Pfunden wuchern kannst, um mittels wohlbedachter Heirat Bündnisse zu schließen. Hochachtung, Tiapolo, vor deiner Weitsicht. Klug hast du gespielt, noch ehe das Spiel begann.
Und Contarini? Er besitzt Steinbrüche sowohl an der hiesigen als auch an der jenseitigen Küste des Mittelmeers, sein Geschäft sind Mörtel, Steine, Ziegel, Lehm und alle geschickten Handwerker, die sich auf den Umgang mit den vorgenannten Materialien verstehen. Seine Kinder sind seit Langem verheiratet – mit Fuhrunternehmern und Marmorhändlern, weshalb in der Stadt fast nichts gebaut werden kann, ohne dass irgendwo das Zeichen der Contarini prangt. Einfältige Zeitgenossen verwechseln den Meister mit seinem Gewerbe, nennen Contarini Steinkopf und spotten, sein Geist wäre so stumpf und schwer wie die Platten eines Sarkophags. Doch wie geschwind sie die Tonart wechseln, diese Spötter, wenn es darum geht, dass ein weiteres Stockwerk auf ihr Haus gesetzt werden soll oder an der Innenverkleidung ihres Brunnens Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden müssen! Wie sie dann zu ihm eilen, unserem Meister Steinkopf, und über seine Scherze lachen, die, man kann es nicht leugnen, ausnehmend schlicht sind und erstaunlich derb. Sie lachen und hoffen, die Kunden, dass sich die gemeinsame Heiterkeit in einem Freundschaftspreis niederschlägt.
Diese beiden – der leutselige Tiapolo und der steife Contarini – sind erbitterte Kontrahenten, jeder nach seiner Façon. Thene sieht, wie sie vor dem Klerus dienern, und fragt sich, was sie wohl von ihrem – Thenes – König halten oder ob sie überhaupt mit ihm rechnen.
Ein Aufleuchten von Farbe in der Kirche, ein aus den Augenwinkeln wahrgenommenes Lächeln. Sie sieht hin, schaut dann genauer, erstaunt über das, was sie sieht! Gebauschte Ärmel, türkisblau, silberne und goldene Ringe, vertraute Züge, die Haltung, das Gehabe bekannt. Wer immer Tiapolo als Spieler führen soll, gibt sich keine Mühe, sein Inkognito zu wahren. Er sitzt, stolz wie Jupiter, auf dem Platz genau hinter seiner Figur, seinem Trumpf, seinem König – wie immer man diese Möchtegernmachthaber nennen möchte. In der Kirche trägt er keine Maske, es wäre eine Beleidigung Gottes und der Diener Gottes, die dort versammelt sind. Kaum tritt man aber nach der Messe auf den Vorplatz, hat er sie schon aufgesetzt, sein Abzeichen von Macht und Würde. Nicht er selbst verbirgt sich hinter dem eingeprägten Lächeln und den goldumrandeten Augenöffnungen. Nein, es ist der, der er sein möchte, der große Mann, der Spieler, den er statt seines eigenen Gesichts trägt, der Lenker der Geschicke, Meister des Spiels.
Sie mustert ihn, dann mustert sie Tiapolo. Sie fürchtet den, der gespielt wird, mehr als den Spieler.
Nach dem Besuch der Messe entschwindet Contarini in seiner privaten Gondel, und danach kann Thene ihn zwei volle Tage lang nicht finden. Er hat sein Haus verlassen, er hält sich versteckt, aber man betrachte das nicht als Zeichen der Schwäche. Wenn er aufgefordert ist, im Dogenpalast zu erscheinen, ist er da, schüttelt Hände, und wenn er wieder geht, erwarten ihn zwei Gondeln, deren eine nach links davonrudert, die andere nach rechts. In jeder sitzt eine verhüllte Gestalt, und niemand kann sagen, welcher tatsächlich Contarini ist. Der Steinkopf fürchtet den Dolch eines Meuchelmörders, und möglicherweise gibt uns seine Furcht Aufschluss darüber, mit welchen Mitteln er seine Mitbewerber mattzusetzen gedenkt. Thene verzichtet darauf, einer der Gondeln zu folgen. Meuchelmörder sind grobe Werkzeuge und sollten erst zum Einsatz kommen, wenn die Situation auf dem Brett übersichtlicher geworden ist. Contarini kann warten.
Abends stellt sie die Figuren in einer Reihe vor sich auf den Tisch. Faliere, Tiapolo, Contarini, Seluda. Sinnieren auch die anderen Spieler über Taktik und Strategie, wie sie es tut? Sitzen sie allein bei einer einzigen, halb heruntergebrannten Kerze und wägen in Gedanken ihre Freunde, ihre Feinde?
Aha, jetzt begreifen wir! Drei namenlose Gegenspieler, verstreut im nächtlichen Venedig. Er, der so von sich eingenommen ist, so stolz auf seine Findigkeit und seine Macht, so zufrieden mit seinem Spiel, so erhaben über gewöhnliche Menschen – er trinkt mit Tiapolo an der erhöhten Tafel und wird betrunken ins Bett fallen und spät erwachen. Wird dann frech herumerzählen, er habe Tiapolos Frau verführt, wissend, dass niemand an seinen Worten zweifeln wird, weil, so glaubt er, man ihn fürchtet.
Und er, der für Contarini spielt – oder mit Contarini, je nachdem –, beobachtet von Ferne das Haus Seludas, wo Thene gerade jetzt sitzt. Er weiß, diesen Gegner darf er nicht unterschätzen, und er wird erst wieder froh sein, wenn er ihn schachmatt gesetzt hat. Er fühlt das Gewicht des Silberkästchens, das man ihm im Spielhaus gegeben hat und denkt an die mächtigen Hilfsmittel, die es enthält, und fragt sich, ob später zu spät ist für die Eröffnung des Spiels.
Und der Vierte im Bunde?
Nun, wie Thene sitzt er allein im Halbdunkel und plant seinen nächsten Zug.
Faliere, Tiapolo. Contarini, Seluda.
Und dahinter eine Frage. Warum nicht Belligno? Warum ist nicht er ihr König in diesem Spiel der Macht und Politik? Er kann vielleicht sogar mit größerem Recht Anspruch auf den Sitz im Tribunal erheben, warum also schweigt er? Und muss man ihn als Bedrohung betrachten, obwohl er weder spielt noch gespielt wird?
Fragen zu nächtlicher Stunde. Überlassen wir Thene diesen unbequemen Bettgenossen.
Kapitel 12
Nehmen wir eine der Spielkarten und betrachten sie.
Sie zeigt auf der Vorderseite die Sieben der Stäbe, aber für wen steht sie?
Für einen Mann, der sich mit den Ellenbogen nach oben gearbeitet hat und fest entschlossen ist, sich von dort nicht verdrängen zu lassen? Einen Staatsdiener von mittlerer Bedeutung, jemand zwischen König und Bauer? Sie bezeichnet wohl eher Alvise Muna, der mit siebenundfünfzig Jahren länger lebt als die meisten, die im Dogenpalast Dienst tun, und von dem man, obschon er seit Jahrzehnten durch diese Räume wandelt und Zeuge geheimer Beratungen und Gespräche zu mitternächtlicher Stunde ist, den Eindruck hat, dass er nicht höher aufsteigen wird. Von dem man glauben muss, dass er immer das bleiben wird, was er ist, ein Kanzleibeamter: verlässlich, gerne die Hand aufhaltend, aber niemals unbescheiden in seinen Forderungen – was in Venedig das Beste ist, das man einem Menschen nachsagen kann. Allem Anschein nach hat er seinen Platz auf der Sprossenleiter gefunden und verlangt nicht mehr.
Thene passt ihn auf der Piazza San Marco ab. Er ist allein unterwegs, unter dem Arm zusammengerollte Schriftstücke, eine Samtkappe auf dem ergrauten Kopf, den Blick zu Boden gerichtet. An seinem Kinn prangt eine große Warze, vollkommen farblos, fast heller als die Haut, aus der sie sprießt. Als Thene ihm in den Weg tritt, will er ausweichen, ohne den Blick zu heben, weil es wieder nur jemand sein kann, der ein Anliegen hat, um das er sich kümmern soll, und er kümmert sich lieber in der Abgeschiedenheit seiner Kanzlei als in Gegenwart des betreffenden Menschen.
»Signore Muna«, sagt sie, und als er seinen Namen hört, wendet er den Kopf und verlangsamt seinen Schritt. »Ich bin im Besitz Eurer Karte.«
Jetzt bleibt er stehen, jetzt schaut er sich nach allen Seiten um, jetzt fasst er nach ihrem Arm und flüstert: »Nicht hier!«
Sie betreten getrennt die Basilika. Er versenkt sich eine Weile ins Gebet, sie tut es ihm gleich. Allerdings kniet er vorn im Mittelgang und sie sitzt hinter ihm in einer Bank, unter Gold und den Augen des Gottessohnes. Dieser Ort verstärkt die Stille mehr als das Geräusch, denn jedes Flüstern prallt gegen Mauern, die Stille aber wächst und wächst in Räume jenseits des Irdischen. Endlich erhebt sich Muna, und sie stehen zusammen unter dem Bildnis von Johannes dem Täufer. Ein Lamm zu Füßen, in der Hand ein Buch, schaut er sorgenvoll auf die Torheiten der Menschenkinder.
»Ich bin etliche Gefallen schuldig«, sagt er halblaut, »einige Personen haben Forderungen an mich. Eine Frau ganz in Weiß hat mir die Möglichkeit geboten, mich aller Verpflichtungen auf einen Schlag zu entledigen. Sie hat mir angekündigt, dass Ihr eines Tages vor mir stehen werdet.«
»Verpflichtungen welcher Art?«
»Das ist allein meine Sache. Wenn das Spiel zu Ende ist, sind sie vergessen.«
»Ihr bekleidet eine verantwortliche Stellung in der Dogenkanzlei?«