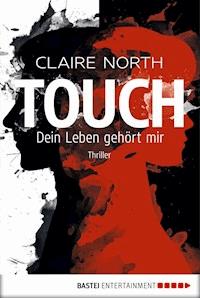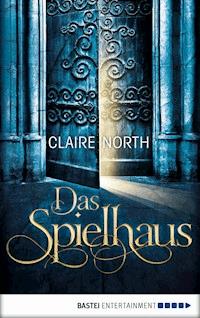3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Spielhaus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Werde Zeuge eines unglaublichen Spiels um Macht und Einfluss!
Venedig in der Renaissance: Die junge Thene führt eine unglückliche, arrangierte Ehe. Doch im Spielhaus erweist sie sich als geschickte Spielerin. Bald wird sie in ein ebenso reizvolles wie grausames Ränkespiel verwickelt: Die Spielfiguren sind echte Menschen, und es geht auf Leben und Tod.
DER SPIELHAUS-ZYKLUS
Das Spielhaus existiert jenseits von Raum und Zeit. Eingeweihte spielen hier um die wirklich interessanten Gewinne: die Macht über ganze Reiche, Einfluss, sogar Lebensjahre. Legendäre Spieler können so den Jahrhunderten trotzen. Doch je höher der Einsatz, desto tödlicher die Regeln ...
In drei Novellen entführt Claire North uns in die faszinierende, Kontinente und Jahrhunderte umspannende Welt des Spielhauses. Jetzt als eBook bei Bastei Entertainment!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44LeseprobeÜber dieses Buch
Venedig im 16. Jahrhundert: Die unscheinbare junge Thene wird von ihrem Mann, mit dem sie eine unglückliche, arrangierte Ehe führt, in das so genannte »Spielhaus« mitgenommen. Während ihr Mann immer wieder verliert, tut sie sich durch ihr intelligentes, aufmerksames Spiel hervor. Und schließlich wird sie in die Oberen Gemächer eingeladen, die höhere Spielklasse, in der es um die wirklich spannenden Einsätze geht.
Doch vorher muss sie sich gegen drei andere Spieler durchsetzen: In nächster Zeit wird im Rat von Venedig der Sitz eines Tribuns vakant. Jedem Spieler – auch Thene – wird einer der Kandidaten zugeteilt – ihr König. Gewinner wird derjenige sein, dem es gelingt, seinen König auf den Thron zu heben. Dies ist der Anfang einer Reihe von Ränken und Intrigen, die die Spieler gegeneinander schmieden. Und Thene wird lernen, dass das Spiel in dieser Liga tödlich sein kann …
Über den Novellenzyklus
Das Spielhaus existiert jenseits von Raum und Zeit. Eingeweihte spielen hier um die wirklich interessanten Gewinne: die Macht über ganze Reiche, Einfluss – sogar Lebensjahre, Charaktereigenschaften und Erinnerungen können eingesetzt werden. Legendäre Spieler können auf diese Weise den Jahrhunderten trotzen. Doch je höher der Einsatz, desto tödlicher die Regeln …
In drei Novellen entwirft Claire North die faszinierende Welt des Spielhauses und verfolgt den Weg der großen Spieler über viele Kontinente und Jahrhunderte.
Über die Autorin
Claire North, geboren 1986, ist das Pseudonym der britischen Autorin Catherine Webb, die bereits seit ihrem vierzehnten Lebensjahr Romane schreibt. Seitdem hat sie viele Fantasy-Romane veröffentlicht. Sie lebt in London, ist Beleuchterin am Theater und liebt große Städte, urbanen Zauber und Thai-Essen.
Claire North
DIE INTRIGE VON VENEDIG
Das Spielhaus Erste Novelle
Aus dem Englischen von Eva Bauche-Eppers
BASTEI ENTERTAINMENT
Deutsche Erstausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Serpent«
Copyright © Claire North 2015
First published in Great Britain in 2015 by Orbit, an imprint of Little, Brown Book Group
Textredaktion: Dr. Frank Weinreich
Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Covergestaltung: © Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von shutterstock/Unholy Vault Designs und thinkstock/Василий Охрименко
E-Book-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3361-9
Dieses E-Book enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »Touch – Dein Leben gehört mir« von Claire North.
Titel der Originalausgabe: »Touch«
Copyright © 2015 by Claire North
First published in Great Britain in 2015 by Orbit, an imprint of Little, Brown Book Group
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Übersetzung: Eva Bauche-Eppers
Redaktion: Hanka Jobke, Berlin
Covergestaltung: www.buerosued.de unter Verwendung von Motiven © © getty-images/Jose Torralbai © Plainpicture/ Philipe Lesprit
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Fort ist sie, sie ist fortgegangen.
Die Münze dreht sich im Fluge, dreht sich um und um, und sie, die ich liebte, ist fort.
Kapitel 2
Kommt. Wir wollen hineingehen und zuschauen, gemeinsam, ihr und ich.
Wir teilen den Vorhang von Zeit und Raum und treten ein, treten auf, inszenieren unser Erscheinen: Sehet, wir sind da, wir sind gekommen. Möge die Musik verstummen, mögen die Wissenden das Gesicht abwenden bei unserem Nahen. Wir sind die Schlichterinnen dieses kleinen Kreises, wir haben das letzte Wort, sind nicht Spieler und doch Teil des Spiels, gefangen vom Weg der Figuren auf dem Brett, dem Flüstern der Karten, dem Rollen der Würfel. Wähntet ihr euch darüber erhaben? Dünkt ihr euch, mehr zu sein im Auge des Spielers? Schmeichelt ihr euch, nicht der zu sein, der gelenkt wird, sondern der, der lenkt?
Wie einfältig wir geworden sind.
N
Nehmen wir einen Ort und nennen ihn Venedig. Nehmen wir eine Zeit und sagen, es ist 1610 AD, sechs Jahre nachdem der Papst wieder einmal die Signorissima der Unbotmäßigkeit geziehen und von allen Segnungen der Heiligen Mutter Kirche ausgeschlossen hat. Und was bedeutete es den Einwohnern der Stadt, dieses päpstliche Interdikt? Nun, es war ihnen nicht mehr als ein Stück Pergament mit einem wächsernen Siegel daran. Kein Bischof in Rom konnte diese nicht auf Sand, sondern auf festem Holz erbaute Stadt erschüttern. Doch über ein Weilchen werden die schwarzen Ratten kommen, sie kommen mit Flöhen und der Pest und dann wird die Stadt ihren Hochmut bereuen.
N
Aber wir greifen vor. Für uns im Spielhaus zieht sich die Zeit wie Teig beim Kneten, Stränge entstehen und reißen ab, aber wir bleiben und das Spiel geht weiter.
Sie soll Thene heißen.
Zum Ende des 16. Jahrhunderts kam sie als Tochter eines Tuchhändlers zur Welt. Ihr Vater kaufte von den Ägyptern und verkaufte an die Holländer und war darüber ein vermögender Mann geworden. Ihre Mutter war eine Jüdin, die aus Liebe geheiratet hatte, und von Kindesbeinen an gab der Vater seinem Töchterchen Schweinefleisch zu essen und ließ sie schwören, dieses Verderben bringende Geheimnis unter keinen Umständen jemals den Mächtigen der Stadt zu offenbaren.
»Was werde ich sein, wenn ich alt bin?«, fragte sie ihren Vater. »Kann ich dann die Tochter meiner Mutter sein und deine?«
Worauf ihr Vater erwiderte: »Weder noch. Ich weiß nicht, was dir bestimmt ist, aber du wirst ganz du selber sein und das ist genug.«
Später, nachdem die Mutter gestorben war, erinnert ihr Vater sich dieser Worte und er weint. Sein Bruder, welcher die Ehe mit der Jüdin von Anfang an missbilligte und dem das Kind als Symbol der Familienschande verhasst ist, wandert gereizt auf und ab und fährt ihn an:
»Hör auf zu flennen! Sei ein Mann! Ich schäme mich deiner, wenn ich dich ansehe!«
N
Sie, die Tochter, acht Jahre alt, beobachtet diese Szene durch einen Türspalt und schwört sich mit geballten Fäusten und brennenden Augen, dass man sie niemals wieder weinen sehen wird.
Einige Jahre später verkündet man Thene, gekleidet in Blau und Grau, mit Handschuhen aus feinem Leder und um den Hals ein silbernes Kruzifix, dass sie heiraten wird.
Ihr Vater sitzt stumm und beschämt daneben, während ihr Oheim die Bedingungen des Ehevertrags herunterrasselt.
Ihre Mitgift ist größer als ihr Name und hat ihr Don Jacamo di Orcelo gekauft, aus alter Familie, jüngst verarmt.
»Er ist angemessen, eine exzellente Partie, bedenkt man deine unrühmliche Abkunft«, erklärt der Oheim. Thenes Hände ruhen locker geöffnet in ihrem Schoß. Dass sie bloß so bleiben; nicht zu dulden, dass sich die Finger ineinanderkrallen, erfordert all ihre Willenskraft. Thene, nunmehr fünfzehn Jahre alt, hat seit sieben Jahren nicht mehr geweint und wird es auch jetzt nicht tun.
»Ist das Euer Wunsch?«, fragt sie ihren Vater. Er wendet das Gesicht ab.
Am Abend vor ihrem Hochzeitstag setzt sie sich mit ihm vor den Kamin, ergreift seine Hand und spricht zu ihm: »Ihr bedürft meiner Vergebung nicht, denn Ihr habt nichts Unrechtes getan. Da Ihr sie aber ersehnt, wisset, ich vergebe Euch, von ganzem Herzen, und wenn ich fort bin, werde ich stets nur mit Liebe an Euch denken, mit nichts als großer Liebe.«
Zum ersten Mal seit ihre Mutter gestorben ist, weint er wieder, doch ihre Augen bleiben trocken.
Jacamo di Orcelo war kein guter Ehemann.
Um der erklecklichen Mitgift willen gelobte der achtunddreißig Jahre alte Spross einer Familie mit klingendem Namen, doch ohne klingende Münze, dass er den Spott seiner Standesgenossen ertragen würde, die über seine weniger als halb so alte Braut lachten, sich über die Kaufmannstochter mokierten und munkelten, unter ihren Röcken sei nur Stoff und nochmals Stoff zu finden und nichts von den geheimen Stätten des Weibes, an welchen ein Mann sein Wohlgefallen hat.
In ihrer ersten gemeinsamen Nacht hielt sie seine Hände, wie sie es als Kind bei ihrer Mutter gesehen hatte, und strich ihm das Haar aus dem Gesicht, doch er sagte, das wäre weibische Torheit, und drückte sie nieder.
Von seiner betagten Mutter erfuhr sie, sein Lieblingsessen seien frische Garnelen, über dem offenen Feuer gegart, akkurat so und so gewürzt; eine Prise von diesem, eine Messerspitze von jenem. Sie lernte die Geheimnisse dieses Gerichts und bereitete es für ihn zu. Er verzehrte die Speise ohne Dank und ohne zu bemerken, wie viel Mühe sie sich gegeben hatte.
»Hat es Euch gemundet?«, fragte sie.
»Als Knabe hat man es mir besser vorgesetzt«, erwiderte er.
N
In der ersten Zeit in seinem Haus pflegte sie zu singen, doch er behauptete, ihre Stimme verursache ihm Kopfschmerzen. Eines Abends, sie ging allein umher, sang sie eines der Lieder ihrer Mutter, und er kam die Treppe herunter und schlug sie und schrie: »Jüdin! Jüdin! Hure und Jüdin!«, und sie sang nie wieder.
Ihr Reichtum verringerte seine Schuldenlast, Geld jedoch schwindet, der Spott blieb. War das der Grund, so fragen wir uns, für die Kälte in ihrer Ehe? Oder waren es die plumpen Zudringlichkeiten des viel älteren Mannes unter der Decke der ehelichen Lagerstatt, seine Liebe zum Wein und zu den Karten und, als der Acker auf dem er säte, keine Frucht bringen wollte, seine Hinwendung zu Kurtisanen? Was davon, sollen wir sagen, verdüsterte die Atmosphäre ihres Heims?
N
Wir betrachten ihr Haus, stolz und hochgebaut im Herzen von San Polo, hören die Dienstboten hinter vorgehaltener Hand flüstern, sehen die Hausfrau sich auf ihre Pflichten zurückziehen, sind Zeuge, wie der Ehemann das Geld sinnlos zum Fenster hinauswirft und die Truhen sich leeren. Während die Jahre vorüberziehen und Jacamo immer rückhaltloser seine Selbstzerstörung betreibt, was erkennen wir in der Frau? Nun, gar nichts, hat es doch den Anschein, dass sie in den Stürmen des Schicksals steht wie ein Marmorbild, die gemeißelten Züge makellos weiß und ausdruckslos.
Thene, wunderschön und nun zur Frau erblüht, verwaltet in Abwesenheit ihres Gatten die Bücher, arbeitet mit dem Gesinde und hortet in den Falten ihrer Röcke, was sie an Dukaten in Sicherheit bringen kann, bevor er sie findet und für eine seiner Grillen verschwendet, welche immer es heute sein mag. Und je lauter er wird, umso stiller ist sie, bis sogar das gehässige Gerede hinter ihrem Rücken verstummt, weil den Klatschweibern Venedigs scheinen will, dass da nichts ist, gegen das sie ihr Gift verspritzen können, keine Kaufmannstochter oder betrogene Gattin eines zügellosen Spielers, keine Frau, kein Judenbalg, nicht einmal Thene selbst, nur Eis; und wer mag sich schon daran die Zunge wetzen?
So könnte es weitergehen. Andererseits, dies ist Venedig – geliebt von der Pest, gehasst von den Päpsten, das Herz des Handels in Europa –, und sogar hier kann nichts bleiben, wie es immer war.
Kapitel 3
Da ist ein Haus.
Ihr würdet es heute nicht finden – nein, auch nicht das Tor mit dem grimmigen Löwenhaupt aus Messing als Türklopfer, nicht die mit Tapisserien behängten Innenhöfe oder die dampfenden Küchen. Nein, keine Spur davon ist geblieben, kein Stein. Damals aber stand es in einer dieser engen, namenlosen Gassen nahe San Pantaleone, nördlich einer kurzen gemauerten Brücke, die von drei Brüdern bewacht wird, denn es gibt nur zwei Dinge, die den Bewohnern Venedigs wichtiger sind als die Familie, und das sind ihre Brücken und ihre Brunnen.
Wie kommt es, dass wir hier sind?
Je nun, ihr seid mit Thene hergekommen, ihr habt Jacamo begleitet, der auf seiner unermüdlichen Suche nach neuen Möglichkeiten, arm zu werden, von einem Ort reden hörte, an dem sich dies auf besonders unterhaltsame Weise bewerkstelligen ließe. Ihr steht mit beiden vor dieser Tür, weil Jacamo seine Gemahlin bestrafen will. Sie hat ihn zur Weißglut gereizt mit ihrer Unnahbarkeit, ihrem unerschütterlichen Gleichmut, ihrer untadeligen Höflichkeit, ihrem klaglosen Dulden. Deshalb hat er sie heute gezwungen, ihn zu begleiten. Sie soll sehen, was er tut, und durch ihn leiden. Folgt ihnen also, da sie eintreten, in ein Vestibül mit Wandbehängen aus Seide und Samt; die Luft ist mit Wohlgerüchen geschwängert und leiser Musik. Sie gehen an zwei ganz in Weiß gekleideten Frauen vorbei, deren Gesichter mit einem Nonnenschleier verhüllt sind, obgleich sie keinem christlichen Orden angehören. Durch diese Schleier weht es, willkommen, tretet ein und seid willkommen.
N
Folgt ihnen ins Peristyl, wo an den Säulen der Wandelgänge Fackeln brennen, während aus den Nischen über den Türen die nach byzantinischer Sitte als Mosaik ausgeführten Gesichter heiliger Märtyrer betrübt auf das Geschehen im Hof schauen. Genau wie Jacamo erspäht ihr vielleicht die Kurtisanen mit ihrem hochgesteckten Haar und den bis über das Knie hinaufgeschürzten Röcken, die im Halbdunkel girren und gurren und ihre Freier locken. Die süßen Klänge der Instrumente, der Bratenduft, das an- und abschwellende Stimmengemurmel, das Klappern der Würfel, das Wispern der Karten – es zieht ihn magisch an, ist ihm Nektar und Ambrosia zugleich.
Es gibt noch mehr.
Wie Thene bemerkt ihr vielleicht auch die Knaben und Männer, welche um die Gunst der anwesenden reichen Damen buhlen, die sich hinter langnasigen Masken oder mit Silberfäden durchwirkten Schleiern verbergen. Ihrem Auge folgend, wandert euer Blick zu den Türen zu anderen Räumen, aus denen andere Stimmen und weitere Gerüche wabern wie reflektierter Kerzenschein, und darüber hinaus in die Runde. Auch wir werden nunmehr der Tatsache inne, dass bei all den Spielen, denen man in diesem Innenhof frönt, nicht allein das Glück maßgeblich ist, das aus einem Würfelbecher rollt. Wir sehen Schach, Dame, Mühle und andere Spiele, welche nur wir zu benennen wissen: Tavli, Toguz Kumalak, Go, Shōgi, Mahjong, Sugoruko und Schatrandsch – Spiele aus allen Weltengegenden scheinen hier vertreten zu sein und auch alle Völkerschaften. Sitzt dort nicht ein Wesir aus dem Reich der Moguln, am Turban einen faustgroßen Diamanten, der gerade den Läufer des jüdischen Arztes schlägt, jener dort mit dem gelben Hut? Ist die Dame in Rot, die ihren Rosenkranz um das Handgelenk geschlungen trägt, nicht eine französische Aristokratin, die gegen einen Piraten aus Ragusa spielt, den das Gold seines letzten Raubzugs juckt? Und mehr – noch mehr Fremdländisches. Will uns doch scheinen, dass es ein moskowitischer Fürst ist, der, während er über die Verderbtheit dieser Stadt räsoniert, eine Karte umwendet, die von der eines Bantu-Prinzen übertrumpft wird, der mit feinem Lächeln fragt: »Noch ein Versuch?« Und ist das nicht chinesische Seide am Ärmel der verschleierten Frau, die Getränke serviert? Und blinkt nicht das Gold der Maya an der Fibel des Wächters vor einer silbernen Tür, die in einen Teil des Hauses führt, den wir noch nicht kennen?
Thene sieht dies alles, und auch wenn sie nicht weiß – nicht wissen kann –, was wir wissen, ist sie klug genug, aus dem Gesehenen ihre Schlüsse zu ziehen.
Kapitel 4
Jacamo spielt.
Und verliert.
Er ist einer, mit dem andere Spieler ihr Spiel treiben, und es bedarf dazu nicht einmal der Besten dieser Zunft. Wir werden uns nur so viel wie nötig mit ihm befassen, und schon bald wird er aus unserer Geschichte verschwunden sein, ohne eine Lücke zu hinterlassen.
Thenes Rolle ist die der Zuschauerin. Auf seinen Befehl muss sie neben ihm Platz nehmen, weil sie sehen soll, wie er zwanzig, dreißig, hundert Dukaten verliert. Als ihre Miene unbewegt bleibt, legt er einen Arm um ihre Taille und zieht sie dichter zu sich heran, damit ihr ja nicht entgeht, dass er mit dem nächsten Blatt den Ring seines Vaters verspielt, das Landgut nahe Forli.
Weil auch das sie scheinbar nicht berührt, packt er den Schenkel der nächsten Dirne, küsst sie auf den Hals.
Thene fragt: »Soll ich Wein bringen?«
Und erhebt sich und geht. Sie hält die Hände sittsam, eine über die andere gelegt, vor dem Leib. Jacamo, anders als andere, die es sehen, weiß diese Gebärde zu deuten und ist’s zufrieden.
Er beschließt, dass sie morgen wieder herkommen werden.
Kapitel 5
Wir sind nicht die einzigen Beobachter.
Ebenso aufmerksam sind die Schlichterinnen, wie wir sie nennen wollen. Sie sind nicht die Mägde, die erlesene Speisen und süße Getränke aus einer unsichtbaren Küche herbeischaffen. Sie studieren hinter ihren Masken das Treiben, und sie bewachen die silberne Tür.
»Wohin führt diese Tür?«, fragen wir.
»Zu den oberen Gemächern.«
Was sind die oberen Gemächer?
»Ein Ort, an welchem man spielt.«
»Das sind die Räume hier unten auch, wie dieses ganze Haus. Worin besteht der Unterschied zu den oberen Gemächern?«
»Die Spiele sind andere.«
»Kann ich mitspielen?«
»Hat man Euch eingeladen?«
»Nein.«
»Dann ist Euch der Zutritt verwehrt.«
»Wie kann ich eine Einladung bekommen?«
»Ihr spielt. Wir schauen zu.«
Die Tür bleibt verschlossen. Einstweilen.
N
Auch Thene studiert das Spiel und die Spieler.
Sie mustert ihren Gemahl, der nicht verhindern kann, dass Gegner von geringem Talent und Witz ihn ausziehen bis aufs Hemd. Sie mustert die Glücklichen und die Glücklosen, die Abwägenden und die Tollkühnen, wie sie von Tisch zu Tisch wandern und sich zu immer gewagteren Einsätzen versteigen. Sie entdeckt ein Mitglied des Rats der Sieben und zwei Nobili, die dem Rat der Zehn angehören. Sie sieht Richter und Händler, Fürsten und Priester, und vor allem sieht sie – Frauen. Matronen und Töchter, Mütter und Kurtisanen. Einige spielen, andere nicht, und für ein paar öffnet sich wie von selbst die silberne Tür. Das Gesicht hinter den Masken des Karnevals verborgen, schauen sie die an, die sie anschaut.
Seht, da ist der Mann.
Silver wollen wir ihn nennen, wegen der Borte mit dem Muster einer silbernen Dornenranke am Ärmelbund seines Gewandes. Schon eine geraume Weile ruht sein Blick auf ihr, und dass sie seine Annäherung nicht bemerkt, beweist, wie überaus unauffällig er sich zu geben weiß. Als sie sich umschaut, weil sie einen Atemhauch im Nacken spürt, fragt er:
»Spielt Ihr?«
»Nein.«
Er lächelt und schüttelt über sich selbst den Kopf.
»Vergebt mir«, sagt er. »Ich habe mich falsch ausgedrückt. Würdet Ihr gerne spielen?«
Sie richtet den Blick auf den Rücken ihres Mannes, auf die leeren Gläser neben seinem Ellenbogen und fühlt Zorn in sich aufsteigen, einen Sturm in ihrer Brust, und ihre Hände schmerzen. Sie brennen davon, dass sie stillhalten müssen, und fast unhörbar entflieht ihr ein Ja.
N
Sie spielen Schach.
Er gewinnt die erste Partie.
Sie die zweite.
Sie wechseln nur wenige Worte, während sie spielen. Der Einsatz, denn es muss einen Einsatz geben, ist die Verpflichtung, eine Frage zu beantworten, die der Gegner stellt.
»Reicht es nicht, dass man zum Vergnügen spielt?«, fragt sie.
Ein Ausdruck des Entsetzens huscht über seine Züge. »Ihr würdet Eure irdische Glückseligkeit aufs Spiel setzen? Ihr würdet riskieren, Eure Selbstachtung zu verlieren? Guter Gott, spielt nicht zum Vergnügen, noch nicht, nicht, wenn es so viele geringere Dinge gibt, die Ihr einsetzen könnt!«
So rätselhaft seine Worte ihr erscheinen, sie umhüllen sie so natürlich wie das Altartuch den kalten Stein. »Dann spielen wir um Fragen«, sagt sie, »und um Antworten.«
So geschieht es, und seine Frage, nachdem er die erste Partie gewonnen hat, lautet: »Empfindet Ihr Liebe für Euren Gemahl?«
»Nein«, erwidert sie und ist erstaunt über ihren Freimut.
Nach ihrer Revanche überlegt sie lange und fragt endlich: »Was wollt Ihr von mir?«
Worauf er versetzt: »Eines Tages werde ich eine Person um eine Gefälligkeit bitten müssen, und ich möchte herausfinden, ob möglicherweise Ihr diese Person seid.«
Dann hat Jacamo sich erhoben. Er ist betrunken, und sie führt ihn nach Hause.
Am nächsten Tag entlässt sie einen weiteren Diener, dem sie keinen Lohn mehr zahlen können, und zwei Abende darauf begeben sie sich erneut zu dem uns nun bekannten Haus.
Und wieder Jacamo, die Karten, der Wein, das Verlieren.
Wir sind taktvolle Beobachter, wir kommen nicht jeden Abend, um Maulaffen feilzuhalten, aber doch regelmäßig. Dabei haben wir ihn schon oft in diesem Zustand gesehen, daher glauben wir mit einigem Recht, annehmen zu können, dass es an den Abenden, die wir nicht zugegen waren, nicht anders gewesen ist.
Wir heben die Brauen, und vielleicht schütteln wir den Kopf, doch enthalten uns jeder tadelnden Äußerung. Wer sind wir, den Stab über andere zu brechen?
An diesem Abend jedoch werden wir Zeuge einer Änderung des gewohnten Ablaufs. Heute Abend fallen ihm nach drei Partien die Augen zu, sein Kopf sinkt auf den Tisch, und aus dem Mundwinkel rinnt Speichel auf die Karten unter seiner Wange. Thene würde sich des würdelosen Anblicks schämen, den ihr Gemahl abgibt, aber solche Regungen sind, wie die Lieder ihrer Mutter, längst in ihr erstorben. Dann steht Silver neben ihr und fragt: »Ein Spiel?«
Sie spielen.
Bei der ersten Partie zieht sie überhastet, schaut kaum auf das Brett und verliert. Er stellt seine Frage, die lautet: »Was fürchtet Ihr?«
Sie überlegt lange.
»Die Dinge, die zu tun ich fähig wäre«, antwortet sie. »Die Frau, zu der ich geworden bin.«
Die zweite Partie dauert länger. Der Kampf ist härter, und drei Züge vor seinem unabwendbaren Schachmatt sagt er: »Wahrscheinlich sollte ich aufgeben, aber es wäre schade um die glanzvolle Vollendung eines meisterlich erkämpften Sieges.«
Also spielt er zu Ende, und sie gewinnt und fragt, da sie seinen König umstößt: »Habt Ihr heute Abend meinen Gemahl vergiftet?«
»Ja«, erwidert er. »Wie kommt Ihr darauf?«
»Ich sah Euch neben ihm stehen und zuschauen, wie er spielt. Das habt Ihr vorher nie getan, zu keiner Zeit Interesse an seinem Spiel gezeigt, weil es so erbärmlich ist. Ihr habt gelächelt und gelacht und Euch gebärdet wie einer von ihnen, den Männern mit ihren Karten, obwohl Ihr nicht von ihrer Art seid. Ich kann nur annehmen, dass Ihr eine bestimmte Absicht verfolgt, und nun schläft er, und nichts vermag ihn zu wecken.«
»Er wird leben, fürchte ich. Ich habe einst mit einem Alexandriner gespielt und meine Kenntnis der Herstellung von Schießpulver gegen sein Wissen auf dem Gebiet der Alchemie gesetzt. Dank eines ungeschickten Manövers seiner Pikeniere gelang es mir, die Burg zu erobern.«
»Ihr sprecht in Rätseln.«
»Dann solltet Ihr meine Sprache lernen.«
»Oder Ihr die meine.«
»Aber Ihr begehrt etwas, das ich habe.«
»Und was ist das?«
»Ihr möchtet wissen, was sich hinter der silbernen Tür befindet.«
»Vielleicht will ich das.«
»Seien wir offen miteinander.«
»Dann ja. Ich will es wissen.«
»Gut. Lasst uns spielen.«
Sie spielen.
Kapitel 6
Am nämlichen Tag, an dem die Not sie zwingt, einen Geldverleiher im Getto aufzusuchen, der ihre Mutter kannte und ihr zuflüstert, dass er, weil sie es ist, ihr den Betrag um einen günstigeren Zins als üblich lassen wird, treten die Schlichterinnen des Spielhauses an Thene heran.
An diesem Abend, wie an vielen anderen zuvor, ist der Mann, den wir Silver nennen, nicht anwesend, aber mit neuem Selbstvertrauen wandert sie allein durch den Saal. Sie tritt gegen viele an, verliert auch manchmal, aber weit häufiger verlässt sie den Tisch als Siegerin. Jacamo hat nach seiner Gewohnheit reichlich dem Trunk zugesprochen und schenkt ihr keine Beachtung, so nutzt sie die Gunst der Stunde und hortet, was sie gewinnt; ein Notpfennig für den nicht mehr fernen Tag, an dem er sich und den gesamten Hausstand in einem Fass Malvasia ertränkt.
Anfangs haben sich die anderen aus Mitleid auf ein Spiel mit ihr eingelassen. Und verloren. Danach war es Neugier auf die Gemahlin des Signore Orcelo, die sich um so viel besser auf das Spielen versteht als der Mann, der rechtmäßig ihr Herr und Meister sein sollte. Jetzt aber spielen sie aus dem einzig wahren Grund und auf die einzig wahre Art, denn der Geist des Spielhauses wirkt in ihnen und sie spielen um das Einzige, was zählt – den Sieg. Wir erleben, es gibt welche, die Thene schlagen können, in diesem Spiel, an jenem Tag. Zahlreicher jedoch sind die, die passen müssen und es dessen ungeachtet nicht lassen können, wieder und wieder Revanche zu fordern.
Dann erscheinen die Schlichterinnen.
»Komm mit mir«, sagt eine von ihnen. »Wir haben gesehen, wie du spielst.«
»Wohin gehen wir?«, fragt Thene.
»Du willst die Herrin des Spielhauses kennenlernen.«
Es ist eine Feststellung, keine Frage. Zu fragen ist auch nicht notwendig.