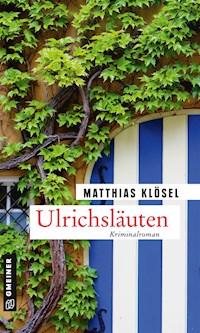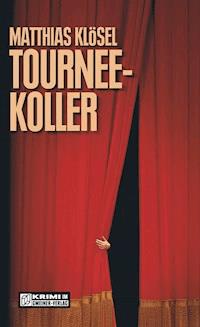
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Beckmann
- Sprache: Deutsch
Als der Augsburger Kommissar Beckmann in aller Frühe zu einer Leiche gerufen wird, geht es ihm gar nicht gut. Er hat vergeblich versucht, den Trennungsschmerz nach seiner Scheidung mit Alkohol zu stillen. Doch dafür hat sein Kollege und Partner Poborsky jetzt kein Verständnis. Vieles an dem Tod des Schweizer Geschäftsmanns deutet auf Selbstmord hin. Aber Beckmann glaubt nicht an diese Theorie. Man erschießt sich doch nicht einfach so, wenn man eine Frau und ein Kind hat. Und wer ist die junge Frau mit dem slawischen Akzent, die den Geschäftsmann laut Zeugenaussage kurz vor seinem Tod noch auf sein Hotelzimmer begleitet hatte? Beckmann stochert im Nebel - ein merkwürdiger Fall. Merkwürdig ist auch, dass er bei seinen Ermittlungen ständig auf das Plakat eines Loriot-Männchens stößt, das den Auftritt einer Tourneetheatergruppe in einer kleinen Gemeinde bei Augsburg ankündigt. Macht es sich etwa über ihn lustig?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Klösel
Tourneekoller
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © SXC.hu
ISBN 978-3-8392-3040-4
Anmerkung des Autors
Schlagzeilen sind rein fiktiv und keiner Zeitung zuzuordnen!
1
Morddrohung
›Halt’s Maul. Jetzt rede ich. Hanswurst, Schmierenkomödiant. Von dir lass ich mir nichts mehr sagen. Hast mir das Leben zur Hölle gemacht. Tag für Tag und jeden Tag von Neuem. Mich erniedrigt. Gedemütigt vor den Kollegen.
Entschuldigung, ist das hier Zimmernummer 107? Bis zum Erbrechen hast du mich diesen dämlichen Satz proben lassen. Verdammter Mist. Jetzt ist das Bier schon wieder alle. Warum muss ich mit so einem Dilettanten zusammenarbeiten? Du bist das größte Antitalent, das mir während meiner ganzen Schauspielkarriere über den Weg gelaufen ist. Nein, das muss ich mir von dir nicht bieten lassen. Das lass ich mir von keinem bieten. Zeit, dass ich dir mal ein bisschen Respekt beibringe. Einer muss es ja mal tun. ›Antitalent‹. Man darf sich nicht alles gefallen lassen, sonst geht man vor die Hunde. So, wie der Struwe. Erinnerst du dich noch an den Struwe von der Requisite? In Bad Reichenhall hat der arme Kerl wegen dir einen Nervenzusammenbruch gehabt. Du hast getobt wie ein Irrer, nur weil der Requisitenpudding nicht süß genug war, den er für deinen Auftritt präpariert hatte. Drei Löffel Zucker, drei, so schwer kann das doch nicht sein. Bin ich denn hier nur von Dilettanten umgeben?
In dem Ton ist das weitergegangen, eine geschlagene Viertelstunde lang. Der arme Kerl ist dagestanden wie ein begossener Pudel vor dem Jüngsten Gericht. Am nächsten Tag hat man ihn dann in seinem Hotelzimmer gefunden. Schlaftabletten. Eine Überdosis. Aber dem Struwe ist noch nicht einmal sein eigener Selbstmord gelungen. Den haben sie im Krankenhaus wieder aufgeweckt. Seither sitzt er in der Anstalt und erkennt nicht mal seine eigene Mutter wieder. Aber der Struwe ist der Letzte gewesen, den du zum Wahnsinn getrieben hast, das sag ich dir.
Aus. Vorbei. Rien ne va plus. Mal sehen, wer deine Rolle übernehmen wird, vielleicht der Tresche, dein ewiger Konkurrent. Ha, du wirst dich im Grab umdrehen, wenn der Tresche das macht. Ausgerechnet der Tresche.
Bei deinem Begräbnis werde ich weinen. Noch verlogenere Tränen, als du je auf der großen Bühne geweint hast. Ich werde die Rolle meines Lebens spielen.
Du lachst mich aus? Lach nur. Ich werde es tun. Okay. Vielleicht habe ich heute Abend schon ein paar Bierchen über den Durst getrunken, was soll man auch sonst tun, allein in einem Hotelzimmer, in diesem elenden Kaff, wo der Hund begraben liegt.
Aber glaub mir, ich werde es tun, verlass dich drauf. ›Antitalent‹. Ich bin kein Feigling. Ich werde es tun. Ich werde es tun. So wahr mir Gott helfe, ich werde es tun.
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ist die Minibar leer. Und alles andere ist dicht um die Zeit. Und jetzt?‹
2
Beckmanns Frust
»Ruf mich an! Dreimal die Eins, dreimal die Sechs, sechs, sechs, sechs, ruf mich an!« Die lüsterne Frauenstimme lässt nicht locker. »Ruf mich an.« Scheiße, das darf ja wohl nicht wahr sein. Mühsam tastet Beckmann nach der Fernbedienung. »Dreimal die Eins, dreimal die …« Endlich Ruhe.
Beckmann hat Kopfschmerzen. Wie lange hat er wohl geschlafen? Drei Stunden, vier? Den verdammten Likör, diese Amarettojauche hätte er sich sparen sollen. In einem Anfall von lustvoller Selbstbestrafung hat er sich das Zeug reingezogen. Er ist ein Versager. Deshalb trinkt er Amaretto. Der Amaretto gehört seiner Frau. Seine Frau ist weg. Die Kinder auch. Die Hälfte der Möbel und der Bücher auch. Den Amaretto hat Anna dagelassen. Aber der ist jetzt ebenfalls weg.
Er kommt sich vor wie in einem Kriminalroman. Da sind die Kommissare ja auch öfter die einsamen Wölfe, denen die Ehe in Stücke gebrochen ist. Er hat sich immer über dieses Klischee mokiert, und jetzt?
Beckmann richtet sich mühsam von der Couch auf und stützt den Kopf in beide Hände. Die Kopfschmerzen werden immer heftiger. Sein ganzer Schädel ist ein einziges Schlachtfeld. El Alamein, die Schlacht von El Alamein wird hier noch einmal geschlagen. Der Zweite Weltkrieg dauert fort, immer noch. Und kein Fronturlaub in Sicht. Die Panzer feuern ohne Unterlass. Seinen Mund hat der heiße Wüstenwind ausgetrocknet, die Zunge ist ein rissiger Lappen. Irgendwo hatte er doch noch eine Flasche Wasser? Oder hat Anna die auch mitgenommen? Die Gegner haben sich ermattet zurückgezogen, und auf der Walstatt stöhnen die Verwundeten. ›Na ja!‹, denkt Beckmann, ›kein besonders gutes Bild, aber ein bisschen Selbstmitleid hat schließlich noch keinem geschadet.‹
Er schaut auf die Uhr. 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens in Augsburg. Ein regnerischer Maitag. Es ist kalt. Stimmt ja, dieser idiotische Uwe Wesp hat im Fernsehen irgendetwas von den Eisheiligen erzählt, der kalten Julie oder der kalten Sophie oder wie auch immer das frigide Weib auch heißen mag. Dieser schwachsinnige Märchenonkel, der das tägliche Wetter verkündet, ist eine Zumutung. Eine der vielen Zumutungen, die Beckmann ertragen muss. Eine der kleineren Zumutungen. Dass Anna und die Kinder weg sind, ist eine große Zumutung. Es ist eine Katastrophe. Die Tränen kommen nicht. Gerne hätte Beckmann geweint. Ist ja immer eine Erleichterung, wenn sich der Schmerz löst. Aber der Schmerz sitzt in seinem Kopf fest. El Alamein eben. Wüste überall. Unendliche Leere. Unendliche Trockenheit. Er steht auf. Da! Im Kühlschrank steht die angefangene Flasche Wasser, die er gesucht hat. Das Wasser schmeckt schal und abgestanden. Er kippt es in einem Zug hinunter. Der zerfurchte Lappen in seinem Mund saugt die Feuchtigkeit auf wie rissige Erde nach einer Dürreperiode. Jetzt fühlt er sich etwas besser.
Die Krise ist ja ab einem bestimmten Alter fast immer eine allumfassende. 42 ist er im März geworden. Aus dem Badezimmerspiegel sieht ihm ein unrasiertes, faltiges Männergesicht entgegen. Scheiße! Da hat sein Vater ja noch besser ausgesehen, als der schon lange in Rente war. Kein Wunder, dass Anna vor ihm davongelaufen ist. Die Haare auf seiner Schädelplatte, unter der noch immer vereinzelte Geschützsalven abgefeuert werden, lichten sich unübersehbar. Die Augen sind rot und blutunterlaufen. Er hat genug gesehen und macht das Licht aus. Im Wohnzimmer lässt er sich auf die abgewetzte Couch fallen. Er wird eine andere Wohnung suchen müssen. Bald! Beckmann hat die Schnauze voll. Von allem. Kriminalhauptkommissar, was für ein Scheiß-Job. Schon als Junge hat er davon geträumt, später einmal Polizist zu werden. Er ist bei den Gendarmen gewesen. Die Räuber, das waren die anderen. Er ist immer bei den Guten gewesen, immer. Die Gewissheiten der frühen Jahre – sie sind verloren, unwiederbringlich. Der Regen trommelt seinen melancholischen Rhythmus auf das Fenstersims. Vergebens sucht er nach Trost in der unendlichen Leere dieser von allen guten Geistern verlassenen Wohnung. Räuber und Gendarm. So einfach ist die Welt einmal gewesen. Er versteht es einfach nicht. Was hat er falsch gemacht? Er versteht es nicht, so sehr er sich auch den Kopf zermartert.
»Bammbamm, ratatatata, ratatatata!« Wann hören die endlich auf mit diesem idiotischen Rumgeballere? Dass Anna es fertigbrachte, ihn zu verlassen – was um Himmels willen verlangt sie denn von ihm? Klar, er hat viel zu tun, immer zu viel zu tun. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten, das Gehalt, auch eher bescheiden. Launisch sei er geworden, unerträglich launisch, hat sie ihn angeschrien. Und dass alles an ihr hängen bleibe.
»Der Lukas braucht einen Vater, Günther, kapierst du das nicht? Und deine Tochter braucht auch einen Vater. Und ich einen Ehemann, der mich nicht wie ein Möbelstück behandelt, kapierst du das nicht?«
Natürlich kapiert er das, er ist doch nicht blöd. Er weiß selber, dass der Zustand nicht ideal ist. Dass er sich mehr kümmern muss, weil ein Job als Krankengymnastin auch kein Zuckerschlecken ist, das sieht er ja ein, auch wenn Anna nur eine 25-Stunden-Woche hat, aber Einkaufen und Saubermachen wollen ja auch erledigt sein, er muss sich einfach mehr kümmern, schon klar. Mal die Kinder nehmen und in den Zoo fahren oder den Babysitter bestellen und mit der Anna den neuen Film anschauen, den sie unbedingt sehen will, und er verspricht das, aber natürlich kommt genau an dem freien Abend dann der Anruf vom Präsidium, und das war’s dann mit Kino. Ist ja nicht die Ausnahme, so was, aber was soll er denn machen? Er bräuchte dringend ein Duplikat von sich, einen Klon, damit die dämliche Gentechnik dann doch noch zu irgendetwas gut ist. Beckmann eins würde dann den Frauenfilm mit der Anna anschauen, und Beckmann zwei könnte Verbrecher dingfest machen. Danach würden sie alle drei dann in aller Ruhe einen trinken gehen und alle wären zufrieden. Und wenn die von der Gentechnik schon dabei wären, vielleicht könnten die ihm dann gleich noch ein Gen einpflanzen, das ihn daran erinnert, Anna ab und an Blumen mitzubringen, denn das mögen Frauen, und in der Hinsicht ist er schon ein bisschen ein Stoffel, das gibt er ja zu. Und das Gen, das ihn oft so ungeduldig und aufbrausend sein lässt, das könnten die bei der Gelegenheit auch gleich entfernen, geht doch in einem Aufwasch. Und mehr Gefühle zeigen können will er, genauer gesagt, die Anna will, dass er will, also wenn die Herren vielleicht so gut sein könnten. Ach, und der Ordentlichste ist er auch nicht immer, vielleicht kann die moderne Medizin da ebenfalls was ändern, ist doch nicht zu viel verlangt, oder?
Gott sei Dank hat ihn der Humor selbst in dieser Situation nicht ganz verlassen. Auch wenn es nur Galgenhumor ist, für einen kurzen Augenblick verzieht sich sein Gesicht zu einem schiefen Grinsen, das ihn jedoch schnell wieder im Stich lässt. Nein, zum Lachen ist ihm nicht zumute, dafür fühlt er sich zu elend.
Er will, dass sie wieder zusammenkommen, die Anna und er und die Kinder. Sie gehören doch zusammen. Er hält das nicht aus, dass die Anna alle zwei Wochenenden die Kinder bei ihm abliefert, und am Sonntagabend muss er sie wieder abgeben, das ist jedes Mal, als ob er ein Stück von sich selbst herausoperieren muss, und das alles ohne Narkosemittel.
»Menschenskind Anna, ich liebe dich doch, ich liebe die Kinder, lass uns doch noch einmal von vorne anfangen, sei nicht so stur, gib uns noch eine Chance, so übel sind wir als Paar doch gar nicht, trotz allem, was passiert ist. Ich liebe dich, Anna. Bis dass der Tod euch scheidet, das hast du doch ...«
Das Klingeln des Telefons schneidet sich in sein Gehirn, ein unbarmherziger, exakt ausgeführter chirurgischer Eingriff von erschreckender Präzision. Anna verschwindet im Nebel, der Tumor ist entfernt. Für einen Augenblick existiert im gesamten Kosmos nur eine ungeheure Leere. Poborsky ist am Apparat. Die merkwürdig fiepsige Stimme seines Kollegen ist das Letzte, was er um diese Uhrzeit hören will. Wie der mit dieser Stimme so einen Erfolg bei Frauen hat, das wird er nie kapieren, sein Lebtag nicht. Und die untersetzte Figur des Kollegen wirkt in seinen Augen auch nicht gerade attraktiv. Aber verstehe einer die Frauen.
»Wir haben eine Leiche«, sagt der andere. »Mittleres Alter, männlich. Mord oder Selbstmord, wie es aussieht. Im Hotelturm. Du sollst in einer halben Stunde draußen sein.«
»In Ordnung.« Er legt auf und geht ins Bad. Den Blick in den Spiegel vermeidet er. Die eiskalte Dusche bringt ihn wieder zu sich. Er zieht sich an, der Kaffee ist inzwischen durchgelaufen, stark und schwarz, wie er ihn mag. Die Haustür klappt hinter ihm ins Schloss.
7 Uhr morgens in Augsburg. Es regnet. Kalt und ausdauernd.
3
Schmerzen
Die Hüfte schmerzt. Die Operation ist bereits über ein Jahr her, und immer noch schmerzt die verdammte Hüfte. Und so ein andauernder Schmerz, der schlägt einem eben irgendwann auf die Laune. Ist ja kein Wunder, nicht wahr? Sicher, du gewöhnst dich an den Schmerz, wie an einen sehr vertrauten Feind. Du weißt, wann er angreift, sich ausbreitet, du weißt, wann er sich zurückzieht. Oft nimmst du ihn gar nicht mehr wahr, du wiegst dich in Sicherheit. Und dann, urplötzlich, schlägt er wieder zu. Ein wildes Tier, das sich nicht zähmen lässt.
Natürlich, sie ist zu dick, das weiß sie selber. Zu viel Gewicht für so eine kleine Person, viel zu viel. Sagt Doktor Kerssenbrock. Dieser Mistkerl. Verpfuscht eine stinknormale Hüftgelenksoperation und hat die Dreistigkeit zu sagen, sie sei zu dick. Aber mach mal was gegen diese Bande. Die halten doch alle zusammen. Ein Gutachten, das dem Kollegen einen Kunstfehler attestiert – undenkbar.
Dem eigenen Körper beim Verfall zuschauen zu müssen – das ist beinahe noch schlimmer als der körperliche Schmerz. Nein, definitiv, es ist definitiv schlimmer. Würdelos ist das, wenn der eigene Körper macht, was er will. Wenn die Kontrolle versagt. Wenn der Kopf Befehle erteilt und der Körper nicht mehr gehorcht. Wenn das Blut mit Hochdruck durch die Adern pumpt und die blutdrucksenkenden Mittel mir nichts dir nichts einfach ignoriert. Bösartig, höhnisch führen das Blut, die Hüfte ein Eigenleben, das immer mehr außer Kontrolle gerät. Ein aussichtsloser Kampf. Ein Kampf, bei dem sie manchmal kleine Siege erringt, den sie auf Dauer jedoch nur verlieren kann.
Was steht am Ende? Das sabbernde Gebrabbel als Demenzkranke im Seniorenheim? Idiotische Ballspiele mit einem osteuropäischen Pfleger, der sie respektlos duzen und ihr Kamillentee aus der Schnabeltasse einflößen würde?
Marianne Mangold trinkt noch einen Schluck Kaffee und verbannt die schwarzen Gedanken von Krankheit und Verfall. Immerhin, der Kaffee ist gut hier, nicht so eine Plörre, die stundenlang in der Warmhaltekanne vor sich hindümpelt.
»Sie, ich hätte gerne noch einen Kaffee.«
»Sofort!« ›Aufmerksames Personal‹, denkt sie. Findet man auch immer seltener. Eine Zumutung, wie unfreundlich und unprofessionell sie einen heutzutage behandeln. Selbst in den guten Hotels. Schlimme Zeiten sind das, sehr schlimme. Demütigend ist das, für so wenig Geld auf Tournee zu fahren. Es ist endgültig das letzte Mal, dass sie zu diesen miserablen Konditionen unterwegs ist. Sie greift nach dem Feuerzeug und zündet sich eine Zigarette an. Sie inhaliert tief, die erste Zigarette morgens ist ein Genuss. Seit 20 Jahren hat sie sich um das Unternehmen verdient gemacht. Die Launen der Stars ertragen. Wofür? Für dieses Mickergehalt? Und das, wo sie neben ihrer Arbeit als Maskenbildnerin auch noch als Kummerkastentante herhalten muss. Noch vier Jahre hat sie bis zur Rente. Vier lange, lange Jahre. Sie hält das nicht mehr aus, dieses Leben. Selbst das doppelte Gehalt wäre keine angemessene Entschädigung für die Demütigungen, die sie in diesem Nomadendasein aushalten muss. Die Schauspieler sind unerträglich. Absolut unerträglich. Eitle Selbstdarsteller. Schwätzer ohne jede Substanz. Sie nimmt einen letzten Zug von ihrer Zigarette, gierig.
Markowitz. Der Markowitz ist der Schlimmste von allen. Jeden Abend ranzt er sie an, nur weil ihr mal ein Bügel runterfällt, ausgerechnet an der leisen Stelle, in der Pause vor seiner besten Pointe. Was kann sie dafür, dass auf der Hinterbühne so wenig Platz ist. Schnell soll sie sein, freundlich soll sie sein, leise soll sie sein. Ein Serviceautomat. Was kann sie dafür, dass ihre Hüfte nicht mehr mitmacht. ›Alte Scharteke‹, hat er sie genannt. ›Du alte Scharteke, beweg deinen fetten Hintern mal ein bisschen flotter durch die Gegend.‹ Na warte. Markowitz. Der Star, der sich für Gott persönlich hält. Der seine Launen an allen auslässt. Die, die den ganz großen Durchbruch nicht geschafft haben, das sind immer die schlimmsten. Leiden an Minderwertigkeitsgefühlen und spielen sich auf. Brauchen andauernd Bestätigung wie süchtige Junkies ihren Stoff. Manchmal hat sie das Gefühl, dass der Markowitz selbst im Schlaf noch nach Bestätigung sucht.
»So, bitte sehr, Ihr Kaffee. Tut mir leid, dass Sie etwas warten mussten, aber wir haben ein kleines Problem mit unserem Kaffeeautomaten.«
»Danke.«
Stimmt ja, der Kaffee, sie hat ja noch einen Kaffee bestellt. Der junge Kellner ist wirklich ausgesprochen höflich.
4
Labyrinth
Wo hat er bloß den verdammten Wagen geparkt? Der Regen fällt gleichmäßig. So früh am Morgen sind noch kaum Leute unterwegs. Die Straßen sind ein Labyrinth, er irrt darin herum und wird nass. Die Autos stehen zusammengepfercht, friedlich, wie eine riesige Herde schlafender Tiere die ihre frierenden Leiber aneinanderpressen, um den Widrigkeiten des Wetters besser standhalten zu können. Wieso kann er sich nicht erinnern, wo er die verdammte Kiste abgestellt hat? Von einer Litfaßsäule blickt ihn ein Strichmännchen von Loriot an und versucht, ihn zum Schmunzeln zu bringen. Unter anderen Umständen wäre ihm das vielleicht sogar gelungen. Verdammte Kälte. Er geht weiter durch den Regen, einfach weitergehen, auf der Suche nach einem Auto, das er als das seinige identifizieren muss und das vielleicht schon abgeschleppt ist, das aber wahrscheinlich nur irgendwo im Heer der anderen geparkten Autos einen Teil dieses verregneten Labyrinths bildet und sich einfach nicht bemerkbar macht. Schon wieder grinst ihn ein Loriotmännchen an. Das gleiche? Ein anderes? Er geht weiter. Es regnet. Seine Frau hat ihn verlassen. Heute Morgen wartet eine Leiche auf ihn. Da vorne, da vorne steht sein R 19. Wer hat denn den so unmöglich eingeparkt?
5
Tourneetheater