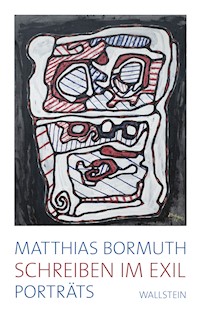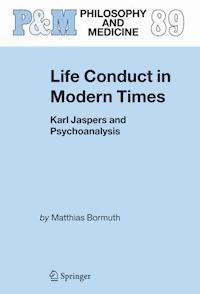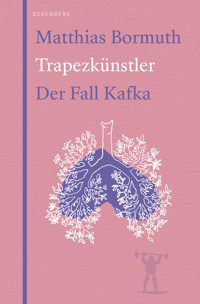
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bevor Franz Kafka sich vor hundert Jahren seiner erkrankten Lunge ergab und starb, hatte sie sein Leben auf geradezu befreiende Weise verändert: Sie hatte dafür gesorgt, dass Kafka seinen ungeliebten Beruf in der Prager Arbeiter- und Unfallversicherung aufgeben konnte; dass er eine am Ende zur Last gewordene Verlobung lösen konnte; dass er sich endgültig vom Vater befreien, den berühmten »room of one's own« und, am Ende, Dora Diamant finden konnte. Matthias Bormuth war Arzt in einer psychiatrischen Klinik, bevor er seine zweite Karriere als Philosoph begann. Er ist wie wenige in der Lage, jene Brücken zu erkennen, die, wie schon bei Max Weber, Karl Jaspers oder Aby Warburg in der Krankheit die Freiheit eröffnen – auch für den Prager Jahrhundertschriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias Bormuth
Trapezkünstler
Der Fall Kafka
Für Jessica und Ulrich
Inhalt
Der Fall Kafka
Vorsatz
Hüter der Verwandlung
Ein Gespräch mit Reiner Stach
Der Bote
Abrahams Welt
Der Beobachter
Nach Palästina
Literatur
Dank
Über den Autor
Der Fall Kafka
Vorsatz
I.
Alles fing mit einer kurzen Reise nach Prag an, für die ich mir im Frühjahr 2023 Kafkas Prosa aus dem Nachlass eingepackt hatte. Auf dem Weg durch das Elbsandsteingebirge las ich seinen Brief an den Vater, an dem mich erstaunte, mit welchem Geschick der Schriftsteller den Kampf zwischen den Generationen aufnahm. Sein Schreiben war ein psychodynamisches Wunderwerk, das auf klassische Weise die Autoritätskonflikte in der Moderne zur Sprache brachte.
Auch beeindruckten mich in dem Band die philosophisch-religiösen Spekulationen, die Kafka nach dem Ausbruch der Tuberkulose 1917 bewegten. Sein Freund Max Brod hatte die Zürauer Aphorismen nach seinem Tod 1924 zuerst unter dem Titel Betrachtungen über Sünde, Hoffnung, Leid und den wahren Weg veröffentlicht. Die Versuchung, aus Kafka einen gläubigen Autor zu machen, der auf eigene Weise den jüdischen Wurzeln verbunden blieb, war groß.
Nach den Prager Tagen, in denen mein intensiveres Nachdenken über Kafka als Schriftsteller begann, rekapitulierte ich auch frühere Lektüren von Erzählungen, Briefen und Tagebüchern. Mir imponierten in der Zusammenschau seine hohe Sensibilität und psychosomatische Vulnerabilität als Bedingungen des literarischen Schaffens. So entstand ein erster Essay, für den ich als sachliche Orientierung Reiner Stachs dreibändiges Panorama von Leben und Werk heranzog. Es war phantastisch, wie der Berliner Forscher, der sich seit Jahrzehnten Kafkas Biographie widmet, den einzigartigen Autor vielschichtig im Horizont seiner Zeit sichtbar werden ließ. Freunde vermittelten bald auch eine persönliche Begegnung mit Stach, bevor mein erster Versuch über Kafka unter dem Titel Der Bote bei Ulrich Keicher im schwäbischen Warmbronn als intime Broschur erschien.
Eine Frucht des Treffens im Garten des Berliner Literaturhauses war unser Gespräch für das Sonderheft der Neuen Rundschau. In Hüter der Verwandlung sprachen Stach und ich, veranlasst durch Sebastian Guggolz, zum Kafka-Jahr über die biographische Arbeit zu Kafka und seine besondere Methode. In der Folge hielt ich selbst auch Vorträge über Krankheit als Passion bei Kafka. Sie fanden in Kliniken alter Freunde statt, die, im Gegensatz zu mir, bei der Psychiatrie als Beruf geblieben waren. Öffentliche Gespräche mit Reiner Stach regten zudem an, die weiteren Überlegungen zum Fall Kafka in einen zweiten Essay münden zu lassen. Der Beobachter will den besonderen Habitus kennzeichnen, mit dem Kafka sein Leben führte, und auch die Bedeutung, welche seine vulnerable Persönlichkeit und die Tuberkulose dabei im Verhältnis von Kunst und Krankheit besaßen.
II.
Dass dieses Triptychon von Texten noch gesammelt zum Ende des Kafka-Jahres erscheinen kann, ist meinem Verleger Heinrich von Berenberg zu danken. Nach der Lehrzeit bei Klaus Wagenbach, dem ersten Biographen Kafkas nach 1945, lag sein Interesse nahe, zumal ihm selbst schon als Schüler die späten Erzählungen aufgefallen waren. Ihn faszinierte besonders der Gedanke, dass für Franz Kafka die ausgeprägte Nervosität und die spätere Tuberkulose Brücken in die Freiheit des Schreibens darstellten. Wir sprachen über Parallelen zu Max Weber und Aby Warburg, die als Forscher zu jener Zeit gravierende psychische Störungen erlitten, aber sie zugleich nutzen, um unabhängig vom fachlichen Zwang ihren Studien zur modernen Lebenswelt zwischen allen Disziplinen nachzugehen. Den Heidelberger Soziologen hatten um 1900 nervöse Störungen bewogen, sein volkswirtschaftliches Lehramt niederzulegen, während der Hamburger Bildwissenschaftler in der Weimarer Republik nach Jahren der klinischen Behandlung bei Ludwig Binswanger die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg ausdrücklich als Medium des »Seismographischen« etablierte. Beide Forscher sahen sich wie der Schriftsteller Kafka als Patienten mit der Herausforderung konfrontiert, die Problematik des modernen Menschen psychodynamisch und philosophisch an sich selbst zu erfahren und in ihren interdisziplinären Gedankenbewegungen genauer zu ergründen.
Schließlich war jüngst verblüffend, bei der erneuten Lektüre des Zauberberg zu entdecken, wie Thomas Mann die humanwissenschaftliche Passion, den Menschen detailliert zu verstehen, in schillernder Beiläufigkeit verdichtete. Sein zeitgemäßer Charakter Hans Castorp, der sich auf der Davoser Hochebene für das »Porträt« interessiert, bringt den neuen Enthusiasmus zur Sprache, zwischen Wissenschaft und Kunst vorläufige Bilder einzelner Menschen zu entwerfen. Hofrat Behrens, dem Arzt, gegenüber stammelt der leicht an Tuberkulose erkrankte Ingenieur, der sich in der illustren Gesellschaft auf humanistischen Abwegen befindet: »Womit beschäftigt sich die medizinische Wissenschaft? Ich verstehe ja natürlich nichts davon, aber sie beschäftigt sich doch mit dem Menschen. Und die Juristerei, die Gesetzgebung und Rechtsprechung? Auch mit dem Menschen. Und die Sprachforschung, mit der ja meistenteils die Ausübung des pädagogischen Berufs verbunden ist? Und die Theologie, die Seelsorge, das geistliche Hirtenamt? Alle mit dem Menschen, es sind alles bloß Abschattierungen von ein und demselben wichtigen und … hauptsächlichen Interesse, nämlich dem Interesse am Menschen«.
Franz Kafka, der noch im März 1924 überlegte, sich nach Davos zu begeben, lässt sich als äußerst eigenwilliger Fall eines solchen Menschen, der nach dem Ganzen des Lebens fragt, besser verstehen. Hierfür ist besonders geeignet die Kunst des interdisziplinären Essays, die Reiner Stach in seiner dreiteiligen Biographie stilistisch zur eigenen Form werden ließ.
Bei Kafka wie in den Fällen von Weber und Warburg war nicht nur der psychodynamische Blick nach innen entscheidend, den Sigmund Freund entwickelt hatte, sondern ebenso die philosophisch-religiöse Frage nach einer letzten Wahrheit, die Søren Kierkegaard und Leo Tolstoi seit Mitte des 19. Jahrhunderts neu formuliert hatten. Als extreme Charaktere wussten alle drei, nicht fern von Nietzsche, dem psychisch verletzten Pfarrerssohn, dass mit dem Verlust endgültiger Antworten nicht die vorläufige Frage nach dem Sinn des Ganzen obsolet geworden war. Aber ebenso bewusst war ihnen, dass die wissenschaftliche Weltanschauung trotz Aufklärung und Fortschritt begrenzt blieb und die alte Sehnsucht nach einem umfassenden Sinn enttäuschen musste. So waren sie alle gesellschaftliche Dystopiker, die noch als Einzelne von der Utopie des individuellen Bewusstseins inmitten kollektiver Bekenntnisse überzeugt blieben, auch wenn sie keine Heilslehren mehr zu formulieren wussten.
Der Prager Schriftsteller spiegelte sich selbst schon früh in dem Künstlertypus, den Thomas Mann in Tonio Kröger der bürgerlichen Avantgarde seiner Zeit mit seinem »Kainsmal« wohldosiert vor Augen geführt hatte. Dieser Typus tritt kurz im Zauberberg auf, scharf konturiert im Kontrast zu Hans Castorp, dessen Mittelmäßigkeit nach Mann für das Zeitalter repräsentativ ist. An der Ausnahmefigur veranschaulicht er im Zauberberg die besondere Verbindung zwischen religiösen Motiven und nervösen Symptomen, die Weber, Warburg und Kafka als außergewöhnlich gewissenhaften Charakteren auf ganz unterschiedliche Weise anders zu eigen war: »[W]enn das Unpersönliche um ihn her, die Zeit selbst der Hoffnungen und Aussichten bei aller äußeren Regsamkeit im Grunde entbehrt, wenn sie sich ihm als hoffnungslos, aussichtslos und ratlos heimlich zu erkennen gibt und der bewußt oder unbewußt gestellten, aber doch irgendwie gestellten Frage nach einem letzten, mehr als persönlichen, unbedingten Sinn aller Anstrengung und Tätigkeit ein hohles Schweigen entgegensetzt, so wird gerade in Fällen redlicheren Menschentums eine gewisse lähmende Wirkung solches Sachverhalts fast unausbleiblich sein, die sich auf dem Wege über das Seelisch-Sittliche geradezu auf das physische und organische Teil des Individuums erstrecken mag.«
Dieser Essay will solche Facetten bei Franz Kafka, der psychosomatisch im tieferen Sinne erkrankt und zugleich literarisch begabt war, aufzeigen. Als Schriftsteller schuf er ein Werk, das 100 Jahre nach seinem Tod neben jenem von Thomas Mann in der modernen Weltliteratur auf einzigartige Weise für den deutschen Sprachraum steht. Es ist, als spräche der Lübecker vom Prager Schriftsteller, wenn es im Zauberberg weiter über solch beachtliche Menschen heißt, die eigenwillig nach dem Sinn des Ganzen suchten: »Zu bedeutender, das Maß des schlechthin Gebotenen überschreitender Leistung aufgelegt zu sein, ohne daß die Zeit auf die Frage Wozu? eine befriedigende Antwort wüßte, dazu gehört entweder eine sittliche Einsamkeit und Unmittelbarkeit, die selten vorkommt und heroischer Natur ist, oder eine sehr robuste Vitalität.«
III.
Jenen Typus außergewöhnlicher Sensibilität, der nach Thomas Mann versucht, sich nicht in den »Wonnen der Gewöhnlichkeit« zu verlieren, zeichnet Kafka auf eigene Art in der Erzählung Frühes Leid, die seine letzte Textsammlung Der Hungerkünstler eröffnet. Das spektakuläre Vermögen des Trapezkünstlers ist nicht, in längerer Askese auf jede Nahrung zu verzichten. Dies kann der Hungerkünstler, der nie eine Speise fand, die ihm geschmeckt hätte. »Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle.« Während jener Zirkusmann ohne Nahrung im Stroh seines Käfigs unbeachtet endet, nachdem seine asketische Kunst dem Publikum langweilig wurde, rückt Kafka für den Trapezkünstler den Anfang eines artistischen Elends in den Blick. Auch dieser zeichnet sich als »außerordentlicher, unersetzlicher Künstler« aus, bewegt von einem »Streben nach Vervollkommnung«. Allerdings beherrscht dieser idealistische Zug den Trapezkünstler so tyrannisch«, dass er »Tag und Nacht« auf seinem Posten unter der Zeltkuppel bleibe. Lediglich für die unabdinglichen Reisen des Wanderzirkus, die »peinlich« seien, das heißt »für die Nerven des Trapezkünstlers jedenfalls zerstörend« wirkten, gibt dieser unfreiwillig seine dem »Blick sich fast entziehende Höhe« auf, um im Gepäcknetz des Zuges die Reise abzuwarten.
Während der Hungerkünstler sich zuletzt somatisch verzehrte, ist der Trapezkünstler bald psychisch belastet, beständig mit seinen »Tränen« kämpfend. Auch ein zweites Trapez, das seine Kunstfertigkeit erhöhen soll, kann ihn nicht beruhigen, zumal eine weitere Stange zum Balancieren ausbleibt. Das Schicksal des Mannes ist leider besiegelt, so dass bald Falten auf dessen »glatter Kinderstirn sich einzuzeichnen begannen«.
Kafka schließt mit beiden Künstlerfiguren im Sinne von Thomas Mann den problematischen Kreis des Lebens. Sie tragen jeweils allegorisch Züge seines eigenen Selbstverständnisses als Künstler. Der untröstliche Mann am Trapez, der unter der Kuppel keinen Frieden mehr findet, eröffnet als Artist das Aufbegehren gegen die unvollkommene Welt. Und der Verendende beschließt im Hunger das Schicksal der künstlerischen Suche nach einem Sinn des Ganzen.
Das vergebliche Bemühen des Künstlers ist autobiographisch nochmals stärker zugespitzt in Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse, der letzten Erzählung des Bandes. Denn die seltsame Sängerin erinnert mit dem immer kläglicher vernehmbaren »Pfeifen« an die Realität der Tuberkulose, die Kafkas Leben zunehmend einschränkte und schließlich vernichtete. Die Erzählung über die fabelhafte Figur zeichnet das Spannungsverhältnis nach, das Kafka selbst zwischen der inneren Berufung als Schriftsteller und dem äußeren Dasein als Versicherungsbeamter erfahren hatte. So prägt auch die musikalische Maus Josefine das lebenslange Bemühen, Erlösung vom lästigen Amt zu finden: »Schon seit langer Zeit, vielleicht schon seit Beginn ihrer Künstlerlaufbahn, kämpft Josefine darum, daß sie mit Rücksicht auf ihren Gesang von jeder Arbeit befreit werde.« Aber ihr »Volk«, das sich fruchtbar vermehrt, während sie allein und kinderlos bleibt, sieht nur die »Sonderbarkeit dieser Forderung«, erwachsen aus einer merkwürdigen »Geistesverfassung«. Allerdings fügt sich Josefine, die wie Kafka keine Familie begründete, einem Kompromiss und bittet zumindest um »Anerkennung ihrer Kunst«.
Zuletzt flüchtet sie nicht nur in die »Empfindlichkeit ihres Körperchens«. Neben der somatischen Krankheit zeigt Josefine auch psychisch bedingte Symptome wie »Müdigkeit« und »Mißstimmung«, so dass sie das Interesse der Öffentlichkeit nicht nur mit ihrem »Konzert« weckt, sondern auch als Kranke ein illustres »Schauspiel« bietet, bis sie mit »undeutbaren Tränen« ihre letzten Gesänge anstimmt.
All dies spiegelt den lebensweltlichen Erfahrungsraum Franz Kafkas. Dieser scheint in der Erzählung nochmals auf, wenn Josefines furchtbares Schicksal zur Sprache kommt, von der Nachwelt nicht erinnert zu werden. Dies musste auch Kafka fürchten, fanden seine kurzen Texte zu Lebzeiten im großen Publikum doch kaum Resonanz und blieben die drei Romane allesamt als Fragmente unveröffentlicht. Die enttäuschte Maus – und mit ihr der todkranke Kafka, der seinem Erzähler die Worte in den Mund legt – darf sich mit dem beruhigenden Hinweis trösten, dass dies allen »außerordentlichen« Menschen geschehe und eine Form der »Erlösung« biete: »Josefine aber, erlöst von der irdischen Plage, die aber ihrer Meinung nach Auserwählten bereitet ist, wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unsers Volkes, und bald, da wir keine Geschichte treiben, in gesteigerter Erlösung vergessen sein wie alle ihre Brüder.«
In den späten Jahren forcierte Kafka scheinbar das mögliche Vergessen, indem er den Freund Max Brod schriftlich anwies, er möge Texte und Briefe aus der Zerstreuung sammeln und sichten, um sie dann jedoch den Flammen zu übergeben. Aber nachdem sich Brod dem provokativen Ansinnen des posthumen Brandopfers verweigert hatte, fand Kafkas Werk langsam den Weg in die Öffentlichkeit. Vielleicht spielt der alttestamentliche Mythos von Abraham, der bereit ist, seinen Sohn auf dem Altar zu verbrennen, und den ein Engel von dem schrecklichen Tun abhält, auch in dieser Hinsicht für den jüdischen Schriftsteller eine wichtige Rolle, seit er Furcht und Zittern von Søren Kierkegaard gelesen hatte. Die Idee des göttlichen Segens, der aus einem unscheinbaren Anfang eine unabsehbare Wirkung schafft, oder die antike Idee des Ruhms, der ein Leben nachträglich erhebt, wurden in Kafkas Fall Jahrzehnte nach seinem Tod zum Ereignis, das vom Autor in seiner paradoxen Anweisung an Max Brod angebahnt wurde.
Heute ist Kafkas Werk aus dem Gedächtnis der Menschheit nicht mehr wegzudenken. Er spricht vom und zum einzelnen Menschen in einersinnwidrigen Welt, die uns alle bedrängt, von innen wie außen, ohne als Schriftsteller irgendeine Form der Erlösung anzubieten. Er hat keine letzte beglückende Botschaft und bleibt der Beobachter menschlichen Unglücks, der den Lebensvollzug scheut, aber es gerade deshalb im Schreiben so genau wahrnimmt. Allerdings etwas Trost wollen seine Worte im ästhetischen Spiel über die möglichen Erkenntnisse hinaus spenden, die seine vielschichtigen Bewusstseinszustände uns bieten. So schreibt Kafka im Tagebuch: »Mir ist immer unbegreiflich, daß es jedem fast, der schreiben kann, möglich ist, im Schmerz den Schmerz zu objektivieren, so daß ich z. B. im Unglück, vielleicht noch mit dem brennenden Unglückskopf mich setzen und jemandem schriftlich mitteilen kann: Ich bin unglücklich.« Solch tiefsinniges Künstlertum wird bei ihm auch durch Nervosität und Tuberkulose entbunden, gründet aber vor allem im Geheimnis des Schreibens, dessen merkwürdige Quelle Kafka in der erstaunten Frage umreißt: »Was für ein Überschuß ist es also?«
Hüter der Verwandlung
Ein Gespräch mit Reiner Stach
Bormuth: Lieber Reiner Stach, seit 1996 haben Sie in drei Bänden Leben und Werk von Franz Kafka beschrieben. Es entstand in 18 Jahren ein biographisches Werk eigenen Rechts. Darin porträtieren Sie auf rund 2000 Seiten den Schriftsteller im zeit- und kulturhistorischen Horizont. Wie wird man zum Biographen Kafkas, der im Juni 1924 mit knapp 41 Jahren verstarb?
Stach: Ich las Franz Kafka schon als Jugendlicher, angeregt von älteren Schulfreunden. Allerdings war ich auf die Lektüre in keiner Weise vorbereitet. Ich weiß noch, wie mich – wohl mit fünfzehn Jahren – Der Proceß erheiterte. Ich konnte die Tragik des Romans noch nicht erfassen. Wir waren in Pforzheim von den Lehrern mit solcher Lektüre alleingelassen. Auch aktuelle Autoren wie Sartre und Camus waren in der Schule nicht präsent, ebenso wenig neuere Kulturtheorien wie die Psychoanalyse, die schon Kafka beeinflusst hatte. Ich las für mich Philosophen wie Schopenhauer und Nietzsche, auch das ohne Anleitung.
Bormuth: Sie entwickelten früh, um mit den Worten der späteren 1960er Jahre zu sprechen, ein emanzipatorisches Interesse, das im schulischen wie bürgerlichen Leben weitgehend ausgeklammert blieb.
Stach: Das Elternhaus war ganz literaturfern. Mein Vater, der 1954 aus der DDR in den Westen geflohen war, interessierte sich als Fernsehingenieur nur für berufliches Fortkommen und einen gewissen Lebensstandard. Ich sollte irgendetwas lernen, womit man Karriere machen konnte, möglichst etwas Technisches. Und die wichtigste Regel war: keine Verschwendung, keine Schulden machen, alles aus eigener Kraft schaffen. Ich wurde streng gemaßregelt, sollte mich völlig auf die schulischen Leistungen konzentrieren und durfte abends nicht meine Freunde sehen. Es waren aber gerade diese eskalierenden Spannungen, die mir allmählich Angst machten, unter solchen Umständen das Abitur nicht zu schaffen. Außerdem hatte ich natürlich Angst vor dem Vater.
Bormuth: In welcher Weise?
Stach: Er reagierte durchaus aggressiv, ein offenes Wort war kaum möglich. So trat ich die Flucht nach innen an, verfolgte meine literarisch-philosophischen Interessen und wurde zu einem ziemlich guten Schachspieler. Das war eine Art von narzisstischer Kompensation, um die Selbstachtung nicht vollends zu verlieren.
Bormuth: Sie hätten selbst auch einen Brief an den Vater schreiben können, wie es Kafka tat, um dessen Machtgebaren als bürgerlicher Aufsteiger zu entlarven.
Stach: Das stimmt, aber Kafka verzichtete auf Schuldzuweisungen, da hätte mein Brief wohl etwas anders ausgesehen. Mein Denken richtete sich direkt gegen die Eltern. Was sie selbst durchgemacht hatten, um so zu werden, wie sie waren, interessierte mich überhaupt nicht.
Bormuth: Sie hatten ein tiefes Freiheitsbedürfnis ausgebildet.
Stach: Das war wohl auch der Grund dafür, warum ich den Existentialismus so schätzte. Er stand dafür, dass dieses Begehren unzerstörbar ist, dass man keinem Menschen die Freiheit völlig nehmen könne – wovon übrigens auch Kafka überzeugt war, wie ich später erfuhr. So entschied ich mich mit siebzehn Jahren, das Elternhaus zu verlassen.
Bormuth: Eine umwälzende Entscheidung.
Stach: Ein Sprung ins eiskalte Wasser. Denn ich hatte überhaupt kein Geld und war darauf angewiesen, dass mich die Familie eines Klassenkameraden für eine Weile aufnahm. Zum Abitur hatte ich erstmals ein Zimmer für mich, ein Kämmerchen. Da ich nach der Schule das Studium selbst finanzieren musste, arbeitete ich länger in einer Pforzheimer Fabrik, bis ich nach einem guten Jahr genügend Geld beisammen hatte.
Bormuth: Sie verfolgten also eine ganz andere Strategie als Franz Kafka, um sich von der Familie zu lösen.
Stach: Ich zog die radikalen Konsequenzen, die ihm nicht lagen, aber alles war mit einer fürchterlichen Angst verbunden.
Bormuth: Wie ging es für Sie weiter?
Stach: Ich kannte nur wenige Erwachsene, die mich hätten beraten können, und Kontakte in die großen Universitätsstädte hatte ich natürlich auch nicht. Aber ich hatte begonnen, mich mit Kritischer Theorie zu beschäftigen. Daher entschied ich mich für Frankfurt, den Ort, an dem Theodor W. Adorno und Max Horkheimer das Institut für Sozialforschung neu begründet hatten.
Bormuth: Es ging um ein intellektuelles Versprechen umfassender Befreiung.
Stach: