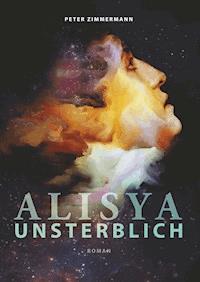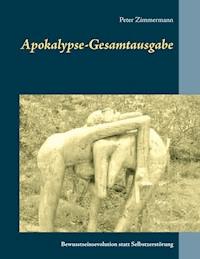31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Traumafolgestörungen
- Sprache: Deutsch
Wenn professionelle Helfer Hilfe brauchen Einsatzkräfte sind im Dienst vielfältigen psychosozialen Stressoren ausgesetzt. Neu ist dabei die Erkenntnis, dass Verletzungen der persönlichen Wertvorstellungen, sogenannte »moral injuries«, bei der Verarbeitung von Einsätzen eine große Rolle spielen und erhebliche psychische Belastungen hervorrufen können. Dieses Buch bietet TherapeutInnen und psychosozialen BegleiterInnen neben einem leicht verständlichen Einstieg zahlreiche Anregungen für die Präventionsarbeit und Therapie. Ergänzt wird das Werk durch Beiträge aus der Seelsorge, die zusätzliche Hilfestellungen geben. Erstes deutschsprachiges Werk zu moralischen Verletzungen Detaillierte Einführung ins Thema mit zahlreichen Fallbeispielen Mit zwei praxisorientierten Manualen zur Präventionsarbeit und Therapie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Zimmermann
Trauma und moralische Konflikte
Einführung und Manual für die präventive und therapeutische Arbeit mit Einsatzkräften
Unter Mitarbeit von Christian Fischer und Thomas Thiel
Klett-Cotta
TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN – VORBEUGEN, BEHANDELN UND REHABILITIEREN
Herausgegeben von Robert Bering und Christiane Eichenberg
Hochwasser, Corona, häusliche Gewalt, Amokläufe – psychische Beeinträchtigungen als Folge von Gewalt, Unfällen oder Naturkatastrophen finden in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen zunehmend Aufmerksamkeit und stellen Psychotherapeutinnen und sozialpädagogische Helfer vor besondere Herausforderungen. Die psychosoziale Versorgung nach potenziell traumatisierenden Erfahrungen reicht von der Psychosozialen Akuthilfe über eine Psychotherapie bis zur Rehabilitation am Ende einer Versorgungskette.
Die einzelnen Bände der Reihe informieren über die Methoden der psychosozialen Versorgung für einzelne Risikogruppen, die Möglichkeiten der Prävention von Belastungsstörungen und innovative Wege der Beratung und Behandlung bei unterschiedlichen Traumata und Verlaufstypen.
Die HerausgeberInnen:
Robert Bering, Prof. Dr., war Mitgründer und zuletzt Chefarzt des Zentrums für Psychotraumatologie/Klinik für psychosomatische Medizin der Alexianer Krefeld GmbH. Heute lehrt er an der Universität zu Köln und ist leitender Arzt der Regionspsychiatrie Mitte-West in Dänemark.
Christiane Eichenberg, Prof. Dr., ist Leiterin des Instituts für Psychosomatik der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Fakultät für Medizin.
Die Einzelbände behandeln folgende Themen:
1. Band: Trauma und moralische Konflikte
2. Band: Kompendium Komplexe Psychotraumafolgen (Herbst 2022)
3. Band: Trauma und digitale Medien – Therapeutische Möglichkeiten und Gefahren (Frühjahr 2023)
4. Band: Krisenintervention und Akuttherapie (Frühjahr 2023)
5. Band: Trauma und Gegenübertragung (Herbst 2023)
Weitere Bände in Vorbereitung
Impressum
Die digitalen Zusatzmaterialien haben wir zum Download auf www.klett-cotta.de bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM96475
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart,
unter Verwendung einer Abbildung von Adobe Stock/Thomas Söllner
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Altusried-Krugzell
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-96475-2
E-Book ISBN 978-3-608-11890-2
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20575-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Geleitwort der Reihenherausgeber
Dank
Trauma und Moral – eine Einführung
Vielfältige Traumafolgen
Besonderheiten bei Einsatzkräften
Hinweise
Kapitel 1
Trauma und Traumafolgestörungen
1.1 Grundlagen und Prävention
1.1.1 Pathogenese und Verlaufstypen
1.1.2 Gesprächsführung und Diagnosestellung bei posttraumatischen Erkrankungen
1.1.3 Epidemiologie posttraumatischer psychischer Erkrankungen
1.1.4 Prävention von Traumafolgestörungen
1.1.5 Psychische Traumafolgestörungen
1.2 Behandlung und Begutachtung
1.2.1 Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen
1.2.2 Rehabilitation bei Traumafolgestörungen
1.2.3 Begutachtung von Traumafolgestörungen
Kapitel 2
Bedeutung moralischer Konflikte in der Psychotraumatologie
2.1 Grundlagen und Prävention
2.1.1 Begriffe und Modelle
2.1.2 Bedeutung moralbezogener Ansätze in der Psychotherapie
2.1.3 Moralbasierte Theorie- und Therapiekonzepte
2.1.4 Definition und allgemeine Bedeutung von Wertorientierungen
2.1.5 Moralische Verletzungen (Moral Injury)
2.1.6 Pathogenese moralischer Verletzungen
2.1.7 Soziale und physiologische Bedeutung von Wertorientierungen und moralischen Konflikten
2.1.8 Moralische Verletzungen in verschiedenen Berufsfeldern von Einsatzkräften
2.1.9 Prävention moralischer Verletzungen bei Einsatzkräften
2.1.10 Trauma- und moralbezogene Selbstfürsorge bei professionellen Helfern
2.2 Behandlung moralischer Konflikte
2.2.1 Allgemeine Grundsätze
2.2.2 Spezielle Therapieformen: Adaptive-Disclosure-Therapie
2.2.3 Spezielle Therapieformen: Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT)
2.2.4 Spezielle Therapieformen: Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT)
2.2.5 Spezielle Therapieformen: Weisheitstherapie
2.2.6 Spezielle Therapieformen: Spirituelle Begleitung
Kapitel 3
Moralische Verletzungen und Wertorientierungen – eine theologische Perspektive
3.1 Über die Möglichkeit moralischer Veränderungen – Biblische Ressourcen
3.1.1 Zugänge
3.1.2 Lot und seine Familie
3.1.3 »Ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen« (Matthäus 5,17)
3.1.4 Perspektiven
3.2 Militärseelsorge als Partnerin im psychosozialen Netzwerk
3.2.1 Allgemeines
3.2.2 Arbeitsfeld Seelsorge für unter Einsatz- und Dienstfolgen leidende Menschen (ASEM)
Kapitel 4
Schulungsmanual für die Primär- und Sekundärprävention einsatzbezogener moralischer Konflikte
Hinweise zur Anwendung
4.1 Allgemeine Stressprävention
4.1.1 Psychoedukation
4.1.2 Aktivierung von Ressourcen
4.1.3 Umgang mit unterstützenden Medien
4.1.4 Früherkennung krankheitswertiger Entwicklungen
4.2 Werte- und moralspezifische Prävention
4.2.1 Psychoedukation: Definition und Bedeutung von Wertorientierungen
4.2.2 Prävention durch Stärkung persönlicher Wertorientierungen
4.2.3 Wertebezogene Sekundärprävention nach Einsätzen
4.2.4 Psychoedukation: Definition und Bedeutung von moralischen Verletzungen
4.2.5 Prävention moralischer Verletzungen durch Verbesserung der moralischen Urteilsfähigkeit
4.2.6 Moralbezogene Sekundärprävention nach Einsätzen: Umgang mit moralischen Verletzungen
4.3 Abschluss der Schulung
Kapitel 5
Manual zum therapeutischen Umgang mit moralischen Konflikten
5.1 Einführung
5.1.1 Überblick und Ziele
5.1.2 Indikationen
5.1.3 Durchführung und Ablauf
5.1.4 Therapeutischer Rahmen
5.1.5 Inhaltliche Vorbereitung
5.1.6 Praktische Durchführung
5.1.7 Methodische Hinweise
5.1.8 Einleitung der Gruppenarbeit und Gruppenregeln
5.1.9 Bewältigung von Anspannung
5.1.10 Wertschätzungskarten
5.2 Modul 1: Bedeutung von Wertorientierungen
5.2.1 Was sind Wertorientierungen?
5.2.2 Wie stehen Werte mit (psychischer) Gesundheit in Verbindung?
5.3 Modul 2: Individuelle Wertorientierungen und Wandlungsprozesse
5.3.1 Welche Wertorientierungen sind für die Teilnehmenden von besonderer Bedeutung?
5.3.2 Wandel von individuellen Wertorientierungen
5.3.3 Umgang mit dem Wandel von Werten
5.4 Modul 3: Moralische Verletzungen durch das Verhalten anderer
5.4.1 Vermittlung allgemeiner Informationen zu moralischen Verletzungen
5.4.2 Besprechung der psychischen Folgen der moralischen Verletzung
5.4.3 Therapeutische Hinweise zum Umgang mit Zorn
5.4.4 Die moralische Verletzung konstruktiv transformieren
5.5 Modul 4: Moralische Verletzungen durch eigenes Verhalten
5.5.1 Charakterisierung moralischer Verletzungen durch eigenes Verhalten
5.5.2 Thematisierung von Schuld und Scham
5.5.3 Therapeutische Hinweise zum Umgang mit Schuld und Scham
5.6 Abschluss und weitere therapeutische Schritte
Literatur
Stichwortverzeichnis
Gewidmet allen Menschen, die in Einsatzdiensten tätig sind – mit dem uneingeschränkten Respekt, den sie verdienen.
Geleitwort der Reihenherausgeber
Trauma und moralische Konflikte: Erst kürzlich waren wir Zeitzeugen, wie sich die USA und ihre Verbündeten nach 20-jährigem Krieg aus Afghanistan zurückgezogen und die alten Machthaber das Land wieder übernommen haben. Auch für die Deutsche Bundeswehr endete damit ein verlustreicher Einsatz – viele ringen mit der Frage der Legitimation. Wir erinnern uns an den Vietnamkrieg, der mit den seelisch hochbelasteten Kriegsveteranen Ausgangspunkt für die Einführung der Posttraumatischen Belastungsstörung 1980 im DSM-III war. In Deutschland hat der Balkankrieg und die Stationierung deutscher Truppen im Kosovo und – im Gefolge des Afghanistan-Einsatzes – in Mali zu Fragen nach der deutschen Verantwortung geführt und brachte Kriegshandlungen wieder in die gesellschaftliche Gegenwart.
Aus heutiger Sicht wissen wir, dass Verletzungen der persönlichen Wertvorstellungen, sogenannte »moral injuries«, bei der persönlichen Aufarbeitung von potenziell traumatischen Erlebnissen eine große Rolle spielen. »Moral injuries« können teilursächlich für die Entstehung von Belastungsstörungen sein bzw. der Ausheilung im Wege stehen. Wie können Psychotraumatologen helfen? Sind wir auf diese Herausforderungen genügend vorbereitet? Eine Antwort geben Prof. Dr. Peter Zimmermann – Chefarzt der psychiatrischen Klinik des Bundeswehrkrankenhauses Berlin – und seine Mitautoren Christian Fischer und Thomas Thiel in diesem Buch.
Das Buch ist die erste Abhandlung im deutschsprachigen Raum, die zugleich Behandlungsmanuale und die theoretische Grundlage liefert, wie »moral injuries« vorgebeugt bzw. spezifisch behandelt werden können. Hierbei findet die Leserschaft auch eine Aufarbeitung der Thematik aus theologischer Sicht. Die Seelsorge bekommt hierdurch einen besonderen Stellenwert. Die Autoren zeigen, dass »moral injuries« zwar aus der Militärpsychotherapie kommen, aber die Mechanismen des Zusammenspiels von Traumatisierungen und Wertvorstellungen weit über die Zielgruppe von Soldaten im Einsatz hinausreichen. Es geht um das Ringen von Glaubwürdigkeit an selbst gesetzten Maßstäben, das auch Polizistinnen, Einsatzkräfte der Feuerwehr, Ersthelferinnen, Journalisten und Leitungskräfte treffen kann.
Das Manual für die präventive und therapeutische Arbeit mit Einsatzkräften ist gleichzeitig der erste Band der Reihe »Traumafolgestörungen«, die sich an Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie an weitere fachnahe Berufsgruppen mit Schwerpunkt Psychotraumatologie richtet. Für alle mit traumatisierten Menschen arbeitenden Berufsgruppen ist unser Ansatz relevant: Eine Belastungsstörung ist nicht eine Momentaufnahme, sondern ein Prozess. Welche Richtung dieser Prozess einschlägt, wird durch das Bedingungsgefüge der Lebensgeschichte, der Situationsfaktoren und der Balance zwischen Risiko- und Schutzfaktoren in der Phase der Bewältigung bestimmt. Zu den relevanten Risikofaktoren gehören auch moralische Verletzungen, die spezifisch zu behandeln sind. Der vorliegende Band greift somit ein zentrales und bislang noch vernachlässigtes Thema auf, von dem heutzutage jedoch alle Traumatherapeuten, Traumaberaterinnen und weitere professionelle Helfergruppen Kenntnis haben sollten.
Robert Bering
Köln, im November 2021
Christiane Eichenberg
Wien, im November 2021
Dank
Meiner Frau für ihre stets geduldige und liebevolle Unterstützung meiner Arbeit.
Meinen Mitarbeitern im Bundeswehrkrankenhaus Berlin für ihre zahlreichen Anregungen und motivierte Mitarbeit bei der Behandlung traumatisierter und moralisch verletzter Patienten.
Unseren Patienten für ihre Bereitschaft, sich zu öffnen, und dafür, mit ihnen gemeinsam lernen zu dürfen.
Den Reihen-Herausgebenden Prof. Dr. Christiane Eichenberg und Prof. Dr. Robert Bering sowie auch Frau Andrea Richter und Frau Katja Burckhardt für die Durchsicht des Manuskriptes und die vielen hilfreichen Anregungen.
Trauma und Moral – eine Einführung
Psychische Traumatisierungen haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Fokus psychotherapeutischer Forschung und Praxis entwickelt. Dies führte zur Entwicklung zahlreicher theoretischer Modelle, aber auch wirksamer manualisierter Behandlungsansätze. Immer mehr ist verstanden worden, wie komplex sich die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen gestaltet.
Anfang der 1980er-Jahre wurde mit der dritten Revision des amerikanischen Diagnostic and Statistical Manual of Diseases (DSM-III) erstmals der Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) in die psychiatrische Diagnostik eingeführt. Dieser Schritt stellte einen Meilenstein in der Geschichte der Psychotraumatologie da, weil mit einer diagnostisch präzisen Beschreibung einer Traumafolgestörung in einem weitverbreiteten Klassifikationssystem eine fundierte klinische Akzeptanz dieser Störungsgruppe verbunden war. Neben der diagnostischen und gutachterlichen Klarheit konnten sich nun auch die Betroffenen deutlich besser mit ihrem Leiden wahrgenommen und verstanden fühlen. Dies wiederum ebnete den Weg für die Entwicklung therapeutischer Verfahren und auch für intensivierte wissenschaftliche Bemühungen.
Vielfältige Traumafolgen
Schon zu Beginn der Beschäftigung mit den psychischen Folgen von Traumatisierungen wurde allerdings deutlich, dass eine diagnostische Kategorie wie die PTBS allein nicht ausreichend ist, um der Vielzahl psychischer Reaktionsweisen gerecht zu werden. In den Anfangsjahren standen zunächst die angstbasierten Symptomkomplexe wie die PTBS oder Phobien mit Vermeidungsverhalten im Mittelpunkt der klinischen Forschung. Dabei konnten z. B. mit Verfahren wie der kognitiven Verhaltenstherapie therapeutische Verbesserungen mit beeindruckenden Effektstärken erreicht werden (Schäfer et al. 2019).
Bei Untersuchungen an speziellen Gruppen von Traumatisierten, wie Einsatzkräften und Soldaten, konnten mit diesen Ansätzen in Metaanalysen jedoch zum Teil nur enttäuschende Heilungserfolge belegt werden (Verstrael et al. 2013). Daraus leiteten sich Überlegungen ab, in diesen Personengruppen ergänzende Techniken und Methoden zur Anwendung zu bringen. Zu diesen gehörte auch die therapeutische Verarbeitung moralischer Verletzungen mit ihren Folgen wie Schuld, Scham oder Zorn. Diese haben als »Moral Injury« bereits eine umfangreiche Resonanz in der englischsprachigen Literatur erfahren, deutschsprachig ist dazu bislang nur wenig verfügbar.
Besonderheiten bei Einsatzkräften
Der therapeutische Umgang mit Einsatzkräften wie der Polizei, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten, den Hilfsorganisationen oder des Militärs ist zudem durch eine Reihe von Besonderheiten gekennzeichnet. Diese Systeme sind geprägt durch hierarchische Strukturen, aber auch durch altruistische, schützende Idealbildungen, die häufig nur wenig Raum für die emotionale Selbstreflexion oder für vermeintliche »charakterliche Schwächen« lassen. Der therapeutische oder beratende Zugang zu den Betroffenen trifft daher auf Vorbehalte, kann aber durch eine Grundkenntnis der Systemstrukturen erleichtert werden.
Dieses Buch soll dazu beitragen, das Verständnis für die psychischen Prozesse und Veränderungen zu vertiefen, die sich bei traumatisierten Menschen, insbesondere bei Einsatzkräften, abspielen. Es soll einen Eindruck von der komplexen Vernetzung zwischen direkten psychischen Traumafolgen und wertebezogenen, moralischen Reaktionsmustern vermitteln. Es kann dadurch helfen, der Gefahr entgegenzutreten, dass sich diese Personengruppen im Rahmen von chronifizierten Krankheitsverläufen der Gesellschaft entfremden und aus ihren sozialen Bezügen herausfallen.
Neben den Grundlagen der Psychotraumatologie werden Modelle der Entstehung und Bedeutung von Wertorientierungen sowie moralischen Verletzungen und ihren psychischen Folgen dargestellt. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die beruflichen Erfahrungen von Einsatzkräften gelegt. Es werden zudem exemplarisch verschiedene Behandlungsansätze zur Bearbeitung von Traumatisierungen und ihren moralischen Folgen vorgestellt.
Eine wichtige Ergänzung stellen Perspektiven aus der interdisziplinären Zusammenarbeit dar, die für eine ganzheitliche Behandlung besonders wertvoll ist. Es wird daher in einem eigenen Kapitel eine geistliche Sichtweise der Problematik angeboten.
Im Anschluss werden ausgewählte Themenschwerpunkte in zwei systematischen Manualen zusammengefasst, die sich für die direkte Umsetzung in der Prävention und im therapeutischen Alltag eignen.
Hinweise
Für eine gendergerechte Schreibung haben wir möglichst neutrale Formulierungen wie »Behandelnde« und »Ärzteschaft« gewählt. Da diese nicht immer möglich sind, verwenden wir ansonsten in unsystematischer Reihenfolge mal die weibliche, mal die männliche Form (»Soldatinnen«, »Psychologen«). Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, sind immer mitgemeint.
Die Therapiemanuale bilden den zweiten, den Praxisteil dieses Buchs. Sie bauen zwar auf den theoretischen Grundlagen der vorherigen Kapitel auf, sollen aber in sich abgeschlossen und selbsterklärend sein, sodass sie direkt als Arbeitsgrundlage für therapeutische Interventionen verwendet werden können. Daher ist es unvermeidlich, dass es an einigen Stellen zu textlichen Wiederholungen kommt.
Kapitel 1
Trauma und Traumafolgestörungen
Moralische Aspekte von Traumafolgestörungen stellen den Schwerpunkt dieses Buches dar, daher wird in diesem Rahmen nur ein Überblick über die allgemeinen Grundlagen von psychischen Traumafolgen gegeben, um das Verständnis der Auswirkungen moralischer Konflikte zu erleichtern. Vertiefungen zu speziellen traumabezogenen Themenkomplexen finden sich in den weiteren Bänden dieser Buchreihe oder z. B. auch bei Eichenberg und Zimmermann (2017).
1.1 Grundlagen und Prävention
Das Erleben traumatischer Situationen und ihre psychische Verarbeitung verkörpern ein maßgebliches Thema der Sozial- und Medizingeschichte der Menschheit. Erste Berichte darüber entstanden bereits in der Antike, finden sich z. B. in dem Epos »Ilias« des griechischen Dichters Homer, und setzen sich bis in die jüngste Neuzeit fort, unter anderem auch als eine Geschichte der Kriege und Katastrophen, in denen militärische und nichtmilitärische Einsatzkräfte eine wesentliche Rolle spielen (Shay 1998).
1.1.1 Pathogenese und Verlaufstypen
Traumatische Situationen. Die posttraumatische Belastungsstörung nimmt unter den psychischen Erkrankungen eine Sonderstellung ein, weil in ihren diagnostischen Kriterien die Ätiologie (die traumatische Situation) eine verbindliche Voraussetzung darstellt: »ein Ereignis oder ein Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde«. Dieses Traumakriterium der International Classification of Diseases der WHO in ihrer 10. Fassung (ICD-10) findet sich in ähnlicher Form auch in der zukünftig gültigen (1)ICD-11 sowie im US-amerikanischen (1)DSM-V wieder (siehe www.dimdi.de).
Bei dieser Formulierung wird der Versuch unternommen, den belastenden Charakter von Ereignissen von der subjektiven Sichtweise der Betroffenen zu lösen und eine objektive pathogenetische Dimension zu finden. Dies kann allerdings nur begrenzt gelingen, denn auch bei schwersten psychischen Belastungssituationen spielen Bewertungen und das emotionale Erleben der Betroffenen eine maßgebliche Rolle für die Verarbeitung.
So sind zwar beispielsweise Kriegserfahrungen zweifelsfrei traumatische Ereignisse, werden aber z. B. von gut ausgebildeten Soldaten anders erlebt, bewertet und psychisch verarbeitet als etwa von der Zivilbevölkerung oder von geflüchteten Menschen.
Pathogenese. Schon während der Exposition mit traumatischen Ereignissen beginnt ein Prozess der psychischen Auseinandersetzung und Verarbeitung, bei dem zahlreiche psychosoziale Schutz- und Risikofaktoren wirksam werden. Deren Zusammensetzung ist bei jedem Betroffenen individuell unterschiedlich. In den letzten Jahren hat sich eine Reihe von Studien mit den einzelnen Faktoren beschäftigt. Dabei ergaben sich verschiedene Wirkmechanismen, Interaktionen und auch Effektstärken. Eine Übersicht findet sich beispielsweise bei Maercker (2019).
Ein wichtiges Beispiel sind persönlichkeitsbezogene Einflussgrößen. Das Geschlecht, das Alter und die Intelligenz haben eine Bedeutung für die Traumaverarbeitung, aber auch biografische Belastungen, (1)Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitsmerkmale wie Optimismus, Kohärenzsinn (Antonovsky 1987) und nicht zuletzt Wertorientierungen (Zimmermann et al. 2014; Eichenberg & Zimmermann 2017).
Dazu kommen Bedingungen aus dem peritraumatischen und persönlichen Umfeld. Hier wären z. B. die Art der traumatischen Situation sowie die Dauer, Häufigkeit und Stärke ihrer Einwirkung zu nennen. Aber auch ergänzende Themenkomplexe sind von Bedeutung, weil sie mit der Kerndynamik interagieren und sich wechselseitig verstärken können: Ein Beispiel sind moralische Konflikte, die im Folgenden noch ausführlich betrachtet werden. Als besonders bedeutend hat sich in zahlreichen Studien die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung erwiesen. Ein stützendes und verständnisvolles soziales Umfeld ist einer der wichtigsten (1)Schutzfaktoren im Hinblick auf einen erfolgreichen Heilungsprozess (Brewin et al. 2000; Eichenberg & Zimmermann 2017).
Die psychischen und sozialen Reaktionen der Betroffenen nach Traumaeinwirkung (einschließlich der Entstehung psychischer Erkrankungen) hängen maßgeblich von der individuellen Zusammensetzung der oben genannten Schutz- und Risikofaktoren ab. So kann es bei einer günstigen Konstellation zu einer schnellen Spontanheilung kommen, die keine weiteren belastenden Folgen hinterlässt. Bei einem Überwiegen von Risikofaktoren bzw. einem Mangel an Schutzfaktoren können demgegenüber erhebliche psychische Belastungen und Krankheiten entstehen. Diese Vorstellungen bilden auch die Grundlage für systematische Evaluationen derartiger Faktoren (z. B. im »(1)Kölner Risiko-Index«) und daraus abgeleitete zielgruppenspezifische Interventionen (Fischer 2000).
(1)Neurobiologische Prozesse. Bei der Symptomentstehung spielen aber auch weitere psychische und neurobiologische Prozesse eine Rolle, die im Rahmen dieser kurz gefassten Darstellung nur angedeutet werden können. Eine Reihe von Botenstoffen im Gehirn ist an der Traumaverarbeitung beteiligt, so z. B. Cortisol und Noradrenalin. Diese stehen mit Veränderungen in der Hirnstruktur in einer komplexen Verbindung, die z. B. mit atrophischen Prozessen einzelner Regionen einhergehen können, wie etwa dem Hippocampus. Diese Veränderungen sind in Teilen durch Psychotherapie reversibel (Butler et al. 2018; Lester & Wong 2013; Schäfer et al. 2019).
Verlaufstypen. Aus den dargestellten pathogenetischen Mechanismen können sich verschiedene Verlaufstypen nach Traumatisierungen entwickeln. Eine Variante ist der (1)Sucht-Verlaufstyp, bei dem Suchtmittel, und insbesondere Alkohol, als »Selbstmedikation« zur Verminderung innerer Anspannung eingesetzt werden. Dazu kommen Verläufe mit anderweitigen im Vordergrund stehenden psychischen Symptomen wie der Angst-, Vermeidungs- oder Dissoziations-Verlaufstyp (Fischer & Nathan 2002; Nathan & Fischer 2001).
Besonders bedeutsam für Einsatzkräfte ist der leistungskompensatorische Verlaufstyp: Hierbei kommt es zu einer starken oder übersteigerten Arbeitsmotivation, die einen Versuch darstellt, empfundene Minderwertigkeit zu kompensieren – denn Arbeit kann mit sozialer Anerkennung und einem Gefühl von Akzeptanz einhergehen. Diese passt zu der helfenden und altruistischen Grundhaltung, die sich häufig bei Einsatzkräften findet. Im Lauf der Zeit kann es dann jedoch zu nachteiligen Folgen kommen, wie beispielsweise einer Burn-out-Symptomatik. Leistungskompensatorisches Verhalten kann zudem begünstigt werden, wenn es im Rahmen der Traumaverarbeitung, insbesondere bei moralischen Verletzungen, bei den Betroffenen zu Schuldgefühlen kommt. Konstruktive Aktivitäten wie Arbeit und Leistungserbringung können dann auch als Versuch einer Wiedergutmachung verstanden werden (Näheres dazu im Kap. 2.1.6. und 2.1.7).
1.1.2(1)Gesprächsführung und Diagnosestellung bei posttraumatischen Erkrankungen
Das Gespräch mit traumatisierten Menschen gehört in die Hand von erfahrenen psychosozialen Berufsgruppen wie von Ärztinnen, Psychiatern und Psychotherapeutinnen, Sozialarbeitern, Seelsorgerinnen und Pädagogen. Insbesondere zu Beginn eines beratenden Kontaktes dient es neben der Informationsgewinnung zur Herstellung einer Arbeitsbeziehung und zum Vertrauensaufbau und es können auch erste erklärende und stabilisierende Hinweise (Psychoedukation) integriert werden.
Gefahr von (1)Triggerungen. Die Gesprächsführung erfordert Feingefühl und therapeutisches Geschick, unter anderem weil die Klienten häufig stark verunsichert sind und zudem die Gefahr von Symptomtriggerungen besteht, wenn Traumaereignisse zu früh und zu intensiv angesprochen werden. Über diese Problematiken sollte bereits früh nach der Kontaktaufnahme gesprochen und Reaktionsweisen vereinbart werden. Beispielsweise ist es sinnvoll, einen für die Klientin sicheren Schutzraum zu schaffen, etwa durch Nutzung eines Gesprächsraums, der über eine angenehme Atmosphäre verfügt und betont ungestört ist. Für den Fall eines ansteigenden emotionalen Druckes kann zudem ein Stoppsignal abgesprochen werden (wie etwa eine Geste, ein Codewort), nach dem das Gespräch vorübergehend unterbrochen und/oder ein stabilisierendes therapeutisches Element eingefügt wird, z. B. eine Entspannungstechnik.
(1)Leitlinie PTBS. Die S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) von 2019 (Schäfer et al. 2019) empfiehlt eine Gesamtdiagnostik der PTBS, die nicht nur die Symptombelastung im engeren Sinne, sondern auch die aktuelle Lebenssituation, komorbide Symptome, Chronifizierungsfolgen im Alltag und salutogenetische (d. h. heilungsfördernde) Faktoren umfasst. In diesem Rahmen können auch erste Fragen zu moralischen Verletzungen oder zu Veränderungen von Wertorientierungen infolge der Traumaeinwirkung gestellt werden, ohne jedoch zu diesem frühen Zeitpunkt zu sehr ins Detail zu gehen, da die Klienten häufig mit derartigen Gedanken noch nicht vertraut sind.
Darüber hinaus gibt die Leitlinie Hinweise zur Reihenfolge des Vorgehens. So empfiehlt sich ein Beginn mit der spontan geschilderten Symptomatik und der Traumavorgeschichte (z. B. frühere Traumatisierungen, anderweitige biografische Belastungen); im Anschluss sind gegebenenfalls ein strukturiertes Interview sowie Fragebögen zur Symptomintensität hilfreich. Zusätzlich sollten Schutz- und Risikofaktoren erfasst werden, die Hinweise auf die Prognose und den weiteren Verlauf geben können.
(1)Traumainformierte Gesprächsführung. Speziell für Primärversorger wie Hausärztinnen oder soziale und seelsorgerische Dienste wurde das Konzept der traumainformierten Gesprächsführung in die Leitlinie aufgenommen. Handlungsleitend für die Gesprächsführenden sollten sein:
traumaspezifisches Wissen
Transparenz und ein individueller Zugang im Gespräch
Erfahrungen in der Anamneseerhebung und der strukturierten Dokumentation
Erfahrungen in der Krisenintervention im Falle psychischer Dekompensation
Thematisierung von sozialer Unterstützung
Beratung zur traumaspezifischen Behandlung
Weitervermittlung in multiprofessionelle Netzwerke
Die therapeutische Grundhaltung sollte geprägt sein von Empathie, Respekt, Ressourcenorientierung und Unterstützung bei der Affektregulation. Ein Vorgehen nach diesen Grundsätzen erzeugt bei den Traumatisierten ein Empfinden von Sicherheit, Kontrollierbarkeit und Entscheidungskompetenz.
Traumabezogene (1)Testungen. In den letzten Jahren sind zahlreiche psychometrische Testverfahren zur Diagnostik von Traumafolgestörungen entwickelt worden, es wird hier auf die entsprechenden ausführlichen Lehrbücher der Psychotraumatologie verwiesen (Maercker 2019; Seidler 2019; Eichenberg & Zimmermann 2017). Als kurze (1)Screeningverfahren für die Praxis werden in der Leitlinie die »kurze Screening-Skala für PTBS« sowie die »Primary Care PTSD Scale« empfohlen (Schäfer et al. 2019). Beide sind kostenfrei online verfügbar, zum Beispiel unter www.psychologie.uzh.ch.
1.1.3(1)Epidemiologie posttraumatischer psychischer Erkrankungen
Das Erleben eines traumatischen Ereignisses ist in der Allgemeinbevölkerung mit einer (1)Lebenszeitprävalenz von bis zu 84 % sehr häufig. Nicht in allen Fällen führt jedoch ein solches Erlebnis zu einer psychischen Erkrankung. Die in Studien gefundenen Prävalenzraten der posttraumatischen Belastungsstörung bei Einsatzkräften schwanken zwischen 5 und 30 %. Sie hängen unter anderem von der Art des Geschehens ab: die Bekämpfung großer Brände durch die Feuerwehr, der Schusswaffengebrauch bei Polizeikräften oder die Teilnahme an Kampfhandlungen im Militär hinterlassen besonders häufig psychische Schädigungen (Wittchen et al. 2013; Eichenberg & Zimmermann 2017).
1.1.4 Prävention von Traumafolgestörungen
Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention setzen in der Regel an einer Modifikation der geschilderten Einflussfaktoren an. Mit Primärprävention werden Hilfsangebote vor einem traumatischen Ereignis bezeichnet, Sekundärprävention greift nach dessen Einwirkung. Diese eignen sich insbesondere für das Arbeitsfeld von Einsatzkräften, denn hier betreffen traumatische Erlebnisse nicht selten ganze Einsatzgruppen (z. B. Löschzüge der Feuerwehr, Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, Kompanien der Bundeswehr). Zudem sind kritische Situationen je nach Art der Tätigkeit im Voraus absehbar, z. B. bei der Teilnahme an einem Auslandseinsatz. Dementsprechend liegt in diesem Bereich auch ein Schwerpunkt der bislang durchgeführten Präventionsstudien.
Inhaltlich wird dabei meist auf Techniken und Methoden zurückgegriffen, die in der Psychotraumatherapie gebräuchlich sind. Dazu gehören unter anderem Aufklärung zu Stress und Stressfolgen sowie Behandlungsoptionen (Psychoedukation), Stress- und Angstmanagement, Entspannungstechniken, Bewältigungsstrategien (Coping), Training der Wahrnehmung von Körperfunktionen, Emotionen und Gedanken (Biofeedback) sowie die Verbesserung von Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation.
Programme. Für eine Reihe von Zielgruppen wurden diese Elemente in Programmen zusammengefasst, zum Teil auch digitalisiert bzw. (1)onlinebasiert. So ist eine Mediensammlung zum Thema Psychotrauma auf der Website der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung unter www.dguv.de verfügbar. Die Bundeswehr hat 2020 die Website www.ptbs-hilfe.de des Sanitätsdienstes der Bundeswehr komplett überarbeitet und enthält nun auch eine Mediathek mit Lehrfilmen zu verschiedenen psychischen Krankheitsbildern. Beide Angebote sind frei verfügbar und auch für Einsatzkräfte gut verwendbar.
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde 2011 ein Manual entwickelt, das unter www.who.int im Internet kostenfrei erhältlich ist. Unter dem Titel »(1)Psychological First Aid – Guide for Field Workers« richtet es sich an Helfende, die unmittelbar nach Krisenereignissen belastete Betroffene unterstützen, jedoch meist nicht über eine psychotherapeutische Ausbildung verfügen. Es enthält eine Reihe von Anregungen, die nicht den Anspruch einer Therapie erheben, sondern eher supportiv und praxisnah orientiert sind. Ein wichtiger Leitgedanke ist dabei der Respekt vor der Würde, der Kultur und den Fähigkeiten der hilfsbedürftigen Menschen.
Frühintervention. Frühinterventionen werden in den ersten Wochen nach einem traumatischen Ereignis angeboten. In diesem Zeitfenster spielt Psychoedukation eine wichtige Rolle, es sind aber auch weitere Angebote empfehlenswert, die bereits in diesem frühen Stadium die Traumaverarbeitung fördern und persönliche Ressourcen stärken können. So wurde beispielsweise festgestellt, dass Serious Gaming, d. h. die Anwendung eines Computerspiels wie »Tetris« für ca. 30 bis 60 Minuten unmittelbar nach dem Trauma, die Engrammierung (Einprägung) und Chronifizierung traumatischer Sinneseindrücke erschweren und den Spontanheilungsprozess unterstützen kann (Holmes et al. 2009).
Die Verbesserung des Schlafes ist ein weiterer Schwerpunkt: Neben Entspannungstrainings können auch Medikamente zum Einsatz kommen, wie beispielsweise Trimipramin (10 bis 30 mg als Tropfen zur Nacht) oder Mirtazapin Schmelztabletten 15 bis 30 mg zur Nacht. Auf Substanzen mit Suchtpotenzial wie Benzodiazepine oder Alkohol sollte verzichtet werden.
Diese Empfehlungen können beispielsweise bereits in einer Erstberatungssituation wie in einer medizinischen Notaufnahme gegeben werden. Im Gespräch sollte zusätzlich die Aktivierung von persönlichen Ressourcen wie Hobbys und körperliche bzw. sportliche Aktivitäten zur Sprache kommen. Von besonderer Bedeutung sind soziale Kontakte und soziale Unterstützung. Allerdings nehmen gerade Einsatzkräfte diese oft zu wenig ernst, sodass eine gezielte Thematisierung (Beispiel s. Kap. 1.1.5) zur Verbesserung ihrer Nutzung im Alltag hilfreich sein kann (Eichenberg & Zimmermann 2017).
Nach einer ersten Intervention dieser Art sollten die Betroffenen noch für eine gewisse Zeit (z. B. 3 bis 6 Monate) nachbetreut werden, weil eine Reihe von Problematiken insbesondere bei Einsatzkräften in der Regel erst mit Verzögerung erkennbar wird.
Hinweis: Im Kapitel 4 findet sich ein Präventionsmanual, das die beschriebenen Optionen der Primärprävention und Frühintervention, auch unter Thematisierung moralischer Aspekte, strukturiert zur unmittelbaren praktischen Umsetzung im Arbeitsalltag anbietet.
1.1.5 Psychische (1)Traumafolgestörungen
»Normal« oder »krankhaft«?
Die Einwirkung eines traumatischen Ereignisses kann angesichts des geschilderten katastrophalen und lebensbedrohlichen Charakters zu psychischen Reaktionen führen, die zunächst als angemessen und nicht krankheitswertig bewertet werden können und meist innerhalb von 4 Wochen abklingen. Dazu gehören etwa Angespanntheit, ein Betäubungsgefühl, Unruhe, Ängste, Schlafstörungen oder Körpersymptome wie Schwindel oder Magen-Darm-Probleme. Das sogenannte (1)Normalitätsprinzip spricht von normalen Reaktionen normaler Menschen auf eine unnormale Situation (Eichenberg & Zimmermann 2017).
Der Übergang zu einer krankhaften Entwicklung ist fließend und nicht immer leicht festzulegen. Beispielsweise kann eine erhöhte Wachsamkeit (Vigilanz) bei Einsatzkräften wie Soldaten oder Polizistinnen im Rahmen einer traumawertigen Situation, wie z. B. Gewalterleben, die Reaktionsgeschwindigkeit und damit das professionelle Agieren verbessern und im Extremfall die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen. Erst bei einer Chronifizierung außerhalb der Einsatzsituation setzt dann der Übergang in eine psychische Erkrankung ein, indem Schreckhaftigkeit und Schlafstörungen im Alltag problematisch werden.
Eine Einstufung beobachteter Veränderungen als »psychisch krank« sollte daher insbesondere bei Einsatzkräften stets vorsichtig und angemessen wertschätzend vor dem Hintergrund der erbrachten Leistung erfolgen. Bei der diagnostischen Einschätzung sollten der subjektive Leidensdruck und die Lebensqualität der Betroffenen, aber auch die (häufig erheblichen) Folgen für das soziale Umfeld berücksichtigt werden.
Vielfältige Krankheitsvarianten
Traumatisches Erleben kann eine Reihe von psychischen Erkrankungen hervorrufen. Die posttraumatische Belastungsstörung ist, wie auch die S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung betont, »nur eine, wenngleich spezifische Form der Trauma-Folgeerkrankungen« (Schäfer et al. 2019, S. 6). Häufig kommen auch affektive Störungen, insbesondere Depression, (1)Angststörungen, vor allem die generalisierte Angststörung und (1)Panikstörung mit (1)Agoraphobie, (1)somatoforme Störungen und Suchterkrankungen vor. Diese können als direkte Traumafolgen auftreten, es ist aber auch eine gemeinsame Entstehung möglich, z. B. mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer Sucht.
Zu den Details und Erscheinungsformen der jeweiligen Krankheitsbilder wird auf die Klassifikationssysteme »International Classification of Diseases« der WHO (ICD-10) und das »Diagnostic and Statistical Manual of Diseases« (DSM-5) verwiesen (verfügbar unter www.dimdi.de). In der neuen ICD, der ICD-11, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird, sind die diagnostischen Kriterien der PTBS im Wesentlichen beibehalten.
Die Klassifikation DSM-V, die vor allem im englischsprachigen Raum gebräuchlich ist, hat ein ergänzendes diagnostisches Kriterium für die PTBS eingeführt, die »negativen Gedanken und Gefühlen im Zusammenhang mit dem Trauma«. Dazu gehören die auch in diesem Manual detailliert thematisierten Schuldgefühle.
(1)Komplexe posttraumatische Belastungsstörung
In der ICD-11 wird als diagnostische Neuerung die Kategorie der »komplexen posttraumatischen Belastungsstörung« aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um »besonders schwere oder wiederholte bzw. lang anhaltende Traumatisierungen, z. B. infolge psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalterfahrungen oder auch Erfahrungen körperlicher bzw. emotionaler Vernachlässigung in der Kindheit. Sie können erhebliche Beeinträchtigungen des Erlebens, Denkens, Fühlens und auch der Interaktion mit der Umwelt nach sich ziehen. Bei vielen Betroffenen prägt sich ein vielfältiges Beschwerdebild aus, das ein Muster typischer Veränderungen beinhaltet« (nach DEGPT o. J.).
Dieses beeinträchtigt unter anderem Erlebnis- und Verhaltensweisen, die die jeweiligen Persönlichkeiten maßgeblich prägen können. Sie
»erleben sich als hilflos und haben das Gefühl, nur wenig Einfluss auf den Verlauf ihres Lebens nehmen zu können. Oft melden sich ausgeprägte Schuldgefühle, selbst in Situationen, in denen deutlich ist, dass der Betreffende keine Verantwortung zu tragen hat. Viele komplex Traumatisierte fühlen sich isoliert von ihren Mitmenschen und haben aufgrund von Schamgefühlen große Schwierigkeiten damit, sich anderen Menschen so zu zeigen, wie sie sind. Zumeist besteht nur ein geringes Selbstwertgefühl und häufig leben Betroffene in der Überzeugung, von niemandem wirklich verstanden zu werden. […] Viele komplex Traumatisierte tragen eine große Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in sich und fühlen sich resigniert und desillusioniert. Werte, Lebenseinstellungen oder religiöse Überzeugungen, die möglicherweise zu einem früheren Zeitpunkt im Leben noch Halt gegeben hatten, haben ihre Bedeutung verloren oder ergeben keinen Sinn mehr.« (DEGPT o. J., o. S.)
Insbesondere in diesen Aspekten der komplexen PTBS besteht eine inhaltliche Nähe zu den psychischen Folgen moralischer Verletzungen im Rahmen traumatischer Situationen, die im Folgenden noch genauer dargestellt werden.
Der Prozess der Krankheitsentstehung und mögliche Interventionen sollen abschließend anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht werden.
Fallbeispiel
Herr W., ein 50-jähriger Rettungsassistent, der seit 27 Jahren im Rettungsdienst einer Großstadt tätig ist, stellt sich wegen Schlafstörungen bei seinem Hausarzt vor. Er habe Einschlafstörungen, grübele oft noch 1 bis 2 Stunden über die Ereignisse des vergangenen und des folgenden Tages nach. Dabei mache er sich Vorwürfe, nicht alles perfekt erledigt zu haben, und beginne bereits mit Planungen für Folgeaktivitäten.
In der Nacht wache er mehrfach auf, meist nach Albträumen, die Situationen aus seinem Einsatzdienst szenisch bildhaft widerspiegelten, er fühle sich »wie im Film«. Er sei dann unruhig, ängstlich, schweißgebadet und brauche 30 bis 60 Minuten, um wieder einzuschlafen, manchmal bleibe er aber auch den Rest der Nacht wach. Am häufigsten handele es sich um Erinnerungen an Gefahrensituationen, in denen Menschen mit schweren Verletzungen auf Autobahnen geborgen würden, bei denen auch er selbst durch vorbeifahrende Autos beinahe verletzt worden wäre.
Tagsüber würde er sich an derartige Szenen vor allem dann erinnern, wenn er quietschende Reifen schnell bremsender Autos höre (»Trigger«). Die alten Bilder seien dann sehr plastisch und bildhaft präsent, er fange an zu zittern und sei kaum noch handlungsfähig. Dadurch fühle er sich auch in seinem Beruf zunehmend verunsichert und habe Zweifel, ob er noch ausreichend professionell agieren könne. So habe er bereits über einen Berufswechsel oder eine Frühberentung nachgedacht.
In seiner Freizeit versuche er den genannten Triggern aus dem Weg zu gehen, meide daher Menschenansammlungen und dichten Verkehr. In den letzten Jahren habe sich dies so gesteigert, dass er kaum noch selbst zum Einkaufen gehen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen könne, es würden dann panikartige Ängste auftreten, die Kontrolle über sich zu verlieren.
Insgesamt koste ihn diese negative Entwicklung so viel Kraft, dass er sich für seine tägliche Lebensführung kaum noch aktivieren könne. So habe er sich aus seinem Freundeskreis weitgehend zurückgezogen, habe auch seinen Sportverein verlassen. Viele Aktivitäten erledige er nur noch lustlos.
In den Anfangsjahren habe er Teile der geschilderten Veränderungen zwar bereits bemerkt, diese aber nicht ernst genommen. So würde auch in seinem Kollegenkreis kaum über psychische Belastungen gesprochen. Man habe Angst, wegen einer vermeintlichen Schwäche nicht mehr ernst genommen zu werden.
Später sei der innere Druck dann aber so groß geworden, dass er nun phasenweise auch verstärkt Alkohol konsumiere, um mit den Anspannungen fertig zu werden oder auch leichter in den Schlaf zu kommen. Seinem Hausarzt waren bereits erhöhte Leberwerte aufgefallen, die zu einem Gespräch über die Folgen von Alkoholmissbrauch und die Möglichkeiten einer Reduktion geführt hatten.
Im Verlaufe von mehreren Beratungsgesprächen wird zunächst eine vertrauensvolle Therapeut-Klient-Beziehung geschaffen und dem Klienten werden im Sinne einer »traumainformierten Gesprächsführung« erste Erklärungen zu den Zusammenhängen seiner Symptome gegeben. Er wird auf vertiefende Informationsmaterialien aufmerksam gemacht (www.ptbs-hilfe.de).
Nachdem ein therapeutisches Bündnis hergestellt ist, wird ein Behandlungsplan entwickelt. Im Vordergrund steht zunächst eine Vereinbarung zur Alkoholabstinenz. Dabei erklärt sich der Patient bereit, eine örtliche Suchtberatungsstelle und eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Dort führt er im Anschluss regelmäßige Einzel- und Gruppengespräche. Die Entgiftung führt er unter engmaschiger hausärztlicher Kontrolle durch, wobei keine körperlichen Entzugssymptome auftreten, die eine stationäre Behandlung notwendig machen würden.
Nach ambulanter Konsultation eines niedergelassenen Psychiaters wird eine Medikation mit dem (1)Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Paroxetin (20 mg) angesetzt, worunter sich Anspannung und Ängste vermindern. Mithilfe dieser ersten Symptomentlastung gelingt es dem Patienten auch leichter, eine ambulante Psychotherapie bei einer psychotraumatologisch ausgebildeten Psychotherapeutin aufzunehmen. Diese arbeitet zahlreiche traumatische Erlebnisse mit ihm auf, thematisiert gleichzeitig aber auch die Aktivierung von Alltagsressourcen wie seiner sozialen Bindungen (zur Traumatherapie mit EMDR wird dieses Beispiel in Kap. 2.2.1 fortgesetzt).
Nach ca. 6 Monaten absolviert der Patient ergänzend eine 6-wöchige stationäre Psychotherapie, die ihm weitere Impulse für seine ambulanten Gespräche gibt. Im Verlauf der insgesamt 2-jährigen Therapie tritt eine deutliche Besserung ein, der Patient bleibt berufsfähig.
1.2 Behandlung und Begutachtung
1.2.1(1)Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen
Allgemeine Prinzipien
Die traumaadaptierte ambulante oder stationäre Psychotherapie spielt bei der Behandlung psychischer Traumafolgestörungen eine maßgebliche Rolle. Sie sollte im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplans erfolgen und sich inhaltlich an der S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung (Schäfer et al. 2019) orientieren.
Dieser Behandlungsplan sollte neben der Psychotherapie vor allem Elemente wie Pharmakotherapie, Soziotherapie und ergänzende, komplementäre Verfahren beinhalten. Dabei haben sich Behandlungsabläufe bewährt, die individuell variable und gegebenenfalls längerdauernde Zeiträume umfassen. Denn insbesondere Einsatzkräfte erleben multiple traumatische Situationen, die zusätzlich inhaltlich wechselnde Bestandteile enthalten, wie beispielsweise angstassoziierte Situationen und moralische Verletzungen. Diese Problematiken sollten schrittweise aufgearbeitet werden.
Im Regelfall verläuft eine (1)Traumatherapie in (1)drei Phasen, die erstmals von Pierre Janet im ausgehenden 19. Jahrhundert beschrieben und später immer wieder aufgegriffen worden sind:
Stabilisierung
Traumakonfrontation
Integration
Phase 1(1): Stabilisierung. Die initiale Stabilisierungsphase beinhaltet unter anderem die Elemente wie Psychoedukation, Verbesserung der sozialen Unterstützung, Arbeit an persönlichen Ressourcen wie Sport oder Entspannung. Ziel der Stabilisierungsphase in der Psychotraumatologie ist es, die durch die Traumatisierung in ihren psychischen Grundstrukturen erschütterten Patienten wieder in die Lage zu versetzen, Gedanken, Impulse und Emotionen wahrzunehmen, auszudrücken und zu kontrollieren sowie alltägliche Aufgaben zu bewältigen und konsequent Selbstfürsorge zu praktizieren. Da diese psychischen Grundthemen nicht nur traumatisierte Menschen betreffen, können Stabilisierungstechniken auch allgemein in der Psychotherapie eingesetzt werden. Ein Überblick findet sich z. B. bei Reddemann (2019).
Ein Beispiel für Stabilisierungstechniken sind die sogenannten (1)