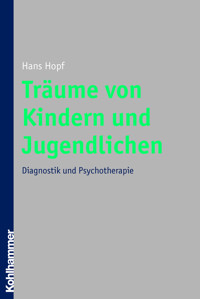
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Träume von Kindern finden in der Psychotherapie kaum Beachtung, da kleinere Kinder seltener Träume erzählen und kaum Einfälle äußern. Therapeuten sind unsicher, wie mit den Träumen umzugehen ist, zumal es wenig Literatur gibt. Dabei können Träume sowohl bei der Erstellung einer Diagnose als auch beim Einstieg in eine tiefere Bearbeitung von Konflikten hilfreich sein. In diesem Buch werden die wichtigsten Erkenntnisse über das Träumen von Kindern und Jugendlichen aus kinderpsychoanalytischer Sicht referiert. An vielen Beispielen wird verdeutlicht, wie es möglich ist, mit Träumen zu arbeiten. Themenbereiche wie Träumen und Malen, der Kindertraum als Fokus, der Traum in der Diagnostik, Traumserien, aber auch behandlungstechnische Erfordernisse in der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen werden aufgezeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Träume von Kindern finden in der Psychotherapie kaum Beachtung, da kleinere Kinder seltener Träume erzählen und kaum Einfälle äußern. Therapeuten sind unsicher, wie mit den Träumen umzugehen ist, zumal es wenig Literatur gibt. Dabei können Träume sowohl bei der Erstellung einer Diagnose als auch beim Einstieg in eine tiefere Bearbeitung von Konflikten hilfreich sein. In diesem Buch werden die wichtigsten Erkenntnisse über das Träumen von Kindern und Jugendlichen aus kinderpsychoanalytischer Sicht referiert. An vielen Beispielen wird verdeutlicht, wie es möglich ist, mit Träumen zu arbeiten. Themenbereiche wie Träumen und Malen, der Kindertraum als Fokus, der Traum in der Diagnostik, Traumserien, aber auch behandlungstechnische Erfordernisse in der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen werden aufgezeigt.
Dr. rer. biol. hum. Hans Hopf ist als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in eigener Praxis tätig.
Hans Hopf
Träume von Kindern und Jugendlichen
Diagnostik und Psychotherapie
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2007 Alle Rechte vorbehalten © 2007 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart
Print: 978-3-17-019663-6
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028076-2
mobi:
978-3-17-028077-9
Ich widme dieses Buch meiner Großmutter Pauline Silbermann, die noch Goethes letzter Liebe, Ulrike von Levetzow, begegnet ist. Meine Liebe zu Träumen habe ich ihr zu verdanken.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Rückblick
1.1 Kinderträume in Biographien, Literatur und Märchen
1.2 Kindertraum und Psychoanalyse
1.2.1 Der Kindertraum und die topographische Theorie der Psychoanalyse
1.2.2 Weiterentwicklung der psychoanalytischen Auffassung vom Traum unter dem Einfluss der Strukturtheorie und der Ich-Psychologie
1.2.3 Der manifeste Traum – nur eine „nutzlose Nussschale“?
1.2.4 Der Kindertraum und Freuds Traumdeutung
1.2.5 Die Bedeutung des Traumes in der Frühzeit der Kinderanalyse
1.2.6 Die Arbeit mit Träumen in der Frühzeit der Kinderpsychoanalyse
1.2.7 Kann in Analysen von Kindern auch ohne deren Assoziationen mit dem manifesten Traum gearbeitet werden?
1.3 Der Kindertraum bei C. G. Jung
1.3.1 Erste Auseinandersetzungen mit dem Kindertraum
1.3.2 Die Kindertraum-Seminare und Jungs theoretisches Verständnis vom Traum
1.3.3 Ein Traumbeispiel aus einem Kindertraumseminar
1.4 Die Bedeutung von Kinderträumen innerhalb der verschiedenen Richtungen und Strömungen
1.4.1 Anna Freud und die ich-psychologische Behandlungstechnik
1.4.2 Melanie Klein, Wilfrid R. Bion und Donald Meltzer
1.4.3 Donald W. Winnicott
2 Struktur
2.1 Die Funktionen des Traumes
2.1.1 Die Funktion des Traumes in der Psychoanalyse und anderen tiefenpsychologischen Schulen
2.1.2 Einige Funktionen des Traumes innerhalb der physiologischen und neurobiologischen Schlafforschung
2.1.3 Psychoanalytische Auffassung von Traum und psychophysiologische Schlafforschung – ein Fazit
2.2 Die Anfänge des Träumens und die Bedeutung der Sprache
2.3 Die kognitive Strukturierung des Kindertraumes – Träumen als kognitive Leistung
2.3.1 Die Stadien des Traumverständnisses beim Kind
2.3.2 Inhaltsanalytische Untersuchungen von Kinderträumen
2.4 Erinnerte Träume als Abbilder spezifischer Konflikte während kindlicher Entwicklungsphasen
2.4.1 Traumbeispiel zum Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt (Michael, 3;2 Jahre)
2.4.2 Mädchen oder Junge – Geschlechtsidentität (Eva, 4;6 Jahre)
2.4.3 Eine Wunscherfüllung im Angsttraum – oder Angst vor Liebesverlust (Stefanie, 5;6 Jahre)
2.4.4 Trennungsängste und Übergangsobjekte (Benjamin, 5;11 Jahre)
2.4.5 Die Veränderungen der Träume während der Adoleszenz
2.5 Die Strukturierung der Träume von Kindern und Jugendlichen – höher- und niederstrukturierte Träume
2.5.1 Symbolische Gleichsetzung und reifes Symbolisieren
2.5.2 Das Tier als Indikator für Symbolisierungsprozesse in den Träumen von Kindern und Jugendlichen
3 Diagnostik
3.1 Ein Arbeitsbündnis wird hergestellt
3.2 Der Traum in der Diagnostik
3.2.1 Traum eines Jugendlichen unter verschiedenen Deutungsaspekten
3.3 Kindertraum und Fokusbildung
3.4 Konflikte in Träumen, die psychische Symptome und Störungen verursachen
3.4.1 Klinefelter-Syndrom
3.4.2 Konflikte der Migration
3.4.3 Mutter-Sohn-Beziehung und psychosexuelle Entwicklung
3.4.4 Waschzwang
3.4.5 Binge Eating Disorder (eine Essstörung mit Episoden von Fressanfällen) mit latent inzestuöser Beziehung zum Vater
3.4.6 Schulphobie mit Aggressionshemmung
3.4.7 Depression, symbiotisch gebunden
3.4.8 Depression bei psychotischer Familie
3.5 Gegenübertragungsträume als diagnostisches Instrumentarium
3.5.1 Der Gegenübertragungstraum dient der Klärung einer aktuellen Konfliktsituation zwischen Analytiker und Patient
3.5.2 Der Gegenübertragungstraum und die prospektive Funktion
3.5.3 Der Gegenübertragungstraum dient der eigenen Psychohygiene
3.5.4 Bearbeitung von Schuld; Versuch der Wiedergutmachung in einem Gegenübertragungstraum
4 Psychotherapie
4.1 Träume in der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen
4.1.1 Einleitung
4.1.2 Initialträume
4.1.3 Ein Gespräch über Träume während einer stationären Psychotherapie
4.1.4 Träumen und Malen – Traumserie eines Kindes
4.1.5 Kindertraum und Märchen (Amplifikation)
4.1.6 Traum eines Jungen nach einer ausgefallenen Stunde
4.1.7 Ich-stärkende Arbeit mit einem niederstrukturierten Traum
4.1.8 Traum und Szene zum Abschluss einer Therapie
4.1.9 Traumserien von Jugendlichen
4.2 Übertragung im Traum
4.2.1 Zwischen Grandiosität und Ängsten vor Nähe und Überwältigung
4.2.2 Eine Patientin träumt vom Therapeuten
5 Traumtypen
5.1 Alpträume, Angstträume, Katastrophenträume
5.2 Traumatische Träume
5.2.1 Ängste und Träume nach traumatischen Ereignissen
5.2.2 Ein generalisiertes Angstsyndrom
5.2.3 Misshandlungen und Missbrauch in Träumen
5.3 Falltraum und Flugtraum – ein Kontinuum?
5.3.1 Der Falltraum
5.3.2 Der Flugtraum
5.4 Geschlechtsunterschiede in Träumen von Kindern und Jugendlichen
5.4.1 Untersuchungen über Geschlechtsunterschiede in den Träumen
5.4.2 Eine eigene Untersuchung
5.5 Epilog
5.5.1 Erwachsene erinnern sich an Träume ihrer Kindheit
5.5.2 Ilses Traum
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Ein Buch über Kinderträume zu schreiben, bedeutet auch, in die eigene Vergangenheit mit allen sinnlichen Eindrücken, Phantasien und Träumen zurückzublicken. Während der Nachkriegswirren lebte ich bei meiner Großmutter, die mich wiederholt morgens fragte, was ich denn geträumt hätte. Dann erzählte sie mir, dass nachts meine Seele den Körper verließe und alles wirklich erlebte, was ich träumen würde. Im Jahre 2006 teilte mir Klaus E. Müller, Professor für Ethnologie, in einem Traumseminar mit, dass dieser Schamanenglaube ziemlich genau 50 000 Jahre alt und über Höhlenmalereien dokumentiert wäre. „Die sogenannte ‚Freiseele‘ vermochte sich jederzeit vom Körper des Menschen zu lösen. Allnächtlich im Schlaf zum Beispiel trat sie aus und bewegte sich in der Umgebung des Schläfers, unter Umständen aber auch weiter fort bis selbst ins Jenseits hinein. Was sie dabei sah und erlebte, bildete den Inhalt der Traumgesichte“ (Müller, 2001, S. 12). Ich erinnere noch heute, wie ich die damalige Aussage meiner Großmutter wohlig gruselnd, aber auch voller Stolz ob meiner grandiosen nächtlichen Abenteuer hinnahm. Sie hat mit ihrer Äußerung – die vielleicht ein wenig konkretistisch formuliert war – in gewisser Weise recht gehabt und mein Interesse an Träumen geweckt.
In meiner ersten Therapie bei einem Jung’schen Psychotherapeuten bin ich über meine Träume in die Kindheit mit all ihren Eindrücken zurückgekehrt, später in meiner Lehranalyse, auf der Couch liegend, nochmals. Dabei habe ich manche Träume, die ich bereits als Kind und Jugendlicher geträumt hatte, erinnert. Träume gewähren einen wunderbaren Einblick ins Unbewusste, sind sie doch die „via regia“ dorthin. Ich gehe davon aus, dass mein damaliges Erleben dazu geführt hat, dass mich bis heute kindliches Staunen begleitet, gepaart mit einem Glücksgefühl, durch ein Schlüsselloch ins Unbewusste schauen und etwas vom Seelenleben begreifen zu dürfen.
1978 habe ich für den Südwestfunk eine Sendung über Kinderträume geschrieben. Der Lektor, Dr. Horst Speichert, hat mich damals angeregt, hieraus ein Taschenbuch bei rororo zu schreiben, das 1980 erschienen ist und das ich 1992 neu verfasst habe. 1990 habe ich mit einer Dissertation über Kinderträume an der Universität Ulm promoviert. Seither habe ich eine Vielzahl von Kindertraumseminaren u.a. während der Psychotherapiewochen in Lindau durchgeführt, 1984 und 1989 auch anlässlich von Tagungen der VAKJP gemeinsam mit meiner geschätzten Kollegin Christiane Lutz aus Jung’scher und psychoanalytischer Sicht.
Ich danke in erster Linie allen Kindern und Jugendlichen, die mich mit ihren Träumen beschenkt haben, auch meinen eigenen Kindern Stefanie, Michael und Florian. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern meiner Seminare für viele anregende Einfälle und Diskussionen. Ein großer Dank gilt meinen Kolleginnen und meinen Kollegen, die mir Träume aus ihren Supervisionen überlassen haben: Frau Andrea Baur, Frau Ulrike Hadrich, Frau Gabriele Häußler, meine langjährige Freundin, sowie den Herren Andreas Bopp, John Rosenlund und Helmut Schäberle. Vor allem meiner Kollegin Irmgard Giepen bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, die mir Träume ihrer eigenen Kinder Thomas, Matthias und Eva zur Verfügung gestellt hat.
Danken möchte ich an dieser Stelle der Lektorin des W. Kohlhammer Verlags, Frau Alina Piasny, für die immer angenehme Zusammenarbeit. Sie hat die Gestaltung und Drucklegung des Buches sorgfältig und kompetent begleitet und aus dem Manuskript dieses Buch geschaffen.
Mit besonderer Dankbarkeit denke ich jedoch an meinen Freund Volker Tschuschke, heute Professor für Medizinische Psychologie an der Universität Köln. Während vieler Stunden hat er mit mir an der Forschungsstelle für Psychotherapie in Stuttgart innerhalb seiner Freizeit Traumtexte untersucht, geratet und codiert. Dabei hat er mich Statistik gelehrt und mich bereits 1986 in der Arbeit am Computer unterwiesen. Er hat mich in die empirische Psychotherapieforschung eingeführt – an diesem Buch hat er indirekt mitgewirkt.
Mundelsheim, im Herbst 2007
Hans Hopf
1 Rückblick
1.1 Kinderträume in Biographien, Literatur und Märchen
Eine „Aura des Unheimlichen“ hat den Traum zu allen Zeiten umgeben, und auf diese Weise hat er seine gleich bleibende, geheimnisvolle Anziehungskraft auf den Menschen ausgeübt. Jenes „Unheimliche“ deutet gemäß Freud immer darauf hin, dass infantile Konflikte durch einen Eindruck wiederbelebt werden (Freud, 1919). Gelegentlich wird die Bedeutung des Traumes geleugnet („Träume sind Schäume“), manchmal wurde seine Funktion auch überschätzt, etwa als Mitteilung Gottes, welche in die Zukunft sehen lässt. In der Antike galten Träume tatsächlich als Botschaften (Offenbarungsträume) einer manifesten Götterwelt (vgl. Hamburger, 2006). Die aufklärerische Entmythologisierung des Mittelalters verbannte den Traum schließlich in die Rumpelkammern des Volks- und Aberglaubens, wo er aber über Traumbücher und mystifizierenden Erklärungen recht lebendig erhalten blieb. Siebenthal (1953) hat gemeint, dass solche „Traumdeutebücher“ dem Ansehen der Wissenschaft „nicht gerade zuträglich“ waren (S. 8). Fröhliche Urstände feiert der Volksglaube heute wieder bei der Esoterik.
Die Dichter haben seit jeher, schon vor Freud, den bedeutsamen Rang des Traumes erkannt. So schrieb Jean Paul: „Der Schein muss dem Menschen oft das Sein zeigen, der Traum den Tag.“ Hermann Hesse lässt sein Gedicht „Adagio“ mit folgender Zeile beginnen: „Traum gibt, was Tag verschloss …“. Und ein Aborigine von Australien sagte einst: „Ein Traum ist der Schatten von etwas Wirklichem.“
Es existiert eine Fülle von Träumen in der antiken Literatur, in der Bibel, in Biographien und in der Literatur von der Klassik bis heute. Aber es sind nur wenige Kinderträume zu finden, was sicherlich verschiedene Gründe hat. So werden beispielsweise in der Bibel mehrere Träume erzählt, angefangen von Jakobs Traum von der Himmelsleiter über die Träume des Nebukadnezars bis zum Traum der Frau des Pilatus und Josephs Traum mit dem göttlichen Auftrag Gottes, nach Ägypten zu fliehen. Ein einziger jugendlicher Träumer ist darunter, der Joseph, Sohn des Jakob, mit seinem eindrücklichen Traum von den Garben der Brüder, die sich vor seiner verneigen. Sein Traum wurde mehrfach interpretiert, unter anderem von Thomas Mann in den Joseph-Romanen sowie von Simon (1972), Seybold (1984), Harnisch (1995) und Mertens (1999). Mit Recht hat Näf (2004) festgestellt, dass sich mit jenen Träumen nicht mehr konstruieren lässt, was geträumt worden ist, weil es sich bei Träumen aus Antike und Historie bereits um Deutungen handle (S. 10). In seinem Buch „Traum und Traumdeutung im Altertum“ werden Kinderträume lediglich an zwei Stellen erwähnt. Aristoteles hat bereits festgestellt, dass der Traum eine notwendige Begleiterscheinung des Schlafes von mit Sinneswahrnehmungen und Vorstellungsvermögen ausgestatteten Lebewesen sei, nur kleine Kinder würden nicht träumen (S. 61). Plinius der Ältere hingegen hat das Folgende über das erste Auftreten der Träume geschrieben: „Nach seiner Geburt schläft der Mensch einige Monate, dann (erst) wird das Wachsein von Tag zu Tag länger. Schon in diesem Säuglingsalter träumt er; denn er wacht erschreckt auf und ahmt das Saugen nach“ (zit. n. Näf, 2004, S. 99).
Auch innerhalb der Literatur besitzen Kinder offensichtlich nur einen geringen Stellenwert, auch hier wird kaum von ihren Träumen berichtet. Dies hängt wohl damit zusammen, dass die Kinderseele erst im 20. Jahrhundert als Gegenstand der Psychologie entdeckt wurde. Vorher ging es wohl vorrangig darum, wie sie pädagogisch geformt werden könnte, damit ein rechtschaffener Mensch heranwachse. Ein wenig anders war das mit den Biographien von Dichtern und Malern. Aber auch hier werden natürlich keine authentischen Kinderträume berichtet, sondern Erinnerungen im Erwachsenenalter. Ich will einige Kinderträume zitieren, die Dichter als Kind oder Jugendlicher hatten und ich will sie im Wesentlichen unkommentiert stehen lassen. Auf einige charakteristische Traumbilder werde ich in späteren Kapiteln eingehen. Eines muss allerdings in diesem Zusammenhang erwähnt werden: Von Erwachsenen erinnerte Kinderträume sind oft sehr lang, während es ja gerade eine wesentliche Eigenschaft der von Kindern erzählten Träume ist, dass sie kurz, klar und kohärent sind. Beispielsweise streckt sich der erste Kindheitstraum, den C. G. Jung erinnert und von dem er glaubt, ihn mit drei bis vier Jahren geträumt zu haben, über 37 Buchzeilen und besteht aus etwa 300 Wörtern (Bei Kindern in diesem Alter sind es durchschnittlich maximal zwanzig Wörter.). Woher rührt der Unterschied? Es mag sein, dass sich die Erzähler im Rückblick noch detailliert an das damalige Traumbild erinnern. Aber sie haben es mit der Sprache eines Erwachsenen nachgezeichnet, mit dessen reichhaltigem Wortschatz und seiner reifen Fähigkeit zur Grammatisierung. Damit haben sie die Verdichtung der kindlichen Traumerzählung aufgehoben und einen Erwachsenentraum erzählt. Eine Traumerzählung unterscheidet sich von der Traumerinnerung; sie ist immer eine Leistung des aktuellen Ichs (vgl. S. 21).
Der Gewerkschaftler und spätere Schriftsteller August Winnig (1878–1956) wuchs als eines von zwölf Kindern im Haushalt eines Totengräbers auf. Man kann sich die tägliche Not sowie eine chronisch überforderte Mutter vergegenwärtigen, und vielleicht hatte sein Traum mit jenen frühen Entbehrungen zu tun:
„Ich hatte wieder geträumt, was ich seit meinem fünften Jahre, lange bevor ich einen Globus gesehen hatte, zuweilen träumte. Ich befand mich auf der Erde, die ich als einen kugelähnlichen Körper empfand, und stieg zu hohen Bergen hinauf. Oben erreichte ich einen Grat von bräunlichem Gestein und wanderte auf ihmweiter, blieb hin und wieder stehen und sah rundum und erschauerte vor der Weite des Blickes und vor dem, was er mir offenbarte. Zwar sah ich nicht die ganze Erde, aber ich sah genug, um sie als etwas Kugelähnliches zu empfinden, sah in furchtbare Tiefen und in gewaltige Weiten und stand auf meinem Grat in entsetzlicher Einsamkeit. Ich war der einzige Mensch auf der Erde“ (Kießig, 1976, S. 181) (siehe auch S. 148).
Es folgt ein Kindheitstraum des Dichters Friedrich de la Motte-Fouqué (1777–1843). Friedrich de la Motte-Fouqué zählte mit E. T. A. Hoffmann und Heinrich von Kleist zu den bedeutendsten Dichtern der deutschen Romantik. Von ihm stammt unter anderem das Märchen „Undine“, das E. T. A. Hoffmann und Lortzing als Libretto für gleichnamige Opern verwendeten. 1788, als der Junge 11 Jahre alt war, zog die Familie von Potsdam auf das neuerworbene Gut Lentzke bei Fehrbellin. Am 28.11. des gleichen Jahres starb die Mutter Marie Luise, geb. von Schlegell, ein Trauma, welches den Jungen zutiefst erschütterte und zu einem grauenvollen Wiederholungstraum führte:
„Dreimal in drei aufeinander unmittelbar folgenden Nächten kam dieser aus sehnsüchtiger Liebe und kaltem Grauen zusammengewobene Traum wieder, und das noch schrecklichere Erwachen damit zu Gewissensbissen … Nach dem dritten Walten jenes Traumes brach des ohnehin durch all das Weh angegriffenen Knaben Gesundheit völlig zusammen.“
„Ihm träumte nämlich, … er schleiche sich in tiefster Dunkelheit einsam nach dem Sterbelager der Mutter hin. Und dann richte sich die Leiche auf, und fasse nach ihm mit langen, kalten Armen, und erfasse ihn, und ziehe ihn grau’nvoll gewaltsam an ihre kalte Brust. Im Sträuben sich frei zu ringen, warf er dann etwas, das ihm in die Hand kam, nach dem plötzlich unheimlich gewordenen, spukhaft verschleierten Wesen. Und was war es, das er geworfen hatte? Ein überaus zierliches buntbemaltes Döschen, ihm vor wenigen Wochen von der Mutter geschenkt, ob seines ganz absonderlichen Wohlgefallens daran, als er es einst unerwartet unter ihren Schmucksächlein fand. Und nun hatte er es nach der lieben Leiche geschleudert voll wahnsinnigen Entsetzens und erwachte darüber, und zwar unter den furchtbarsten Schauern der Selbstanklage“ (Kießig, 1976, S. 33).
Im Traum bildet sich eine ambivalente, sehr bedrohliche und destruktive Beziehung ab. Erkennbar hat der 111/2-jährige Junge den Tod der Mutter und die damit verbundenen heftigen Affekte nicht verarbeiten können, so dass sie sich in traumatischen Wiederholungsträumen entluden. Im Anschluss an diese Träume traten schwere psychische Symptome auf, wie der Dichter später berichtete (Diegmann-Hornig, 1999, S. 17).
Der schlesische Dichter Hermann Stehr (1864–1940) wurde als Sohn eines armen Sattlers geboren, arbeitete zunächst als Volksschullehrer und wurde schließlich mit Werken wie „Der Heiligenhof“ bekannt. Seine Kindheitserinnerung ist ebenfalls eindrücklich: „Ich wusste, das ich im Bett liege und Furcht überfiel mich, weil es Nacht war und meine größere Schwester noch nicht ihr Lager neben mir aufgesucht hatte. Ich hörte sie in der Kammer nebenan herumgehen, vorsichtig an Gegenständen rücken und leise dazu singen. Ich bemühte mich, nach ihr zuschreien, brachte aber keinen Laut heraus. In diesem Bangen hörte ich, dass drunten an der Haustür unwirsch und polternd gerüttelt wurde. Irgend jemand wollte ins Haus, aber die Tür widerstand ihm. Endlich gab sie nach. Sie ging mit einem tiefen Brummlaut in den Angeln und jemand trat so schweren, langen Schrittes in den Flur, dass ich diesen plumpen, gefährlich-groben Lauten das Bild eines riesigen, furchtbaren Mannes vor mir sah. So bewegte er sich über den Flur und begann, langsam die steinerne Stiege zu uns heraufzusteigen. Doch schon nach wenigen Stufen stand er still, und ich hörte ihn auf den Steinen ein metallisches Wetzen vollführen.
Ich wusste, dass er sein großes Messer auf dem Stein schärfte und hatte eine schreckliche Angst um meine Schwester, die noch immer in der Kammer nebenan vorsichtig an Gegenständen rückte und leise dazu sang. Um mich war mir gar nicht bange, denn ich lag ja im Bett, und die Tür war zu. Langsam und schwer kamen jetzt die furchtbaren Schritte über die Stiege herauf, tappten auf unser Zimmer zu, dass mir das Herz schlug, gingen aber an der Tür vorüber und näherten sich der Bodenkammer. Da überfiel mich eine solche schreckliche Angst um meine Schwester, dass, ich wusste nicht, von dem baumgroßen furchtbaren Unmenschen, der zu springen angefangen hatte, oder dem Laufen und entsetzten Schreien meiner Schwester, ein ungeheurer Lärm entstand, mit dem der Traum abbrach“ (s. a. Träume während der Adoleszenz, S. 69f.).
Es existieren nur wenige Märchen, in denen Träume von Kindern vorkommen, die meisten hiervon sind zudem Kunstmärchen. Auch davon will ich einige Beispiele anführen. In Hans Christian Andersens Märchen „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ (Andersen, o. D.) träumt das kleine Mädchen zunächst von einem wärmenden Feuer, dann von einem festlich gedeckten Tisch mit üppigen Speisen, schließlich von einem Weihnachtsbaum. Im letzten Traum begegnet es der alten Großmutter, die sie von Kälte, Hunger und Angst erlöst und mit zu Gott nimmt. Es sind Träume mit eindeutigem Wunscherfüllungscharakter, die kompensatorisch die reale Situation des Mangels und Leidens zu bewältigen suchen.
In Wilhelm Hauffs Märchen (Hauff, o. D.) „Der kleine Muck“ träumt dieser das Folgende: „Im Traum erschien ihm das Hundlein, welches ihm im Hause der Frau Ahavzi zu den Pantoffeln verholfen hatte, und sprach zu ihm: ‚Lieber Muck, du verstehst den Gebrauch der Pantoffeln noch nicht recht; wisse, dass wenn du dich in ihnen dreimal um den Absatz herumdrehst, so kannst du hinfliegen, wohin du nur willst und mit dem Stöcklein kannst du Schätze finden, denn wo Gold vergraben ist, wird es dreimal auf die Erde schlagen, bei Silber aber zweimal‘.“ Dieser Traum gehört zur Gruppe der Flugträume, wo dem Träumer Allmacht und Größe verliehen werden (s. S. 146). Das Stöcklein als Symbol für phallisch-männliche Potenz kommt in vielerlei Märchen vor, unter anderem in Grimms Märchen „Hänsel und Gretel“ dort in Gestalt eines Knochens (s. S. 117).
Im Grimm’schen Märchen „Jorinde und Joringel“ (von der Leyen, 1969) träumt Joringel, „er fände eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum Schlosse: alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei frei: auch träumte er, er hätte seine Jorinde wiederbekommen.“ Die Blume verkörpert das weibliche Prinzip in Gestalt des empfangenden Gefäßes, des Kelches. Sie symbolisiert auch Zerbrechliches, die rote Blume zudem den Aufbruch, die Morgenstimmung. Es ist also zutreffend, diesen Traum während des Übergangs von der Adoleszenz zum Erwachsenenalter anzusiedeln und ihn als Reifungs- oder Wandlungstraum zu begreifen.
Warum ist das Ergebnis letztendlich bescheiden? Zum einen war das Interesse an der Kindheit in der Literatur der Vergangenheit nicht sehr groß und schon gar nicht an Träumen, trotz aller Bemühungen der Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Märchen sind schon Traumbilder des kollektiven Unbewussten. Und Träume sind kleine Märchen. Insofern wären darin enthaltene Träume Traum im Traum. Auf die Möglichkeit, Träume von Kindern amplifizierend mit Märchen zu erweitern, wird in einem späteren Kapitel (s. S. 115) eingegangen. Es kann festgestellt werden, dass die Beschäftigung mit dem Traum vor Freud bereits eine lange Geschichte hat, Träume der Kinder und Jugendlichen wurden allerdings kaum beachtet. Erst die Entdeckung der Psychoanalyse hat angeregt, sich auch mit ihnen zu befassen und sie als eigenständige Produkte von Kindern zu begreifen.
Ich möchte an dieser Stelle auf einige Autoren verweisen, die in den vergangenen Jahren Fachbücher, Sachbücher, pädagogische Bücher, auch Elternratgeber über Kinderträume verfasst haben.
Bücher in deutscher Sprache zum Kindertraum
Blaich, B. (1995): Wie deuten wir Kinderträume? Ein Ratgeber für Eltern. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh
Endtinger-Stückmann, S. (2006): Traumwelt von Kindern und Jugendlichen. Entwicklung- Verständnis – therapeutischer Umgang. Karger Verlag, Basel
Ennulat, G. (1998): Du, ich will dir einen Traum erzählen. Mit Kindern über ihre Träume sprechen. Walter Verlag, Zürich und Düsseldorf
Eschenbach, U. (1995): Kinderträume, und was sie bedeuten. Ullstein Taschenbuch, Frankfurt a. M., Berlin, Wien
Fink, G. (1993): Kinderträume. Ein Ratgeber für Eltern. Falken-Verlag, Niedernhausen Hamburger, A. (1987): Der Kindertraum und die Psychoanalyse. Ein Beitrag zur Metapsychologie des Traums. S. Roderer Verlag, Regensburg
Harnisch, G. (1995): Was Kinderträume sagen. Traumbilder verstehen, deuten, gestalten. Herder Verlag, Freiburg, Basel, Wien
Hopf, H.: (1980): Kinderträume. Traumbilder verstehen und auf sie eingehen. rororo Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg
Hopf, H. (1992): Kinderträume verstehen. rororo Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg
Hopf, H. (2005) (Hrsg.): Traum, Aggression und heilende Beziehung. Edition Déjà-vu – Verlagsabteilung der Sigmund-Freud-Buchhandlung, Frankfurt a. M. (enthält u.a. empirische Arbeiten zum Kindertraum)
Kardorf, U. (1982): Wünsche in der Nacht. Junge Menschen zwischen 4 und 18 Jahren erzählen ihre Träume. Herder Verlag, Freiburg
Siegel, A., Bulkeley, K. (1999): Kinderträume und ihre Bedeutung. Eine Reise in die kindliche Seele. Econ & List Taschenbuch Verlag, München
Sommer, R. (1997): Der Baum steht mitten im Fluss. Was Kinderträume sagen können. Walter Verlag, Zürich und Düsseldorf
1.2 Kindertraum und Psychoanalyse
1.2.1 Der Kindertraum und die topographische Theorie der Psychoanalyse
In den folgenden Abschnitten werde ich psychoanalytische Theorien vom Traum nicht ausführlich diskutieren, sondern vor allem jene Bereiche, die zum Verständnis des Kindertraums notwendig sind. Ich verweise auf die Literatur u.a. von Ermann (2005), Mertens (1999), Thomä & Kächele (2006), die aktuelle Einführungen zu Traum und Träumen veröffentlicht haben.
Kein Mensch kennt die Träume eines anderen wirklich, sondern jeder nur die eigenen bruchstückhaft aus der Erinnerung. Diese Problematik gilt es ständig zu vergegenwärtigen, weil sie erhebliche Konsequenzen für die wissenschaftliche Untersuchung von Träumen mit sich bringt. Siebenthal (1953) betonte beispielsweise, dass es lediglich „sprachliche Formulierungen von Erinnerungen an den Traum“ seien, welche das Material für die Traumlehre lieferten (vgl. S. 141).
Doch sprachliche Formulierungen von Erinnerungen sind nur unscharfe Abbilder des Phänomens Traum, und Kemper (1955) ging sogar davon aus, dass sich der Traumtext zum erlebten Traum wie unter dem Mikroskop betrachtete Gefrierschnitte eines zu anatomischen Präparaten verarbeiteten Organgewebes zum einst lebendigen Organ verhalten würde (S. 41). Blum (1976) begriff darum – zu Recht – den Traumbericht bereits als Ich-Leistung, abhängig von den verschiedenen Persönlichkeitsvariablen und Abwehrmechanismen des Träumers.
Auch Zeppelin & Moser (1987) sahen als Kernproblem jeder Traumforschung, dass der eigentliche Traumvorgang nicht zugänglich ist, sondern nur über das Protokoll einer Traumerinnerung erschlossen werden kann, so dass mit einer „Verzerrungs-Konsistenz-Hypothese“ gearbeitet werden muss: „Diese enthält die Annahme, dass durch den Erinnerungsprozess Lücken und Verzerrungen entstanden sein können, die grundsätzliche Struktur und Dynamik des geträumten Traums hingegen erhalten bleibt“ (S. 144). Der Traum bleibt somit ein Konstrukt, „ein zu rekonstruierendes Narrativ, dessen ursprüngliche Gestalt nicht mehr zu haben ist“ (Mertens, 1999, S. 112). Diese Tatsache gilt es ganz besonders bei den Träumen der Kinder zu berücksichtigen, Übergänge zwischen Traumbericht, Tagtraum und Phantasie sind bei ihnen immer fließend. Unter „Traum“ verstehe ich darum gemäß einer Definition von Strauch (1981) alle jenen „kognitiven und emotionalen Phänomene, an die sich jemand nach dem Aufwecken erinnert und diese dem vorangegangenen Schlafzustand zuordnet“ (S. 23).
Dass der eigentliche Traumvorgang unzugänglich bleibt, hat bereits Freud (1900) als Problem gesehen. Er hat sich jedoch einer Auseinandersetzung mit dieser Problematik geschickt entzogen, indem er in seiner Theorie nicht vom geträumten Traum ausging, sondern vom sog. „manifesten Trauminhalt“ und indem er Traum, Traumtext und manifesten Trauminhalt gleichsetzte (Freud, 1933, S. 453). Der manifeste Trauminhalt umfasst entsprechend „alle Aspekte dessen, woran der Träumer sich nach dem Erwachen bewusst erinnert und das ihm in jeder beliebigen Form im Gedächtnis haften bleibt, in Form von Bildern, widersinnigen Situationen, gegensätzlichen Gefühlen usw.“ (Nagera, 1974, S. 277).
Hinter dem manifesten Trauminhalt verbirgt sich allerdings nach der Theorie von Freud erst die eigentliche Aussage des Traums, wofür er den Begriff „latenter Trauminhalt“ (oder „Traumgedanken“) prägte. So stellte Freud (1900) fest: „Traumgedanken und Trauminhalt liegen vor uns wie zwei Darstellungen desselben Inhaltes in zwei verschiedenen Sprachen, oder besser gesagt, der Trauminhalt erscheint uns als eine Übertragung der Traumgedanken in eine andere Ausdrucksweise, deren Zeichen und Fügungsgesetze wir durch die Vergleichung von Original und Übersetzung kennen lernen sollen“ (S. 280).
Die psychische Tätigkeit, welche den latenten Trauminhalt in den manifesten Inhalt verwandelt, bezeichnete Freud als die Traumarbeit. Auf eine ausführliche Darstellung ihrer Mechanismen (Verdichtung des Materials, Verschiebung, Umsetzung in sinnliche Bilder und dramatische Situationen, Verwendung von Symbolen und die sekundäre Bearbeitung) wird in diesem Buch, das sich speziell dem Kindertraum widmet, verzichtet.
In Abbildung 1.1 wird Freuds Theorie zur Traumarbeit kurz zusammengefasst.
Freud (1900) definierte den Traum insgesamt als eine „(verkleidete) Erfüllung eines (unterdrückten, verdrängten) Wunsches“ (S. 175). Der latente Trauminhalt enthielt für ihn also immer eine maskierte Wunscherfüllung. Um an diesem einheitlichen Erklärungsprinzip festhalten zu können, bedurfte es jedoch einiger Anstrengungen, und Freud sprach daher später (1925) einschränkend nur noch vom „Versuch einer Wunscherfüllung“.
Die latenten Traumgedanken entstammen, gemäß seiner damaligen topographischen Theorie vom Traum, dem Vorbewussten. Sie werden dann zum latenten Trauminhalt, wenn sie durch unbewusste Wünsche, die von der Zensur daran gehindert werden, im Wachleben ins Bewusstsein oder auch nur ins Vorbewusste zu gelangen, verstärkt werden und so den Drang nach Ausdruck gewinnen. Jene drängenden Wünsche waren für Freud allerdings immer Triebwünsche aus den frühesten Kindheitsstadien, ein gedanklicher Schritt, den Thomä & Kächele (1985) sehr zu Recht als einen seiner kühnsten bezeichneten. Freud hatte dies bereits 1900 apodiktisch so formuliert: „Der Wunsch, welcher sich im Traum darstellt, muss ein infantiler sein“ (S. 528). Ergänzend dazu: „Die aus dem bewussten Wachleben erübrigten Wunschregungen lasse ich also für die Traumbildung in den Hintergrund treten“ (S. 528). Träumen bedeutete für Freud somit nichts weniger, als ein Wiederbeleben der Kindheit des Träumers, Regression zu den damaligen Triebregungen und natürlich auch zu den frühen Ausdrucksweisen, was eine – nicht nur für die damalige Zeit – extreme Position darstellte.
Freud unterschied dabei eine dreifache Art der Regression, eine topische, eine zeitliche und eine formale. Bei der formalen ersetzen primitive Ausdrucksweisen und Darstellungsweisen die gewohnten, bei der zeitlichen wird auf ältere psychische Bildungen zurückgegriffen, unter dem topischen versteht Freud die Regression vom System Vbw (dem Vorbewussten) zum System Ubw (dem Unbewussten). Dies bedeutet gleichzeitig, dass während des Träumens der Sekundärprozess von der älteren Arbeitsweise des seelischen Apparates, dem Primärprozess, abgelöst wird. Die infantile Struktur des Traumes wurde somit innerhalb der topographischen Theorie auf eine einheitliche und vollständige Regression vom System Vbw zum System Ubw zurückgeführt.
Wie aus infantilen Wünschen und Kindheitserinnerungen manifeste Traumberichte werden
manifester Trauminhalt
umfasst alles, woran sich der Träumer nach dem Erwachen erinnert: Es ist der erinnerte und mitgeteilte Traum.
⇑
sekundäre Bearbeitung
Der Traum verliert durch sie den Anschein der Absurdität und Zusammenhanglosigkeit und nähert sich einem verständlichen Erlebnis an.
So entsteht eine nahezu logische Geschichte.
⇑
Traumarbeit
ist die Umwandlungsarbeit der Traumzensur
• Verdichtung
Ein Motiv erhält mehrere Bedeutungen; vergleichbar einer Fotografie mit übereinander gelegten Negativen.
• Verschiebung
Wichtige Gefühle können auf andere Personen oder Sachverhalte verschoben werden.
• Verkehrung ins Gegenteil
• Symbolisierung
⇑
Widerstand gegen das Bewusstwerden
⇑
Tagesreste ⇒ latenter Traumgedanke
Sinnesreize ⇒ unbewusste Regung, die den Anlass zum Träumen gibt
⇑
verdrängte infantile Triebwünsche + Lebensgeschichte
Abb. 1.1: Freuds Theorie zur Traumarbeit (vgl. Ermann, 2005; Mertens, 1999)
1.2.2 Weiterentwicklung der psychoanalytischen Auffassung vom Traum unter dem Einfluss der Strukturtheorie und der Ich-Psychologie
Weil sich verschiedene Konflikte mit der topographischen Theorie nicht schlüssig erklären ließen, vollzog Freud (1923) bekanntlich einen Wandel seiner Konzeption vom topographischen Modell (bewusst, vorbewusst, unbewusst) zum Strukturmodell (Ich, Es, Über-Ich). Es sind dies zwei Theorien, die sich zwar in vieler Hinsicht gleichen, jedoch letztlich nicht miteinander vereinbaren lassen (vgl. Arlow & Brenner, 1964). Seither ist es darum notwendig, zwischen zwei psychoanalytischen Theorien des psychischen Apparates zu unterscheiden: Die topographische Theorie teilt den Apparat in Systeme, welche durch das Kriterium der Zugänglichkeit bzw. Unzugänglichkeit für das Bewusstsein bestimmt sind. Die Strukturtheorie teilt den Apparat so ein, dass eine Innenwelt – in Form von sich manifestierenden Triebregungen – einer Außenwelt gegenübersteht. Zwar sprach Freud von einer „Beteiligung des Ichs bei der Traumarbeit“ und hatte bereits 1930 die Entstehung der Strafträume mit einer Wunscherfüllung des Über-Ich erklärt.1 Er konnte sich jedoch nicht entschließen, seine Lehre vom Traum im Hinblick auf die Strukturtheorie insgesamt zu revidieren, und so blieb der topographische Gesichtspunkt vorherrschend.
Vereinzelte Arbeiten suchten die neuen Auffassungen vom Ich in Freuds Traumlehre einzuarbeiten. A. Freud (1936) sprach beispielsweise davon, dass die Traumdeutung auch der Erforschung der Ich-Instanzen und ihrer Abwehrtätigkeit diene. Federn (1933) stellte erstmals fest, dass das Traum-Ich nur einen Bruchteil des Umfangs und Inhaltes des wachen Ich habe, seine Ich-Grenze nur nach Bedarf der jeweiligen Traumszene besetzt sei und ihm ganze Funktionen fehlten (Selektive Regression von Ich-Funktionen).
Erst Arlow & Brenner (1964) versuchten konsequent, Entstehung und Funktion des Traumes im Rahmen der Strukturtheorie zu erklären, behielten jedoch dabei Freuds ursprüngliche Konzeption vom Traum bei. Sie erklärten die Traumarbeit als ein Ineinandergreifen verschiedener Tendenzen des Es, Ich und Über-Ich, „Tendenzen, die sich gegenseitig verstärken können, die zusammenarbeiten, sich aber gegenseitig Widerstand leisten können“ (S. 107). Im Schlafzustand kommt es somit nach Arlow & Brenner zu einer regressiven Veränderung vieler Ich-Funktionen, wie Realitätsprüfung, Denken, Sprache, Abwehrmechanismen, integrative Fähigkeiten, Sinneswahrnehmung und motorische Steuerungsfähigkeiten.
Gleichzeitig verändern sich in ähnlicher Weise die Über-Ich-Funktionen, und darum spielen vom Es stammende Triebansprüche und Phantasievorstellungen in den Träumen eine größere Rolle, als dies im seelischen Geschehen des Wachzustandes eines Erwachsenen meistens der Fall ist (vgl. S. 101). Aufgrund dieses erweiterten Verständnisses wurde es möglich, über dem Studium der Träume nicht mehr allein die infantilen Wünsche, sondern das gesamte innerseelische Konfliktgeschehen des Träumers zu verstehen. Die zuvor erwähnte Regression von Ich-Funktionen kann auch nur selektiv erfolgen und innerhalb einer Traumperiode schwanken, – weshalb im gleichen Traum vorsprachliches, visuelles Denken und verbalisiertes Denken (als Kennzeichen einer reifen Ich-Leistung) nebeneinander gefunden werden können (vgl. auch Schepank, 1987, S. 16).
Mit Hilfe der Strukturtheorie konnten somit einige Widersprüche des topographischen Modells aufgelöst werden: etwa die Überzeugung des Träumenden, dass der Traum Wirklichkeit wäre, die Entstehung von Bestrafungsträumen, Zensur und sekundäre Bearbeitung und die Schwankungen der Regression während des Träumens (vgl. Arlow & Brenner, 1964, S. 108 f.).
1.2.3 Der manifeste Traum – nur eine „nutzlose Nussschale“?
Freuds Postulate über die alleinige Bedeutung des latenten Trauminhaltes und über den Traum als „via regia“ zum Unbewussten hatten lange erschwert, den manifesten Trauminhalt und seine Bedeutung als Ich-Manifestation entsprechend zu würdigen – dies, obwohl das Ich längst in den Mittelpunkt des psychoanalytischen Interesses gerückt war. So wies beispielsweise noch Fenichel (1936) in seiner Kritik der „Quantitativen Dream Studies“ von Alexander & Wilson darauf hin, dass eine von den Autoren erstellte Triebdiagnose der Träume nach ihrem manifesten Inhalt bedenklich wäre, weshalb auch Freud vor statistischer Verarbeitung von Träumen gewarnt hätte (S. 419 f.).
Erst Erikson (1955) kritisierte die einseitige dogmatische Fixierung auf den latenten Trauminhalt, indem er schrieb: „Offiziell aber sind wir bei jedem Traum, vor den wir gestellt sind, sehr schnell damit bei der Hand, seine manifeste Gestalt aufzuknacken wie eine nutzlose Nussschale, die wir eilends wegwerfen, um zu dem scheinbar so wertvolleren Kern zu gelangen“ (S. 31). Mit dem Wort „offiziell“ hatte Erikson angedeutet, dass man sich mit einem solchen Vorgehen dem Freud’schen Dogma von der alleinigen Bedeutung des latenten Trauminhaltes gebeugt hatte. Zwar akzeptierte auch er, dass der latente infantile Wunsch die Energie für den wiedererwachten Konflikt und damit den Traum liefern würde, allerdings in eine manifeste Traumstruktur eingebettet, die auf jeder Ebene bezeichnende Züge der Gesamtsituation des Träumers widerspiegeln würde (S. 72).
Aus den manifesten Ich-Konfigurationen des Traumes, also den Variablen der Ich-Leistungen, schloss Erikson auf Fähigkeiten und Unfähigkeiten der Ich-Funktionen des Träumers. Die jeweiligen Mängel führte er auf neurotisierende, aber auch soziokulturelle Einflüsse zurück. Diese neue Betrachtungsweise rückte den manifesten Trauminhalt wieder mehr in den Mittelpunkt für diagnostische Überlegungen, und seine späte Einbeziehung in die psychoanalytische Behandlung wurde quasi legitimiert, indem Erikson schrieb: „Bei näherem Hinsehen löst sich also die radikale Unterscheidung zwischen manifestem und latentem Traum, so nötig sie als Mittel der Lokalisation dessen ist, was am latentesten ist, in ein kompliziertes Kontinuum von stärker manifesten und stärker latenten Zügen auf, die manchmal durch sorgfältige Nachzeichnung der manifesten Konfiguration aufgefunden werden können“ (S. 50).
Tatsächlich wirkte Eriksons Arbeit bahnbrechend für eine späte Rehabilitierung des manifesten Trauminhaltes, so wie es erst mit Hilfe der Strukturtheorie gelungen war, verschiedene Phänomene des Träumens schlüssig zu erklären und einige Widersprüche der topographischen Theorie zu vermeiden.
1.2.4 Der Kindertraum und Freuds Traumdeutung
Die Geschichte des Kindertraums beginnt bekanntlich bei Freud mit einer Reihe von Träumen, zum Teil von seinen eigenen Kindern, die infantile Wunscherfüllungen enthalten. Das jüngste Kind unter den kleinen Träumerinnen und Träumern war die 19-monatige Anna. Sie hatte im Jahr 1896 eines Nachts energisch jene Nahrung eingefordert, die ihr tagsüber von der Kinderfrau verweigert worden war, weil sie morgens erbrochen hatte: „Anna F.eud, Er(d)beer, Hochbeer, Eier(s)peis, Papp“ (Freud, 1900, S. 148), vielleicht zu fokussieren in: „Ich will essen, was ich will und niemand soll mich daran hindern.“ Freud betrachtete diese Sorte von Träumen als simple, unverkleidete Wunscherfüllungen, die er im Gegensatz zu den Träumen Erwachsener gar nicht interessant fand (S. 145).
Die ersten Kinderträume, die in einer psychoanalytischen Behandlung interpretiert wurden, sind jene drei Träume des Herbert Graf (1903–1973), der als „Kleiner Hans“ in die Geschichte der Psychoanalyse eingegangen ist. Den ersten Traum hatte er bereits mit 31/4 Jahren erzählt, dem dritten folgte mit 43/4 Jahren der Ausbruch der Pferdephobie. Dieser Traum, dessen Wünsche ebenfalls nur wenig verkleidet waren, lautete: „Wie ich geschlafen hab’, hab’ ich gedacht, du bist fort und ich hab’ keine Mammi zum Schmeicheln.“ (Freud, 1909a, S. 26). Mit den Traumtexten des kleinen Hans sah Freud bestätigt, was er in der Traumdeutung und in der Sexualtheorie festgestellt hatte: „Er ist wirklich ein kleiner Ödipus, der den Vater ‚weg‘ beseitigt haben möchte, um mit der schönen Mutter allein zu sein, bei ihr zu schlafen“ (S. 96). In weiteren Fallgeschichten hat sich Freud detailliert mit Träumen von Kindern und Jugendlichen befasst, wie etwa im Fall Dora (eigentlich Ida Bauer, 1882–1945) („Bruchstück einer Hysterieanalyse“), in welchem er bereits den Zusammenhang zwischen Traumerzählung und szenischem Handeln beschrieb („Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen …“) (1905). Am ausführlichsten hat sich Freud mit jenem Traum auseinander gesetzt, den 1891 ein knapp vierjähriger Junge geträumt hatte. Dieser Traum wurde erst zwanzig Jahre später erzählt, und wegen seines Inhaltes bekam der Träumer das Pseudonym „Wolfsmann“ (mit wirklichem Namen Sergej Pankejeff, 1887–1979) verliehen („Aus der Geschichte einer infantilen Neurose“). Die Deutungen des Wolfstraums dienten wiederum dem Nachweis für die infantile Sexualität (1918).
Nichtsdestotrotz charakterisierte Sigmund Freud (1916/1917) die Träume der Kinder bis etwa zum fünften Lebensjahr als kurz, klar, kohärent, leicht zu verstehen und unzweideutig. Er verstand die Kinderträume als einfache, meist an ein Vortagesereignis anknüpfende unverhüllte Wunscherfüllungen und erwähnte auch, dass bis zum fünften Lebensjahr manifester und latenter Trauminhalt zusammenfielen, erst dann setze in der Regel die Traumentstellung ein und die Träume würden komplizierter. Insofern waren die Träume der kleinen Kinder für Freud auch nicht interessant, als dass sie eben für das Studium der Träume der Erwachsenen von Nutzen sein könnten: „Die allereinfachsten Formen von Träumen darf man wohl bei Kindern erwarten, deren psychische Leistungen sicherlich minder kompliziert sind als die Erwachsener. Die Kinderpsychologie ist nach meiner Meinung dazu berufen, für die Psychologie der Erwachsenen ähnliche Dinge zu leisten wie die Untersuchungen des Baues oder der Entwicklung niederer Tiere für die Erforschung der Struktur der höchsten Tierklassen. Es sind bis jetzt wenig zielbewusste Schritte geschehen, die Psychologie der Kinder zu solchem Zwecke auszunützen“ (Freud, 1900, S. 145). Dieses Zitat verdeutlicht sicherlich Freuds ernsthafte Bemühungen, über den Kindertraum zu einem tieferen Verständnis des Traumes zu gelangen. Die herangezogenen Bilder – etwa der Vergleich von Kindern mit niederen Tieren – verraten jedoch auch ein zum damaligen Zeitpunkt ambivalentes Verhältnis zum Kind und seinen Besonderheiten.
1.2.5 Die Bedeutung des Traumes in der Frühzeit der Kinderanalyse
Natürlich beschäftigten sich auch die Pionierinnen und Pioniere der Kinderpsychoanalyse mit den Träumen von Kindern, wie Anna Freud (1927, 1957, 1965), Melanie Klein (1926) sowie Hans Zulliger (1972), und verwendeten ähnliche Definitionskriterien wie Freud. Klein hat bereits 1926 darauf hingewiesen, dass das Kind die fehlenden Assoziationen zu einem Traum über sein nachfolgendes Spiel liefert (S. 204 f.). Hug-Hellmuth (1913) erklärte die mit dem Alter fortschreitende Entstellung der kindlichen Träume aus der schrittweise einsetzenden Traumzensur aufgrund der Wirkungsweise von Erziehungseinflüssen (S. 164). Auch Morgenstern (1937) betonte, dass die Zensur in den Träumen der Kinder zunächst weniger streng wäre und die Konflikte darum einen deutlicheren Ausdruck fänden. Hug-Hellmuth hat sich darum auch deutlich für die Verwendung von Träumen in der Kinderanalyse ausgesprochen, auch wenn sie die Problematik, welche aus den Erfahrungen der Kinder rührte, deutlich sah: „Natürlich kommt den Träumen auch in der Kinderanalyse ihre Rolle zu und man hat nicht mehr als beim Erwachsenen zu befürchten, dass der Widerstand ein gehäuftes oder erdichtetes Traumleben bedinge. Der angebliche Nachttraum bedeutet ja nur eine Tagphantasie, die das Kind als solche vielleicht nie ausspräche. Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, wie schwierig es ist, manches Kind zur kritiklosen Mitteilung jedes Einfalles zu bringen, weil es von der Nutzanwendung der guten Lehre seiner täglichen Umgebung, ‚keinen Unsinn zu reden‘ usw., nicht loskommt“ (1920, S. 21). Allerdings konnte der Kindertraum auch später nie jene zentrale Bedeutung für die Kinderanalyse gewinnen, wie sie die Träume der Erwachsenen in der Psychoanalyse einnahmen. Nach Despert (1949) und Ablon & Mack (1980) rührte das vor allem daher, dass Kinder ungern Träume berichten würden.
Eine andere Ursache sahen manche Autoren darin, dass Kinder, wie beispielsweise Zierl (1973) schrieb, in der Wiedergabe ihrer Träume ungenau und unzuverlässig seien: „Erinnerungsfälschungen, Umdichtungen nach Maßgabe des Wachbewusstseins, konfabulatorische Ausschmückungen und Elemente des Wunschdenkens können den Traumtext bis zur Unkenntlichkeit modifizieren“ (S. 415).
Tatsächlich sind die Übergänge zwischen Traumbericht, Tagtraum und Phantasien fließend, und daher ist es bei Kinderträumen oft nicht möglich, den Unterschied zwischen eigentlichem Traumbericht und im Nachhinein produzierten Phantasien und Ausschmückungen auszumachen. Innerhalb der Kinderpsychoanalyse wiegt diese Tatsache letztlich gering; denn nach psychoanalytischem Verständnis gelten auch Phantasien und Tagträume als mehr oder weniger verkleidete Wunscherfüllungen, als Ersatz für Versagungen in der Realität und besitzen darum die gleiche Funktion wie nächtliches Träumen, um psychische Spannungen abzureagieren (vgl. A. Freud, 1978, S. 2 834).
Ein entscheidender Grund für die stiefmütterliche Behandlung des Traumes in der Psychoanalyse des Kindes resultiert aus einer anderen Entdeckung: Da sich nach psychoanalytischer Auffassung Triebabkömmlinge, Impulse und Wünsche auch im freien Spiel, in bewussten Phantasien und in Tagträumen ausleben, erübrigt sich in den meisten Fällen eine konsequente Traumanalyse.
Es war darum weniger die Weigerung von Kindern, Träume zu berichten, noch ihre Neigung zur konfabulatorischen Ausschmückung, sondern es war der Ausfall der freien Assoziation, der die Psychoanalyse auf konsequente Nutzung des Kindertraumes verzichten ließ: Kinder verweigern die analytische Grundregel, ihre Träume kritiklos mitzuteilen. Wenn sie gelegentlich Träume in die psychoanalytische Behandlung bringen, liefern sie im Gegensatz zu Erwachsenen selten und weniger Einfälle zu den einzelnen Traumelementen. Anna Freud (1965) beschrieb dies in folgender Weise: „Sie teilen ihre Erlebnisse mit dem Analytiker, vorausgesetzt, dass ein Vertrauensverhältnis innerhalb der Analyse hergestellt ist; aber ohne das Mittel der freien Assoziation können ihre Mitteilungen nicht über den Rahmen des Bewusstsein hinausgehen“ (S. 2 149f.).
Anna Freud führt diesen Ausfall der freien Assoziation zum einen darauf zurück, dass die Position des Erwachsenen als Autoritäts- und Über-Ich-Figur eine uneingeschränkte Aufrichtigkeit des Kindes verhindere. Zum anderen misstraue das kindliche und unreife Ich der eigenen Widerstandskraft dem Triebleben gegenüber: Eine Ausschaltung von Kritik und Zensur bedeute somit eine größere Gefahr für das Kind als für den Erwachsenen. Eine sehr sorgfältige Darstellung des Kindertraums und der Psychoanalyse in Vergangenheit und Gegenwart findet sich bei Hamburger (1987).
1.2.6 Die Arbeit mit Träumen in der Frühzeit der Kinderpsychoanalyse
Es existiert ein ausführlicher Fallbericht, der den Umgang mit Träumen in der Frühzeit der Kinderanalyse dokumentiert: Peter, nicht ganz zehn Jahre alt, leidet an Pavor nocturnus und treibt sich mit Vorliebe auf öffentlichen Toiletten herum. Die Ehe der Eltern ist quasi zerbrochen, sie wollen sich demnächst trennen. Peter ist in kinderpsychoanalytischer Behandlung und erzählt seiner Analytikerin den folgenden Traum:
„Mein Vater hat mich weggegeben zu jemandem anderen. Dort ist die Lydia. Ich spiel’ und flirt’ so mit ihr. Dieser andere sagt plötzlich, er will seine Kinder erschießen. Denn es ist Krieg und da ist es besser, er erschießt sie gleich. Er erschießt alle seine eigenen Kinder. Dann kommt die Reihe an mich. Er lässt mir dieWahl, ob ich betteln gehen will oder erschossen werden. Ich laufe weg und überlege, dann komme ich zurück und sage, erschossen. Er fragt womit. Ich sage, mit einer Pistole. Er nimmt eine Pistole, zielt auf mich, es macht einen Krach – und plötzlich sitzen wir alle friedlich um den Frühstückstisch. Dann kommt mein Vater und holt mich wieder ab“




























