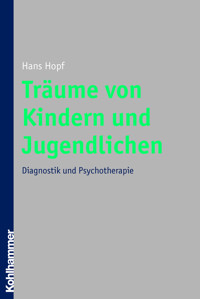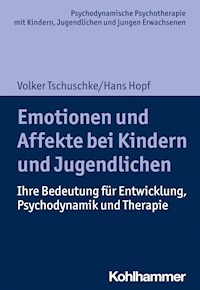35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Jungen sind zum Problem geworden. Sie sind aggressiv, bewegungsunruhig, unaufmerksam, risikobereit, gelten als Störer. Vom ersten Tag an sind sie anders als Mädchen und entwickeln viel häufiger psychischen Auffälligkeiten. Warum ist das so? Und was können wir therapeutisch und erzieherisch dagegen tun? "Lieber Doc, Himmel, was für ein Teil, Sie furchterregender Vielgescheiter, uff! So viele klugen Gedanken haben in EINEM Kopf Platz, ich verneige mich mal schnell." Andreas Altmann, Autor des Bestsellers "Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend" in einem Brief an Hans Hopf über "Die Psychoanalyse des Jungen". Das Buch greift anhand vieler Beispiele und Fallsequenzen folgende wichtige Themen auf: - die Entwicklung der männlichen Identität im Beziehungsdreieck mit Mutter und Vater, - die psychischen Ursachen von Aggression, mangelhafter Affektregulierung, Bewegungsunruhe und Aufmerksamkeitsdefiziten, - die Biologie des Jungen, - Triebentwicklung des Jungen, - die Geschwisterbeziehungen, - die Möglichkeiten einer hilfreichen pädagogischen und therapeutischen Begleitung. Die These von Hans Hopf, einer der renommiertesten Kinderanalytiker Deutschlands mit 40-jähriger Erfahrung: Die Jungen sind die "Emanzipationsverlierer", sie wachsen überwiegend "vaterlos" in einer feminisierten Welt auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Hans Hopf
Die Psychoanalysedes Jungen
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2014 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Roland Sazinger, Stuttgart, unter Verwendung eines Fotos © shuravaya/fotolia
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94775-5
E-Book: ISBN 978-3-608-10676-3
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20220-5
Dieses E-Book entspricht auf aktuellen Auflage der Printausgabe
Inhalt
Vorwort
Einführung – Jungen auf der Suche nach ihrer Identität
Eine persönliche Einleitung
Traumatisierte Kinder – heute wie damals
Traumatisierte Väter der Nachkriegszeit
Kriegskinder als spätere Väter – eine »geschlagene« Generation
In einer »Kalten Heimat«
Männlich werden …
Existieren Geschlechtsunterschiede? Wie viel »Junge« darf sein?
Wer hat Angst vorm »Schwarzen Mann«?
Geschlechtsunterschiede – erste Überlegungen und Fragen
Beängstigende Entwicklungen oder alles nicht so schlimm?
»Das Gehirn macht die Seele« und die Seele formt das Gehirn!
Kleine Biologie des Jungen
X- und Y-Chromosom
Hormone und Gehirnentwicklung
Evolutionstheoretische Überlegungen
Zusammenfassung
1 Mutter und Sohn
Das Bild von der Mutter in unterschiedlichen psychoanalytischen Theorien
Sigmund Freud – Der Sohn, ein Liebling der Mutter
Melanie Klein – Die gute und die böse Brust
C. G. Jung – Facettenreicher Mutterarchetyp
René A. Spitz – Deprivation und Verfall
Margaret Mahler – Loslösung von der Mutter
Die Mutter, gut genug – Mutterschaft ein »Zustand«
Die Mutter und das väterliche Gesetz
Ausblick
Die Mutter und ihr Einfluss auf die Entstehung von Sexualität und männlicher Identität
Entwicklung von Sexualität
Die pflegende Mutter und die Geschlechtsentwicklung beim Jungen
Die allgemeine Verführungstheorie von Laplanche: Infantile Sexualität ist erworbene Sexualität – wie kommt die Sexualität ins Kind?
Zusammenfassung
2 Vater und Sohn
Einleitung
Mann wird Vater
Welche Funktionen hat der Vater?
Bedeutung und Funktion des Vaters innerhalb der Psychoanalyse
Identifizierung mit Mutter und Vater von Anfang an
Die Entwicklung von Über-Ich und Ich-Ideal
Das Inzestverbot
Entwicklung der Geschlechtsidentität
Bisexualität
Geschlechtsidentität
Kerngeschlechtsidentität
Geschlechtsrollenidentität
Geschlechtspartneridentifizierung
Verlauf der Geschlechtsidentitätsentwicklung
»Entidentifizierung« – wie wird der Junge »männlich«?
Triangulierung
Die Phantasie vom Dritten und der innere trianguläre Raum
Der Weg hin zum Dritten – das Spiel mit dem Dritten
Kleine Zusammenfassung
Schlusswort für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten
3 Schaltstellen der Triebentwicklung des Jungen
Der Kastrationskomplex
Vorüberlegungen
Beschneidung und Kastrationskomplex
Kastration und Mythologie
Der kleine Junge und der Kastrationskomplex
Der Kastrationskomplex bei Lacan
Kastrationsangst und Geschlechterdifferenz
Kastrationsangst und die fragile männliche Identität
Phallische Phase
Kleine Einleitung
Beginn der phallischen Phase
Phallisch und ödipal
Das phallische Spiel
Wie sieht die phallische Entwicklung eines Jungen aus?
Wie viele phallische Qualitäten darf ein Junge heute haben?
»Wie viel Junge« darf also heute sein?
Der Ödipuskomplex
Ödipale Triangulierung
Der Mythos
Der Ödipuskomplex bei Freud
Scheitern des Wisstriebes – Lern- und Arbeitshemmungen
Elektra mordet nicht!
Der Ödipuskomplex beim Jungen
Das ungleiche Beziehungsdreieck
Voyeurismus und paranoide Angst
Eine Mutterliebe – oder ein totgeborenes Lebensglück?
Der negative Ödipuskomplex und die Geschlechtspartneridentifizierung – Der vollständige Ödipuskomplex
Heterosexuelle oder homosexuelle Geschlechtspartneridentifizierung
Untergang des Ödipuskomplexes und Beginn der Latenz
4 Die Latenz heute
Einleitung
Externalisierende Störungen mit Spiel- und Symbolisierungsstörungen
Zunehmende Sexualisierung
Probleme, weil der Vater abwesend ist
Wie sieht die Latenzphase heute aus?
5 Adoleszenz
Einleitung
Einbruch der Sexualität
Konflikte der Adoleszenz
Kognitive Weiterentwicklung und Suche nach Identität
Ödipuskomplex und Adoleszenz
Wenn die Loslösung scheitert
Geschlechtsidentität und Homophobie
Wege zur Identität
Spezielle Gefährdungen
Abschied, Trauer und Depression
Hass auf den Vater und Vatersehnsucht
Aggression und Autoaggression
Über-Ich und Abwehrmechanismen
Abschließende Überlegungen
6 Die Mutter – zwischen Ernähren und Begehren
Einleitung
Theoretische Vorüberlegungen
Die Mutter – die erste Beziehungsperson
Zuschreibungen von Männlichkeit
Die unterwürfige, vom eigenen Vater »unterstimulierte« Frau als Mutter
Inzestuöse Ängste und ihre Abwehr über Aggressivierung und Sexualisierung
Wenn der Vater fehlt
Was bedeuten diese Ergebnisse?
Zu lange und zu nahe dem Körper der Mutter ausgesetzt
Die verführerische, vom eigenen Vater »überstimulierte« Mutter
Folgen von sexuellem Missbrauch durch die Mutter
Der verdächtige Dritte – Dr. Jekyll ist Mr. Hyde
Von der »Schuld« der Mutter
Kurze Überlegungen zu »männlicher Identität« und ihren Varianten
7 Das Elternpaar
Einleitung
Das heterosexuelle Elternpaar
Alleinerziehen
Die Mutter kann die Bedeutung des Vaters fördern oder blockieren
Das gleichgeschlechtliche Elternpaar – die Regenbogenfamilien
Psychoanalytische Behandlungen von Kindern aus Regenbogenfamilien
Resümee
Psychoanalyse und gesellschaftliche Realität
Kinder und ihre Eltern können ganz unterschiedliche Lebensziele haben
Protektive Faktoren in der Entwicklung eines Kindes
Kinderkrippen für Kleinkinder ab dem 13. Lebensmonat und die Folgen für die Jungen
Bedürfnisse von Gesellschaft, Eltern und Kindern
Außerfamliäre Betreuungsformen, Tagesmütter, Kinderkrippen und andere Einrichtungen werden gebraucht
Von Krippenbetreuung profitieren Jungen kaum
Ist die Kinderpsychoanalyse reaktionär?
8 Brüder und Schwestern
Einleitung
Geschwister – damals und heute!
»Das Kind als Substitut einer Geschwisterfigur«
Kinder ohne Geschwister
Einflüsse des Altersabstands und Geschlechts der Geschwister
Geschwisterinzest
Schlussgedanke
9 Die Aggression des Jungen
Theorien zur Aggression innerhalb der Psychoanalyse
Die Entwicklung der Freudschen Auffassung von Aggression
Das Konzept des Todestriebes bei Melanie Klein
Die Bedeutung der Ich-Psychologie
Kritik an der Theorie vom angeborenen Destruktions- und Todestrieb
Aggression bei D. W. Winnicott
Resümee: Ist Aggression primär ein Trieb oder reaktiv?
Affektregulierung
Aggression und Autoaggression
Alle werden sie es büßen! Ein Fall von narzisstischer Wut
Resümee
Gemeinsamkeiten von Symbolisierung und Mentalisierung
Die Bedeutung der Geschlechtsunterschiede für die Entstehung von aggressiven und destruktiven Tendenzen
Empirische Untersuchungen
Externalisieren
Was bedeutet Externalisieren?
Externalisierungen und Externalisierende Störungen treten häufiger bei Jungen auf
Fallgeschichte zu Externalisierung
10 Externalisieren – Bewegung – Räume
Die Lust der Jungen an den äußeren Welten und an den unbelebten Dingen
Eine Theorie von Michael Balint über die Entstehung von Objektbeziehungen und ihren Störungen
Philobatismus und Männlichkeit
Existiert ein »normaler« Philobatismus?
Von der Lust an der Bewegung
Von der Affektmotilität zur Leistungsmotorik
Gefährliche Objekte, Skills und Sehnsucht nach der Weite
Mögliche Ursachen für starke Ausprägungen von Philobatismus – Gelungene Anpassung an eine freundliche Welt
Skills, Thrills und Lust am Risiko
Der Computer – ein Beruhigungsmittel für frühe Verletzungen bei Jungen?
Jungen und Computergewalt – einige Fakten
Computer und Denken
Zusammenfassung
11 Jungen und Aufmerksamkeit
Einführung
Habituation in einer »Erregten Gesellschaft«
Einige Erkenntnisse der Hirnphysiologie
Einige Begriffsbestimmungen
Psychoanalytisches Verstehen von Aufmerksamkeit
Warum sind vor allem Jungen unaufmerksam?
Narzisstische Tendenzen
Jungen sind den Mädchen sprachlich unterlegen
Kinder werden aufmerksam geboren – Entwicklung von Aufmerksamkeit beim Säugling
Vermessung und Erzwingen von Aufmerksamkeit
Zusammenfassung
Epilog
Jungen werden männlich – eine abschließende Zusammenfassung
Die Disziplinierung der Jungen
Literatur
Stichwortverzeichnis
Anmerkungen
Informationen zum Autor
Pressestimmen zum Buch
Vorwort
Warum ein Buch nur über Jungen?
Mit den zentralen Inhalten dieses Buches habe ich mich über Jahrzehnte hinweg auseinander gesetzt. In den neunziger Jahren begannen Jungen zum Problem zu werden. Ich war therapeutischer Leiter eines psychotherapeutischen Kinderheims und es wurden immer mehr Jungen mit der Diagnose ADHS vorgestellt, die, so hatte ich aus den Unterlagen erfahren, an Störungen der Transmittersubstanzen im Gehirn leiden sollten. Aus psychoanalytischer Sicht waren es altbekannte soziale Störungen, allerdings hatten diese Jungen immer häufiger massive Probleme mit der Beherrschung ihrer Affekte. Dieses Störungsbild hatte es schon immer gegeben, es war in unterschiedliche Gewänder gekleidet worden und hatte Psychoorganisches Syndrom (POS), Minimale Cerebrale Dysfunktion (MCD), schließlich Hyperkinetisches Syndrom (HK S) geheißen. Nissen schreibt in seiner Geschichte der Kinderpsychiatrie, dass neuere Untersuchungen auf eine hirnorganische Kerngruppe von 1–2% mit diesem Störungsbild verweisen (Nissen, 2005, S.445). Die in der alten psychiatrischen Literatur beschriebenen Kinder mit einem hyperkinetischen Syndrom wiesen so gut wie immer feststellbare organische Defizite auf, zumeist nach Krankheiten des Zentralnervensystems. Jetzt war die Diagnose in das DSM aufgenommen worden, es gab das passende Medikament und flugs wurde die Diagnose ausgeweitet. Hauptgrund war, dass das DSM zwar akribisch beschreibt, aber nicht nach Ursachen fragt. So wurde die ursprüngliche Zappelphilipp-Diagnose in kurzer Zeit auf alle sozialen Störungen ausgedehnt, seelische Ursachen wurden ausgeblendet und alle Störungen wurden mit einem schlichten Wackelkontakt im Gehirn erklärt. Über den Topf mit brodelnden Konflikten kam ein eiserner Deckel mit einer Diagnose ADHS, die nicht mehr angezweifelt werden durfte. Ansonsten wurde man der Unwissenschaftlichkeit geziehen und zum Kinderfeind erklärt – weil man das unentbehrliche Medikament für entbehrlich hielt und Eltern beschuldigte, da man ihnen unterstellte, sie trügen die Verantwortung für ihr Kind.
Um den Jungen die Seele zurückzugeben, habe ich vor allem die folgenden Themen in den Mittelpunkt dieses Buches gestellt: an erster Stelle natürlich die Entwicklung von männlicher Identität im Beziehungsdreieck Mutter–Vater–Sohn. Die weiteren Schwerpunkte sind die psychischen Ursachen von Aggression und Affektregulierung, Bewegung und Bewegungsunruhe sowie von Aufmerksamkeit und ihren Störungen. Weil diese Bereiche bei den Jungen höchst störanfällig sind und sie darum Sand ins soziale Getriebe streuen, wird ihnen auch das meiste Methylphenidat verordnet, ungeachtet der Tatsache, dass männliche Wesen zu stoffgebundenen Süchten neigen.
Ein solch vielseitiges, umfangreiches Buch kann nicht ohne die Hilfe vieler kollegialer Freunde und im intensiven geistigen Austausch entstehen, darum habe ich an dieser Stelle einigen Menschen zu danken. Es ist kein leeres Ritual, wenn ich mit meiner Frau Gisela beginne. Mit ihr habe ich mich fortwährend über alle Inhalte, alle kritischen Fragen intensiv ausgetauscht. Sie hat mich jahrelang geduldig angehört, mich allenthalben unterstützt und mich liebevoll ins Alter begleitet. Ich danke meinen erfahrenen Kolleginnen Sigrid Barthlott-Bregler, Ulrike Hadrich und Gudrun Merz für ihre kritischen Anmerkungen, ihren fraulichen Blick und ihre konstruktiven Gedanken. Jürgen Heinz hat mich mit Texten und klugen Gedanken versorgt. Rosalinde Baunach, Andrea Baur, Stefan Hetterich und Kathrin Kömm haben mir eindrückliche Fallsequenzen aus Supervisionen zur Verfügung gestellt, für die ich ihnen ebenfalls danke. Ich wollte kein pures Theoriebuch verfassen, sondern alle Überlegungen sollten über lebendige Beispiele anschaulich werden. Hierbei hat mir auch meine Kollegin Gabriele Häußler geholfen, die mir aus ihrem Säuglingsbeobachtungsseminar anschauliche Protokolle zur Verfügung gestellt hat. In unserer Arbeitsgruppe zur männlichen Identität, geleitet von J. C. Aigner, Frank Dammasch und Hans-Geert Metzger, habe ich viele anregende Gedanken erfahren und konstruktive Rückmeldungen erhalten, die mich in meinen eigenen Überlegungen bestärkt haben.
Ganz besonders danke ich dem Lektor des Klett-Cotta-Verlags, Dr. Heinz Beyer, für die vielen anregenden Diskussionen, seine konstruktiven Hilfestellungen und Ermunterungen. Herr Oliver Eller hat die Texte schließlich sorgfältig lektoriert, alle Quellen geprüft und die Literatur vervollständigt. Ihm danke ich für seine gründliche Arbeit, seine Geduld und Zuverlässigkeit.
Dieses Buch ist auch ein kleiner Rückblick auf mein 40-jähriges Kinderanalytiker-Leben und -Handeln geworden. So hoffe ich, dass es viele Leserinnen und Leser finden wird, Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern und Großeltern.
Mundelsheim, im Herbst 2013
Hans Hopf
Einführung – Jungen auf der Suche nach ihrer Identität
Eine Geburtstagsfeier. Drei etwa 3-jährige Jungen rennen schreiend durch den Raum. Plötzlich wirft sich der Größte auf den Kleinsten, dieser kreischt lauthals und windet sich los. Beide stehen wieder auf, rennen durch den Raum und johlen. Dann wird der dritte umgeschubst. Er schlägt sich den Kopf an, heult, hält sich den Kopf und rennt hinter dem Jungen her, der ihn umgestoßen hat. Kreischen, Johlen, knallrote verschwitzte Gesichter.
Am Rand steht ein kleines, vielleicht 4-jähriges Mädchen, schaut mit entgeistertem Gesichtchen, gleichzeitig fasziniert auf das Geschehen. So wie sie vielleicht später als Mutter den Sohn sehen wird, wie so manche Ehefrau ihren Mann, Erzieherinnen ihre Jungenhorde. Ein wenig befremdlich, unglaublich laut, immer in Bewegung, rivalisierend und streitend.
Eine persönliche Einleitung
Dieses Buch versucht, eine Entwicklungspsychologie des seelisch gesunden Jungen unter psychoanalytischen Aspekten zu entwerfen. Seelische Gesundheit ist jedoch nur zu beschreiben, indem man Gegebenheiten untersucht, bei denen sich ein Mangel offenbart oder etwas gestört ist, denn die Psychoanalyse ist bekanntlich der Meinung, dass Pathologie und Normalität nur gradweise voneinander unterschieden sind; die Pathologie ist lediglich eine besondere Ausprägung allgemeiner und normaler Eigenschaften (vgl. auch Dornes, 1994, S.27). Es ist das große Verdienst von Freud, dass er mit seiner Konzeption der Hysterie und seinen Variationen des Sexualtriebs das Normale und Pathologische auf einer Ebene ansiedelte und als Varianten des gleichen fundamentalen seelischen Geschehens betrachtete (Marcus, 2004, S.389).
Traumatisierte Kinder – heute wie damals
Darum sollen auch Vulnerabilitäten herausgearbeitet werden, etwa indem auf Fragen eingegangen wird, woher die doch erheblichen seelischen Geschlechtsunterschiede von Jungen und Mädchen herrühren, beispielsweise auch die wichtige Frage, warum Jungen so häufig externalisierende Störungen zeigen etc. Es ist also auch ein Buch über die sogenannte ADHS, ohne sich mit diesem umstrittenen Störungsbild explizit auseinander zu setzen. Wenn auf Problembereiche des Jungen eingegangen wird, müssen auch Überlegungen angestellt werden, wie eine erfolgreiche Erziehung aussehen könnte, die negativen Entwicklungen vorbeugt. Es ist aber vor allem ein Buch für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und soll auch Hilfestellungen für effektive psychoanalytische Behandlungen entwickeln. Ich habe darum versucht, alle theoretischen Überlegungen immer mit Fallbeispielen zu illustrieren.
Dabei genügt es nicht, ausschließlich individuelle Entwicklungen zu beschreiben. Betrachten wir Entwicklungen wie das Entstehen von neurotischen Störungen als interpersonale Prozesse mit innerseelischen Folgen, so wird deutlich, dass solches Geschehen in keinem abgegrenzten familiären Bereich stattfinden kann, sondern dass in diesen Raum unaufhörlich Einflüsse der Gesellschaft dringen, die sich atmosphärisch niederschlagen – damals und heute.
Noch eine private Anmerkung. Ich bin Kriegskind, bin Sohn eines vom Krieg traumatisierten Vaters und bin Vater und Großvater. Wenn ich meine eigene ethnische Identität überdenke, so erkenne ich auch die lebenslangen Anstrengungen, die eine solche Integration erfordert. Ich bin Nachkomme von deutschen, tschechischen und jüdischen Vorfahren, in Tschechien geboren, bin in meinem Leben sechzehnmal umgezogen und bin schließlich ein schwäbischer Kinderpsychoanalytiker geworden. Dennoch machen sich immer wieder die einzelnen Komponenten bemerkbar. Aber vielleicht macht temporäre Desintegration erst lebendige Identität aus, damit wir nicht nur zu einem neuen kohärenten Wesen in einer beständigen Kontinuität werden, sondern dass auch die Grundsubstanzen und Bausteine unserer Identität weiterhin leben und wirken dürfen.
Diese unterschiedlichen Identitäten und vielerlei Repräsentanzen werden in meine Reflexionen einfließen, denn ich bin von transgenerationalen Weitergaben von Erlebtem, des Verarbeiteten und Unbewältigten an die folgenden Generationen überzeugt. Ich zitiere zu diesen Gedanken aus einem Lehrbuch:
»Wohl selten sind die Entwicklungsbedingungen der Kinder so unruhig und ungeordnet gewesen wie in den vergangenen zehn oder gar fünfzehn Jahren. (…) Jeder Lehrer klagt über die nicht zu bändigende Wildheit und motorische Unruhe der prozentual stark hervortretenden sogenannten ›Störer‹. Die Hoffnung, dass man mit einfachen, billigen, leicht zu handhabenden Maßnahmen diese so störend unruhigen Kinder zur Ruhe bringen möchte, wird immer wieder ausgesprochen. Dass diese Hoffnung kaum verwirklicht werden kann, leuchtet von selber ein, wenn man nur einen kurzen Augenblick der Bemühung darauf verwendet, die Kinderschicksale solcher ›Störer‹ wirklich zu überdenken.«
Dieser Text wurde zum ersten Mal 1954 veröffentlicht und stammt aus dem Buch Psychogene Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen von Annemarie Dührssen (9. Aufl. 1972, S.279). Weggelassen habe ich lediglich die Einleitung des Textes, die da lautet: »Der vergangene Krieg hat mit der jetzigen Kindergeneration ein Riesenexperiment gestartet. Wohl selten sind die Entwicklungsbedingungen der Kinder so unruhig und ungeordnet gewesen wie in den vergangenen zehn oder gar fünfzehn Jahren. Ausbombung, Evakuierung, Dienstverpflichtung der Mütter, Flüchtlingselend im Treck, langjährige Wohnungsnot ist nur den wenigsten Kindern erspart geblieben. Die Quittung auf dieses Unglück ist nicht ausgeblieben.«
Die von Dührssen erwähnten unruhigen Kinder mit den bewegenden Schicksalen sind also die während des Zweiten Weltkriegs und danach geborenen Kinder. Eine auffällige Zahl von bewegungsunruhigen Kindern gab es also schon zu anderen Zeiten: Die sogenannte »Langeoog-Untersuchung« ist wohl die wichtigste und zugleich eine exemplarische Beschreibung von traumatisierten Kriegskindern des Zweiten Weltkriegs. In den Jahren ab 1947 waren 50000 Schüler der Geburtsjahrgänge 1927 bis 1941 im Lebensalter zwischen 6 und 20 Jahren untersucht worden. Festgestellt wurden damals »nervöse Störungen«, übergroße Schreckhaftigkeit, motorische Unruhe, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Schlaf- und Sprachstörungen (Radebold, 2005, S.47), Symptome, welche der heute so häufig diagnostizierten ADHS außerordentlich geähnelt haben. Damals (wie heute) entstanden diese Störungen vor dem Hintergrund von Trennungstraumata und Vaterlosigkeit. Doch zu jener Zeit durften Kinder ihren Bewegungsdrang noch ausleben, die Welt war noch nicht zubetoniert und die Jungen waren auch nicht an die Computer gefesselt und zappelten dort herum. Gemäß King sind die Räume oder Spielräume der Kindheit kleiner, weniger dauerhaft und weniger verlässlich oder weniger überschaubar geworden (King, 2013, S.32).
Welche Identifikation mit »Männlichkeit« war damals überhaupt möglich gewesen, in einer Zeit der gefallenen Helden, gestürzten Tyrannen, der Kriegsverbrecher und zerstörten Soldaten? Wer waren diese künftigen Väter und Großväter?
Traumatisierte Väter der Nachkriegszeit
Für eine geglückte Identitätsbildung braucht der Junge vor allem den Vater. Welchen Vater wir haben, hängt nicht allein von einer gelungenen individuellen Persönlichkeitsentwicklung und den entsprechenden Identifizierungen ab. Franz (2010) geht davon aus, dass seit hundert Jahren die Identitätskerne vieler Männer von toxischen väterlichen Introjekten mitbestimmt werden, was bis heute zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen ihrer Identitätssicherheit und Verzerrung ihres Gefühlslebens geführt hat. Er rechnet dazu die patriarchalisch-wilhelminische Vaterautorität, den nationalsozialistisch-soldatischen Vater, die toten oder traumatisierten Väter der Kriegs- und Nachkriegszeit, die heutigen abwesenden Väter, die bis in die Gegenwart spürbare und empirisch nachweisbare Spuren hinterlassen haben (S.16). Ich will zum dritten negativen »Vatermodell« des Autors, dem traumatisierten Vater des Zweiten Weltkriegs, einen eigenen Erinnerungssplitter hinzufügen:
Ich war viereinhalb Jahre alt und es war März oder April 1947, in einem kleinen Dorf in Hessen. Ich hielt die Hand meiner Großmutter, wir liefen auf einen Bauernhof zu. Wir, das waren noch meine Mutter und meine beiden Brüder, waren gerade über die Grenze in Stendal aus der Sowjetischen Besatzungszone in die amerikanische Zone geflüchtet. In diesem Dorf, das habe ich erst später erfahren, wollten wir unseren Vater treffen. Er war in Serbien in Kriegsgefangenschaft gewesen. Dort hatte er in einem Bergwerk einen schweren Unfall erlitten. Von da an war er arbeitsunfähig und wurde aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Mit Hilfe des Roten Kreuzes hatte er aufgespürt, dass in diesem Dorf in Hessen eine Schwester meiner Mutter lebte. Dort fand also der Treff statt.
Ein hagerer Mann in einer abgerissenen Uniform kam auf uns zu. Er war mir völlig fremd. Ich hatte Angst vor ihm. Er umarmte und küsste alle, am innigsten meinen drei Jahre älteren Bruder. Als er auf mich zukam, versteckte ich mich hinter meiner Großmutter, da wandte er sich ab. Meine Mutter rief: »Aber das ist doch Dein Papa.« Ich glaube, ich habe geweint.
Wenig später reisten alle ab, ins Flüchtlingslager. Ich blieb bei meiner Großmutter auf dem Dorf, über zwei Jahre lang. Als ich eingeschult wurde, musste ich zur Familie ins Flüchtlingslager. Da habe ich ihn zum zweiten Mal, jedoch zum ersten Mal richtig gesehen. Er war ein mir völlig fremder Mensch, so wie ich für ihn ein fremdes Kind war. Meine Mutter hatte ich zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Ich sehnte mich nach meiner 75-jährigen Großmutter, die mich so sehr geliebt und den ganzen Tag mit mir verbracht hatte. Ich war unendlich traurig. Ich wurde in eine Baracke gebracht, in der etwa vierzig Familien in einem einzigen Raum ohne Abtrennungen wohnten, dicht an dicht, in Stockbetten. Jeden Tag kamen neue Männer aus dem Krieg zurück. Sie hatten ausgemergelte Körper. Mit toten, starren Augen lagen viele tagsüber auf den Betten und rauchten Kette. Ihre Frauen schimpften unaufhörlich, weil sie so müde und passiv waren. So wie mein Vater waren sie traumatisiert, und viele fanden nicht mehr recht den Weg ins Leben. Ich lebte fast sechs Jahre in diesem Flüchtlingslager, bis mein Vater wieder zum Arbeiten fähig war und in Süddeutschland eine Anstellung gefunden hatte.
Kriegskinder als spätere Väter – eine »geschlagene« Generation
Kriegskinder – die Jahrgänge 1939 bis 1945 – waren durch Kriegserfahrungen wie Bedrohungen und Verluste von Angehörigen, Krankheit und Entbehrung, Bombenkrieg und Militäraktionen, Fluchterlebnisse und Vertreibung, Heimatlosigkeit und Fremdheit, Armut und Isolierung geprägt worden. Richter schreibt 2010, dass die damaligen Eltern den Kindern verschwiegen, was in ihrem Innern an Traumata, Schuld, Scham, Ängsten, Trauer angestaut war. »Gerade darum wirkte das Verschwiegene höchst pathogen: Es kam bei ihren Kindern in Gestalt der bereits zuvor erwähnten Schwierigkeiten, Schlafstörungen, Unruhe, Schulversagen, Weglaufen, Jähzorn oder psychosomatischen Symptomen zum Vorschein« (S.177). Die Kriegskinder entwickelten – wie zuvor erwähnt – viele psychische Probleme, die jedoch niemanden so recht kümmerten und mit denen sie selbst zurechtkommen mussten. Viele leiden noch heute an den schweren Folgen der Traumatisierungen. Aber sie haben gemäß Ermann ein merkwürdig gespaltenes Bewusstsein für ihre Biographie. Sie wussten immer um ihr Schicksal, aber es ist ihnen lange fremd geblieben – es fehlte ein Bewusstsein für die erlittenen Verletzungen. Die Kriegskindheit führte in die Entfremdung, »die Betroffenen wurden zu einer Generation, die ihr eigenes Leid nicht wahrnahm« (Ermann, 2010, S.327f.).
In seiner Mannheimer Kohortenstudie hat Schepank bereits 1987 festgestellt, dass ein länger abwesender Vater, wie das bei den Kriegskindern häufig festzustellen ist, zu psychogenen Auffälligkeiten in ihrem späteren Leben geführt hat. Eine Untersuchung von Franz et al. (2007) ging dieser Frage nochmals nach. 883 aufgewachsene Kriegskinder im Alter von durchschnittlich 68 Jahren wurden dieses Mal befragt. Vaterlos aufgewachsene Kriegskinder berichteten auch in dieser Untersuchung von signifikant stärkeren psychischen Problemen, wie depressive Beschwerden, soziale Ängste und chronisches Misstrauen (S.16). Die Seele wurde ununterbrochen mit nicht aushaltbaren Reizen überflutet: Das Leben eines Kriegskindes mit Vaterlosigkeit, ständiger Angst, Luftangriffen, Vertreibung und Heimatlosigkeit glich einem emotionalen Karussell, das sich immer schneller zu drehen schien und aus dem man auch jederzeit herausgeschleudert werden konnte; wie die Untersuchungen gezeigt haben, immer wieder, bis ins hohe Alter. Während ihrer darauf folgenden psychosexuellen und psychosozialen Entwicklung standen Kriegskinder vor der Aufgabe, »ihre beschädigenden oder sogar traumatisierenden Erfahrungen seelisch zu bearbeiten«. Dies geschah in der Regel mit den Abwehrmechanismen Verleugnung, Bagatellisierung, Generalisierung, Verkehrung ins Gegenteil sowie Aufspaltung von Inhalt und Affekt. Erlebnisse und Erfahrungen blieben jedoch unter einer psychischen Betondecke erhalten (Radebold, 2010, S.38).
Hinzu kam noch etwas anderes. Die Generation der Kriegskinder wurde später von vielen traumatisierten Kriegsteilnehmern unterrichtet. Ich begegnete unter anderem einem malariakranken Volksschullehrer, einem traumatisierten Russlandheimkehrer, der seine Traumata mit Alkohol betäubte, und vielen schwadronierenden Altnazis. Gemeinsam war ihnen allen, vom Pfarrer bis zum Oberstudienrat, dass sie auch nicht kleine Spannungen aushalten konnten und uns schon bei geringsten Störungen mit grausamen Schlägen bestraften. Meine Klassenkameraden und ich wurden gnadenlos von ihnen geprügelt und niedergeschlagen, mit Stöcken und anderen Utensilien, mit der flachen Hand, mit Fäusten, mit Schlägen auf den Kopf – noch bis kurz vor dem Abitur. Niemand traute sich, sich zu wehren, weil alle ansonsten den Rauswurf befürchteten. Irgendwann habe ich festgestellt, dass nicht nur aus dem Affekt heraus gedemütigt und geschlagen wurde, sondern ganz gezielt eine bestimmte Gruppe ins Visier genommen wurde, von der keine Gegenwehr zu erwarten war: Die brutalste Gewalt erfuhren jene Kinder, deren Eltern arm waren und die sich darum nicht trauten, gegen die geballte gymnasiale Autorität anzutreten. Die Straf- und Prügelpädagogik der 50er Jahre hatte grausames System!
In einer »Kalten Heimat«
Kriegskinder hatten oft noch mit einem anderen Problem zu kämpfen, das bislang nur marginal diskutiert wurde. Ausgebombte, Flüchtlinge, Heimatvertriebene hatten keine Heimat mehr und blieben in den neuen Welten fremd und ungeliebt. Für die Einheimischen waren sie Feinde, »Reingeschmeckte«, die ihnen unheimlich waren. Sie sahen sich von ihnen bedroht, denn die unerwünschten Eindringlinge wollten von ihnen Lebensmittel und Lebensraum, was sie als Übergriffe verstanden. Mit Kriegsende waren Fremdenhass, Antisemitismus und Vernichtungswünsche gegenüber vermeintlich Schwachen keineswegs verschwunden. Nachdem eine Verfolgung von Juden nicht mehr möglich war, füllten die neuen Fremden das entstandene Vakuum für Hass und Ablehnung rasch auf. Da die meisten von ihnen aus dem Osten kamen, konnten sie problemlos zu den neuen Untermenschen werden – sie wurden zum »Flüchtlingspack«. Im Flüchtlingslager wurden wir von den Einheimischen als »Lagerstinker« bezeichnet. Auch hatten die meisten Vertriebenen keinerlei Wertsachen, ja, überhaupt keine Gegenstände, keine Bücher, Bilder, Möbel mehr aus der verschwundenen Heimat, die sie erinnern und wie ein Übergangsobjekt ein wenig trösten konnten. Als ich die fünfte Klasse des Gymnasiums besuchte, war ein Thema im Kunstunterricht, das Haus zu malen, in dem wir wohnten. Ich malte, detailgerecht, die Baracke des Flüchtlingslagers, in der ich lebte. Daraufhin zeigte der Kunst»erzieher« mein Bild der Klasse mit der Bemerkung, dass man doch mal hersehen solle, wo ich denn wohnte. Noch während der Vorbereitung zur Hochzeit wurde meine künftige Frau 1968 – 23 Jahre nach Kriegsende – in meinem Beisein vom katholischen Pfarrer gefragt, ob sie denn nichts Besseres bekommen habe als einen »Flüchtling«. Zu den Traumatisierungen und Schmerzen des Krieges und der Vertreibung kamen die Verletzungen durch einen gnadenlosen Rassismus gegen die Vertriebenen und deren Kinder. Kossert weist darauf hin, dass die heute noch lebenden deutschen Vertriebenen die Jugendlichen, Kinder und Kleinkinder von damals sind. »Seit einiger Zeit wird deutlich, dass diese Kinder und ihre Nachkommen unter ähnlichen psychischen Langzeitbelastungen leiden, wie sie bei überlebenden Holo- caust-Opfern und deren Kindern diagnostiziert wurden« (2008, S.349). Es ist hier nicht der Ort, diesen Bereich weiter zu vertiefen, ich verweise auf das aufschlussreiche Buch von Andreas Kossert. Ich bin davon überzeugt, dass es darum wichtig ist, in allen Analysen an eine transgenerationale Weitergabe der Traumata der Kriegs- und Nachkriegszeit zu denken, denn Kriegskinder sind die Mütter und Väter der heutigen Elterngeneration. Existieren womöglich Zusammenhänge zwischen der Bewegungsunruhe und den anderen Störungen der Kriegskinder, so wie sie in der »Langeoog-Untersuchung« erfasst wurden, und den externalisierenden Störungen, der Bewegungsunruhe, den Aufmerksamkeitsdefiziten und der defizitären Affektbeherrschung der heutigen Generation? Die erstaunlichen Parallelen sollten zumindest zur Kenntnis genommen werden.
Männlich werden …
Wie findet ein Junge – im günstigen Fall bei Anwesenheit eines sich verstehenden und liebenden elterlichen Paars – zu einer Identität, die als männlich bezeichnet wird? Theoretisch hört sich das recht einfach an: Am besten gelingt dies durch eine gute Bindungs- und Beziehungserfahrung mit der Mutter, der Großmutter oder anderen weiblichen Bezugspersonen sowie durch eine geglückte Identifikation mit einem affektiv aufmerksamen Vater (gegebenenfalls eines Vertreters) durch alle Reifestadien hindurch (vgl. Blaß, 2010, S.695). Das galt damals, und das gilt auch heute. Doch nicht nur die damaligen Kriegskinder hatten kaum eine Chance für einen solch idealen Entwicklungsverlauf. Dieser wird auch heutzutage bei vielen Kindern von den gegenwärtigen gesellschaftlichen Problemen – von denen noch berichtet wird – massiv gestört. Dammasch (2008) geht davon aus, dass Jungen und Männer heutzutage weitaus mehr als Mädchen und Frauen von den Anforderungen des sozialen und pädagogischen Wandels tendenziell überfordert zu sein scheinen. Allen Jungen auf ihrer schwierigen Suche nach ihrer Identität möchte ich dieses Buch widmen.
Im Folgenden betrachte ich einige Feststellungen aus Nachbardisziplinen der Psychoanalyse, was natürlich nur in knapper Zusammenschau geschehen kann. Diese Erkenntnisse sollen in die Fragestellungen der folgenden Kapitel übergeleitet werden.
Existieren Geschlechtsunterschiede? Wie viel »Junge« darf sein?
Die in dieser Überschrift gestellte Frage erscheint grotesk; denn wäre es nicht so, hätten wir es nicht mit zwei verschiedenen Geschlechtern zu tun. Natürlich sind die biologischen Unterschiede eindeutig und gut zu beschreiben. Anders ist es mit den sogenannten geschlechtsspezifischen Persönlichkeitsmerkmalen. Sie können objektiv beschreibbar sein, sich jedoch auch mit vorgefassten Meinungen und Zuschreibungen, sogenannten Stereotypen mischen. Kinder werden vom ersten Lebenstag an, letztendlich beginnend mit der Schwangerschaft der Frau, mit entsprechenden Erwartungshaltungen betrachtet und behandelt (Rendtorff, 2003, S.58).
Eine andersartige Fragestellung ist, ob die Persönlichkeitsmerkmale rein biologischer Herkunft sind, durch Einflüsse der Umwelt geformt oder sogar ausschließlich durch soziokulturelle Faktoren entstanden sind. Alle drei wissenschaftlichen Standpunkte existieren.
Die siebziger Jahre waren im Anschluss an die 68er-Revolte durch eine höchst kreative Frauenbewegung gekennzeichnet, die für die Emanzipation und Gleichberechtigung der Frau eintrat. An der Spitze war die streitbare Alice Schwarzer, der die Frauen nicht genug dafür danken können, was sie mit anderen Feministinnen erreicht hat. Parallel hierzu veröffentlichten Psychoanalytikerinnen wichtige Gedanken zur Frau, aufbauend auf die Arbeiten u.a. von Helene Deutsch und Karen Horney. Ich nenne hier stellvertretend einige von ihnen – die mich in meinem Denken sehr beeinflusst haben –, wie Jessica Benjamin, Janine Chasseguet-Smirgel, Nancy Chodorow, Margarete Mitscherlich-Nielsen, Christiane Olivier, Christa Rohde-Dachser sowie Evelyn Heinemann, deren ethnoanalytische Studien im Buch zitiert werden. Die siebziger Jahre waren aber auch durch einen – gelegentlich – dogmatisch und selbstgerecht1 geführten Geschlechterkampf gekennzeichnet. Männliche Dominanz und Vorherrschaft wurden in Frage gestellt und geschlechtsneutrale Erziehung wurde eingefordert. Margarete Mitscherlich, nicht gerade eine Widersacherin des Feminismus, hat in einem ihrer letzten Interviews mit Alice Schwarzer rückschauend gemeint: »Was mich an der deutschen Frauenbewegung vor allem störte, war das Ideologische. Genau wie bei den 68ern. Da gab es ganz fanatische Frauen, für die alle Männer böse waren. Diese Art von Schwarzweißdenken und die Unfähigkeit, Ambivalenzen zu ertragen, fand ich unerträglich« (2010, S.255).
Die damalige Haltung in der Frauenbewegung wurde teilweise von der Vorstellung geleitet, dass geschlechtsspezifische Persönlichkeitsmerkmale ausschließlich auf Umweltfaktoren zurückzuführen seien und dass es sich bei allen geschlechtstypischen Persönlichkeitsmerkmalen lediglich um Stereotypien handele – alle seien auf unbewusste Manipulationen von Erwachsenen zurückzuführen. Diese sogenannte Gender-Forschung hatte sich bereits in den 50er Jahren entwickelt. Geschlechtlichkeit in ihren somatischen Aspekten wird gemäß Bischof-Köhler (2011) als »sex« von »gender« unterschieden, um schon durch diese Wortwahl klarzumachen, dass die Biologie nichts mit dem Verhalten zu tun hat. Die Verfasserin zitiert in diesem Zusammenhang eine Verlautbarung des Bundesfamilienministeriums (2003): »Gender bezeichnet die gesellschaftlich sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen von Männern und Frauen. Diese sind – anders als das biologische Geschlecht (sex) – erlernt und damit veränderbar.« Bischof-Köhler meint hierzu, ein wenig ironisch, dass nur »gender« als erlernte und von der Kultur übernommene Geschlechtsrolle von Interesse sei. »Sex« könne zwar kulturell kommentiert werden, zwingend sei dies aber nicht (S.32). Die somatischen Unterschiede dürfen also ausgeblendet und ignoriert werden. Dies mag aus didaktischen Gründen gelegentlich hilfreich sein, als grundlegende Theorie entsprechen solche Überlegungen nicht der Wirklichkeit.
Aber es existiert auch anderes Denken. Eine bedeutende Vertreterin der Frauenbewegung, Barbara Sichtermann, hat schon 1989 auf das Problem hingewiesen, dass Verweise auf die Biologie des Geschlechtsunterschiedes in der Frauenbewegung unbeliebt seien und von vornherein als kontraemanzipatorisch gälten. Es sei jedoch wichtig, nicht auf Biologie zu verzichten, die Frauenbewegung brauche einen Begriff vom Geschlechtsunterschied, der die Legierung von Natur und Geschichte zu verstehen lehrt; »sie muss aufhören zu unterstellen, die Geschichte habe als Prägerin von Wünschen und Realitäten innerhalb einer Biographie die Natur ohne Rest verdrängt« (Sichtermann, 1989, S.153). Zu Recht bemerkt auch Aigner, dass die Bemühungen der Frauenbewegung um Geschlechteregalität die Differenz der Geschlechter zugunsten einer radikal sozialkonstruktivistischen Positionierung aus den Denkzusammenhängen ausgeblendet haben. »Alles, was sich um geschlechtsspezifische Zuschreibungen bemüht, war und ist heute teilweise noch bzw. wieder verpönt und steht im Verdacht, alte hegemoniale Verhältnisse zugunsten des Mannes zu legitimieren oder wieder aufzurichten« (Aigner, 2011, S.16). Wir können feststellen, dass Pädagogik, Psychologie und Psychotherapie heutzutage »verweiblicht sind« und dass Männer in Pädagogik, Psychologie und Psychotherapie kaum mehr vorhanden sind. Sie haben sich aus vielerlei Ursachen zurückgezogen, über die u.a. bei Aigner (2011) nachzulesen ist, obwohl beispielsweise in der Erzieherbranche ein Y-Chromosom einer Karrieregarantie gleichkommt. Die heutigen unruhigen Jungen bilden in der von Frauen dominierten Bildungsinstitution eine Art Gegenbesetzung zu »weiblich-ruhigem« Verhalten, und sie werden von Erzieherinnen und Lehrerinnen oft nicht mehr ausreichend erreicht (Leuzinger-Bohleber et al., 2008); hierauf werde ich an anderer Stelle noch zu sprechen kommen.
2011 wird zu diesem Thema in einer höchst fragwürdigen Studie festgestellt, dass mit der Kritik an einer – vermeintlichen – Feminisierung der Pädagogik ein Verständnis von jungentypischem Verhalten verknüpft sei, welches angeblich von Frauen unterdrückt werde. Diese Darstellung von Jungen bilde jedoch die Vielfalt von Jungen nicht ab und lege eine »Reproduktion von traditionellen Geschlechterverständnissen und Zweigeschlechtlichkeit nahe, anstatt diese zu überwinden« (Rieske, 2011). Wer nicht Softie sein will, dem stehen lediglich die Schubladen Chauvi und Macho offen! Die beängstigende Frage stellt sich, wer hier denn feststellt, was »jungenhaft« ist. Ähnliche Aussagen zur Jungenpädagogik lauten wie folgt: »Jungen sollen in profeministischer, antisexistischer und patriarchatskritischer Jungenarbeit lernen, dass sie so wie sie sind, nicht sein sollten und einem fatalen Männlichkeitsbild hinterherjagen.« »Nicht die stabile (männliche) Identität (kann) das Ziel von Jungen- und Männerarbeit sein. Das Ziel (ist) nicht der ›andere Junge‹, sondern gar kein Junge« (zit.n. Bischof-Köhler, 2011, S.33). Mit seinen fraglos auch problematischen und schwierigen Seiten soll der gesamte Junge mit dem Bade ausgeleert – sprich entsorgt – werden!
Diamond hat geschrieben, dass man Männlichkeit entweder als biologisch determiniert, evolutionär vermittelt und deshalb unwandelbar betrachten kann oder als ein soziales Konstrukt, als Produkt von Umwelt und Kultur, das infolgedessen unendlich wandelbar sei (2010, S.19). Ich möchte – wie Diamond – eine solche Polarisierung meiden und als Psychoanalytiker einem integrativen Verstehen folgen.
Wer hat Angst vorm »Schwarzen Mann«?
Robert Bly (2010) hat in seinem Buch vom »Eisenhans« versucht, die Identität des Mannes vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen neu zu begreifen. Er meint, dass die dunkle Seite der Männer Realität sei: »Ihre irrwitzige Ausbeutung der Bodenschätze unseres Planeten, ihre Geringschätzung und Erniedrigung der Frauen und ihre zwanghafte Leidenschaft für atavistische Kriegsspiele sind nicht zu leugnen. Ihr genetisches Erbe ist diesen Obsessionen ebenso förderlich wie das kulturelle und gesellschaftliche Umfeld« (S.8). Mit dieser Seite des Mannes werde ich mich noch im Abschnitt über die Geschlechtsunterschiede bei den Aggressionen (Kapitel 9, S.299) auseinander setzen.
Diese Problematik einiger Männer wurde in den vergangenen Jahrzehnten allerdings generalisiert und auf alle Männer übertragen. Gewalt ist mittlerweile durchweg negativ-männlich konnotiert, obwohl gemäß Aigner nach den empirischen Ergebnissen über Gewalt in der Familie hier Frauen und Mütter – allein schon wegen der Haupterziehungslast, die sie tragen – ebenso häufig vertreten sind:
»Betrachtet man den öffentlichen oder auch fachlichen Diskurs darüber, so scheint auch dies ein Feld zu sein, in dem nur Männer die Täter sind. Nur Männer schlagen, prügeln und demütigen angeblich; und die Jungen treten schon früh mit Schulhofschlägereien in ihre Täter-Fußstapfen. Dieses generalisierte Männerbild und sein Abfärben auf die Jungen muss kritisch hinterfragt werden« (Aigner, 2011, S.17).
In einem Zeit-Dossier schrieb Christoph Kucklick über das »verteufelte Geschlecht«. Er stellte in seinem Essay überzeugend dar, wie mittlerweile alles Männliche dämonisiert und verachtet wird und warum das letztendlich auch den Frauen schade. Männlichkeit ist seiner Meinung nach zur Kurzformel für Missstände aller Art geworden (Kucklick, 2012, S.17). Ich schließe mich auch Kimmel an, der meint, dass die »chronische, anachronistische und potentiell tödliche Assoziation von Gewalt mit Männlichkeit die wahre Jungenkrise« ist (2011, S.40). Man kann mittlerweile feststellen, dass Männlichkeit nicht selten mit destruktiver Gewalt symbolisch gleichgesetzt wird. In einem Essay in der Süddeutschen Zeitung hat Serrao das plumpe Lagerdenken mancher Feministinnen wie folgt auf den Punkt gebracht: »Das Problem vieler, vor allem älterer Feministinnen ist, dass sie sich weigern, ihr in jüngeren Jahren geformtes Bild von Männern in Frage zu stellen: Das des dauergeilen Patriarchen, der männerbündelnd seine Privilegien verteidigt« (SZ, 2013, S.9). Eine sorgfältige Diskussion über den »entwerteten Mann« findet sich bei Hollstein (2011).
Eine 2010 neu eröffnete Vorschule in Stockholm – mit Namen »Egalia« – verfolgt beispielsweise einen komplett geschlechtsneutralen Ansatz und erzieht die Kinder auf radikale Weise zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das Personal vermeidet Wörter wie »er« und »sie« und spricht die 33 Kinder nicht als Jungen und Mädchen, sondern als »Freunde« an. Von der Farbe und Anordnung der Spielsachen bis zur Auswahl der Bücher ist alles bis ins Detail darauf ausgerichtet, dass die Kleinen nicht in Rollenklischees verfallen. »Die Gesellschaft erwartet, dass Mädchen mädchenhaft, nett und hübsch sind und Jungen männlich, robust und offen«, erklärt eine Lehrerin. »›Egalia‹ bietet ihnen eine fantastische Möglichkeit zu sein, wer sie sein wollen.« Die Geschlechterrollen »aufzubrechen«, ist ein wichtiges Ziel im Lehrplan dieser Vorschule (focus.de, 2011). Natürlich sind Unterfangen, Stereotype nicht aufkommen zu lassen, primär gut gemeint, was ja bekanntlich noch lange nicht gut ist. Geschlechtsunterschiede sollen in der Tat nicht aus vorgefassten Stereotypien bestehen und sie sollen nicht zur jeweiligen Diskriminierung des anderen eingesetzt werden. Aber Geschlechtsunterschiede bestehen eben nicht nur aus vorgefassten Meinungen, sondern sind auch biologische, soziale und psychologische Realitäten.
Ist das Ziel, den »Jungen« eliminieren zu wollen, etwa keine Ausübung von Gewalt? Rollenzuweisungen im Namen des biologischen Geschlechts sind zweifellos schädlich und engen ein. Festzustellen ist, dass keines der Geschlechter »besser« ist als das andere. Tatsache ist jedoch auch, dass Jungen und Mädchen, Männer und Frauen verschiedene Wesen sind. Deshalb existieren Geschlechtsunterschiede, und sie sind auch notwendig. Dann nützen auch keine verkrampften oder dogmatischen Versuche, sie zu leugnen oder gar zu »beseitigen«. Vielmehr sollten gemäß Hüther (2009) Bedingungen geschaffen werden, »die es den Jungen und den Mädchen gestatten, entsprechend ihrer wesensgemäßen Unterschiede aufzuwachsen und später als Männer und Frauen, sich in ihrer Verschiedenheit ergänzend, miteinander zu leben« (S.54). Vor diesem Hintergrund soll in den folgenden Kapiteln versucht werden, sich einer »männlichen Identität« beschreibend anzunähern, wie sie für Kinder und Jugendliche im Rahmen unserer Kultur zutrifft (vgl. Aigner, 2011, S.16).
Geschlechtsunterschiede – erste Überlegungen und Fragen
Es existieren viele Fragestellungen, gelegentlich auch größere Probleme, die regelmäßig zu pädagogischen Diskursen führen. Ist Koedukation immer hilfreich? Offensichtlich nicht immer. Dürfen Jungen am Schulhof raufen? Sie brauchen ein lustvolles, rivalisierendes Kräftemessen, also gerade am Schulhof! Ist zu langes Computerspielen schädlich? Alles kann zur Abwehr benutzt werden, zu Fluchten und Süchten. Im Folgenden will ich einige Geschlechtsunterschiede beschreibend aufzählen, ohne schon jetzt auf mögliche Ursachen einzugehen. Jungen haben einen starken Drang nach Bewegung und dieses Bedürfnis wirkt bereits im Mutterleib. Der männliche Fötus bewegt sich bereits mehr und ungestümer als der weibliche. Neugeborene Jungen sind impulsiver, geraten rascher in emotionale Erregung und lassen sich nur schwer beruhigen. Einfache Wiederholungsbewegungen können Jungen besser, aber die Bewegungen der Mädchen sehen später wesentlich harmonischer und geschickter aus. Hüther hat die Geschlechtsunterschiede sehr treffend mit einem Orchester verglichen (S.66). Bei den Mädchen sitzen in den ersten Reihen harmoniesichere, melodietragende Instrumente, wie Streichinstrumente, Holzbläser, bei den Jungen jedoch Pauken und Trompeten, die krawallig alle feinen Melodien und Zwischentöne übertönen.
Gemäß Bischof-Köhler (2008, S.18) sind Jungen vom ersten Lebenstag an impulsiver, störbarer, schlechter zu beruhigen, emotional rascher aufgedreht. Sie sind aber auch explorativer als Mädchen, erforschen die Umwelt und zeigen früh Vorlieben für alles Technische. Schon bald neigen Jungen auch zu riskantem Verhalten, zur Angstlust und damit zu einer größeren Risikobereitschaft, was in der Adoleszenz zu gefährlichen Mutproben verführen kann. Bischof-Köhler stellt auch fest, dass Jungen bereits im ersten Lebensjahr Verhaltensbesonderheiten aufweisen, die auf Geschlechtsstereotypen hinweisen, wie sie später für Erwachsene empirisch belegt sind: »Männer sind eher durchsetzungsorientiert, explorativ und risikobereit, Frauen stärker personorientiert, fürsorglicher und einfühlsamer« (ebd., S.19).
Auch die psychischen Störungen sind deutlich geschlechtsspezifisch. Jungen neigen zur Bewegungsunruhe, externalisieren ihre Konflikte und tragen Sand ins soziale Getriebe (vgl. auch Ihle und Esser, 2002). Sie zeigen häufiger eine narzisstische Persönlichkeit (Mädchen eher eine depressive) mit entsprechenden Verhaltensweisen. Gemäß Dammasch (2008) neigen Jungen dazu, frühe Mangelerfahrungen durch den Aufbau einer Illusion narzisstischer Unabhängigkeit und phallischer Größe abzuwehren: Im Gefolge von narzisstischen Störungen treten nicht selten Aufmerksamkeitsdefizite auf. Es wird deutlich, dass das Lustprinzip gewahrt werden soll und grandiose Phantasien das Handeln bestimmen, bei gleichzeitigen Ängsten, zu versagen: Kränkungen werden gerne mit Wutdurchbrüchen beantwortet.
Das führt in eine schwierige gesellschaftliche Situation. Weil sie mit ihrer Bewegungsunruhe in sozialen Bezügen stören und um sie an die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen, wird den Jungen mittlerweile fast das gesamte verordnete Methylphenidat verabreicht. Das waren in Deutschland im Jahr 2010 bereits 1,3 Millionen Tabletten und bedeutet innerhalb von 17 Jahren einen Anstieg von 5200%. Dass Jungen häufiger als Mädchen schwere Störungen durch Substanzgebrauch haben, scheint in diesem Zusammenhang keiner Überlegung wert.
Motorik, Aggression und Sexualität sowie eine archaische Lust an der Bewegung sind gemäß Dammasch bei Jungen eng miteinander verknüpft (2002). Weil ihnen in vielen Fällen keine ausreichenden anderen Möglichkeiten zur Regulation und symbolvermittelten Abfuhr ihrer Affekte zur Verfügung stehen, machen sie aus dieser Not offensichtlich eine Tugend – die kinetische Funktion wird überbesetzt. Mädchen ist es anscheinend leichter möglich, Bewegung zu symbolisieren und zu sublimieren.
Ein großes Problem sind die Lernstörungen der Jungen, die sich mittlerweile sogar als Intelligenzprobleme bemerkbar machen: Im Rahmen der bundesweiten Normierung des Intelligenztests CF T 1-R hat Weiß (2013 a, S.13) festgestellt, dass gegenüber den Untersuchungen vor Jahrzehnten in allen drei Klassenstufen ein Vorsprung von durchschnittlich 0,8 Rohwerten bei den Mädchen (von 5;9 bis 9;5 Jahren) vorhanden ist, in der ersten Klasse sogar 1,4 RW. Diese Differenzen sind zwar statistisch – noch – nicht signifikant, aber sie stellen einen deutlichen Trend dar. 18% der Jungen haben sonderpädagogischen Förderbedarf, dagegen nur 13% der Mädchen. In den Förder- und Sonderschulen erzielen Mädchen zudem 1,7 Rohwerte mehr im Intelligenztest als die Jungen. Da die meisten Förderbedarfe (Lernen, Sprache, Verhalten) Jungen wesentlich häufiger als Mädchen betreffen, verwundert dieses Ergebnis nicht. Auch auf den Zusammenhang, ob diese Ergebnisse auch darauf beruhen, dass in Grundschulen kaum mehr Männer unterrichten, will ich später eingehen, denn »die öffentliche Erziehung ist komplett in weiblicher Hand« (vgl. Dammasch, 2010, S.82).
In der Regel sind auch ihre kommunikativen Fähigkeiten weniger gut, die Sprache ist störanfälliger und Jungen erscheinen oft ungenügend mentalisiert und symbolisierungsfähig. Jungen zeigen häufiger Lese- und Rechtschreibschwächen sowie Störungen beim Sprechen, wie etwa Lispeln oder Stottern (Heinemann und Hopf, 2004, S.326f.; Hirschmüller et al., 1997). Wenn sich also ein Mädchen anders verhält, wenn es im Spiel anderes darstellt als ein Junge, so ist das gemäß der Psychoanalyse immer Ausdruck sowohl von Biologie, von Gehirn und Hormonen sowie der Seele. Darum muss zunächst der jeweilige Einfluss dieser Bereiche beschrieben werden.
Beängstigende Entwicklungen oder alles nicht so schlimm?
Kinderanalytikern wird gelegentlich vorgeworfen, sie entwürfen Katastrophenszenarien, wenn sie von Veränderungen der Störungsbilder sprechen, wie Zunahme der externalisierenden Störungen, Verlust an Spiel- und Symbolisierungsfähigkeit oder von Problemen der abwesenden Väter und Risiken des Alleinerziehens. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass Kinderanalytiker, die regelmäßig Therapien durchführen, zu anderen Ergebnissen kommen als universitäre Theoretiker. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Kinderanalytikern lediglich eine Minderheit von Probanden, allerdings mit schweren Störungen, vorgestellt wird. Ob die Analytiker auch zu sehr mit dem Kind identifiziert sind oder ob manche Theoretiker die Situation nicht ausreichend einschätzen können (weil sie vielleicht das unbekannte Wesen »Kind« überhaupt nicht direkt zu Gesicht bekommen), kann zunächst nicht ausreichend sicher beurteilt werden.
Dornes (2012) hat in seinem Buch den Realitätsgehalt vieler jener kritischen Aspekte, die bei Kindern heutzutage beschrieben werden, untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Kinder und Eltern besser seien als ihr Ruf. Er hat über statistische Vergleiche nachgewiesen, dass die psychischen Störungen nicht zugenommen haben. Ich gehe davon aus, dass er Recht hat. Verändert hat sich allerdings die Qualität der Störungsbilder mit Externalisierungen, Mentalisierungs- und Symbolisierungsstörungen, da haben sicherlich wiederum die Kinderanalytiker recht, die weniger Statistiken als psychodynamische Zusammenhänge beobachten. Ich halte an dieser Stelle fest, was Göppel in einem Aufsatz überzeugend herausgearbeitet hat: »Die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen mag durchaus von den beschriebenen Wandlungen in den Erziehungshaltungen der Eltern profitieren. Bei einer kleineren Gruppe mit überforderten, desorientierten, desolaten Elternhäusern verdichten sich jedoch die Risikofaktoren in besonderer Weise« (2013, S.69).
»Das Gehirn macht die Seele« und die Seele formt das Gehirn!
Alles ist jedoch noch etwas komplizierter. Die funktionellen bildgebenden Verfahren haben vielerlei Unterschiede in der Arbeitsweise von männlichen und weiblichen Gehirnen deutlich gemacht und man könnte somit feststellen, dass viele Geschlechtsunterschiede primär biologisch verursacht werden. Die gegenwärtige neurologische Forschung hat aber auch festgestellt, dass das Gehirn plastisch und formbar ist, vor allem zu Beginn der Hirnentwicklung. Gemäß Hüther (2009, S.59) reagiert das Gehirn bereits im Mutterleib auf Hormonsignale und passt seine Entwicklung entsprechend an. »Es wird zeitlebens auf Signale von innen und auf Reize von außen reagieren. Das Gehirn lernt täglich dazu – bis ins hohe Alter« (ebd.). Dies bedeutet, ebenfalls nach Hüther, dass es sich bei den im männlichen Gehirn feststellbaren strukturellen und funktionellen Besonderheiten nicht einfach um biologische Ursachen für bestimmte typisch männliche Verhaltensweisen handelt. Sie können genauso erst als Folge der unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen und der unterschiedlichen Nutzung bestimmter Feinstrukturen entstanden sein (ebd.). Das heißt vereinfacht, Umwelt, Affekte und Beziehungen verändern auch die Struktur und Funktion des Gehirns. Gehirnstrukturen passen sich den sozialen Bedingungen an – Ursachen und Wirkungen bedingen einander. Hüther formuliert lapidar: »Männer haben ein anderes Gehirn als Frauen, aber männerspezifische Gene, die ihr Gehirn so anders konstruieren, gibt es nicht« (ebd., S.60).
Dieses Buch befasst sich vor allem mit psychoanalytischen Erkenntnissen über Jungen. Es beschäftigt sich mit Beziehungen, mit Wahrnehmung, mit Gefühlen sowie unbewussten Prozessen und vielem mehr. Dennoch muss auch seitens der Psychoanalyse akzeptiert werden, dass »das Gehirn die Seele macht« (Roth, 2001). Geist ist bekanntlich immer Biologie, Hirnfunktionen basieren auf der Übertragung von elektrischen und chemischen Signalen.
Ich will an dieser Stelle einen weiteren – kleinen – Abstecher zur Hirnforschung machen. Was wir als unseren Geist verstehen, ist also immer ein Ausdruck der Funktionsweise unseres Gehirns. Alle geistigen Prozesse, selbst die komplexesten psychologischen Prozesse, leiten sich von Operationen des Gehirns ab. Als Folge davon sind Verhaltensstörungen, die psychische Krankheiten charakterisieren, Störungen der Gehirnfunktion, und zwar auch in jenen Fällen, in denen die Ursachen der Störungen ihren Ursprung eindeutig in der Umwelt haben (Kandel, 2008, S.81f.). Roth definiert es so, dass psychische Erkrankungen auf dysfunktionalen Veränderungen – insbesondere im limbischen System – von Neuronen-Netzwerken beruhen. Dies sagt allerdings gemäß Roth noch nichts über deren Ursachen aus, »denn Veränderungen in den Verarbeitungseigenschaften von Neuronen-Netzwerken bedeuten erst einmal nichts anderes«. Die Plastizität des Gehirns ermöglicht immer Veränderungen. Durch Lernen, also über Pädagogik und Psychotherapie, wird die Wirksamkeit schon vorhandener Pfade im Gehirn verändert, was neue Verhaltensmuster ermöglicht. Dies gilt für alle psychischen Störungen von ADHS bis Zwangsstörungen. Es besteht somit ein ständiges Wechselspiel zwischen Leib und Seele sowie einer störenden und fördernden Umwelt. Gemäß Kandel vereinigt sich so der biologische mit dem psychologischen Ansatz (ebd., S.65). Eine explizite Trennung von Biologie, hormonellen Wirkungen, den Chromosomen sowie der Evolution ist nicht möglich. Dennoch ist es wichtig diese Bereiche wenigstens kurz gesondert zu betrachten.
Kleine Biologie des Jungen
X- und Y-Chromosom
Das chromosomale Geschlecht beim Menschen (XY oder XX) wird bei der Befruchtung einer Eizelle durch ein Y- oder X-tragendes Spermatozoon determiniert: Von der Mutter wird stets ein X-Chromosom weitergegeben, vom Vater kann es ein X- oder ein Y-Chromosom sein. Kommt also die Geninformation aus dem Y-Chromosom hinzu, so entsteht ein Junge. Sind ein X- und ein Y-Chromosom vorhanden, aber erweist sich das Y-Chromosom als defekt, entwickelt sich ein Mädchen (Kaiser & Pfleiderer, 1989, S.6). Hüther (2009) meint recht pessimistisch, dass Männer von Anfang an mit einem Defizit ins Leben starten. Ihnen fehlt ein zweites X-Chromosom, dafür haben sie lediglich ein Y-Chromosom, in dem keine »Ersatzteile« enthalten sind – es fehlt quasi das »Ersatzrad«. Ist das X-Chromosom beschädigt, haben Jungen und Männer keinen Behelf und können Mängel nicht kompensieren. Etwa 30000 Gene sind bei Frauen und Männern übrigens identisch, lediglich zwanzig auf dem Y-Chromosom sind anders. Hüther fasst das Ganze wie folgt zusammen: »Der einzige genetische Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht darin, dass sich die Männer mit einem Y-Chromosom und einem fehlenden X-Chromosom auf den Weg machen.« Denn für die Entwicklung von Männlichkeit ist etwas anderes viel bedeutsamer.
Hormone und Gehirnentwicklung
Gemäß Hüther bekommen Männer nicht deshalb einen anderen Körper als Frauen, weil sie andere Gene oder ein anderes Gehirn haben, sondern weil ihre Keimdrüsen andere Hormone produzieren und in den Blutkreislauf ausschütten (2009, S.68). Hormone sind Signalstoffe, die ihre Zielzellen über die Blutbahn erreichen. In den ersten Schwangerschaftswochen entwickelt sich der Fötus bisexuell, also geschlechtsindifferent. Bei Vorhandensein eines X- und eines Y-Chromosoms werden ab der 6. – 7. Woche Hodenwachstum, Androgenproduktion und somit Maskulinisierung von Körper und Gehirn eingeleitet. Androgene, vor allem das Testosteron, haben in der Zeit vor und kurz nach der Geburt den entscheidenden organisierenden Effekt für die Hirnentwicklung sowie in der Pubertät und danach einen primär aktivierenden Effekt auf das Sexualverhalten. Bei Männern ist der Testosteronspiegel übrigens etwa fünfzehnmal höher als bei Frauen.
Das Y-Chromosom ist demnach für die Umwandlung undifferenzierter Gonaden in männliche Testikel verantwortlich. Die Entwicklung der Hoden löst eine Kaskade von Veränderungen aus, von denen die sexuelle Veränderung des Gehirns die wichtigste ist (vgl. Jänig und Birbaumer, 2010, S.230). Green weist darauf hin, dass der Begriff »Sex«, »Geschlecht«, von secare, von sexion herrührt. Somit trage der Name die Spur eines Schnittes, der die beiden Geschlechter trennt und damit auf eine ursprüngliche mythische Androgynie verweist. Wird der Fötus während seines intrauterinen Lebens kastriert, zeigt er bei der Geburt ein weibliches Geschlecht. Ohne Androgene bleibt der sich entwickelnde Organismus weiblich (1996, S.15): Insofern ist der biblische Mythos nicht richtig, dass Eva aus einer Rippe Adams gebildet wurde, sondern nach neueren physiologischen Erkenntnissen ist es eher umgekehrt. Laut Green ist das erste Geschlecht ein weibliches, die Männlichkeit ist lediglich eine sekundäre Bildung. Ein Macho könnte gemäß Green allerdings auch zur Feststellung kommen, die Frau sei lediglich ein unvollständiges Wesen. Der Mann dagegen sei eines, dessen Entwicklung abgeschlossen wird, weil seine Weiblichkeit zurückgedrängt und sein Entwicklungsplan bis zur männlichen Vollendung durchlaufen wird.
Daneben wirken die Androgene auf die männliche Geschlechtsdifferenzierung, auf die Spermienbildung sowie auf Wachstum und Funktion der Genitalien, Prostata und Samenbläschen. Zudem steuert Testosteron auch die Ausbildung der sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale sowie die Stärke der Libido. Testosteron wirkt auch Gewebe aufbauend, was zu der stärker entwickelten Muskulatur des Jungen führt. Kurz gesagt, so gut wie alle körperlichen Geschlechtsunterschiede sind auf Androgene zurückzuführen. Testosteron beeinflusst im Gehirn auch bestimmte Verhaltensweisen wie etwa Aggressivität (Silbernagl und Despopoulos, 2003, S.306), und es fördert die Kampfeslust, macht risikobereiter und schärft die Wahrnehmung. Der Testosteronspiegel korreliert zwar nicht generell mit Aggressivität, steht aber im Zusammenhang mit »Wettbewerbsorientierung«, mit Leistungsbereitschaft und Kräftemessen (Bischof-Köhler, 2008, S.27). Es ist also das Hormon, das den Jungen phallisch werden lässt.
Fast alle der zuvor kurz erwähnten Geschlechtsunterschiede rühren hieraus: Jungen bewegen sich bereits im Mutterleib mehr als Mädchen. Von Geburt an sind sie schon impulsiver und störbarer. Sie sind emotional rascher in Fahrt, sie streiten herum und zeigen ein krawalliges Hahnenkampf- und Imponiergehabe, vor allem in Gruppen. Ihr Verhalten ist dominant und oft wettbewerbsorientiert. Alles tun sie etwas aufgeregter, etwas überschießender, immer mit Vollgas und einem hochtourigen Motor. Bekannt ist der schwitzende Junge mit hochrotem Kopf, der hereingerannt kommt, kurz etwas trinkt und mit viel Geschrei schon wieder draußen ist. Dennoch ist festzuhalten: Das frei im Blut vorhandene Testosteron ist nicht kausal mit Dominanz, Maskulinität oder Attraktivität von Männern assoziiert. Hohe pränatale Testosteronwerte dienen dazu, männliche Gesichtsmerkmale zu organisieren, die dann spätere Dominanz- und Maskulinitätscharakteristika reflektieren, die während der Pubertät aktiviert werden – viele unserer Eigenheiten werden uns bereits in die Wiege gelegt, wie Körperwachstum, Erscheinungsbild, die sexuelle Orientierung, geistige Fähigkeiten (Grammer et al., 2011, S.240f.).
Ein rauer und grober Spielstil ist für Jungen ebenfalls charakteristisch, sie stören schon in Kindergärten viel häufiger als die Mädchen. Maccoby et al. (1990) haben nach Auswertung einer Langzeitstudie das generelle Fazit gezogen, dass Jungen eher egoistische Ziele verfolgten und dass sie dominanter und autoritärer seien. Das Hochtourige ist auch schlechter zurückzufahren, Jungen sind viel schwerer zu beruhigen. Kein Wunder also, dass Männer häufiger an hohem Blutdruck leiden, am Herzen erkranken und früher sterben. Über die Lust der Jungen an der Bewegung, aber auch die Nutzung von Bewegung zur Affektabfuhr soll in Kapitel 10 gesprochen werden.
Der englische Psychologe Simon Baron-Cohen (2003; 2004; 2009) hat festgestellt, dass Frauen die Welt mit Empathie erfassen, also mit der Kunst, sich in andere hineinzuversetzen. Sie seien mehr an Gefühlen interessiert, Männer hingegen an Systemen. Er schreibt: »Das weibliche Gehirn ist so ›verdrahtet‹, dass es überwiegend auf Empathie ausgerichtet ist. Das männliche Gehirn ist so ›verdrahtet‹, dass es überwiegend auf das Begreifen und den Aufbau von Systemen ausgerichtet ist« (2009, S.11). Empathie definiert Baron-Cohen als das Vermögen, die Gefühle und Gedanken eines anderen Menschen zu erkennen und darauf mit angemessenen eigenen Gefühlen zu reagieren. Bei der Emotion geht es darum, dass man eine angemessene emotionale Reaktion im eigenen Inneren spürt, die durch die Emotion der anderen Person ausgelöst wird. »Wer sich in einen anderen Menschen einfühlt, will ihn verstehen, sein Verhalten vorhersagen und eine emotionale Verbindung zu ihm herstellen« (ebd., S.12). Mit Systematisieren meint Baron-Cohen den Drang, Systeme zu begreifen und aufzubauen. Er meint dabei jedes Objekt oder Phänomen, das bestimmten Regeln folgt, die den Zusammenhang zwischen Input, Operation und Output steuern. Dabei könne ein System winzig sein, eine einzelne Zelle oder gar ein politisches System (ebd., S.93). Baron-Cohen fasst darum zusammen und meint: »In der Praxis lässt sich Empathie am leichtesten auf handelnde Personen anwenden, während das Systematisieren am leichtesten auf Umweltaspekte anzuwenden ist« (ebd., S. 95).
Das typisch männliche Gehirn bezeichnet Baron-Cohen darum als S-Gehirn, das weibliche als E-Gehirn. Diese geschlechtstypische Prägung existiert nach Baron-Cohen bereits direkt nach der Geburt, sie sei Folge der Hormonkonzentrationen, denen Föten im Mutterleib ausgesetzt seien. Hohe pränatale Testosteronwerte korrelieren bei den Jungen mit weniger Blickkontakt, geringerem sozialen Interesse sowie niedriger sozialer Kompetenz. Die niedrigeren Testosteroneinflüsse führen bei den Mädchen wiederum zu einem stärker personorientierten und sozial kompetenteren Verhalten. Geschlechtstypische Prägung findet also bereits im Mutterleib statt. Baron-Cohen spricht jedoch von Tendenzen, er diskutiert statistische Durchschnittswerte und er ist von der Formbarkeit über soziale Beziehungen ebenfalls überzeugt. Er betont, dass er keineswegs alte Klischeevorstellungen verstärken will, sondern der Frage nach Geschlechtsunterschieden nachgehen möchte.
Baron-Cohen hat für seine Forschungen auch viel Kritik erfahren. Bischof-Köhler (2011, S.322f.) hat vor allem die Pauschalität, mit der der Autor verschiedene Leistungen über einen Kamm schere, heftig kritisiert. In erster Linie seien seine Definitionen von System und Empathie höchst vage, wenig spezifisch und es fehle an präzisen Analysen. Sie mag dabei zum Teil Recht haben, jedoch halte ich Baron-Cohens Entdeckung für eine richtige und wichtige Erklärung mancher Geschlechtsunterschiede. Eine noch heftigere Kritik erfuhren die Forschungen von Baron-Cohen in dem Buch von Fine (2012).
Wir sollten auch bei solch überraschenden biologischen Entdeckungen bedenken, dass es immer um ein Zusammenspiel von Biologie und Psyche geht. Brizendine schreibt, dass der Unterschied zwischen den Gehirnen von Jungen und Mädchen zwar anfangs biologischer Natur sei. Neuere Forschungsergebnisse zeigten jedoch, dass es nur der Beginn sei. »Anders als man früher glaubte, wird der Aufbau des Gehirns nicht bei der Geburt oder am Ende der Kindheit in Stein gemeißelt, sondern er wandelt sich während des gesamten Lebens weiter. Unser Gehirn ist nichts Unveränderliches, sondern viel plastischer und wandelbarer, als man noch vor zehn Jahren glaubte« (2010, S.16).
Keineswegs ist Baron-Cohen pauschal, sondern höchst differenziert und faszinierend. Ich habe vor vielen Jahren Geschlechtsunterschiede in Kinderträumen festgestellt, die mit Baron-Cohens Entdeckungen in verblüffender Weise korrelieren. Ich werde hierüber in Kapitel 10 (S.319) ausführlich berichten.
Evolutionstheoretische Überlegungen
Gemäß Bischof-Köhler darf der Anlagefaktor nicht ignoriert werden, denn das Geschlecht »werde nicht erst durch einen Akt sozialer Konstruktion erschaffen« (2011, S.105). Es wurde bereits erwähnt: Die Biologie wurde von Freud bis heute von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern niemals kleingeredet oder gar geleugnet: Die Psychoanalyse war immer und sie ist immer noch auch eine Triebpsychologie. Und Freuds Aussage war eindeutig: »Anatomie ist Schicksal!« Es ist darum durchaus plausibel, wenn bestimmte Verhaltensweisen aus der biologischen Herkunft des Menschen hergeleitet werden. Wir gehen innerhalb der Psychoanalyse immer von einer Interaktion von biologischen mit soziokulturellen Faktoren aus. Eine andere Frage ist, wie menschliches Verhalten und Erleben aus der evolutionsbiologischen Situation des Menschen zu erklären ist. Anders formuliert, wie mussten sich Menschen verhalten, um einen Selektionsvorteil zu erlangen und zu überleben? Wie konnten sie immer besser und effizienter zur Fortpflanzung gelangen?
Während meiner stationären Tätigkeit als therapeutischer Leiter eines psychotherapeutischen Kinderheims hat mich die Fülle von archaischen Ängsten bei schwer gestörten Kindern beeindruckt. Sie waren vielfältig traumatisiert, hatten keine schützenden Objekte introjiziert und waren ihren Ängsten hilflos ausgeliefert. Die archaischen Ängste aus der phylogenetischen Vergangenheit dieser kleinen Menschen wurden von keiner Ich-Struktur neutralisiert und brachen in vielfältiger Weise durch. Dennoch erlebte ich diese Ängste wiederum sinnreich, vor dem, was diesen Kindern geschehen war.
Freud wollte übrigens sein Triebmodell ursprünglich um die »phylogenetische Phantasie« erweitern. Er glaubte, dass Spuren von Umweltereignissen und soziale Handlungen, die in der grauen Vorzeit in der Außenwelt real stattgefunden hatten, unveränderlich auf dem Vererbungswege über das Körpersubstrat weitergegeben wurden (Wolfram-Ertl, 2007, S.71). Jung hat Ähnliches mit seinem kollektiven Unbewussten beschrieben. Rosemeier geht davon aus, dass Gefahrreize bereits im Laufe der Evolution herausgebildet worden sind. Darum lassen sich panische Ängste nicht allein von der Intensität oder Neuheit einer Reizsituation her erklären. Die Gefährdung des Menschen während der Evolution glaubt Gray (1971, zit.n. Rosemeier, 1987, S.72) als »atavistische Anteile in der Angst vor Dunkelheit, in der Klaustrophobie oder Agoraphobie« wieder zu finden. Angriffe gegen die relativ wehrlosen Menschen der Frühgeschichte waren tatsächlich im Dunkeln, in Höhlen oder auf frei übersichtlichen Flächen wahrscheinlich und real bedrohlich. Wenn sich also kleine Kinder im Dunkeln vor einem Monster unter dem Bett fürchten, so ist in dieser Angst noch etwas davon enthalten, dass unter den Bäumen, auf denen unsere Vorfahren einst schliefen, gefährliche Raubtiere lauern konnten. Aber auch Trennungs- und Verlustängste, Fremdenängste, Ängste vor Tieren enthalten Reste unserer evolutionären Vergangenheit. Angst ist ein Merkmalskomplex, der in der Evolution entstanden ist, weil er seinem Träger half zu überleben. Kinder, die sich vor realen Gefahren ihrer Umwelt nicht gefürchtet hatten, dürften kaum Chancen gehabt haben, zu unseren Vorfahren zu zählen (Paul, 2004, S.45f.; Hopf, 2009).
Sind auch Eigenschaften, die als männlich bezeichnet werden, von der Evolution herausgebildet worden? Bischof-Köhler meint hierzu, dass die Gesellschaft immer die anlagebedingten geschlechtstypischen Neigungen aufgegriffen und zur Partitur ihrer Geschlechtsrolleninszenierung gemacht hat. So sind Risikobereitschaft, Unternehmenslust, die Freude, sich in Gefahr zu begeben, sich im Kampf zu messen einerseits und Kooperationsbereitschaft für die spezifischen Funktionen des Mannes bei der Daseinsbewältigung sicherlich von Vorteil gewesen. Wem dies von der genetischen Position her leichter fiel, war nicht nur als Jäger erfolgreich und ein tapferer Krieger, sondern auch als Ehepartner begehrt (Bischof-Köhler, 2011, S.151). Die Annäherung seines Verhaltensrepertoires an die Frau bestand in Form einer fürsorglichen Haltung und der Bindungsbereitschaft an Frau und Kinder. So war wahrscheinlich schon der Vater der Vorzeit in den meisten Fällen ein »aufmerksamer Beschützer«.
Diese Neigung des Mannes rührt aus der biologischen Vergangenheit des Männchens her, bei ihren Weibchen zu bleiben, sie bei der Brutpflege zu unterstützen, sich an der Ernährung, vor allem jedoch an der Verteidigung der Jungen zu beteiligen. Es existiert jedoch noch eine andere Variante von Männchen, denen es genügt, eine paarungsbereite Partnerin zu finden und mit dieser zur Zeugung zu kommen. Am erfolgreichsten ist, wer sich danach möglichst schnell auf die Suche nach der Nächsten macht und es dem trächtigen Weibchen überlässt, für sich und die Nachkommenschaft zu sorgen. Männer können die Strategie verfolgen, sich auf möglichst viele sexuelle Begegnungen einzulassen, ohne die Folgelasten auf sich zu nehmen (ebd., S.146).
Ich war als Psychotherapiegutachter von der Tatsache beeindruckt, wie viele Männer ihre Gefährtinnen und Ehefrauen bereits während der Schwangerschaft oder noch während des ersten Lebensjahres des Kindes verlassen haben. Es wiederholt sich damit genau das, was oben beschrieben wurde. Diese Männer wollten (oder konnten) ganz offensichtlich nicht die Verantwortung übernehmen, Vater zu sein. Sie wollten nicht zum aufmerksamen Beschützer eines Kindes werden.
Dieses Beispiel ist bestens geeignet, das Zusammenspiel von biologischen Verursachern und der Seele zu verdeutlichen sowie die Entstehung von Verhalten durch phylogenetisch bedingte Dispositionen zu hervorzuheben. Nach Hüther und Krens (2011) reagiert nicht nur die Frau auf die Schwangerschaft mit hormonellen Veränderungen, auch der werdende Vater ist davon betroffen. Vor und nach der Geburt lassen sich in seinem Speichel erhöhte Werte von Prolaktin, Kortisol und Östrogen nachweisen. Dies sind Hormone, die Umbauprozesse im Gehirn vorbereiten und mütterliches fürsorgliches Bindungsverhalten stimulieren, andererseits reduziert sich die Testosteronproduktion des werdenden Vaters. Der Grund für diese sich abgleichenden hormonellen Veränderungen von Mann und Frau liegt vermutlich in der räumlichen und emotionalen Intimität der werdenden Eltern, die Übertragung erfolgt wahrscheinlich über Pheromone, also Geruchsstoffe. Die Männer fühlen, dass sie empathischer werden, verwundbarer und vertrauensvoller, was sie zu fürsorglichen Vätern werden lässt. Denn auch der Vater braucht »Mutterinstinkte«, die es ihm ermöglichen, liebevoll und feinfühlig zu handeln. Dies sind aber auch Eigenschaften, die in unserer Kultur häufig als »typisch weiblich« gelten (Hüther und Krens, 2011, S.36f.).
Dieser Moment birgt darum für manche Männer Gefahren. Seine neue, »weiche« und damit weibliche Seite kann der werdende Vater mitunter als bedrohlich erleben und abwehren, vor allem dann, wenn sie mit seiner männlichen Identität nicht vereinbar erscheint. Dies gilt für jene Männer, die ein unsicheres Männlichkeitsgefühl haben und zu frauenverachtendem, hyperphallischem Verhalten neigen. Beim Versuch, diesen inneren Konflikt durch Stimulierung ihrer Testosteronproduktion zu bekämpfen, gehen solche Männer dann während der Schwangerschaft fremd oder sie zeigen gegenüber dem Kind eine ablehnende oder sogar gewalttätige Haltung. Diese Handlungen können durch vielerlei Fallgeschichten bestätigt werden. An dieser Stelle wird wiederum augenscheinlich, wie sich biologische und sozialpsychologische Prozesse ständig durchdringen und wie sich Biologie in Phantasien niederschlägt: So betont Schon (2010, S.24) unter anderem die Angst des Vaters vor seinem Kind und im Speziellen vor dem Sohn als Gegenstück seiner Sehnsucht nach ihm. Eine weitere Angst, die viele werdende Väter kennen, ist die Angst vor dem Verlust seines Platzes als wichtigste Person im Leben der Frau und Partnerin. Diese Angst kann beispielsweise aus der Erfahrung heraus erwachsen, einst selbst von der Mutter dem Partner bzw. dem Vater vorgezogen worden zu sein. Der werdende Vater fürchtet deshalb, ihn könne dasselbe