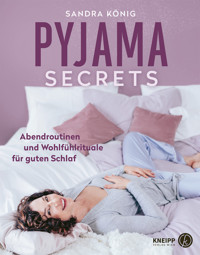Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Lara Johannson versteht endlich, weshalb sie ein Burnout erlitten hat. Der Weg dorthin war beschwerlich und hart, mit Stolpersteinen gepflastert und voller Rückschläge. Der Grund ihrer Erkrankung liegt viel weiter zurück, als sie bisher geglaubt hat. Eine Therapie hat ihr geholfen, das zu erkennen, und gibt ihr nun den Mut, ihr Leben so zu leben, wie sie es sich erträumt hat. Kurz entschlossen wirft sie ihren bisher geliebten Job hin und beginnt ein neues Leben in Heiligenhafen an der Ostsee. Dort erlernt sie nicht nur einen neuen Beruf, sondern findet auch die verlorene geglaubte Liebe zum Reiten wieder. Doch das ist noch nicht alles: In der kleinen Stadt trifft sie auf den Stallburschen Björn und verliert ihr Herz an ihn. Doch Björn hat ein Geheimnis, das alles verändern könnte. Immer wieder verschwindet er, und wenn sie ihn doch sieht, kommt es zu merkwürdigen Funken zwischen den beiden. Lara braucht Gewissheit und Klarheit. Sie möchte nicht wieder in einem Strudel aus Unsicherheit versinken. Aber ist Björn bereit dazu, ihr zu vertrauen? Kann Lara das Geheimnis um ihn lüften? Die junge Liebe der beiden wird auf eine harte Probe gestellt. Sollte Lara das Glück einfach nicht gegönnt sein? Und was hat es mit dieser Legende und der Prophezeiung auf sich, die sie von seinem Vater erfährt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Über die Autorin: Sandra König wurde 1986 in Kassel geboren, seitdem lebt sie in Vellmar, einer Kleinstadt im Landkreis von Kassel. Schon zu ihrer Kinder- und Jugendzeit hat sie gerne Geschichten erfunden und aufgeschrieben. Den Traum, irgendwann ein eigenes Buch in den Händen zu halten, hatte sie bereits zu dieser Zeit. Im Herbst 2013 packte sie diesen beim Schopf und begann damit, Zeile für Zeile ihr Debüt zu schreiben. Melancholische Musik, ein Platz in der Sonne oder am Wasser, das sind für Sandra König die schönsten Orte und Gegebenheiten, um neue Ideen für ihre Geschichten zu sammeln. Immer mit dabei – ein Notizbuch, um alle Ideen, Gedanken oder Gefühle direkt festzuhalten. Am liebsten schreibt sie Geschichten für Kinder und Jugendliche.
Bereits von der Autorin erschienen:
Die Raben-Bande: Abgezockt! (Band 1)
Die Raben-Bande: Giftköder! (Band 2)
Die Raben-Bande: Der geheimnisvolle Turmfalke (Band 3)
Die Raben-Bande: Der Rätselspass
Es ist nie zu spät für einen Neuanfang! An all die Seelen, die jeden Tag mit sich und der Welt und all dem Druck kämpfen. Holt euch euer Leben zurück.
Inhaltsverzeichnis
Flashback
Meine Geschichte
Die Wurzel allen Übels des Problems
Die Erkenntnis
Mein Entschluss
Hast du den Mut, neu anzufangen?
Das Gestüt: Reiten am Meer
Der Neuanfang
Diego – Eine neue tierische Liebe
Björn – der Stallbursche
Auf den Spuren eines Detektives
Die Frau mit dem Tattoo
Die alte Liebe
Der erste Kuss
Eine heiße Nacht
Wer bist du?
Der Traumfänger
Valeas Geheimnis
Der Hass Elbors
Überraschender Besuch
Alte Geschichten
Freunde
Die Legende des Traumfängers
Die Erden-Frau
Lara und Elbor
Sascha und Björn
Das magische Happy End
Danksagung
Flashback
Obwohl heute ein warmer Tag war und ich mit meinem Lieblingsshirt durch den nahegelegenen Ahnepark, ein kleiner Stadtpark in Vellmar, schlenderte, fröstelte es mich und mir war kalt. Der Park war ungewöhnlich leer für den sonnigen Tag heute, was mich sehr wunderte. Denn normalerweise tobte hier das Leben. Kinder spielten auf dem Spielplatz, schaukelten, rutschten oder sprangen jauchzend auf dem Trampolin, während die Eltern auf den Bänken saßen und sich unterhielten. Aber heute? Heute waren nur wenige Kinder da, die Enten schwammen friedlich auf den verschiedenen Seen, die sich im Park befanden und die Sonne verschwand hin und wieder zwischen ein paar Schleierwolken. Ich schlich zu der Hütte, die an einem der Seen lag, etwas abseits von den Wegen und setzte mich ins Grün hinter der Hütte. Ein Fischreiher hatte sich auf die andere Seite des Ufers ins Schilf gesetzt und starrte auf das Wasser. Vermutlich wartete er auf einen Mittagssnack. Und ich? Ich wartete auf meine nächste Therapiesitzung, vor der ich heute doch sehr nervös war. Ich schloss meine Augen und plötzlich lief es wie ein Film vor mir ab.
Es geschah vor achtzehn Monaten, an einem Dienstag im November. Es überrollte mich, wie das Grollen eines Donners, welcher über das Land fegte. An diesem Dienstag hatte ich an der Arbeit eine Teambesprechung, was nichts Außergewöhnliches war. Einmal im Monat kamen meine Kolleginnen und ich mit unserer Chefin in den frühen Stunden an einem Tisch zusammen, um Probleme, Änderungen oder Beschwerden zu besprechen. Doch dieses Mal, hatten wir als Team nur einen Wunsch – wir brauchten dringend mehr Kolleginnen. Damals hatten mehr als die Hälfte der Kolleginnen gekündigt und das Rad drehte sich immer noch so weiter, wie es sich immer gedreht hatte. Zwar gab es nicht mehr so viele Zahnräder, die ineinandergriffen, um das Uhrwerk am Laufen zu halten, aber die wenigen liefen. Sie funktionierten von Tag zu Tag langsamer. Einige Zacken brachen heraus, stolperten und fingen an, langsam zusammenzubrechen. Gemeinsam wollten wir unserer Chefin klar machen, dass wir mehr Personal brauchten. Es war schwer geworden, in unserer Branche gutes Personal zu finden, das wussten wir, aber so konnte es auch nicht weitergehen. Frau Dr. Wülmersen, unsere Zahnärztin, setzte sich zu uns in den Personalraum an den Tisch, legte ihre Papiere ab, zückte den Kuli und schaute uns fragend an.
»Guten Morgen. Dann legen wir mal los. Was habt ihr für Themen?« Sie schien gar nicht zu spüren, dass die Stimmung seit Wochen auf einem Gefrierpunkt war. Wollte oder konnte sie es nicht spüren?
»Nun, wir haben als Team eigentlich nur ein Thema, worüber wir gerne sprechen würden«, erwiderte Karin ruhig, aber bestimmend. Dabei klappte sie das Buch, welches wir für unsere Besprechungen führten, zu. Zwar standen dort noch andere Themen drinnen, die besprochen werden mussten, aber wir waren uns alle einig gewesen, dass dies Punkte waren, die derzeit nicht so relevant waren. Karin war eine Kollegin, die bereits zum Inventar gehörte und für uns als Sprachrohr zur Chefin diente. Zudem war sie ihre rechte Hand. Sie war sehr groß, etwas kräftiger gebaut und trug ihre dunkelblonden Haare kurz.
»Das klingt aber ernst. Worum geht es?« Unsere Chefin schien plötzlich zu merken, dass es etwas gab, was geändert werden sollte. Jedoch schien sie sich angegriffen zu fühlen, zumindest entnahm ich dieses Gefühl. Sie beugte sich vor, legte ihre Unterarme auf den Tisch, bewaffnete sich mit ihrem Kuli, den sie zuvor abgelegt hatte, und blickte jeden Einzelnen von uns mit finsterer Miene an.
»Wir haben in den letzten Monaten über zehn Mitarbeiter verloren und wir können das Rad langsam nicht mehr so weiterdrehen. Wir schieben seit Monaten Überstunden ohne Ende. Die Prophylaxe läuft über und die Patienten beschweren sich über die langen Wartezeiten. Wir schleppen uns krank an die Arbeit, was kein gutes Bild nach außen wirft. Wir verlieren unser Lachen! Schuften wie die Blöden! Verlieren die Freude an unserem Beruf und versuchen irgendwie zu funktionieren. Manche haben bereits die Klinke in der Hand. Teilweise sind die Kündigungen schon geschrieben und alles, was uns hier noch hält, ist die Hoffnung, dass Sie endlich mal neues Personal einstellen und es so wird wie früher. Sie haben uns hier immer ein zweites zu Hause geschenkt. Wir sind hier wie eine Familie und all das zerbricht. Wir brauchen dringend neue Kolleginnen, das kann so nicht weitergehen.« Karin sprach sich richtig in Rage, während wir anderen unsere Chefin nickend anschauten. Ich sah, wie sie versuchte, ihren Puls zu beruhigen, der scheinbar in die Höhe zu schießen schien. Ihre Ohren erröteten. Dies passierte immer, wenn sie sich aufregte. Ihr Griff festigte sich um den Kuli, sodass ihre Knöchel weiß wurden. Ich wartete darauf, dass sie explodierte, aber sie atmete mehrmals tief ein und aus und schwieg. Ihr Schnaufen war deutlich zu hören. Meine Blicke trafen sich mit Karins und dann mit denen meiner Chefin. Zornig funkelte sie mich an, dann traf ihr grimmiger Blick jeden Einzelnen im Raum. Die Luft war zum Schneiden dick. Wärme stieg in mir auf, mein Herz raste und ich verspürte eine Nervosität. Eine Anspannung in jedem meiner Muskeln. Ein Kloß breitete sich in meinem Hals aus. Tränen suchten sich einen Weg in meine Augen. Aber ich schluckte sie hinunter. War es Wut, Enttäuschung, Traurigkeit oder die blankliegenden Nerven? Ich wusste es nicht. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte geschrien. Mir war nach frischer Luft zu Mute, als unsere Chefin plötzlich aufstand. Der Stuhl ratterte über den Boden.
»Eure Probleme möchte ich mal haben«, sagte Dr. Wülmersen in einem sehr ruhigen Ton, obwohl sie nach außen so wirkte, als würde sie explodieren. Schließlich drehte sie sich um und ging aus dem Personalraum heraus. Wie versteinert saßen wir alle dort, tauschten schweigend unsere Blicke und Karin knallte ihren Stift auf den Tisch. Keiner wagte es ein Wort zu reden und ich verspürte die erneut aufsteigenden Tränen. Dieses Mal wusste ich es genau – es war Wut, die meinen Körper durchfuhr. Ich setzte meinen Mundschutz auf, wobei ich spürte, wie meine Hände zitterten und stand schwungvoll auf. So schwungvoll, dass mein Stuhl nach hinten krachte und auf dem Boden lag. Mit einem Ruck stellte ich ihn auf, stürmte hinaus in mein Behandlungszimmer und knallte dort die Tür hinter mir zu. Was für eine blöde Kuh! Diese Hexe! Ein Drachen und so unsensibel, rauschte es mir durch den Kopf. Mit meiner Faust schlug ich auf die Arbeitsplatte.
»Fuck!«, fluchte ich, sodass es sicherlich auf dem Gang zu hören gewesen war. Langsam öffnete sich die Tür zu meinem Behandlungszimmer.
»Dein Patient zur Zahnreinigung ist da«, sagte Miriam, unsere zahnmedizinische Verwaltungsassistentin leise.
»Danke«, erwiderte ich kurz, ohne sie anzuschauen. Als ich hörte, wie die Tür wieder ins Schloss fiel, richtete ich mich auf und schaute in mein verheultes Spiegelbild. Kaltes Wasser spritzte ich mir ins Gesicht und hielt meine Unterarme unter das kalte Wasser. Es kühlte meine innerliche Hitze herunter und ich beruhigte mich.
»Krone richten und weiter geht es«, sagte ich zu meinem Spiegelbild und versuchte zu lächeln, aber es gelang mir nicht. Ich trocknete meine Augen, zog meinen Mundschutz an, richtete meine Schultern auf und ging ins Wartezimmer, um meinen Patienten zu holen.
»Guten Morgen, Herr Braun, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen?«
»Danke, der Nachfrage. Sehr gut. Die Zahnreinigung ist mal wieder nötig. Beschwerden habe ich keine. Zum Glück«, sagte er fröhlich und schaute mich mit einem Lächeln an. Er war ein Patient, der alle drei Monate kam und den ich bereits seit sieben Jahren betreute. Ich mochte meine Patienten sehr und gerade jene, die so oft kamen, lagen mir sehr am Herzen. Mit ihnen tauschte man auch den einen oder anderen Plausch aus, was mir in diesem Moment aber zum Verhängnis wurde.
»Ihnen geht es aber nicht so gut heute?«, bemerkte Herr Braun, als ich mich auf meinen Stuhl setzte.
»Ach, irgendwie scheint mich meine Allergie heute ein wenig zu ärgern«, log ich und war mir nicht sicher, gegen was ich in dieser Jahreszeit allergisch sein konnte. Ich hatte eine Allergie bei den Frühblühern, aber glücklicherweise fragte Herr Braun nicht weiter nach und ich begann mit meiner Arbeit. Der Tag zog sich wie Kaugummi und immer wieder schossen mir während der Behandlung die Tränen in die Augen, was die Patienten zum Glück nicht wirklich mitbekamen, da diese bei der Behandlung meistens die Augen geschlossen hielten. Unter meiner Maske und der Schutzbrille bemerkte ich jedoch, dass mein Blick immer wieder verschwamm, was dazu führte, dass ich öfters eine kurze Pause einlegen musste. In der Mittagspause spürte ich einen innerlichen Druck, dass ich hier raus und nie wieder herkommen wollte. Das Essen schmeckte nicht und ich setzte mich für die restliche Pause in mein Behandlungszimmer, um alleine zu sein. Entschlossen, morgen nicht mehr an die Arbeit zu kommen, rief ich in der Praxis von meinem Hausarzt an. Die sich nach mehrfachem Klingeln endlich meldete und ich freundlich begrüßt wurde.
»Johannson, kann ich heute bitte noch zu Ihnen kommen? Ich brauche dringend eine Krankmeldung«, versuchte ich selbstsicher zu klingen. Aber erneut setzte sich ein Kloß in meinem Hals fest, der meine Stimme wackeln ließ.
»Sind Sie krank?«, kam es von der anderen Seite der Leitung.
»Bitte, ich kann nicht mehr«, wisperte ich in den Hörer und die Tränen nahmen ihren Lauf. Ich begann zu schluchzen und konnte nicht mehr weitersprechen.
»Kommen Sie heute um siebzehn Uhr«, sagte die medizinische Fachangestellte und ich nickte. Ich bemerkte aber schnell, dass sie das Nicken nicht sehen konnte.
»Danke«, schluchzte ich und legte auf. Die Pause nahm ein Ende. Ich wischte mir die Tränen weg und versuchte die letzten zwei Stunden noch herumzubekommen. Sechzehn Uhr, endlich Feierabend. Zügig ging ich mich umziehen, verabschiedete mich kurz und lief zu meinem Auto. Den Blick zu Boden gesenkt und mit Tränen in den Augen setzte ich mich ins Auto und dann passierte es. Mein Körper begann zu zittern, als würde ich mitten im Winter frieren. Ich schluchzte nicht mehr leise, sondern weinte bitterlich. Noch nie in meinem Leben hatte mich etwas so traurig gemacht, dass ich am ganzen Leib zitterte und innerlich vor Wut bebte. Es fühlte sich alles so leer an. Als sei ich seelisch kaputt. Sogar nach Luft musste ich japsen, weil ich so sehr weinte. Da gehe ich nie wieder hin. Ich will das nicht mehr und ich kann das nicht mehr, dachte ich im Stillen, legte meinen Kopf auf das Lenkrad und verschränkte meine Arme darüber. Meine Nase fühlte sich an, als wäre ich stark verschnupft und meine Augen wurden mit Tränen überflutet. Sie liefen meine Wangen herunter. Einige versiegten auf meinen Lippen, andere tropften mir am Kinn herunter auf die Hose. Zitternd suchte ich nach einem Taschentuch und schnäuzte mir die Nase. Als ich einen Blick in den Rückspiegel warf, erschrak ich vor meinem eigenen Spiegelbild. Wenn ich es auch nur verschwommen sehen konnte, so erkannte ich, dicke rote und verweinte Augen. Ich versuchte durchzuatmen und mich zu beruhigen. Mom, ich wollte meine Mom jetzt anrufen, rauschte es mir durch den Kopf. Wenn mich einer beruhigen konnte – dann sie. Schließlich saß ich immer noch im Auto und wollte zum Arzt fahren. Wimmernd hatte ich versucht, meiner Mutter am Telefon zu erklären, was los war. Doch verstehen konnte sie mich nicht. Immer wieder bekam ich Worte zu hören, wie: Stell dich nicht so an! Das sind nur Phasen! Das geht wieder vorbei! Aber ich wusste, dass es nicht einfach nur eine Phase war. Seit Monaten war es mir nicht gut gegangen, allerdings musste ich auch eingestehen, dass ich bisher mit niemanden darüber gesprochen hatte. Oder jemanden erzählt hatte, wie schlecht es mir ging und dass ich oft allein, weinend zu Hause gesessen hatte. Immer wieder hatte ich nach außen funktioniert, gelächelt und Freude vorgetäuscht. Bei Fragen, wie es auf der Arbeit lief, bin ich ausgewichen mit – Na ja, wie immer. Wie sollte jetzt also jemand meine Reaktion verstehen? Irgendwie auch nachvollziehbar, dass meine Mutter es für eine Phase hielt.
»Ich fahr zum Arzt und melde mich«, sagte ich kurz.
»Fahr vorsichtig!«, erwiderte sie und ich versprach ihr, mich später zu melden. Ich wusste, dass es heute nicht nur eine Phase war. Es fühlte sich anders an, als sonst. Ich merkte, dass ich innerlich leer war, mein Kopf brummte und ich spürte, dass ich nicht mehr an die Arbeit wollte. Dabei hatte ich meinen Job immer sehr geliebt. Bin zielstrebig meinen Weg gegangen. Seit siebzehn Jahren war ich nun in meinem Job und hatte vor einigen Jahren meine erste Aufstiegsfortbildung zur zahnmedizinischen Fachassistentin absolviert. Der Bereich in der Prophylaxe, war das, was ich eigentlich liebte, mein Herzblut und eine Berufung. Doch in diesem Moment brach genau das in sich zusammen, wie ein Kartenhaus und ich wollte das nicht mehr. Langsam schritt ich die Treppen zu meinem Hausarzt nach oben in den dritten Stock des Ärztehauses und klingelte. Ohne ein Wort legte ich meine Versichertenkarte ab und durfte direkt ins Behandlungszimmer durchgehen. Meine Tränen waren getrocknet, doch mein Herz pulsierte und das Warten schien in eine Unendlichkeit zu verfallen. Ich starrte auf das Foto an der gegenüberliegenden Wand und versuchte etwas zu denken, aber alles, was ich fand, war ein großes schwarzes Loch. Als ruckartig die Tür zu dem Behandlungszimmer geöffnet wurde, in dem ich saß, schrak ich zusammen und sah aus dem Augenwinkel die weiße Hose meines Hausarztes. Doch statt sich mir gegenüberzusetzen, an seinen Schreibtisch, wie er es sonst tat, trat er neben mich und legte seine Hand sanft auf meine Schulter.
»Na, was ist los?«, hörte ich seine Worte, denn anschauen konnte ich ihn nicht. Gerade als seine letzten Worte seinen Mund verlassen hatten, kullerten mir erneut die Tränen über die Wangen. Aber dieses Mal weinte ich still. Den Kopf zu Boden gesenkt, mit hängenden Schultern und die Arme in meinem Schoß liegend. Am liebsten hätte ich die Knie eng an mich herangezogen und meinen Kopf darin vergraben. Mein Arzt sagte zunächst nichts, aber ich spürte seine Hand auf meinem Rücken, was mich etwas beruhigte.
»Die Arbeit?«, fragte er nach einer Weile. Ich nickte und traute mich endlich meinen Kopf zu heben, um ihn anzuschauen. Er kannte mich mittlerweile seit vielen Jahren und hatte mir vor einigen Jahren schon einmal viel Mut zugesprochen, aber damals war es eine andere Sache gewesen. Einen Lungenriss, der mich, mit meinen damals achtzehn Jahren, aus der Bahn geworfen hatte. Doch dieses Mal, war es seelisch, was mich innerlich zerstörte und ich kannte keinen Ausweg.
»Wollen Sie drüber reden?«
»Ich will da nicht mehr hin. Ich kann nicht mehr. Es ist zu viel«, stotterte ich und bekam kaum ein Wort raus. Es wollte sich einfach nicht sortieren in meinem Kopf.
»Frau Johannson, es ist nicht das erste Mal, dass Sie wegen der Arbeit, müde und schlapp vor mir sitzen, aber ich sehe, dass es dieses Mal sehr schlimm ist und wir etwas tun müssen. Ich werde Sie erst einmal krankschreiben, aber Sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Wo die Problematik ist und was Sie ändern möchten.« Mit ernster, aber besorgter Miene schaute er mich an.
»Ich weiß«, erwiderte ich kurz. Mir war es selbst bewusst gewesen, dass ich darüber nachdenken musste.
»Wie lange soll ich Sie krankschreiben? Zwei, vier oder sechs Wochen?«
Verwundert über diese Frage, schaute ich meinen Hausarzt an und zuckte mit den Schultern. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Ich wollte aber auch nicht zu lange krankgeschrieben sein. Eigentlich hatte ich ja auch einen Entschluss gefasst – ich wollte da nicht mehr hin.
»Zwei Wochen?«, fragte ich mehr, als dass ich antwortete.
»Zwei Wochen ist gut. Denn, Sie müssen auch bedenken – mit jedem Tag, werden die Gedanken mehr, wie es wohl sein wird, wenn Sie wieder hinmüssen. In der ersten Woche machen Sie bitte nur das, was Ihnen Freude bereitet. Gehen Sie mit Freunden aus, machen Sie Sport oder gehen Sie spazieren. In der zweiten Woche, denken Sie darüber nach, was Sie wirklich wollen und wie es weiter gehen soll.« Eindringlich schaute er mich an und ich nickte. Mein Hausarzt setzte sich an seinen Schreibtisch, mir gegenüber und tippte etwas in seinen Computer, während ich ins Leere starrte. Erst als ich das Geräusch vom Drucker hörte, kam ich wieder ins Hier und Jetzt.
»Frau Johannson …«, begann mein Hausarzt und hielt mir die Krankmeldung hin, » … Sie haben einen beginnenden Burnout und ich vermute, dass die letzten Jahre, als Sie mit den immer wiederkehrenden Magenbeschwerden bei mir waren, bereits damit zu tun hatten. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich Hilfe holen. Denken Sie in Ruhe darüber nach und melden Sie sich dann bei mir. Das ist kein leichter Schritt und kein einfacher Weg, aber wenn Sie wieder Ihren klaren zielstrebigen Weg begehen wollen, müssen Sie aus dem Loch heraus.« Eindringlich sah mein Hausarzt mich an. Obwohl ich es bereits geahnt hatte, schockten mich die Worte – beginnender Burnout. Er ließ die Krankmeldung los, als ich danach griff und steckte sie in die Tasche. Ich nickte, stand auf und ging zur Tür.
»Sie schaffen das!«, hörte ich seine Stimme, als ich die Tür öffnete. Ehe ich ganz raus war, drehte ich mich noch einmal um und formte ein stummes Danke auf meinen Lippen.
Das Klingeln meines Handys riss mich aus meinen Gedanken. Mein Terminkalender meldete sich zu Wort und sagte mir, dass ich mich auf den Weg zur Gruppentherapie machen musste. Ich hatte auf den Rat meines Hausarztes gehört und mir professionelle Hilfe geholt. Was nicht so einfach war, denn die Plätze bei einem Psychologen waren heiß begehrt. Vier Monate nach meinem Zusammenbruch hatte ich meine erste Sitzung, die man dafür nutzte, um zu schauen, ob es mit dem Psychologen passt oder nicht. Schließlich vertraute man dem alles an und wenn die Chemie zwischenmenschlich nicht passt, kann es nicht funktionieren. Ich hatte Glück und es hatte auf Anhieb gepasst. Glücklicherweise musste ich bis zum Beginn der Therapie nicht so lange warten. Ich wurde in eine Gruppentherapie gesteckt, wo ich mir anfangs nicht sicher war, ob dies das Richtige für mich war. In der Zeit bis zum Beginn der Therapie war für mich viel passiert. Ich war mir sicher gewesen, dass ich meinen Job liebte und ich nicht aufgeben wollte. Ich hatte auch versucht, mit meiner Chefin zu reden und sogar die Karten offen auf den Tisch gelegt. Ihr offenbart, dass ich mich in die Therapie begeben hatte, aber sie schien das alles nicht hören zu wollen. Oder konnte es nicht, weil sie selbst viel um die Ohren hatte. Was letztendlich auch ein Grund dafür war, dass ich meinen Arbeitsplatz gewechselt hatte. Zu Beginn war es in der neuen Praxis auch schön gewesen, aber bereits nach wenigen Wochen, wollte ich dort wieder weg. Und nun? Seit Monaten hatte ich jede Woche meine Gruppensitzung, die mir sehr guttat und ich fühlte mich auch nicht mehr krank, müde oder schlapp, aber heute – heute war ich sehr aufgeregt.
Meine Geschichte
Meine langen blonden Haare hatte ich meistens zu einem Zopf gebunden. Nur selten trug ich sie offen, da es für mich so bequemer war und morgens am schnellsten ging. Ich war mittlerweile Anfang dreißig und wirkte nach außen hin sehr kühl, manchmal abweisend und introvertiert. Dies war nicht immer so gewesen. Als Kind war ich sehr aufgeweckt, wollte immer Action haben und bin mit einem Freundeskreis von Jungs großgeworden. Habe im Dreck gespielt, bin mit dem Bike durch den Wald gebrettert und habe keine Rampe ausgelassen. Ich habe mit meinen Inlineskates die Halfpipe unsicher gemacht und immer die starke Anführerin der Clique gegeben. Als Jugendliche habe ich mich gerauft und die Schule war mir völlig egal. Jedoch wusste ich auch, wie ich mich einem Erwachsenen gegenüber zu benehmen hatte. Aber all dies änderte sich, als ich zu arbeiten anfing und ich mich plötzlich von meinem Freundeskreis entfernte. Während alle auf weiterführende Schulen gingen, um ihr Abi oder Fachabi zu machen, begann ich meine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Mein Leben, meine Freunde und meine Interessen änderten sich. Ich schien erwachsen zu werden und als ich mit achtzehn lange im Krankenhaus liegen musste, weil mir die Lunge gerissen war, wurde ich in meinem Leben zurückgeschleudert. Plötzlich fühlte sich nichts mehr so an, wie es mal war. Keiner von meiner alten Clique ließ sich im Krankenhaus blicken. Eine Enttäuschung? Oder bitterer Ernst, das erste Mal im Leben zu erkennen, wem man wichtig war und wem nicht. Damals hatte ich keine Luft mehr bekommen und die Worte des Klinikarztes hallten mir heute noch in den Ohren. »Wären Sie jetzt nicht gekommen, hätten Sie die Nacht vermutlich nicht überlebt.« Worte, die mich bis heute verfolgten und mich aus der Bahn warfen. Still und heimlich weinte ich manchmal. Nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen war, konnte ich nicht einmal in den ersten Stock laufen, ohne eine Pause zu machen. So wurde ich von dem raufenden Mädchen von damals, zur ängstlichen, jungen erwachsenen Frau. Keineswegs brauchte ich fette Partys, rauschende Nächte oder wilde Abenteuer. Ich liebte es, alleine zu sein und mir fiel es schwer, jemandem zu vertrauen. Konnte man überhaupt jemandem vertrauen? Wer war wirklich da, wenn es einem nicht gut ging? Vielleicht zwei oder drei Leute, wenn es hochkam. Traurig, aber wahr. In meiner Freizeit war ich gerne mit meiner Familie zusammen, traf mich mit Freunden oder ging spazieren. Besonders liebte ich die Zeit draußen in der Natur, fernab von allem Alltagstrott. Tag ein Tag aus das gleiche. Morgens früh aufstehen, an die Arbeit gehen, den Tag herumbekommen, Feierabend. So hangelte ich mich von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub.
Gemütlich ging ich zum Termin meiner Gruppentherapie und wurde bereits vor der Tür von einem aus meiner Gruppe herzlich empfangen.
»Hi Lara«, begrüßte Maik mich freundlich, als ich aus meinem Auto stieg. Er war einer von den vieren, die mit mir in der Therapiegruppe saßen und der einzige Mann unter uns. Maik war groß, hatte breite Schultern und war sportbegeistert, wie er in der ersten Sitzung erzählt hatte. Mit seinen braunen Augen wirkte er wie ein treuer und ehrlicher Mensch. Durch die Gruppensitzungen kannten wir uns alle recht tiefgehend. Teilweise wussten die Menschen aus der Therapie mehr von mir als meine engsten Freunde. Maik wirkte auf mich etwas zurückhaltend, aber er war jemand, der genau zuhörte und alles hinterfragte. Ein Umstand, der mir vor dem heutigen Tag und der anstehenden Therapiestunde auch ein wenig Angst bereitet hatte. Heute war ich an der Reihe, meine Geschichte zu erzählen, und ich wusste, dass Maik Fragen stellen würde, die ich gedanklich nicht zu beantworten wusste. Wir wussten alle voneinander, warum wir in der Therapie waren und was uns hierhergebracht hatte. Durch die immer wiederkehrenden Blitzrunden zu Beginn einer Therapiestunde, lernten wir unsere Charaktere jedes Mal besser kennen. In den Blitzrunden ging es darum, sehr kurzgefasst mitzuteilen, wie es uns gerade ging. Was in der vergangenen Woche geschehen war und ob wir eine Veränderung spürten. Mit jeder Stunde musste ich feststellen, dass ich danach oft müde und platt war von den Geschichten der anderen, die mich seelisch sehr mitnahmen. Allerdings konnte ich auch nie sagen, dass es mir seit Beginn der Therapie schlecht ging. Im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass mir allein die Anwesenheit der anderen guttat. Ich Dinge nicht ganz so ernst sah. Vielleicht spürte ich aber auch, dass das, was mir auf der Seele lag, nicht mein Problem war, weshalb ich hier in der Therapie saß. Einfach überarbeitet schien im Gegensatz zu den anderen ein Witz zu sein. Nachdem ich meinen Zusammenbruch in der Praxis gehabt hatte und beschlossen hatte, diese Therapie zu machen, hatte ich in meiner alten Praxis gekündigt. Ich wollte neuanfangen und plötzlich schienen auch meine Probleme weg zu sein, oder waren sie immer noch da und ich sah sie nicht mehr? Würden sie durch etwas getriggert werden? Fühlte ich mich stabiler durch den neuen Job oder die Gruppe? Innerlich spürte ich, dass ich heute durch meine Geschichte und durch Maiks Fragen, die sicherlich kommen würden, ein Problem in mir aufdeckte, was bisher verborgen schien. Ja, ich hatte wirklich Angst vor der Erkenntnis. Würde sie mich noch weiter aus der Bahn werfen?
Es ist Zeit, mit dem Herzen zu antworten, sagte ich mir im Stillen und lächelte Maik zufrieden und ehrlich an. Ein ehrliches Lächeln, was mir in den letzten Jahren nur selten über die Lippen gekommen war. Doch es fühlte sich gut und richtig an. In der vergangenen Zeit hatte ich oft gelächelt, um keine Fragen beantworten oder mir sinnlose Ratschläge und dumme Sprüche anhören zu müssen. Doch es war ein falsches Lächeln gewesen. Warum? Weil es wirklich das Letzte gewesen war, was ich an meinem tiefsten Punkt im Leben hatte hören wollen: gut gemeinte Ratschläge, die doch den Kern nicht trafen.
Dabei ging es mir seit dem Praxiswechsel doch gut und ich wusste teilweise nicht einmal, was ich hier in der Gruppe eigentlich bereden sollte. Aber in den letzten Wochen war mir klar geworden, dass ich zwar zufrieden mit meinem neuen Arbeitsplatz war, aber nicht glücklich. Durch Zufall und eine gute Freundin hatte ich von der Arbeitsstelle gehört und durch ihr Vitamin B hatte ich die Stelle auch erhalten. Ich musste also keine großen Bewerbungen schreiben, sondern wurde zu einem Gespräch eingeladen. Ich bat meinerseits um ein Probetag und wenige Wochen später unterschrieb ich bereits den Vertrag. Alles klang so perfekt und einfach. Nach meinem Nervenzusammenbruch wollte ich eigentlich nie wieder in meinem Job arbeiten, sondern lieber in einem Büro. Geregelte Arbeitszeiten, pünktlich Feierabend und eine Tür, die ich zumachen konnte. Anderseits liebte ich meinen Job sehr, sodass ich das Angebot annahm und dem Ganzen noch eine Chance geben wollte.
»Hi Maik«, grüßte ich zurück und wir gingen gemeinsam in das Gebäude, in dem sich die Therapiepraxis befand. Die anderen waren bereits da und schlenderten gemütlich durch die Räumlichkeiten. Wir begrüßten uns alle kurz und nahmen dann wie gewöhnlich unsere Plätze ein. Jeder hatte unbewusst einen festen Platz für sich errungen. Mit mir und Maik waren noch drei weitere mit in der Gruppe. Zum einen gab es da Klara, eine junge Frau, die etwas älter als ich und auch sehr nett war. Mira war etwas jünger als ich. Dann war Claudia noch mit von der Partie. Diese mochte ich besonders gern. Instinktiv hatte sie sich in der ersten Sitzung neben mich gesetzt. Ihre Anwesenheit hatte eine positive Wirkung auf mich, obwohl ich sie zuvor noch nie gesehen hatte. Sie strahlte Herzlichkeit und ein Wohlbefinden aus, was mich innerlich beruhigte. Doch heute war alles anders. Mein Puls beschleunigte sich, als der Blick der Psychotherapeutin auf mich fiel. An sich war es für mich nie ein Problem gewesen, vor einer Gruppe zu sprechen. Schließlich war ich es seit vielen Jahren von meinem Sport her gewohnt, aber hier und jetzt ging es darum, über meine Gefühle zu sprechen. Während meiner Tätigkeit als Trainerin stand ich mehrmals die Woche vor einer Gruppe und sprach laut und deutlich. Ich unterhielt die Schüler, gab Anweisungen und korrigierte bei Fehlern. Seit meinem Lungenriss vor ein paar Jahren, war es mir nicht mehr möglich, meinen Kampfsport selbst aktiv zu betreiben, aber als Trainerin gab es mir zumindest ein gutes Gefühl, nicht ganz von meinem Sport, den ich seit vielen Jahren betrieb, weg zu sein. Er war mir in die Wiege gelegt worden und bereits als Baby war ich mit in der Halle herumgekrabbelt. Hier, vor meiner Therapiegruppe zu sprechen, war jedoch etwas anderes. Von der selbstsicheren Trainerin war hier nichts zu spüren. Es war mein introvertierter Charakter, der zum Vorschein kam. Ich zog mich gerne zurück, war gerne alleine. Aus meinem Alleinsein gewann ich meine Energie. Mein Innerstes zu offenbaren. Mauern einzureißen. Über Gefühle und Emotionen zu reden, fiel mir besonders schwer. Lieber trug ich sie mit mir alleine aus – zurückgezogen und im Stillen weinend. Das nun zu ändern, stellte eine große Herausforderung für mich dar.
»Frau Johannson, wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie uns erzählen, warum Sie hier sind?«, fragte die Therapeutin mich da auch schon. Starr richtete ich meinen Blick auf die gegenüberliegende Wand und nickte.
»Ich bin ehrlich gesagt sehr aufgeregt und weiß nicht recht, was ich erzählen soll, denn eigentlich geht es mir ja wieder gut. Oder habe ich da den falschen Eindruck?«
»Ich denke nicht, dass Sie einen falschen Eindruck haben, schließlich haben Sie Ihren Arbeitsplatz gewechselt. Dies ist sicherlich ein wichtiger Schritt gewesen, aber ob das das Grundproblem war, können wir ja jetzt vielleicht gemeinsam herausfinden. Wie geht es Ihnen seither, was hat sich verändert? Sind Sie glücklich und zufrieden?«
Glücklich und zufrieden?, fragte ich mich im Stillen und schaute an die Decke. In meinen Gedanken schienen Engel und Teufel zu gleichen Teilen zu sitzen. Ja, du bist zufrieden mit der Arbeit, sagte der Engel zum einen und merkst du nicht, dass du dir das alles nur einredest, sagte der Teufel zum anderen. Doch wie ging es mir wirklich? War der neue Arbeitsplatz das, was ich wollte? Ich spürte, wie meine Gruppe mich anschaute. Lass dich von deinem Herzen leiten, sagte ich mir im Stillen und ermutigte mich, endlich eine Antwort zu geben.
»Ja und nein. Also, ja, ich bin zufrieden, aber nicht glücklich. Ich war es mal, in den ersten zwei Wochen nach dem Wechsel, und dann fing das Problem mit meiner Kollegin an. Wie ich bei unserem ersten Gespräch schon berichtet habe. Sie gab mir das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Eiskalt hat sie mich abgewiesen. Hätte sie mich einfach bloß ständig angemeckert oder mir Beleidigungen an den Kopf geworfen, wäre das schlimm genug, aber erträglich gewesen, doch sie hat einfach nichts gemacht. Wie ein kaltes Wesen hat sie mich von Anfang an ignoriert. Schlecht über mich gesprochen, obwohl ich direkt neben ihr stand. Mich missachtet, als wäre ich gar nicht da. Ignoranz und nicht miteinander zu reden, ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Nicht zu wissen, woran ich bei meinen Mitmenschen bin, bringt mich sofort dazu, zu glauben, ich selbst sei an allem Schuld. Ich sei dafür verantwortlich, dass ich nicht erwünscht bin«, stammelte ich. Dabei versuchte ich, krampfhaft zu überlegen, ob dieses Gefühl des Nichterwünschtseins ein Auslöser für meinen Zusammenbruch sein könnte. Ob ich dieses Gefühl vielleicht schon einmal erlebt hatte. Aber mir kam nichts in den Sinn, was mich in meiner Vergangenheit je so gedemütigt haben könnte. Jeder in der Gruppe hatte irgendwo einen Zusammenhang zu seinem Auslöser gefunden. Doch ich ruderte noch immer mit meinen Gedanken irgendwie auf offener, aber ruhiger See herum – ohne Land in Sicht. Wie ein Segelboot, welches auf den Wind wartete, um in die richtige Richtung getrieben zu werden. Es war kein Sturm, aber eben auch kein Hafen zu sehen. Ich spürte, wie sich meine Stirn in Falten legte. Stille herrschte im Raum und ich sah, wie die anderen mich abwartend anschauten. Sie warteten darauf, dass ich fortfuhr, aber sie gaben mir Zeit und drängten mich nicht. Dies hier war ein sicherer Raum.
»Ich denke …«, unterbrach die Therapeutin die Stille. »… Sie fangen mal bei dem Tag an, als Sie das Gefühl verspürten, etwas Entscheidendes hätte sich für Sie geändert.«
Ich war dankbar für ihren Vorschlag, denn er stellte für mich kein Problem dar. Ich wusste genau, wann es für mich anfing, bewusst so richtig scheiße zu werden. Einmal tief durchatmend hielt ich meinen Blick fest auf das Bild gerichtet, welches gegenüber an der Wand hing. Es war nicht viel zu sehen auf dem Bild, aber es schien mir Halt zu geben. Ich sah ein Meer und in der Ferne ein kleines Segelboot, welches den Anker gerade einzuholen schien, oder ging es an dieser Stelle vor Anker? Ich wusste es nicht, aber ich wusste, dass es ein schöner Gedanke war, am Meer zu sein. Beim Einatmen verleitete es mir das Gefühl von einer frischen, salzigen Ostseebrise.
»Es war vor zwei Jahren, als ich das erste Mal bewusst spürte, dass sich etwas zu ändern schien. An meinem vorherigen Arbeitsplatz, meine ich. Es war nicht unnormal, dass Kolleginnen kamen und gingen, aber es gab immer diesen einen festen Kern, der bereits seit vielen Jahren da war und zusammenhielt. Doch plötzlich kam es zu einer Unruhe, die alles durcheinanderwirbelte. Ich konnte nicht einmal sagen, woher es kam. Es wirkte auf mich so, als käme eine allgemeine Unzufriedenheit im Team auf. Vermutlich hatte es bei dem einen oder anderen schon länger, innerlich gebrodelt und letztendlich zur Kündigung geführt. Richtig festmachen kann ich es ehrlich gesagt nicht. In mir selbst war ebenfalls eine Unstimmigkeit zu spüren, aber ich wusste, woher es kam. Mir wurde es zu viel. Jeden Tag Überstunden und immer wieder musste ich mir anhören, dass ich unwirtschaftlich arbeiten würde. Dabei stimmte dies nicht. Bereits als ich mir diesen Vorwurf das erste Mal anhören musste, hatte ich begonnen, mir meinen eigenen Umsatz aufzuschreiben. Selbst mit den Kosten, die ich verursachte, sah ich mit eigenen Augen, dass ich gewinnbringend arbeitete. Aber das wollte natürlich keiner sehen. Im Gegenteil. Meine Behandlungszeiten wurden immer weiter gekürzt und der Druck immer größer. Dies war nicht nur bei mir so, sondern auch bei meinen Kolleginnen. So passierte es. Langjährige Kolleginnen kündigten, das Team bröckelte und fiel schließlich in sich zusammen. Die festen Säulen brachen plötzlich alle weg. Damals hatte ich das Gefühl, es würde nie aufhören. Zu Beginn des Jahres waren wir noch fast zwanzig Angestellte gewesen und am Ende nur noch neun. Aber das Rad drehte sich mit den wenigen Leuten genauso weiter, wie vorher auch. Es wurde immer mehr Leistung von uns gefordert. Eines Tages, bei einem Gespräch mit meiner damaligen Chefin, sagte diese mir, dass sie Ende des Jahres die Praxis verkaufen oder schließen würde. Ein Horror, aber ich schien es nur noch aufzunehmen und zu funktionieren. Ich ließ es nicht wirklich an mich ran. Es würde sich schon eine Lösung auftun, dachte ich damals. Und dann kam jener Albtraumtag, einfach so.« Ich hielt kurz inne, denn ich fühlte eine innerliche Enge. Das Bild vor mir wurde unklar. Tränen schossen mir in die Augen und ich ließ sie das erste Mal vor anderen kullern. Meine Hände wurden feucht. Ich zog eines meiner Knie eng an mich heran und schlang meine Arme darum. Ich spürte, wie Claudia mir über den Rücken strich. Es beruhigte mich und ich atmete tief durch. Mich nahm jener Tag damals noch immer sehr mit und es fiel mir schwer, zu unterscheiden, ob ich Wut, Traurigkeit oder Enttäuschung empfand.
»Es war ein Dienstagmorgen. Wir hatten unsere monatliche Teambesprechung und für uns als Team gab es nur ein Thema – wir wollten unserer Chefin klarmachen, dass wir dringend neue Kolleginnen brauchten, dass wir so nicht mehr weitermachen konnten. Zwar hatte unsere Chefin geplant, die Praxis zu verkaufen, aber sie wollte selbst als Angestellte noch weiter in der Praxis bleiben und es war auch geplant, dass wir, sollte es einen Nachfolger geben, auch übernommen werden sollten. Zudem lag diese Entscheidung noch einige Monate entfernt und es gab noch keine konkreten Aussagen. Daher planten wir erst einmal, dass es so weiterlaufen würde. Wir redeten auf sie ein, doch es wirkte so, als würde alles an ihr abprallen. Kein Wort sagte sie, aber ich sah, dass sie irgendetwas beschäftigte. In Folge fragte ich mich und sie, ob es sie gar nicht interessierte, wie es uns ging. Dass wir alle langsam in uns zusammenbrachen. Auch die anderen schienen das zu merken und es trat eine Stille ein, die mir die Luft zum Atmen nahm. Doch statt etwas zu erwidern oder unsere Sorgen überhaupt ernst zu nehmen, stand sie einfach auf und verließ den Raum. Wir saßen alle geschockt da. Ich stand als Erste völlig sauer auf, ging in mein Behandlungszimmer und knallte meine Tür zu.« Bei diesen Worten musste ich eine Pause einlegen, denn es übermannte mich ein Gefühl von Hass. Solch einen Hass hatte ich zuvor nicht gespürt, wann immer ich an jenen Tag zurückgedacht hatte. Ich erschrak etwas vor mir selbst, denn ich bemerkte, dass es sich anders anfühlte.
War dies schon ein Zeichen der Veränderung? War das wichtig, dass ich etwas fühlte? Die Veränderung erkannte? Fragen über Fragen füllten meine Gedanken aus, doch konnte ich sie laut stellen?
»Das klingt wie in einem schlechten Film«, flüsterte Klara und schüttelte den Kopf. Ich nickte, dabei konnte ich selbst kaum glauben, was ich gerade erzählt hatte und dass das alles wirklich so geschehen war. Ich fasste all meinen Mut zusammen, um auch noch den Rest zu erzählen.
»Ich habe versucht, mich zu beruhigen. Habe meinen ersten Patienten ins Zimmer gerufen und die professionelle Zahnreinigung durchgeführt. Allerdings war ich sehr schweigsam, denn mir liefen während der Behandlung die Tränen. Immer wieder musste ich sie heimlich wegwischen, hoffen, dass mein Patient sie nicht bemerkte und sich dadurch verunsichert fühlte. Es gelang mir zum Glück, fehlerfrei und schonend zu arbeiten. Ich war froh, dass mein Mundschutz und die Schutzbrille meine Gefühle versteckten. Einfach funktionieren war mein Tagesmotto. Die geschwollenen Augen erklärte ich damit, dass ich arge Allergieprobleme hätte, was die meisten auch einfach so hinnahmen. Ich war froh, dass ich an diesem Tag nur bis um halb vier arbeiten musste. Bereits vor der Mittagspause rief ich meinen Hausarzt an und bat um einen zeitnahen Termin. Vermutlich handelte ich aus dem Unterbewusstsein, aber ich wollte einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich wollte raus und eine Auszeit haben. Mir war es nicht einmal peinlich, am Telefon zu weinen. Ich riss mich noch bis zum Feierabend zusammen. Mein Abschied damals fiel sehr kurz aus. Bereits beim Umziehen spürte ich diesen Druck auf meinem Brustkorb. Er nahm mir nahezu die Luft zum Atmen. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals und ich verließ hastig die Praxis, um nicht weiter still zu weinen. Mit hängenden Schultern eilte ich zu meinem Auto, schloss es auf, setzte mich hinein und senkte meinen Kopf auf das Lenkrad. Ich musste bitterlich weinen und zitterte dabei am ganzen Körper. So was hatte ich bisher körperlich von mir nicht gekannt. Nicht diese Reaktion und schon gar nicht in dieser Heftigkeit. In jenem Moment entschied ich: Da gehe ich nie wieder hin. Ich konnte nicht mehr, war von den letzten Wochen emotional und körperlich vollends erschöpft. Ich wollte das alles nicht mehr. Ich hasste meinen Job. Und genau das waren meine Gedanken, die ich meiner Mutter wenige Minuten später am Telefon mitteilte, ehe ich auflegte.« In diesem Moment, während ich in der Runde der Gruppentherapie saß, überkam mich das gleiche Gefühl wie damals im Auto, aber irgendwie war es heute sanfter. Wie eine Erinnerung an den Schmerz, aber ohne das Grauen darin. Ich weinte und spürte, dass ich innerlich zitterte. Jedoch fühlte es sich anders an als damals. Eine Last fiel von mir ab. Auch wenn ich damals ebenfalls darüber gesprochen hatte, war es dieses Mal anders. Es war ein Unterschied, ob jemand nur zuhörte oder ob dieser Jemand auch verstand, was in mir vorging. Ratschläge waren genau das, was ich damals nicht hatte hören wollen. Jedenfalls nicht von Menschen, die nicht einmal erahnen konnten, was mich heruntergezogen hatte. Wie es tief in mir drin ausgesehen hatte.
»Wollten Sie Ihrem Leben ein Ende setzen?«, hakte die Therapeutin vorsichtig, aber bestimmt nach.
»Nein«, erwiderte ich sofort und vehement. Mich wunderte diese Frage nicht, denn es war die gleiche, die mein Hausarzt mir damals auch zuerst gestellt hatte. Sie war nicht unberechtigt, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, Selbstmord zu begehen. Ich wollte leben – so unbedingt –, aber dabei glücklich und zufrieden sein. Das verdiente ich.
»Ich wollte einfach nicht mehr zur Arbeit. Mein Arbeitsplatz damals brachte mir kein Gefühl mehr von Freude, Spaß oder Glück. Dabei liebe ich meine Arbeit am Patienten sehr, aber damals zu dem Zeitpunkt, schlug es mir nur noch auf den Magen. Ich behielt nichts mehr zu essen drin. Selbst, wenn ich das Essen in mich hineinzwang, übergab ich mich kurz danach wieder. Zwar steckte ich mir nicht den Finger in den Hals, es war eher der heftige Druck im Magen, der dazu führte, dass ich wenige Minuten nach dem Essen mich übergab. Der Appetit war nicht richtig da. Als ich mich beruhigt hatte, bin ich zum Arzt gefahren und habe mit ihm darüber gesprochen. Er sagte mir, dass er mir empfehlen würde, mir professionelle Hilfe zu nehmen. Dass es so nicht weitergehen könnte. Dass es mich innerlich kaputt machte.«
»Hast du dann gleich versucht, einen Termin auszumachen?«, fragte Maik und schaute mich mit einem liebevollen Blick an.
»Nein, ich habe das erst einmal sacken lassen und bin zu meinen Eltern gefahren. Mein Hausarzt hatte mich für zwei Wochen krankgeschrieben. In dieser Zeit sollte ich erst einmal wieder zu mir selbst finden, zur Ruhe kommen und mich neu fokussieren. Dinge tun, die mir Freude bereiten, und mir dann aber auch klar darüber werden, was ich wirklich will in meinem Leben«, erklärte ich. Dabei spürte ich, dass ich wieder ruhiger wurde, und atmete tief durch. Mit meinen eiskalten und feuchten Händen wischte ich mir die Tränen von den Wangen, die langsam versiegten.
»Und die Gedanken hast du dir gemacht?«, hakte Maik nach.
»Ja, mir war irgendwie klar, dass ich meinen Job ja eigentlich gerne mache, aber ich dort so nicht mehr arbeiten wollte. Nach den zwei Wochen dachte ich mir, es ist doch nur ein Job. Abarbeiten und danach Arsch lecken, aber das klappte auch nur die ersten zwei Stunden und dann habe ich beschlossen, dass ich da raus muss. Und zwar so schnell wie möglich. Zu meiner Überraschung konnte ich die Praxis rasch wechseln, fühlte mich zunehmend zufriedener, aber ich bin nicht glücklich und irgendwas passt nicht. Leider macht mir die eine Kollegin das Leben echt schwer dort, was mich so unglücklich macht. Vielleicht sehe ich es auch nur so eng, weil es mir seelisch nicht gut geht. Vermutlich ist es das Gesamtpaket, was für mich nicht passt. Ich fühle mich dort nicht wohl«, gestand ich und blickte in die Runde.
»Und warum?«, fragte die Therapeutin. Sie schien dem Ganzen nachgehen zu wollen, aber ich zuckte nur mit den Schultern. Ich hatte keine Antwort darauf und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich grübelte, starrte wieder nur zur gegenüberliegenden Wand, blickte ab und an in die Runde und versuchte, einfach zu atmen. Ich spürte, dass es irgendwas Verborgenes gab, aber ich wusste nicht weiter. Stille breitete sich im Raum aus, alle schienen nachzudenken.
»Hast du vielleicht so ein Gefühl schon einmal in deinem Leben gehabt?«, fragte Maik. Er schien der Sache auf den Grund gehen zu wollen und genau das, war das, wovor ich Bedenken hatte. Würde etwas Verborgenes aufgedeckt werden?
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Warst du schon einmal in deinem Leben so traurig?« Maik schien auf Spurensuche gehen zu wollen. Ich schloss meine Augen und kramte gedanklich in meinen Erinnerungen, aber nichts in meiner Vergangenheit ließ mich an diesen gleichen Punkt bringen. Verdrängte ich innerlich etwas? War es vielleicht ein Gefühl, was nur so ähnlich war, wie dieses beim Zusammenbruch? Musste ich vielleicht an etwas anderes denken, außer an meinen Arbeitsbereich? Im Stillen dachte ich darüber nach, aber mir fiel keine Situation ein, in der ich mich schon einmal so gefühlt hatte. Ich zuckte mit den Schultern und schaute Maik ein wenig ratlos an. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. In meinem Kopf wirbelten die Gedanken herum. Ich ließ meinen Blick durch den Raum schweifen und blieb bei Maik hängen. Er schaute mich direkt an. Als dieser plötzlich die Stille brach, zuckte ich zusammen.
Die Wurzel allen Übels des Problems
»Hattest du das Gefühl, jemand wolle dir etwas wegnehmen?«, fragte er. Verwundert über diese Frage, schaute ich Maik an. Ich begann unbewusst meine Hände zu kneten, als ich dies wahrnahm. Dies tat ich öfters, wenn ich nervös wurde oder angestrengt nachdachte. Gedanklich kramte ich in meinen Erinnerungen und versuchte etwas zu finden, ob mir jemand vielleicht etwas weggenommen hatte. Es musste ja nicht zwingend ein Gegenstand sein. War es vielleicht auch eine Person, die nicht mehr da war? Oder ein Gefühl? Verzweifelt schaute ich meine Therapeutin an.
»Das ist eine gute Frage«, stimmte die Therapeutin zu und ich überlegte erneut krampfhaft, ob es stimmte. Ob mir jemand etwas weggenommen hatte.
»Oder hast du dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, irgendwie schon einmal erlebt?«, hakte Maik weiter nach, als ich nicht antwortete und brachte mich weiter ins Grübeln. Im Stillen fragte ich mich, ob ich schon einmal in so eine Lage geraten war. Ob ich solch ein Gefühl der inneren Zerrissenheit bereits erlebt hatte, als ich plötzlich bei einer Erinnerung hängen blieb. Ich wollte schon tiefer dringen, doch es wirkte zu absurd, denn es war zehn Jahre her und stammte aus einem völlig anderen Bereich – es ging um die Liebe meines Lebens.
»Die Trennung von meinem Ex hat mich innerlich sehr entzweigerissen und mich völlig aus der Bahn geworfen, aber das hat ja nichts mit der Arbeit zu tun, oder? Die beiden Sachen liegen Jahre auseinander.« Ich blickte fragend in die Runde und schaute Frau Weber, meine Therapeutin, hilfesuchend an.
»Oft liegt die Wurzel des Problems weit in der Vergangenheit vergraben. Ein Burnout kommt nicht von heute auf morgen. Erzählen Sie uns doch einfach, was damals passiert ist? Es könnte Ihnen helfen, die Dinge und Vernetzungen klarer zu sehen. Und vielleicht fällt Ihnen dabei auch etwas auf, was als Warnsignal von Ihrem Körper ausgehend in Erscheinung getreten ist, bisher nur nicht von Ihnen als solches wahrgenommen wurde«, erklärte sie weiterhin. Es klang irgendwie logisch. Eigentlich wollte ich nie wieder darüber sprechen, denn er – meine große Liebe – hatte mir damals das Herz gebrochen. Doch ich wollte meinem Problem auf den Grund gehen, damit ich es endlich in die Hand nehmen und nach vorne blicken konnte. Vielleicht gab es eine Verbindung zwischen den beiden Ereignissen.
»Vor einigen Jahren lernte ich Leon im Urlaub kennen. Es funkte sofort zwischen uns und wir sind zusammengekommen. Er war der erste Mann, den ich wirklich sehr geliebt habe. Leider lebten wir beide weit voneinander entfernt und mussten eine Fernbeziehung führen. Wir konnten uns nur an den Wochenenden sehen. Es hat mir jedes Mal das Herz zerrissen, wenn er wieder nach Hause gefahren ist. Da Leon in einer WG wohnte, kam er lieber zu mir, damit wir die Zeit alleine genießen konnten. Zwar hatte er ein eigenes Zimmer gehabt, aber Bad und Küche teilte er sich mit drei anderen Mitbewohnern. Dies war mir zu viel. Ein Gefühl, was ich