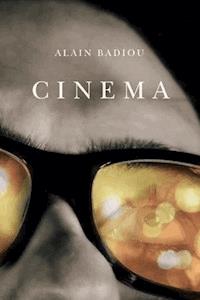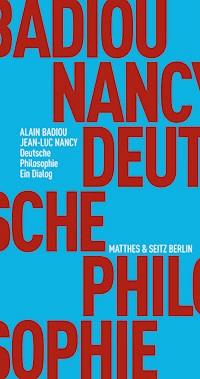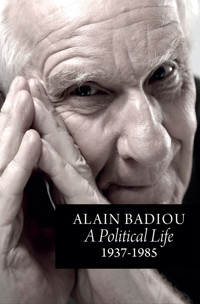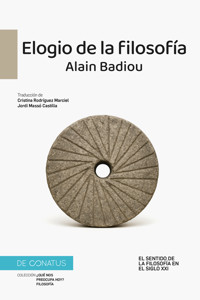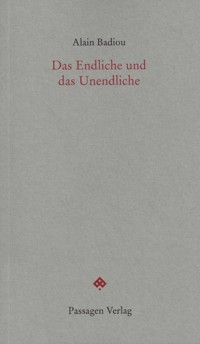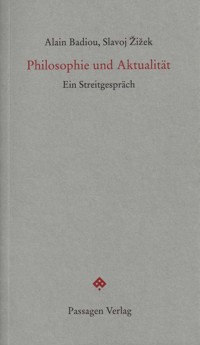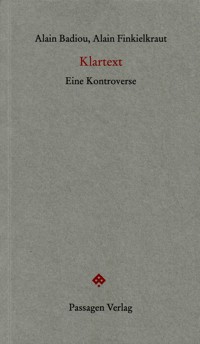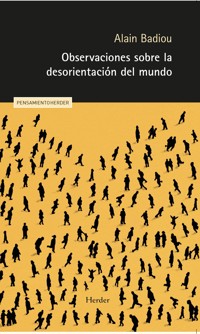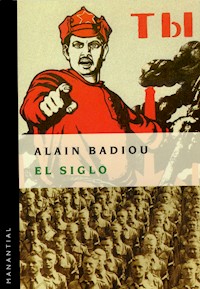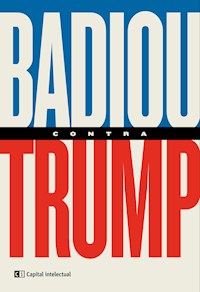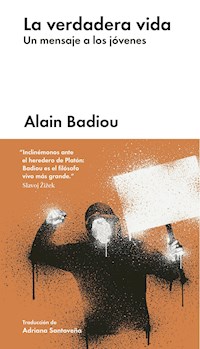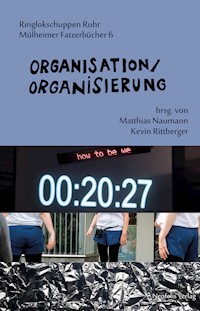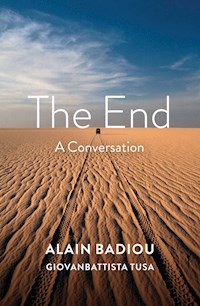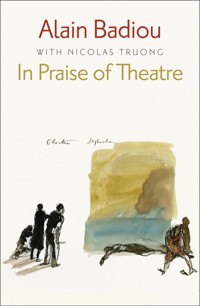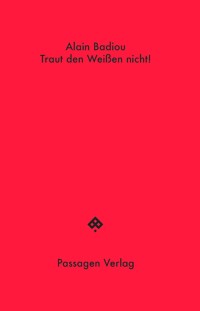
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passagen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alain Badiou untersucht in Auseinandersetzung mit philosophischen, politischen und dichterischen Texten – unter anderem Derridas Von der Gastfreundschaft und Chamoiseaus Migranten –, wie es aktuell um die Sache des universalen nomadischen Proletariats steht. Ausgehend von dem französischen Phänomen der Gelbwesten und der Arroganz der Politikerkaste rückt Badiou den Gedanken in den Mittelpunkt, dass die Welt unsere Heimat ist und dass die sogenannten Migranten eine zentrale Rolle in der Gegenwartspolitik spielen. Das Ertrinken im Mittelmeer, die Festnahmen und Abschiebungen dürfen nicht länger geduldet werden. Gemeinsam mit dem universalen nomadischen Proletariat muss an einer Ethik des Welt-Lebens gearbeitet werden, an dem, was Badiou den neuen Kommunismus nennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alain Badiou
Traut den Weißen nicht!
Inhalt
Vorbemerkung
Haupttext
Anmerkungen
An die Schwelle zu diesem Buch stelle ich ein „madagassisches Lied“, das 1783 von Évariste de Parny geschrieben wurde, der dabei, wie es scheint, auf madagassische Überlieferungen zurückgegriffen hat. Es zeigt, und das ist eine gute Nachricht, dass ein radikaler, ja sogar gewalttätiger Antikolonialismus ebenso alt wie der Kolonialismus ist. Ravel, selbst ein wahrer Progressist, der insbesondere die Bolschewiken unterstützte, hat diesem Text 1926 eine herrliche Melodie gegeben.
A. B.
Trauet den Weißen nicht,
ihr Bewohner des Ufers!
In den Zeiten unsrer Väter
landeten die Weißen auf dieser Insel.
Man sagte zu ihnen: da ist das Land,
eure Frauen mögen es bauen;
seid gerecht, seid gut,
und werdet unsere Brüder.
Die Weißen versprachen, und dennoch
warfen sie Schanzen auf.
Eine drohende Festung erhob sich;
der Donner ward in eherne Schlünde gesperrt;
ihre Priester wollten uns
einen Gott geben, den wir nicht kennen;
sie sprachen endlich
von Gehorsam und Sklaverei.
Eher der Tod!
Lang und schrecklich war das Gemetzel;
aber trotz den Donnern, die sie ausströmten,
die ganze Heere zermalmten,
wurde sie alle vernichtet.
Trauet den Weißen nicht!
Neue, stärkere und zahlreichere Tyrannen
haben wir ihre Fahne am Ufer pflanzen gesehn.
Der Himmel hat für uns gefochten.
Regengüsse, Ungewitter und vergiftete Winde
sandt’ er über sie, sie sind nicht mehr,
und wir leben und leben frei.
Trauet den Weißen nicht,
ihr Bewohner des Ufers.1
In gewissen Situationen scheint eine Frage eine andere zum Verschwinden bringen zu können, die gerade noch als die wichtigste erschien.
Wir alle wissen, dass die sogenannte Immigrationsfrage – die Frage der Migranten, der Ausländer, der Flüchtlinge – noch vor kurzer Zeit die öffentliche Meinung in Frankreich, in Europa und schließlich in der gesamten sogenannten westlichen Welt, das heißt in der Gesamtheit der privilegierten Länder unseres Planeten, spaltete und heftig spaltete. Man könnte behaupten, dass seit ein paar mageren Wochen die Frage der sogenannten Gelbwesten in Frankreich die sogenannte „Migrantenfrage“, was die Äußerungen des Entsetzens und der Begeisterung in der öffentlichen Meinung angeht, ersetzt habe.
Nun ist aber die Frage der Gelbwesten in gewisser Weise das genaue Gegenteil der Frage der sogenannten „Migranten“. Es handelt sich nämlich um das Schicksal des alten Frankreichs, das bedroht ist. Zuerst sind da die französischen Angestellten auf der untersten Ebene – Handwerker, Händler, kleine Chefs und Bauern –, die sich gegen das offensichtliche Schwinden ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihres Einkommens auflehnen, die Angst haben und wütend sind über das geringe Interesse, das man ihnen entgegenbringt, über die Verachtung, die die transnationale Oligarchie, die heute an den Schalthebeln des globalen Kapitalismus sitzt, ihnen zollt. Es handelt sich um ein Aufbegehren der Regionen und Landkreise, der schrumpfenden Städte der Provinz, der Welt der Jäger und der Gemeinderäte. Es gibt aber auch ein großes vorstädtisches Kleinbürgertum und namentlich eine große Anzahl an Rentnern, die am Ende ihrer schwierigen Monate das Gespenst der Verarmung, der Proletarisierung umgehen sehen. Es handelt sich um jene Welt, die erlebt und ausspricht, dass sie von den Staatsmächten – Mächten, die selbst im Dienste der Mächte des Kapitals stehen – in einem sehr spürbaren Sinne aufgegeben worden ist. An dieser Aufgabe, dieser Verlassenheit lässt sich auch der schleichende erdgeschichtliche Niedergang ablesen, in dem sich heute Europa und die Welt, die sich westlich und demokratisch nennt, dahinschleppen. Die Aufgabe und Verlassenheit einer alten, provinziellen, alternden, vorstädtischen und kolonialen Welt, die den jungen Schnöseln aus den Wirtschaftshochschulen, der Sciences Po oder der ENA, deren Prototyp Macron ist, herzlich gleichgültig ist.2
So stehen sich eine globalisierte Moderne, in Gestalt einer arroganten und letztlich kriminellen kapitalistischen Oligarchie, und der Archaismus einer landesweiten und umfassenden Reaktion gegenüber, die von jenem Teil der Gesellschaft vorangetrieben wird, der durch die Entfaltung des zeitgenössischen Kapitalismus in dem bedroht wird, was lange Zeit seine kleinen Privilegien waren. Frankreich – ein im Vergleich zu den Ungeheuern vom Typ der Vereinigten Staaten oder Chinas kleines und im Niedergang begriffenes Reich – kann die Unterstützung der unteren Mittelschichten, die immer das waren, worauf sich unsere berühmten „Demokratien“ im Wesentlichen stützten, nicht länger zu einem vernünftigen Preis – in Form von Gehältern, öffentlichen Dienstleitungen und „sozialen Vergünstigungen“ – erkaufen.
Wir stehen also auf der einen Seite unvermeidlicher Weise einem Staat gegenüber, der den Erfordernissen des Weltmarktes und einer Handvoll Milliardäre unterworfen ist, und auf der anderen Seite einer Protestbewegung, die zwar aus dem Volk zu kommen scheint, deren politische Vision aber undeutlich, schüchtern (man gelangt nicht zum Kern der Frage, das heißt zur Frage nach dem Privateigentum der Produktionsmittel und der internationalen Konkurrenz), nationalistisch (in einer Zeit, in der Frankreich ein zukunftsloses Gebilde ist) und aus falschen Gerüchten gestrickt ist. Der einzige wirklich auf der parlamentarischen Bühne organisierte Teil dieser Bewegung ist die extreme Rechte.
Diese Art Konflikt hat rein gar nichts anzubieten, das tragfähig wäre, nichts, das uns über das hinaustragen könnte, was in der Wiederholung der Herrschaftsstrukturen verharrt. Das ist der Preis, der dafür zu zahlen ist, dass in diesem schlecht ausgerichteten Konflikt, der unsere aktuelle Sorge ausmacht, der einzige andere mögliche Weg – der einzige Weg, der zugleich modern und egalitär ist, der kommunistische Weg – beinahe abwesend ist. Ich nenne ihn bei seinem Namen, denn ich habe niemals einen anderen finden können, trotz der drängenden, von überall herkommenden Aufforderungen, dieses medial verruchte Wort nicht zu verwenden.
Egal welches Interesse man für diese eng umgrenzte nationale Situation und für die Risiken hegt, die sich in einem Konflikt zwischen zwei Protagonisten ausmachen lassen, die weder politische Konsistenz haben noch Träger einer egalitären Zukunft sind, wir müssen zumindest am intrinsischen Internationalismus jeder affirmativen und neuen politischen Vision festhalten. Wir müssen die Tatsache betonen, dass die Kulisse des alten Frankreichs der Vergangenheit angehört, und an der Überzeugung festhalten, dass alles, was heute wirklich wichtig ist, in der Einsicht liegt, dass am Ausgangspunkt unseres Denkens die Welt, die gesamte Welt stehen muss. Denn der Aphorismus, demzufolge die „Arbeiter kein Vaterland haben“3, ist heute noch wahrer, als er es zu Marx’ Zeiten war. Das bedeutet, dass die Welt unser Vaterland ist und dass unsere Landsleute die arbeitenden Menschen in ihrer gesamten Diversität sind.
Das bringt uns sogleich zu den sogenannten „Migranten“ zurück, die die Ankunft und die Anwesenheit von dieser unendlichen Diversität sind, von all dem, was von anderswo herkommt; sie sind das Zeichen dafür – da unser Vaterland das ihre wird, ohne dass ihr Ursprung ausgelöscht würde –, dass wir („wir“: die kommunistische Politik unserer Zeit) uns auch in Richtung der Ausgebürgerten ausbürgern müssen und mit ihnen kein anderes politisches Vaterland4 haben als das, das unser gemeinsames Werk verlangt.
Ich möchte den Ausgebürgerten sogleich das Wort erteilen, in Bezug auf das Wort „Migrant“. Es handelt sich um eine Deklaration, die ein noch Minderjähriger gemacht hat, der vor kurzem mit einigen anderen aus Guinea hier angekommen ist. Wir werden nicht mehr über ihn sagen, aus Vorsicht. Er hat Folgendes über das Wort gesagt, das uns hier beschäftigt:
Das Wort „Migrant“, ich sage mir, dass das Wörter sind, die nur geschaffen wurden, um die Personen zu verletzen, die den wahren Sinn des Wortes verstehen. Ansonsten, warum verwendet man nicht die Wörter, die schon da sind, und sagt „die Ausländer“? Denn wir, in unserem Land, wenn du Franzose bist, sagt man nicht „ein Migrant“. Auf jeden Fall ist er nicht mehr in seinem Land. Er ist in einem fremden Land. Aber wir sagen: „Er ist Franzose.“ Nur um einen Unterschied zu den Guineern zu machen. Man sagt: „Der, der ist Europäer. Der ist Franzose, der ist Engländer, der ist Spanier.“ Man bezeichnet ihn nach seinem Vaterland. Man sagt nicht, dass er ein „Auswanderer“ ist. Man sagt nicht, dass er ein „Migrant“ ist. Man sagt nicht, dass er ein „Flüchtling“ ist. Selbst wenn du ein politischer Flüchtling bist, denn früher gab es Kriege in der Unterregion von Westafrika. Alle Personen aus diesen Ländern sind nach Guinea geflüchtet, aber man hat sie nicht „Flüchtlinge“ genannt. Das sind Wörter, die von bestimmten Personen verwendet werden, aber die die Mehrheit der Leute nicht verwendet. Das heißt, man sagt: „Das sind Leoner“ oder „das sind Liberianer“, ganz einfach. Man braucht nicht sagen, dass das „Flüchtlinge“ oder „Migranten“ sind. Ich glaube, dass das Wort „Migrant“ nur für uns Afrikaner ist, weil das Wort „Migrant“ hört man, seit die Leute begonnen haben, übers Mittelmeer von Afrika nach Europa zu kommen.
Ich sehe mich nicht sonderlich als „Migrant“. Alle Personen, die „Migranten“ sagen, tun das, weil sie nicht richtig die eigentliche Bedeutung des Worts verstehen. Das heißt, ich sage mir, dass „Migrant“ für Tiere ist. Tiere migrieren.5 Das ist eine Beobachtung. Man sagt: „Die Migration der Tiere hat zu soundso geführt.“ Ich sage mir, dass das Wort „Migrant“ nicht für Leute verwendet werden sollte, die ihr Land verlassen haben, um nicht misshandelt zu werden. Es gibt diese Leute, die aus ihrem Land flüchten konnten, weil die Dinge schlecht standen, das Wirtschaftsproblem. Man kann sie „Flüchtlinge“ nennen. Aber selbst das Wort „Flüchtling“, ich finde nicht, dass es für einen Menschen angemessen ist.
Ich würde den Leuten, die sich als „Migranten“ ansehen, gerne sagen, dass sie sich nur sagen brauchen, dass sie Fremde sind. Mit diesem Wort bin ich einverstanden, weil es nicht dein Vaterland ist. Ja, du bist ein Fremder. Wenn du ein Fremder bist, bist du ein Fremder. Aber was auch deine Natur ist, man darf nicht hinnehmen, dass man dich „Migrant“ schimpft. Das Wort „Migrant“ ist nur, um das Herz der Leute zu erhitzen. Das ist nur, um sie zu verachten. Das ist alles. Man hat noch nie einem Weißen gesagt: „Migrant“. Nie im Leben! Das heißt, normalerweise dürfte es das Wort „Migrant“ heute nicht geben. Das Wort „Migrant“ ist nur für die Schwarzen, die Afrika verlassen, um nach Europa zu gelangen.6
Wenn man diese starke Deklaration hört, könnte man denken, dass der Fall bereits abgeschlossen ist, dass das Wort „Migrant“ verurteilt worden ist. Doch die Geschichte von all dem ist viel komplizierter.
Erinnern wir zuerst an ein paar Tatsachen, die oft vergessen werden. Sie betreffen die Geschichte der Ankunft und der Ansiedelung von mehreren Millionen Ausländern in Frankreich, die heute in unseren Städten oft auf drei Generationen verteilt leben. Man kann mehrere Momente klar unterscheiden:
– Von den 1950er- bis zu den 1970er-Jahren muss die in vollem Wiederaufbau und Aufschwung befindliche französische Industrie unbedingt Arbeitskräfte importieren, weil diese nicht mehr in ausreichender Menge durch Landflucht und Zuzug in die Städte zur Verfügung stehen. Man holt Arbeiter mit dem Flugzeug aus dem ganzen Maghreb und dann aus Subsahara-Afrika. Mehr als eine Million Portugiesen kommt nach Frankreich zum Arbeiten. Man spricht nicht von Einwanderung als einem Problem, man spricht von Arbeitern. Man baut in den Städten zahlreiche „Arbeiterheime“, um diese Arbeitskraft zu beherbergen. All das wird von der Tatsache unterstützt, dass der französische Kapitalismus weitgehend ein Staatskapitalismus ist. Die berühmten Fabriken wie Renault-Billancourt sind Staatseigentum. Ganze Sektoren der Energie-, Transport- und Kommunikationsindustrie sind verstaatlicht. Die Banque de France genießt keinerlei Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, und zahlreiche Banken sind verstaatlicht. Als Ergebnis von all dem konnte man in der Organisation, der ich am Ende der 1960er-Jahren angehörte, vom „internationalen Proletariat Frankreichs“ sprechen.
– Seit dem Ende der 1970er-Jahre und dem Anfang der 1980er-Jahre beginnt als Wirkung des Drucks des Weltmarkts auf ein verkleinertes imperiales Frankreich der Abbau des staatsmonopolistischen Kapitalismus, der unser Land kennzeichnete. Dieser Moment der Privatisierung wird tatsächlich von einer massiven Desindustrialisierung begleitet. Mit dem Verschwinden der großen Fabriken verändert sich die Bevölkerung und das Erscheinungsbild des Umlands der großen Städte völlig. Man beginnt damals, nicht mehr von Arbeitern, sondern von Immigranten zu sprechen. Und damit beginnt eine ungewisse Zeit, was das Schicksal der Arbeiterschaft in den alten Vorstädten betrifft. Die herrschende und offizielle Vorstellung in Bezug auf die sogenannten „Immigranten“ ist, dass sie keine Bewohner dieses Landes wie die anderen sind, ja nicht sein können, und nicht dieselben Rechte haben. Es entsteht ein Streit darüber, ob ein paar Regularisierungen ausreichen oder ob strengere Dispositive, die eine regelrechte Segregation skizzieren, anzuwenden sind.
– Von den 1990er-Jahren bis heute macht eine regelrechte ideologische Gegenrevolution die Immigranten und die Immigration zu einem angeblich großen politischen „Problem“. Nun erscheint nach „Arbeiter“ und „Immigrant“ das Wort „Migrant“. Die nationalistische und faschistoide Thematik des Fremden als Bedrohung für die Identität zeigt sich rege wie in den 1930er-Jahren. Man schreckt nicht davor zurück, die Situation als die einer Invasion unserer zivilisierten Länder durch Horden darzustellen, durch Horden von „Migranten“, zum Beispiel durch Horden von „Roma“. Die moslemische Religion wird als eine barbarische Gefahr angesehen. Man schließt die Arbeiterheime, man unterstellt die Jugend der Vorstadtviertel einer polizeilichen Kontrolle, man macht Delogierungen zur Norm, die Erlangung eines Aufenthaltstitels wird zu einem Kreuzweg, man lässt Tausende der sogenannten „Migranten“ im Mittelmeer ertrinken, man beschließt neue ruchlose Gesetze, die es auch noch auf die Bekleidungs- und Ernährungsgewohnheiten der Betroffenen abgesehen haben.
Somit haben die Stellungnahmen zur Frage der Menschen fremder Herkunft, die Teil des internationalen Proletariats Frankreichs waren und weiterhin sein wollen, die Stellungnahmen zu jenen, die wir auf Baustellen sehen, bei der Müllabfuhr, in Restaurants, als Reinigungskräfte, als Installateure, im Gastgewerbe, bei den großen Wein-, Gemüse- oder Obsternten, in der Altenbetreuung, in der Kinder- und Hausbetreuung, ja, all das, was man von ihnen hält, was man im Hinblick auf sie sagt und tut, all das hat langsam eine ideologische Grenze gezogen, ist langsam ein wesentliches Motiv der Spaltung und des Kampfes in unserer im Niedergang befindlichen Gesellschaft geworden, die aber nichts davon wissen und keine entschlossenen und umgreifenden politischen Konsequenzen daraus ziehen will.
Hinsichtlich des schlechten Wortes „Migrant“ gibt es eine Entscheidung, der man sich nicht entziehen kann. Es gibt eine Trennlinie, ein ambivalentes Anliegen, einen Moment, in dem ich mich zwischen Untätigkeit und Tätigkeit entscheiden muss, und auch zwischen meiner stabilen Identität und der Provokation, die die Ankunft des anderen, sein Beharren darauf, hier zu sein und meine Brüderlichkeit zu erbitten, für diese Identität darstellt.
All das, um das schlechte Wort „Migrant“ herum.
Der große Schriftsteller Patrick Chamoiseau hat in einem bestimmten Sinn dieses schlechte Wort aufgegriffen und mit Poesie erfüllt, und zwar in dem Essay mit dem Titel Migranten. Er weist von Anfang dieses Buches an darauf hin, dass es sich darum handelt, von einer Sache zu sprechen, die gleichsam erbarmungslos ist, die verlangt, dass man handelt. Er sagt Folgendes: