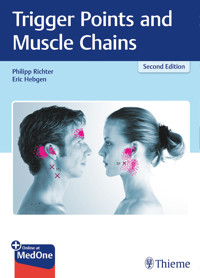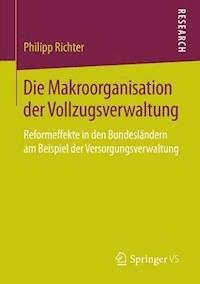89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Diagnose und Therapie myofaszialer Triggerpunkte sowie verschiedene Erklärungsmodelle der Muskelfunktionsketten für die tägliche Praxis.
In diesem Buch finden Sie relevante Informationen über Muskulatur, Muskelketten und Triggerpunkte, die Sie für den Praxisalltag benötigen. Erklärungen zur Entstehung von Schmerzen am Bewegungsapparat erleichtern Ihnen die Diagnose. Die Behandlungsmethoden der myofaszialen Strukturen werden durch Dehnungsübungen ergänzt. Anatomische Zeichnungen und zahlreiche Fotos helfen Ihnen bei der Lokalisation der Triggerpunkte und ihrer zugehörigen Schmerzareale.
Neu in dieser Auflage ist die Erklärung eines weiteren Muskelkettenmodells und über 40 neue Eigenübungen für den Patienten.
Ein äußerst gelungenes Werk, eine gute Mischung aus Hintergrundinformationen und praxisrelevanten Themen, welche nicht nur osteopathisch interessierte Leser begeistern wird. (physiopraxis)
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform Osteothek zur Verfügung (Zugangscode im Buch).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Triggerpunkte und Muskelfunktionsketten
in der Osteopathie und Manuellen Therapie
Philipp Richter, Eric Hebgen
5. aktualisierte und erweiterte Auflage
344 Abbildungen
Die Autoren
Philipp Richter D.O., geb. 1960.
Studium der Physiotherapie in Lüttich (Belgien) mit Abschluss
1981. Osteopathieausbildung an der A. T. Still
Academy in Paris mit Abschluss 1991.
Tätigkeiten:
1981–1989 niedergelassen in eigener Physiotherapiepraxis
in Thommen, Belgien.
Seit 1989 niedergelassen in eigener Osteopathiepraxis,
ebenfalls in Thommen, Belgien.
Seit 1997 Dozententätigkeit am Institut für angewandte
Osteopathie (IFAO).
Eric Hebgen D.O. M.R.O., geb. 1966.
1987-1990 Studium der Humanmedizin (1. Staatsexamen)
in Bonn.
1990-1992 Krankengymnastikausbildung an der
Eva-Hüser-Schule in Bad Rothenfelde.
1995-2000 Osteopathieausbildung am Institut für angewandte
Osteopathie (IFAO) in Düsseldorf.
2000-2001 Diplomarbeit der Osteopathie mit Verleihung
des Titels „D.O.“ im September 2001.
2002 Heilpraktikerprüfung.
Tätigkeiten:
1992-1993 St. Josef Krankenhaus in Koblenz.
1993-1997 Lehrkraft an der Physiotherapieschule des
St. Josef Krankenhaus.
Seit 1993 eigene Krankengymnastikpraxis in Dierdorf
(Fortbildungen in Manueller Therapie
nach DGMM (Diplom); Brüggertherapeut
nach Murnauer Konzept).
2000-2016
Dozententätigkeit am IFAO, verantwortlicher Dozent für das Fach „Viszeralosteopathie“
Seit 2002
Praxis für Osteopathie in Königswinter-Vinxel.
Seit 2011
Leiter und Inhaber des Vinxel Institute of Osteopathy (VXIO)
Dozent des VXIO in Deutschland, Schweiz, Ungarn, Kanada u.a.
Vorwort zur 3. Auflage
Fünf Jahre ist es her, dass wir das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, in der Erstauflage veröffentlicht haben. Der große Erfolg des Buches, auch international, war überraschend und hat uns gezeigt, wie wichtig und richtig es war, dieses Buch zu schreiben. In der nun vorliegenden 3. Auflage haben wir zwei Ergänzungen vorgenommen. Zum einen haben wir das Kapitel über die Statik deutlich erweitert. Statische Störungen werden häufig als potenzielle Ursache für Funktionsstörungen des Bewegungsapparates und insbesondere der Wirbelsäule übersehen. Schon A. T. Still war überzeugt, dass Fehlfunktionen des Bewegungsapparates und insbesondere der Wirbelsäule die Ursache für alle körperlichen Leiden sind. Eine Erweiterung dieses Kapitels scheint uns der Bedeutung des Themas gerecht zu werden. Im Teil über die Triggerpunkte haben wir Dehnungsübungen eingefügt. Dehnungen stellen die eigentliche Behandlung der Triggerpunkte dar. Hier kann der Patient in hervorragender Weise in die Behandlung mit einbezogen werden, indem er einfache Dehnübungen als „Hausaufgabe" aufgetragen bekommt. Wichtig ist es dabei, dass die Übungen einfach zu erlernen sind, denn dadurch erhöht sich die Akzeptanz dieser Hausaufgabe und bei schnellem Erfolg auch die Einsicht in die Notwendigkeit der Mitarbeit am Behandlungserfolg. Es konnte in dieser Auflage auch eine Vereinheitlichung in der Schreibweise der anatomischen Bezeichnungen erreicht werden, was die Strukturierung des Buchs noch einmal verbessert hat. Unser Dank hierfür und für die redaktionelle Überarbeitung des gesamten Textes gebührt der Redakteurin Frau Dr. Stefanie von Pfeil.
Königswinter und Burg Reuland (Belgien), im Juli 2011
Eric Hebgen, Philipp Richter
Vorwort zur 1. Auflage
Die Idee zu diesem Buch ist bereits vor mehreren Jahren entstanden. Praktische Erfahrungen, die Lektüre von Fachliteratur, der Besuch von Seminaren und das Fachsimpeln mit Kollegen und Spezialisten aus anderen Disziplinen haben uns die Bedeutung des Bewegungsapparats jedes Mal aufs Neue gezeigt. Der Praxisalltag zeigte uns im Laufe der Jahre, dass häufig die gleichen Läsionsmuster immer wieder auftreten. Nach jahrelangen intensiven Beobachtungen und Untersuchungen sowie gründlichen Literaturrecherchen konnten wir uns vergewissern, dass unsere Beobachtungen der Realität entsprechen und kein Wunschdenken sind. Sowohl Osteopathen als auch Posturologen und Manualtherapeuten sprechen von Bewegungsmustern, wobei es verschiedene Erklärungsmodelle für die Entstehung dieser Muster gibt. In einem Lehrgang über Muskelenergietechniken sprachen sowohl Dr. F. L. Mitchell jr. als auch Dr. Ph. Greenman von einem universellen Muster (Pattern). Beide sind der Meinung, dass es ein allgemeines Muster geben muss, da bei Dysfunktionen des Bewegungsapparats andere Körperbereiche sich durch immer dieselben Muster anpassen. In der Physiologie folgt der gesamte Organismus ebenfalls bestimmten Mustern; als Beispiele seien Bewegungsabläufe wie der Gang oder die Atmung erwähnt. Der gemeinsame embryologische Ursprung aller Gewebe, die bindegewebli-chen Verbindungen und der Organismus als hydropneumatisches System sprechen für diese Theorie. Das endokrine System ist ebenfalls ein gutes Beispiel für ganzheitliches Verhalten. Das dem Osteopathen so wertvolle Ganzheitsprinzip sowie embryologische, physiologische und neurologische Grundsätze geben Erklärungen für die Entstehung bestimmter Muster. Unserer Meinung nach spielt das Nervensystem als Organisator und die myofaszialen Strukturen als ausführendes Organ dabei eine bedeutende Rolle. Wir haben verschiedene Muskelkettenmodelle, aber auch verschiedene osteopathische Denkmodelle miteinander verglichen und nach Gemeinsamkeiten untersucht. Dabei ist uns bewusst geworden, dass all diese Modelle im Grunde das Gleiche sagen, jedoch unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wir präsentieren in diesem Buch ein Muskelkettenmodell, das auf den beiden Bewegungsmustern der kranialen Osteopathie basiert, der Flexion und Extension. Da der Organismus aus zwei Körperhälften besteht, gibt es dementsprechend auch zwei Flexions- und Extensionsketten. Wir haben uns von Littlejohns Modell der „Mechanik der Wirbelsäule" und den „Zink-Pattern" des amerikanischen Osteopathen Gordon Zink, DO inspirieren lassen, um das Rumpfskelett in Bewegungseinheiten aufzuteilen. Nicht wenig überrascht waren wir, als wir dabei feststellten, dass diese Einteilung in Bewegungseinheiten sehr stark mit der Einteilung der neurologischen Versorgung von bestimmten Organen und Muskeln kor-reliert. Die beiden Ketten haben wir mit Muskeln versehen, wobei wir uns der Tatsache bewusst sind, dass dies nur sehr unvollständig und theoretisch sein kann. Der Leser möge dies bitte berücksichtigen. Da der Organismus nur Bewegungsmuster und keine einzelnen Muskeln kennt, ist dies jedoch nicht von allzu großer Bedeutung. Im zweiten Teil des Buches stellen wir einige Behandlungsmethoden der myofaszialen Strukturen dar. Die Triggerpunktbehandlung beschreiben wir dabei sehr detailliert, weil sie für die Praxis von unschätzbarem Wert ist. Wir haben uns bewusst auf die Darstellung des mechanischen Aspekts in der Osteopathie beschränkt, da er für die Haltung von Bedeutung ist und somit diagnostisch verwendet werden kann. Die physiologischen kranialen Dysfunktionen haben wir durch ein mechanisches Modell versucht zu erklären. Auf eine detaillierte Darstellung der viszeralen Dysfunktionen haben wir jedoch verzichtet, obwohl es auch hier deutliche Hinweise auf ein Verhalten nach denselben Mustern gibt. Organische Störungen manifestieren sich durch Fehlhaltungen über direkte fasziale Züge und vor allen Dingen über viszerosomatische Reflexe. Im Sinne der Ganzheitlichkeit passen sich die Organe an den „Behälter", den Bewegungsapparat, an genauso wie statische Störungen die Lage und die Funktion der Organe beeinflussen (Anpassung der Funktion an die Struktur). Unser Muskelkettenmodell ist nur ein Denkmodell wie viele andere auch; wir erheben auch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. In der Praxis haben wir jedoch feststellen können, dass sowohl die Diagnostik als auch die Behandlung der Patienten sehr viel rationaler und effektiver möglich sind, wenn wir ihnen diese Betrachtungsweise zugrunde legen. Dies trifft ganz besonders für chronische und therapieresistente Fälle zu.
Thommen und Königswinter, im Frühjahr 2006
Philipp Richter, Eric Hebgen
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Die Autoren
Vorwort zur 3. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Teil I A Muskelfunktionsketten
1 Einleitung
1.1 Die Bedeutung der Muskelfunktionsketten im Organismus
1.2 Die Osteopathie des Dr. Still
1.3 Wissenschaftliche Belege
1.4 Mobilität und Stabilität
1.5 Der Organismus als Einheit
1.6 Interrelation von Struktur und Funktion
1.7 Biomechanik der Wirbelsäule und des Bewegungsapparates
1.8 Die Bedeutung der Homöostase
1.9 Das Nervensystem als Schaltzentrale
1.10 Verschiedene Modelle von Muskelfunktionsketten
1.11 In diesem Buch
2 Modelle myofaszialer Ketten
2.1 Herman Kabat (1950): Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation
2.1.1 Bewegungsmuster
2.1.2 Anwendungsmodalitäten
2.1.3 Feststellungen
2.2 Godelieve Struyf-Denys
2.2.1 Gliederung der fünf Muskelketten
2.3 Thomas W. Myers
2.3.1 „Anatomy Trains“ (myofasziale Meridiane)
2.3.2 Myofasziale Ketten nach Myers
2.4 Leopold Busquet
2.4.1 Die Muskelketten
2.4.2 Myofasziale Ketten nach Busquet
2.4.3 Funktionen der myofaszialen Muskelketten
2.5 Paul Chauffour: Der mechanische Link in der Osteopathie
2.5.1 Biomechanische Ketten von Paul Chauffour
2.6 Fazit der verschiedenen Modelle der myofaszialen Ketten
3 Physiologie
3.1 Das Bindegewebe
3.1.1 Die Zellen
3.1.2 Die Interzellularsubstanz
3.1.3 Die Versorgung des Bindegewebes
3.1.4 „Creep“-Phänomen
3.2 Der Muskel
3.3 Die Faszien
3.3.1 Funktion der Faszien
3.3.2 Manifestationen von faszialen Störungen
3.3.3 Bewertung der faszialen Spannungen
3.3.4 Ursachen muskuloskelettaler Dysfunktionen
3.3.5 Genese myofaszialer Störungen
3.3.6 Schmerzmuster
3.4 Vegetative Innervation der Organe
3.5 Irvin M. Korr
3.5.1 Bedeutung einer somatischen Dysfunktion der Wirbelsäule für den gesamten Organismus
3.5.2 Bedeutung des Rückenmarks
3.5.3 Bedeutung des autonomen Nervensystems
3.5.4 Bedeutung der Nerven für die Trophik
3.6 Sir Charles Sherrington
3.6.1 Antagonistenhemmung oder reziproke Innervation (oder Inhibition)
3.6.2 Postisometrische Entspannung
3.6.3 Temporäre und lokale Summation
3.6.4 Sukzessive Induktion
3.7 Harrison H. Fryette
3.7.1 Die Lovett’schen Gesetze
3.7.2 Die Fryette’schen Gesetze
3.7.3 Der Gang als globales, funktionelles Bewegungsmuster
3.7.4 Ganganalyse
3.7.5 Die Muskelaktivität beim Gang
3.7.6 Fazit
4 Kraniosakrales Modell
4.1 William G. Sutherland
4.2 Biomechanik des Kraniosakralsystems
4.3 Die Bewegungen und Dysfunktionen des kraniosakralen Mechanismus
4.3.1 Flexion – Extension
4.3.2 Torsion
4.3.3 Seitneigung – Rotation
4.3.4 Verticalstrain und Lateralstrain
4.3.5 Kompressionsdysfunktion der SSB
4.3.6 Intraossäre Dysfunktionen
4.3.7 Sakrumdysfunktionen
4.4 Einfluss kranialer Dysfunktionen und Fehlstellungen auf die Peripherie
5 Das biomechanische Modell von John Martin Littlejohn – Die Mechanik der Wirbelsäule
5.1 Geschichte
5.2 Die „Mechanik der Wirbelsäule“ und die Kraftlinien des Körpers
5.2.1 Die zentrale Kraftlinie (central gravity line)
5.2.2 Die anteriore Körperlinie (anterior body line)
5.2.3 Die anteroposteriore Linie
5.2.4 Zwei posteroanteriore Linien
5.3 Das Kräftepolygon
5.4 Bögen, Drehpunkte und Doppelbögen
5.4.1 Bögen
5.4.2 Drehpunkte
5.4.3 Doppelbögen
5.5 Die Specific Adjusting Technique (SAT) nach Dummer
5.5.1 Geschichte
5.5.2 Vorgehensweise
5.5.3 Die drei Einheiten
6 Posturale Muskeln, phasische Muskeln und gekreuzte Haltungsmuster
6.1 Statik
6.2 Motorik
6.3 Posturale Muskelfasern (rote Fasern)
6.3.1 Typ-I-Fasern (slow twitch fibres)
6.4 Phasische Muskelfasern (weiße Fasern)
6.4.1 Typ-II-Fasern (fast twitch fibres)
6.5 Muskeln mit Tendenz zu Verkürzungen
6.6 Muskeln mit Tendenz zur Abschwächung
6.7 Die gekreuzten Haltungsmuster
6.7.1 Das obere gekreuzte Haltungsmuster
6.7.2 Das untere gekreuzte Haltungsmuster
6.8 Praktische Konsequenzen
7 Die Zink-Pattern
7.1 Die Zusammensetzung der Zink-Pattern
7.1.1 Okziput-Atlas-Axis (OAA)
7.1.2 Obere Thoraxapertur (OTA)
7.1.3 Untere Thoraxapertur (UTA)
7.1.4 Becken (BE)
7.2 Praktische Anwendung der Zink-Pattern
7.2.1 Okziput-Atlas-Axis (OAA)
7.2.2 Obere Thoraxapertur
7.2.3 Untere Thoraxapertur
7.2.4 Becken
8 Myofasziale Ketten – ein Modell
8.1 Die Muskelketten
8.1.1 Flexionskette
8.1.2 Extensionskette
8.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen der Flexions- und Extensionsketten
8.2.1 Flexionskette
8.2.2 Extensionskette
8.3 Torsion
8.4 Besonderheiten einiger Muskeln oder Muskelgruppen
8.4.1 M. sternocleidomastoideus
8.4.2 Mm. scaleni
8.4.3 Diaphragma
8.4.4 M. iliopsoas
8.4.5 Hüftrotatoren
8.4.6 Zusammenfassung
9 Rückenschmerz als Folge von Triggerpunkten und Störungen des Kavitätendrucks?
9.1 Können Triggerpunkte Ursache für Instabilität und Rückenschmerzen sein?
9.1.1 Triggerpunkte als Ursache für segmentale Sensibilisierung
9.1.2 Neurologisch bedingte Muskelatrophie als Folge von Schmerz
9.1.3 Instabilität als Folge von neuromuskulären Dysbalancen und propriozeptiven Störungen
9.2 Der Kavitätendruck als wichtiger Faktor für die Rumpfstabilität
9.3 Wechselbeziehung zwischen Extremitätenmuskulatur, Wirbelsegmenten und Organen
9.4 Fazit und praktische Konsequenzen
10 Statik
10.1 Haltung
10.2 Einfluss der Schwerkraft auf den Bewegungsapparat
10.3 Scharnierzonen
10.4 Die Gleichgewichtsregulation
10.4.1 Praktische Relevanz
10.4.2 Statikrezeptoren
10.4.3 Zusammenfassung Gleichgewichtsregulation
10.5 Untersuchung
10.5.1 Methodik
10.5.2 Haltungsanalyse
10.5.3 Differenzierung parietal – viszeral – kranial
10.5.4 Untersuchung der Statikrezeptoren
10.5.5 Schlussfolgerung
10.6 Beinlängendifferenzen
10.6.1 Statische Veränderungen von Becken und Wirbelsäule bei Beinlängendifferenzen
10.6.2 Folgen für das muskuloskelettale System und Symptome der Beinlängendifferenz
10.6.3 Diagnostik einer Beinlängendifferenz
10.6.4 Soll man Beinlängendifferenzen ausgleichen oder nicht?
10.6.5 Fazit
11 Diagnostik
11.1 Anamnese
11.2 Untersuchung
11.2.1 Beobachtung
11.2.2 Palpation
11.2.3 Bewegungstests
12 Therapiemöglichkeiten
12.1 Muskelenergietechniken (MET)
12.1.1 Definition
12.1.2 Indikationen und Kontraindikationen
12.1.3 Voraussetzungen für optimale MET-Anwendungen
12.1.4 Technische Voraussetzungen und Hilfsmittel (enhancer) für die MET
12.1.5 Varianten der MET
12.1.6 Physiologische Prinzipien
12.2 Myofascial-Release-Techniken
12.2.1 Loose – tight/locker – fest
12.2.2 Direkt – indirekt
12.2.3 Dreidimensional
12.2.4 Ausführung der Technik
12.3 Neuromuskuläre Techniken (NMT)
12.3.1 Ausführung der Techniken
12.4 Myofascial-Release-Technik mit ischämischer Kompression
12.4.1 Vorgehensweise
Teil II B Triggerpunkte und ihre Behandlung
13 Definition
14 Klassifikation der Triggerpunkte
14.1 Aktive und latente Triggerpunkte
14.2 Symptome
14.3 Begünstigende Faktoren
15 Pathophysiologie der Triggerpunkte
15.1 Lokale Spannungserhöhung des Triggerpunkts, ausstrahlender Schmerz
15.2 Konvergenzprojektion
15.3 Konvergenzfazilitation
15.4 Axonverästelungen
15.5 Sympathische Nerven
15.6 Metabolische Entgleisung
15.7 Muskeldehnungen wirken auf den Muskelmetabolismus ein
15.8 Der hypertone palpierbare Muskelstrang
15.9 Muskuläre Schwäche und schnelle Ermüdbarkeit
16 Diagnostik von Triggerpunkten
16.1 Genaue Anamnese
16.2 Schmerzmuster aufzeichnen
16.3 Muskeln in Aktivität untersuchen
16.4 Nach Triggerpunkten suchen
17 Therapie der Triggerpunkte
17.1 Stretch-and-Spray-Technik
17.1.1 Kühlspray aufbringen
17.1.2 Passive Dehnung
17.1.3 Aktive Dehnung
17.2 Postisometrische Relaxation/Muskel-Energie-Technik/Myofascial Release
17.3 Ischämische Kompression/Manuelle Inhibition
17.4 Tiefe Friktionsmassage (deep friction)
17.5 Dehnübungen
17.6 Eigenbehandlung mit Hilfsmitteln
17.6.1 Igelball
17.6.2 Jacknobber
17.6.3 Triggerpointer
18 Triggerpunkt aufrechterhaltende Faktoren
18.1 Mechanische Faktoren
18.2 Systemische Faktoren
19 Das fazilitierte Segment
20 Die Triggerpunkte
20.1 Muskeln des Kopf- und Nackenschmerzes
20.1.1 M. trapezius
20.1.2 M. sternocleidomastoideus
20.1.3 M. masseter
20.1.4 M. temporalis
20.1.5 M. pterygoideus lateralis
20.1.6 M. pterygoideus medialis
20.1.7 M. digastricus
20.1.8 M. orbicularis oculi, M. zygomaticus major, Platysma
20.1.9 M. occipitofrontalis
20.1.10 M. splenius capitis und M. splenius cervicis
20.1.11 M. semispinalis capitis, M. semispinalis cervicis, Mm. multifidi
20.1.12 Mm. recti capitis posterior major et minor, Mm. obliqui capitis inferior et superior
20.1.13 Dehnung der seitlichen Hals- und Nackenmuskulatur
20.2 Muskeln des oberen Thoraxschmerzes und des Schulter-Arm-Schmerzes
20.2.1 M. levator scapulae
20.2.2 Mm. scaleni
20.2.3 M. supraspinatus
20.2.4 M. infraspinatus
20.2.5 M. teres minor
20.2.6 Dehnung der Außenrotatoren der Schulter
20.2.7 M. teres major
20.2.8 M. latissimus dorsi
20.2.9 Dehnung der lateralen Rumpfseite
20.2.10 M. subscapularis
20.2.11 Mm. rhomboideii
20.2.12 M. deltoideus
20.2.13 M. coracobrachialis
20.2.14 M. biceps brachii
20.2.15 Dehnung des M. biceps brachii
20.2.16 M. brachialis
20.2.17 M. triceps brachii
20.2.18 M. anconaeus
20.3 Muskeln des Ellenbogen-Finger-Schmerzes
20.3.1 M. brachioradialis
20.3.2 M. extensor carpi radialis longus
20.3.3 M. extensor carpi radialis brevis
20.3.4 M. extensor carpi ulnaris
20.3.5 M. extensor digitorum
20.3.6 M. extensor indicis
20.3.7 M. supinator
20.3.8 Dehnung der Unterarmextensoren
20.3.9 M. palmaris longus
20.3.10 M. flexor carpi radialis
20.3.11 M. flexor carpi ulnaris
20.3.12 M. flexor digitorum superficialis
20.3.13 M. flexor digitorum profundus
20.3.14 M. flexor pollicis longus
20.3.15 M. pronator teres
20.3.16 Dehnung der Unterarmflexoren
20.3.17 M. adductor pollicis
20.3.18 M. opponens pollicis
20.3.19 M. abductor digiti minimi
20.3.20 Mm. interossei
20.4 Muskeln des oberen Rumpfschmerzes
20.4.1 M. pectoralis major
20.4.2 M. pectoralis minor
20.4.3 M. subclavius
20.4.4 Dehnung der Pektoralismuskulatur
20.4.5 M. sternalis
20.4.6 M. serratus posterior superior
20.4.7 M. serratus posterior inferior
20.4.8 M. serratus anterior
20.4.9 M. erector spinae
20.4.10 Dehnung der autochthonen Rückenmuskulatur
20.4.11 M. rectus abdominis, M. obliquus internus et externus abdominis, M. transversus abdominis, M. pyramidalis
20.4.12 Dehnung der Bauchmuskulatur
20.5 Muskeln des unteren Rumpfschmerzes
20.5.1 M. quadratus lumborum
20.5.2 Dehnung der lateralen Rumpfseite
20.5.3 M. iliopsoas
20.5.4 Dehnung der Hüftbeuge- und Glutealmuskulatur
20.5.5 Muskeln des Beckenbodens
20.5.6 M. glutaeus maximus
20.5.7 M. glutaeus medius
20.5.8 M. glutaeus minimus
20.5.9 M. piriformis
20.5.10 Dehnung des M. piriformis
20.6 Muskeln des Hüft-, Oberschenkel- und Knieschmerzes
20.6.1 M. tensor fasciae latae
20.6.2 M. sartorius
20.6.3 M. pectineus
20.6.4 M. quadriceps femoris
20.6.5 Dehnung des M. quadriceps femoris
20.6.6 M. gracilis
20.6.7 M. adductor longus
20.6.8 M. adductor brevis
20.6.9 M. adductor magnus
20.6.10 Dehnung der kurzen Hüftadduktoren
20.6.11 Dehnung der langen Hüftadduktoren
20.6.12 M. biceps femoris
20.6.13 M. semitendinosus
20.6.14 M. semimembranosus
20.6.15 Dehnung der Ischiokruralmuskulatur
20.6.16 M. popliteus
20.7 Muskeln des Unterschenkel-, Knöchel- und Fußschmerzes
20.7.1 M. tibialis anterior
20.7.2 M. tibialis posterior
20.7.3 M. peronaeus longus
20.7.4 M. peronaeus brevis
20.7.5 M. peronaeus tertius
20.7.6 M. gastrocnemius
20.7.7 M. soleus
20.7.8 M. plantaris
20.7.9 Dehnung der Wadenmuskulatur
20.7.10 M. extensor digitorum longus
20.7.11 M. extensor hallucis longus
20.7.12 M. flexor digitorum longus
20.7.13 M. flexor hallucis longus
20.7.14 M. extensor digitorum brevis
20.7.15 M. extensor hallucis brevis
20.7.16 M. abductor hallucis
20.7.17 M. flexor digitorum brevis
20.7.18 M. abductor digiti minimi
20.7.19 M. quadratus plantae
20.7.20 Mm. interossei dorsales
20.7.21 Mm. interossei plantares
20.7.22 M. adductor hallucis
20.7.23 M. flexor hallucis brevis
21 Literatur
21.1 Muskelfunktionsketten (Richter)
21.2 Rückenschmerz (Richter)
21.3 Statik (Richter)
21.4 Triggerpunkte und ihre Behandlung (Hebgen)
22 Abkürzungen
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I A Muskelfunktionsketten
Philipp Richter
1 Einleitung
2 Modelle myofaszialer Ketten
3 Physiologie
4 Kraniosakrales Modell
5 Das biomechanische Modell von John Martin Littlejohn – Die Mechanik der Wirbelsäule
6 Posturale Muskeln, phasische Muskeln und gekreuzte Haltungsmuster
7 Die Zink-Pattern
8 Myofasziale Ketten – ein Modell
9 Rückenschmerz als Folge von Triggerpunkten und Störungen des Kavitätendrucks?
10 Statik
11 Diagnostik
12 Therapiemöglichkeiten
2 Modelle myofaszialer Ketten
2.1 Herman Kabat (1950): Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation
Begründer des PNF-Konzeptes war Dr. Herman Kabat in den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Er entwickelte die Behandlungsmethode eigentlich für die Behandlung von Poliomyelitispatienten. Unterstützt wurde Herman Kabat von Margaret Knott und Dorothy Voss, die 1956 ein erstes Buch über PNF veröffentlichten. Seitdem wurde die Methode weiterentwickelt und auch bei Patienten mit anderen Krankheitsbildern erfolgreich angewandt.
Das PNF-Konzept basiert auf den neurophysiologischen Erkenntnissen von Sir Charles Sherrington ▶ [21], ▶ [160]:
reziproke Innervation oder Inhibition (reciprocal innervation or inhibition)
räumliche, lokale Summation (spatial summation)
Ausbreitung der Reizantwort (temporal summation)
sukzessive temporäre Summation (successive induction)
Irradiation (Erregbarkeit)
postisometrische Relaxation (after discharge)
Kabat entwickelte eine Behandlungstechnik, bei der schwache Muskeln in eine Muskelkette integriert werden. Durch gezielte Stimuli wird die Muskelkette angeregt (durch visuelle, auditive und taktile Reize). Dabei werden die von Sherrington beschriebenen Eigenschaften der Nerven und Muskeln optimal eingesetzt, um den schwachen Muskel (oder die Muskelgruppe) optimal in das Bewegungsmuster zu integrieren.
Die propriozeptiven Fähigkeiten des Bewegungsapparates werden angeregt, um schwache Muskeln zu kräftigen und um Bewegungsabläufe zu koordinieren. Ziel ist es, dem Zentralnervensystem positive Inputs zu geben, damit normale Bewegungsmuster über zentrale Regelkreise fazilitiert werden. Deshalb werden kontinuierlich die gleichen Bewegungsmuster angewandt.
2.1.1 Bewegungsmuster
Folgende Motor Patterns werden stimuliert:
2.1.1.1 Schulterblatt und Becken
anteriore Elevation
anteriore Depression
posteriore Elevation
posteriore Depression
2.1.1.2 Obere Extremität
Flexion – Abduktion – Außenrotation
Extension – Adduktion – Innenrotation
Flexion – Adduktion – Außenrotation
Extension – Abduktion – Innenrotation
2.1.1.3 Untere Extremität
Flexion – Abduktion – Innenrotation
Extension – Adduktion – Außenrotation
Flexion – Adduktion – Außenrotation
Extension – Abduktion – Innenrotation
2.1.1.4 Nacken
Flexion nach links – Extension nach rechts und umgekehrt
Flexion – Lateralflexion nach links – Rotation nach links und umgekehrt
Extension – Lateralflexion nach rechts – Rotation nach rechts und umgekehrt
2.1.1.5 Rumpf
Rumpfflexion – Lateralflexion – Rotation nach links (oder rechts)
Rumpfextension – Lateralflexion – Rotation nach rechts (oder links)
Für die Extremitätenmuster beziehen sich die genannten Bewegungsrichtungen auf die großen rumpfnahen Gelenke Schulter und Hüfte. Zwei antagonistische Bewegungsmuster ergeben eine Diagonale.
2.1.2 Anwendungsmodalitäten
Die Ausgangsstellung des Patienten kann variieren (Rücken, Bauch, Seitenlage, Sitz, Stand).
Das Segment, das behandelt werden soll, wird so in Vordehnung gebracht, dass alle bei dem Muster beteiligten Muskeln (Agonisten und Synergisten) gestretcht werden.
Die Vordehnung wie auch die Ausführung der Bewegung müssen absolut schmerzfrei sein.
Ausweichbewegungen werden korrigiert.
Der Therapeut fordert den Patienten auf, sich in die gewünschte Richtung zu bewegen und stimuliert die Bewegungsrichtung durch taktilen Kontakt bzw. Widerstand.