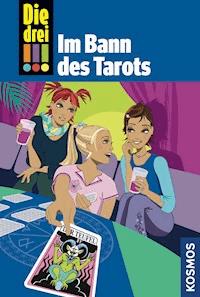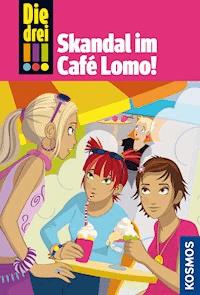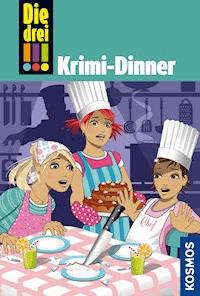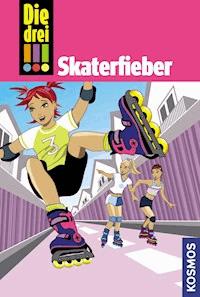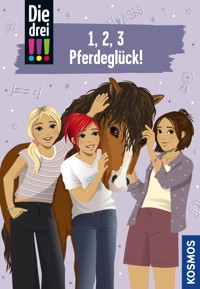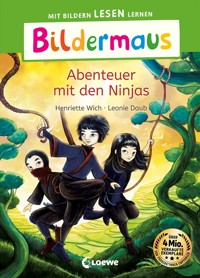9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein Ritter ohne Furcht und Tadel, ein großes Abenteuer zwischen den Zeiten! Tristan stammt aus dem Mittelalter. Aber wegen eines Fehlers spukt der Knappe seit 777 Jahren als Geist auf Burg Adlerstein. In dieser Burg - inzwischen eine Ruine - testet der Erfinder Professor Neufeld ein Teleportier-Gerät. Der Versuch schlägt fehl, stattdessen landet Tristan in der modernen Welt, als Mensch aus Fleisch und Blut! Zum Glück hat der Professor eine Tochter namens Isolde, die sich des kühnen Knappen annimmt. So beginnt eine tolle Freundschaft und ein großes Abenteuer - samt Zeitreisen, Schatzsuche und Bösewicht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Henriette Wich & Christian Dreller: Tristan Treuherz – Ein Ritter, ein Schatz und ein Abenteuer mit Isolde
Tristan stammt aus dem Mittelalter. Aber wegen eines Fehlers spukt der Knappe seit 777 Jahren als Geist auf Burg Adlerstein. In dieser Burg – inzwischen eine Ruine – testet der Erfinder Professor Neufeld ein Teleportier-Gerät. Der Versuch schlägt fehl, stattdessen landet Tristan in der modernen Welt, als Mensch aus Fleisch und Blut!
Zum Glück hat der Professor eine Tochter namens Isolde, die sich des kühnen Knappen annimmt. So beginnt eine tolle Freundschaft und ein großes Abenteuer – samt Zeitreisen, Schatzsuche und Bösewicht!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Viten
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Für meinen Vater, den wahren Treuherz in meinem Leben
Christian Dreller
Für Christiane, für das Geschenk unserer Freundschaft
Henriette Wich
Ein gewaltiger Blitz zerriss den Nachthimmel über Burg Adlerstein und für einen Wimpernschlag erstrahlte der Burghof in kaltem Licht. Erste fette Regentropfen platschten auf das Blechdach des zerbeulten Pritschenwagens, in dem Professor Johannes Neufeld wartete. Gebannt starrte er auf das Display seines Laptops. Der Regenradar zeigte eine tiefviolette Gewitterzelle – wie ein gefräßiges Monster wälzte sie sich heran.
»Ach, du heiliger Einstein!«, flüsterte Neufeld und fuhr sich durch die wirren grauen Haare. Das, was sich da zusammenbraute, war das große, heftige Gewitter, auf das er so lange gehofft hatte.
Wie zur Bestätigung ertönte ein mächtiger Donnerschlag, der Neufeld zusammenzucken ließ. Doch den Burghof behielt er weiter im Auge und das Grinsen wich nicht eine Nanosekunde aus seinem Gesicht. Heute würde er die Gesetze der Physik auf den Kopf stellen!
Der Regen wurde stärker. Neufeld rupfte sich die Brille von der Nase und putzte die fleckigen Gläser mit dem Hemdzipfel. Kaum hatte er die Brille wieder aufgesetzt, zuckte erneut ein Blitz über den Himmel. Einen kurzen Moment lang funkelten draußen auf dem Burghof zwei unförmige Gebilde im geisterhaften Licht: Ringwülste aus Metall, so groß wie Lkw-Reifen und überzogen von einem Gewirr aus Schläuchen und Leitungen.
Hastig aktivierte der Professor die Audio-Aufnahme seines Laptops.
»Donnerstag, 7. Juli 2018, null Uhr, sieben Minuten, fünf Sekunden«, begann er aufgeregt. »Ein historischer Moment! Erstmals in der Menschheitsgeschichte wird ein Objekt durch Teleportation von einem Ort zum anderen befördert.« Dann hämmerte er auf die Tastatur. »Aktiviere Ringbeschleuniger und Blitztraktor.«
Auf diesen Befehl hin begann das Gebirge aus Lkw-Batterien, das auf der Ladefläche des Pritschenwagens thronte, zu arbeiten. Durch ihren Strom wiederum erwachten die beiden Ringbeschleuniger jetzt zum Leben. Grüne und rote Kontrolllämpchen begannen zu blinken, begleitet von einem tiefen Brummen.
»Ringbeschleuniger hochgefahren. Überdruckventile und Kühlkreislauf okay. Blitztraktor …« Ein gewaltiger Donnerschlag unterbrach ihn und eine heftige Sturmbö schüttelte den Wagen. Immer wilder trommelte der Regen auf das Kabinendach. »Blitztraktor online«, brüllte Neufeld begeistert gegen den Krach an.
Der Blitztraktor war seine genialste Erfindung überhaupt, sozusagen nobelpreisverdächtig. Das Ganze war an der Spitze des Westturms befestigt: eine Spezialtitanschüssel mit magnetischem Schutzschild, die wie eine Art Mega-Staubsauger Blitze einfing, sie verstärkte und dann geradewegs in die Ringbeschleuniger jagte – so lange, bis genug Energie für die Teleportation vorhanden war.
Nahtlos folgte nun Blitz auf Donner. Wie hypnotisiert starrte der Professor durch die Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer verrichteten Schwerstarbeit.
»Es tut sich was!« Aufgeregt setzte Neufeld seinen Bericht fort: »Luft über Ringbeschleunigern fängt an zu leuchten!«
So weit, so gut. Aber irgendetwas stimmte nicht. Hektisch überflog er die Anzeigen. Alles im grünen Bereich. Er blickte wieder zu den zwei Beschleunigern. Ihr Leuchten erhellte die kleinen Holzpodeste, die er in die Mitte der beiden Ringe platziert hatte. Die leeren Podeste.
»IDIOT!« Neufeld schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. An wirklich alles hatte er gedacht … nur nicht an das, was eigentlich teleportiert werden sollte: Tobi!
Der Professor pfefferte den Laptop auf den Beifahrersitz, riss das Handschuhfach auf und zerrte eine gelbe Gummiente heraus. Er ignorierte das laute Quietschen, mit dem sie gegen die grobe Behandlung protestierte, stieß die Fahrertür auf und kämpfte sich mühevoll durch Regen, Sturm, Blitz und Donner.
Als er vor den Beschleunigern stand, packte ihn kalte Angst. Nicht einmal ein Genie wie er konnte vorhersagen, was geschehen würde, wenn er das neu entstandene Licht berührte. Gut möglich, dass es ihm die Finger samt Tobi bis nach Timbuktu wegfetzte.
Sei’s drum! Todesmutig streckte er die Hand aus, tauchte in das wabernde Leuchten ein. Es war, als ob eine Horde Mikro-Quantenmonster an jedem Atom seines Arms zerren würde. Mit einem lauten Fluch setzte er Tobi aufs Podest.
Völlig erledigt und nass bis auf die Knochen schleppte er sich zum Auto zurück. Doch ein Blick auf die Anzeigenwerte des Laptops ließ ihn alle Strapazen vergessen. Es war noch nichts verloren, im Gegenteil. Der Blitztraktor sammelte weiterhin Energie, gleich würde Tobi von seinem Podest auf das benachbarte befördert werden.
Mit zittriger Stimme nahm Neufeld seinen Bericht wieder auf. »Kritisches Energielevel fast erreicht. 90 Prozent … 95 … 98 …«
WADAWUMM! WADAWUMM!
Mit offenem Mund starrte Neufeld durch die Windschutzscheibe. Anstelle des Leuchtens hatten sich über den Ringbeschleunigern urplötzlich zwei Kugeln aus ultraweißem Licht materialisiert. Ihre Oberfläche kräuselte sich wie flüssig gewordene Sahne. Von Tobi und den Podesten war nichts mehr zu erkennen.
»Transportzonen stabil!«, brüllte der Professor gegen das tosende Unwetter an. »Initiiere Teleportation.«
Johannes Neufelds Zeigefinger schwebte über der Entertaste. »Gute Reise, Tobi«, flüsterte er.
Tristan Treuherz blieb wie erstarrt stehen. Ein tosender Donner rollte über Burg Adlerstein hinweg. Doch das war es nicht, was ihn aufgeschreckt hatte. Angestrengt starrte er in die Finsternis – die Hand am Schwertgriff, die Muskeln zum Zerreißen gespannt.
War das eben ein leises Klirren gewesen? Von jemandem, der sich im Kettenhemd bewegte? Dort draußen auf der Wehrmauer, hinter der Turmöffnung, auf die er gerade zuschlich?
Er wartete, bis der Donner verhallt war, und lauschte angestrengt. Doch er hörte nur den Regen, der auf das verwitterte Mauerwerk prasselte. Und die Schritte seiner Verfolger, noch ziemlich weit unten im Turm. Aber sie kamen schnell näher.
Tristan nickte zufrieden. Die Sache lief wie am Schnürchen. Nach 777 Jahren hatte er endlich eine echte Chance, während der Vollmondnacht alle drei seiner Gegner zu besiegen. Mit ein bisschen Glück war der albtraumhafte Spuk ab heute auf immer vorbei.
Er riss sich aus seinen Gedanken, denn jetzt konnte er den keuchenden Atem seiner Verfolger schon deutlicher hören. Er musste weiter, den Köder für die verschiedenen Fallen spielen, die er zu Beginn der Geisterstunde vorbereitet hatte.
Entschlossen schritt er auf die Turmöffnung zu. Doch als ein Blitz den Nachthimmel zerriss, blieb Tristan wie angewurzelt stehen. Für einen Moment war draußen auf der moosüberwachsenen Wehrmauer eine Schattengestalt im grellen Licht zu erkennen. Und die Umrisse einer zum Schlag erhobenen Streitaxt.
Dreifach verflixte Krötenkacke, stieß Tristan einen stummen Fluch aus. Hinter der nächsten Ecke lauerte einer seiner drei Gegner: Hartmann von Schwarzthal. Spitzname: Knochenspalter. Markenzeichen: besagte Streitaxt. Tristan konnte nicht mehr zählen, wie oft er in den letzten 777 Jahren schon üble Bekanntschaft mit dem Ding gemacht hatte.
Was zum Henker suchte der Knochenspalter auf einmal hier? Bis eben war Tristan davon ausgegangen, dass er Hartmann erfolgreich in den Kellergewölben abgehängt hatte.
Na, primos, dachte Tristan. Jetzt saß er selbst in der Falle. Vor ihm der Knochenspalter und hinter ihm die anderen zwei: Orok aus den Steppenlanden und Tristans Erzfeind Knut Drexel, ehemals sein Mitschüler in der Ritterschule. Der Erste zu Lebzeiten ein gefürchteter Schwertkämpfer übelster Sorte, der Zweite so abgrundtief hinterhältig, dass es auch nach Jahrhunderten einfach nicht zu fassen war.
Den Geräuschen nach zu schließen waren sie nur noch drei Treppenwindungen hinter ihm. Er musste handeln. Und zwar schnell, sonst würden sie ihn in Stücke hacken. Und dann ging in der nächsten Vollmondnacht wieder alles von vorne los.
Eine verschwommene Idee blitzte in Tristans Kopf auf. Nicht gerade ein Plan, aber besser als gar nichts. Leise zog er sein Schwert aus der Scheide. Zählte stumm bis drei. Nahm Anlauf – und warf sich mit einem Hechtsprung durch die Turmöffnung nach draußen.
In elegantem Bogen pfiff Knochenspalters Streitaxt durch die Luft. Aber seine Waffe traf ins Leere. Denn offensichtlich hatte Hartmann nicht damit gerechnet, dass sein Gegner in Schienbeinhöhe an ihm vorbeischießen würde. Genauso wenig wie Tristan damit gerechnet hatte, dass er auf dem patschnassen, moosigen Untergrund so vertrackt viel Schwung bekam. Statt wie gehofft eine halbe Schwertlänge vor Knochenspalters Plattfüßen zu stoppen und ihn mittels einer blitzschnellen Kombination aus Körperdrehung und Schwerthieb in die Knie zu zwingen, sauste er geradeaus weiter – mit dem Kopf voran auf einen Haufen Steinquader zu, die von einer eingestürzten Mauerzinne stammten.
Gleich darauf explodierte trotz Streithelm ein Feuerwerk in Tristans Schädel. Eine Sekunde lang sah er nichts als Sterne.
Stöhnend wälzte Tristan sich herum. Das war’s jetzt, dachte er. Gleich würde Knochenspalters Axt auf ihn niederkrachen. Gleich war es aus und vorbei … wieder einmal.
Aber die Axt kam nicht.
Verwirrt blinzelte Tristan in den grellen Gewitterhimmel. Hartmann von Schwarzthal stand am Rand der Wehrmauer und ruderte wie wild mit Armen und Streitaxt. Der Schwung seiner Waffe hatte ihn auf dem rutschigen Untergrund offenbar aus dem Gleichgewicht gebracht. Fast hatte er sich wieder gefangen, als plötzlich der verwitterte Steinboden unter ihm wegbrach. Begleitet von einem mächtigen Donnerschlag stürzte der Knochenspalter in den Abgrund. Tristan beobachtete noch, wie sein Körper durchsichtig wurde und sich dann in Rauch auflöste.
Für Hartmann war die Geisterstunde vorbei. Zumindest bis zur nächsten Vollmondnacht.
Ächzend rappelte Tristan sich hoch und griff nach seinem Schwert. Keinen Augenblick zu früh. Denn jetzt tauchten seine zwei Verfolger in der Turmöffnung auf.
Tristan wirbelte herum, sprang über den Quaderhaufen und rannte davon, so schnell es auf dem schlüpfrigen Untergrund ging.
»Hat Tristilein mal wieder die Hosen voll?«, höhnte Knut Drexel hinter ihm.
»Abwarten, wer gleich die Hosen voll hat«, murmelte Tristan nur und steuerte auf das andere Ende der Wehrmauer zu, wo eine dunkle Öffnung in den Nordturm führte. Oder in das, was vom Nordturm noch übrig war. Drinnen steckte er das Schwert in die Scheide und wandte sich nach links. Hastete exakt drei Treppenstufen nach unten. Zerrte sich die nassen Lederschuhe von den Füßen. Klemmte sie unterm Schwertgurt fest. Flitzte zur Öffnung zurück. Und lugte vorsichtig um die Ecke. Als der nächste Blitz den Himmel zerriss, sah er, dass seine Verfolger noch ein gutes Stück entfernt waren.
Tristan grinste. Primos Primissimus!
Er wartete, bis für einen Moment alles wieder in Dunkelheit getaucht war, sprang an der Öffnung vorbei und flitzte die gegenüberliegende Treppe hoch – jedoch nur eine halbe Windung. Denn dahinter hörten die Stufen jäh auf und machten der abgrundtiefen Höllenschlucht Platz.
Tristan presste den Bauch gegen die Reste der Mauer und krallte sich mit den Fingern in irgendwelche Ritzen. So stand er auf der letzten Treppenstufe. Hoffentlich bröckelte der verwitterte Stein nicht unter ihm weg wie beim Knochenspalter … Mit angehaltenem Atem lauschte er in Richtung Öffnung.
»Wo ist Tristilein hin?«, hörte er gleich darauf Knuts Stimme. Seine Verfolger waren also da!
»Fußspuren … Er … nach unten.« Oroks Antwort wurde vom Gewitterdonner so gut wie verschluckt.
»Du zuerst!« Das war wieder Knut. Klar, der Feigling schickte Orok vor. Genau wie geplant!
Tristan schob seinen Oberkörper ein wenig zur Seite und lugte nach unten. Dort standen die zwei mit gezogenen Schwertern und starrten auf die feuchten Fußspuren, die Tristan auf der Treppe hinterlassen hatte.
Ungeduldig stieß Knut Orok an. Gehorsam setzte der sich in Bewegung. Die Stufen hinunter. Dem Zauberleim entgegen.
Tristan zählte im Kopf die Schritte mit. Eins … zwei … drei … VIER!
»AAAHHH!«, hallte Oroks gellender Schrei durch die Turmruine. Gefolgt von wildem Gepolter und dem metallenen Geschepper, das sein Brustpanzer beim Sturz erzeugte. Dann Stille … Totenstille.
In Gedanken sah Tristan vor sich, wie auch Orok sich in Rauch auflöste. Dazu verdammt, bis zur nächsten Vollmondnacht als körperloser Geist durch die Ruinen von Burg Adlerstein zu streifen.
Die Sache mit dem Zauberleim war geglückt! Tristan hatte das klebrige Zeug auf der vierten Stufe verteilt, und wie erhofft war Orok mit einem Fuß daran hängen geblieben, gestolpert und dann kopfüber die steile Treppe hinuntergestürzt – seinem diesmaligen Ende entgegen.
Tristan hatte den seltsamen, knallroten Metallschlauch mit Zauberleim vor ein paar Vollmondnächten im Burghof gefunden. Der Schlauch war mit Buchstaben versehen. Mit merkwürdigen Buchstaben, die nur entfernt denen ähnelten, die er aus der Ritterschule kannte:
MOKLEIM.
Was das hieß, wusste er nicht. Was der Zauberleim konnte, allerdings schon. Kaum hatte er nämlich etwas davon zwischen Daumen und Fingern verrieben, bekam er die Hand ums Verrecken nicht mehr auseinander. Leider war es ausgerechnet seine Schwerthand gewesen, wodurch jene Vollmondnacht für Tristan ein schmerzhaftes und jähes Ende gefunden hatte.
Aber egal. Was zählte, war, dass der Zauberleim heute seinen Zweck erfüllt hatte. Genauso wie hoffentlich gleich die magische Schnur – zart wie Engelhaar, durchsichtig wie Eis, aber unglaublich fest –, die er ebenfalls vor Kurzem gefunden hatte.
Denn noch war die Vollmondnacht nicht vorbei.
Rasch schlüpfte Tristan wieder in seine Schuhe, zückte sein Schwert und sprang mit einem Satz die Stufen hinunter. »Hallo, Verräter!«
Knut reagierte blitzschnell. In einer fließenden Bewegung wirbelte er herum und ließ sein Schwert auf Tristan herabsausen. Gerade noch rechtzeitig blockte Tristan mit seiner Klinge den Hieb ab, bevor dieser ihm – Helm hin oder her – den Schädel gespalten hätte. Eins musste Tristan zugeben: Im Gegensatz zu früher war Knut mittlerweile ziemlich auf Zack. Aber 777 Jahre harte Kämpfe hatten auch Tristan geschickter und stärker gemacht. Letzten Endes war er immer noch der bessere Schwertkämpfer. Genau wie damals in der Ritterschule.
»Gib auf, Knut«, knurrte Tristan, während sie ihre Klingen gegeneinanderpressten. »Wir müssen uns nicht dauernd wehtun.«
»Nur damit Herzogs Liebling, der ach so edle Treuherz, vom Fluch erlöst ist?«, keuchte Knut und starrte Tristan wütend an. »Von wegen. So leicht kommst …« Mitten im Satz brach er ab und riss das Knie hoch, um es Tristan in den Unterleib zu rammen.
Doch der hatte das Funkeln in Knuts Augen gesehen und richtig gedeutet. Er fegte die Klinge seines Gegners zur Seite und brachte sich mit einem Sprung aus der Gefahrenzone.
Na schön, dachte Tristan. Dann eben doch die Zauberschnur.
Statt dem Hagel von Schwerthieben, mit dem Knut ihm jetzt nachsetzte, entschlossen ein Ende zu bereiten, beschränkte er sich darauf, sie zu parieren. Nach und nach lockte Tristan seinen Gegner so zur anderen Öffnung des Nordturmes hinaus und weiter auf die nächste Wehrmauer, die zur Höllenschlucht abfiel. Genau an die Stelle, wo Knut und er in jener fatalen Nacht vor 777 Jahren in den Abgrund gestürzt waren und Knut seinen schrecklichen Fluch ausgestoßen hatte. Der Fluch, der Tristan dazu verdammte, während jeder Vollmondnacht zur Geisterstunde auf Leben und Tod zu kämpfen.
Tristan ertappte sich dabei, wie seine Gedanken abschweiften. Aufgemerkt, du Esel!, schalt er sich selbst sofort. Durch Träumereien wirst du deinen letzten Gegner nie besiegen, geschweige denn den Fluch brechen.
Während Knut ihn weiter bedrängte, wich Tristan stetig zurück. Hin und wieder warf er einen Blick über die Schulter. Gleich musste es so weit sein.
Dann, im Licht des nächsten Blitzes, sah er sie: die dünne magische Schnur, die er auf Knöchelhöhe gespannt hatte. Das eine Ende hatte er um einen Ast des Ahornbaums geschlungen, der unten im Burghof stand und mittlerweile bis hinauf zur Wehrmauer reichte. Der Ast war jetzt stark zurückgebogen. Das andere Ende hatte er an einem rostigen Ring befestigt, der aus einer Mauerzinne ragte – gerade so fest geknotet, dass sich die Schlinge bei Berührung der Schnur sofort lösen würde.
Mit zwei energischen Schwerthieben zwang er Knut kurz zum Zurückweichen. Dann wirbelte er herum und rannte davon, sorgfältig darauf bedacht, die Schnur nicht zu berühren.
»Du verfluchter Feigling!«, brüllte Knut, stürmte hinterher – und riss dabei die Schnur los, ohne es zu merken.
Er hatte kaum Zeit, sich zu wundern, warum Tristan unvermittelt stehen blieb, sich umdrehte und einfach nur grinste, da fegte ihn auch schon der zurückschnellende Ast von den Beinen.
Mit voller Wucht knallte Knut rücklings auf den harten Stein. Sein Streithelm kullerte scheppernd über den Rand der Wehrmauer und das Schwert rutschte ihm aus der Hand. Benommen lag er da, während der Regen auf ihn niederprasselte.
Tristan näherte sich mit bedächtigen Schritten.
Er hatte jetzt alle drei Gegner besiegt. Der Fluch war gebrochen. 777 Jahre als ruheloser Geist, der jede Vollmondnacht für eine Stunde wieder ein Mensch aus Fleisch und Blut werden musste, nur um mit den drei anderen zu kämpfen – all das war vorbei.
Jedenfalls fast.
»Sag, dass du dich ergibst!«, befahl Tristan und richtete die Schwertspitze auf Knuts Brust.
Knut starrte ihn aus dunklen Augen an. Die nassen schwarzen Haare klebten ihm auf der bleichen Stirn. Fast tat er Tristan leid, wie er so dalag. Er wollte die Sache eigentlich gar nicht auf diese Art zu Ende bringen. Nicht mehr. Aber das musste Knut ja nicht wissen.
»Los, sag es«, drängte Tristan. Doch plötzlich nahm er aus dem Augenwinkel unten im Burghof etwas Helles wahr. Überrascht wandte er den Blick ab. Und riss staunend den Mund auf.
Dort unten schwebten zwei weiße Bälle in der Luft. Bälle aus flüssigem Licht, die sich wie Spielkreisel drehten. Was für eine Zauberei war das denn jetzt?
Tristan war nur eine Sekunde abgelenkt. Aber mehr brauchte Knut nicht, um ihm einen harten Tritt gegen das Knie zu verpassen. Tristan ruderte hilflos mit den Armen, verlor das Gleichgewicht und stürzte unaufhaltsam hinab in die Tiefe. Genau einem der weißen Bälle entgegen.
Na primos, dachte er noch. Dann umfing ihn das flüssige Licht mit heißem Atem. Die Welt wurde weiß. Dann schwarz. Dann … nichts.
Nebel waberte Isolde entgegen und der Geruch verbrannter Kräuter. Weil sie die Tür ziemlich energisch aufgemacht hatte, schlug das Windspiel mit einem hektischen Dreiklang Alarm. Als es sich wieder beruhigt hatte, hörte Isolde irgendwo aus den dunklen Tiefen des Raums eine Panflöte.
»Hallo? Jemand zu Hause?« Keine Antwort. Der Flötist spielte unbeirrt weiter.
Entschlossen drang Isolde ins Zentrum des Ladens vor, das von einem Zimmerbrunnen beherrscht wurde. Dabei streifte sie achtlos Regale voller Klangschalen, Engelkerzen, Traumfänger, Orakelkarten und eine Vitrine mit antiken Streichinstrumenten.
Der Brunnen war neu. Er bestand aus einem beeindruckenden Rosenquarz, der von innen heraus rosa zu leuchten schien. Der Quarz ruhte in einer mit Wasser gefüllten Schale, aus der die geheimnisvollen Nebelschwaden aufstiegen.
Isoldes Mund verzog sich zu einem Lächeln, als sie den Grund für das magische Glühen erkannte: Ein dünnes schwarzes Kabel schlängelte sich unauffällig am Rand der Brunnenschale entlang, vorbei an einer Fernbedienung und weiter zu einer Steckdose an der Bodenleiste.
»Genug genebelt!« Isolde griff zur Fernbedienung und beendete mit einem Daumendruck die aufdringliche Show. Dann rief sie noch mal lauter: »Hallo?«
Wieder keine Antwort.
Seufzend stellte Isolde ihren Rucksack neben dem Brunnen ab und ging in den hinteren Teil des Ladens. Der Flötenspieler wurde leiser. Über seine dahingehauchten Klänge, die aus den Lautsprecherboxen schwebten, legte sich eine sanfte Männerstimme: »Ich bin jetzt bereit für die Kontaktaufnahme mit dem Jenseits. Ich bin gaaanz ruhig. Ich spreche nun zu den Geistern, die ich rufen möchte.«
Vor der Stereoanlage saß eine Frau im Schneidersitz. Die dunkelblonden Haare rahmten ihr Gesicht wie ein Vorhang ein. Sie hatte die Augen geschlossen und wiederholte feierlich den letzten Satz der CD: »Ich spreche nun zu den Geistern, die ich rufen möchte. Hört ihr mich, Geister von Burg Adlerstein? Heute an Vollmond, da ihr um Mitternacht wieder verdammt seid zum Spuk, öffnet mir eure Seelen, auf dass ich euch Trost spende.«
Fassungslos stand Isolde da und lauschte.
Die Frau fing an zu lächeln. »Ja! Ich spüre etwas. Eine Schwingung, ganz tief in meinem Innern. Ich werde sie jetzt nach außen lenken, mich öffnen und –«
Isolde hatte genug gehört. »Mama, wir müssen los!«
»Wir müssen?« Beatrix Neufeld behielt die Augen geschlossen. »Dieses Wort mögen Geister überhaupt nicht. Wohin müssen wir denn, Isi?«
Isolde drehte die Stereoanlage leiser. »Zur Schule. Du hast versprochen, dass du mich fährst.«
Ihre Mutter schlug verwundert die Augen auf. »Aber Isi, es ist zehn Uhr abends.«
»Ich weiß. Deshalb heißt unser Schulausflug ja auch Nachtwanderung. Wir gehen heute zur Fledermaushöhle.«
»Oh! Das hab ich völlig vergessen. Tut mir furchtbar leid, Schatz.« Beatrix Neufeld stand in aller Ruhe auf. »Ich werde nur noch meinen Zen-Bogen wegräumen und ein Mantra ausdrucken.«
»Kannst du das nicht morgen machen, Mama?«
Frau Neufeld wiegte nachdenklich den Kopf. »Der Zen-Bogen kann vielleicht warten, aber das Mantra brauche ich heute noch. Es ist ein Mitternachts-Mantra, mit dem man Geister aus dem Jenseits ruft.«
»Mama, es gibt keine …«, fing Isolde an, sparte sich jedoch den Rest. Es nützte ja doch nichts. Ihre Mutter hatte sich schon immer brennend für die Geschichte von Burg Adlerstein interessiert, für all die tragischen Schicksale der Menschen, die dort gelebt hatten. Und seit Neuestem beschäftigte sie sich mit den »Geistern« dieser Menschen – den Aura-Schicksalen, wie sie sie nannte.
»Ich sause, ich sause«, sang Beatrix Neufeld jetzt vor sich hin, während sie ihren Computer einschaltete.
Der gab die üblichen Geräusche von sich. Dann zeigte er einen schmalen Balken, der sich langsam von links nach rechts füllte. Sehr, sehr langsam. Eigentlich hätte sich das besonders augenfreundliche Display öffnen müssen. Stattdessen wurde der Bildschirm grau – und blieb es auch.
»Ich komme gaaanz ruhig zum Ende und bedanke mich bei den Geistern«, säuselte im Hintergrund die Stimme aus der Stereoanlage.
»Scheiße!«, brüllte Isoldes Mutter.
Isolde musste lachen. »Also, die CD hat den Test definitiv nicht bestanden. Du solltest sie nicht in deinem Laden verkaufen.«
Frau Neufeld stieß drei Verzweiflungsrufe hintereinander aus. »Nein! Nein!! Nein!!!«
»Was ist?«, fragte Isolde und brachte die CD zum Schweigen.
»Das passiert mir jetzt schon zum dritten Mal. Er hängt sich beim Hochfahren einfach auf und bleibt grau. Ausgerechnet Grau! Die Farbe zwischen Licht und Finsternis, wie ein Geist zwischen Leben und Tod.«
Isolde verdrehte die Augen. »Mama! Das ist ein Computer, kein Geist.«
»Ja, stimmt«, räumte Frau Neufeld ein. »Kannst du dir das nicht mal kurz ansehen? Du kennst dich doch mit diesen Dingen so gut aus. – Bitte!«
Isolde schwang sich auf den Gymnastikball, den ihre Mutter zum Bürostuhl befördert hatte. »Du hast hoffentlich eine Komplettsicherung gemacht, oder?« Ein Blick in die halb erschrockenen, halb schuldbewussten Augen ihrer Mutter genügte als Antwort. »Mensch, Mama!« Isolde versuchte den Computer mit einer Tastenkombination zurückzusetzen. Als das nichts brachte, checkte sie die externen Geräte … und entdeckte prompt einen USB-Stick. Mit einem Seufzer zog sie den Übeltäter heraus.
Beim nächsten Startversuch fuhr der Computer brav hoch und wechselte zügig zum Startbildschirm. Zwei Delfine sprangen aus den Fluten des Meeres. Im Hintergrund ging die Sonne unter.
Frau Neufeld klatschte in die Hände, dass die bunten Holzperlen an ihrem Armband nur so klackerten. »Du hast mich gerettet. Danke, Isi! Dafür darfst du dir auch was aus dem Laden aussuchen. Was möchtest du gerne haben? Einen Heilstein vielleicht? Oder eine Engelkerze?«
»Das ist wirklich nicht nötig«, wehrte Isolde schnell ab.
Sie konnte mit dem abgedrehten Schnickschnack im Laden ihrer Mutter nicht viel anfangen. Da ging es ihr wie ihrem Vater. Wobei der sich als Physiker auch oft mit ganz schön seltsamen Sachen beschäftigte. Zurzeit war es irgendwas mit Quanten und Teleportation und außerdem supergeheim.
Aber Frau Neufeld ließ sich nicht beirren. »Gestern kam doch eine Lieferung mit wunderbaren Sachen aus Nepal. Und vorgestern hab ich auch was Tolles reinbekommen …«
Hektisch durchwühlte sie zwei Kartons auf dem Boden. Und erntete prompt ein empörtes »Miau!«.
Beatrix Neufeld zuckte zusammen. »Sphinx?! Wie oft soll ich es dir noch sagen? Auf meiner schönen neuen Ware ist kein Platz für dich! Dein Katzenkissen ist da drüben.«
Sie wedelte mit der Hand, um Isoldes Katze zu verscheuchen. Doch Sphinx machte es sich erst recht auf der sternenbestickten Samtdecke gemütlich.
Isolde kraulte ihr das weiche, graue Fell. »Du hast wirklich einen super Geschmack, Sphinx: nur die teuersten Stoffe!«
Die Katze blickte sie ruhig an. Klar doch, was sonst?, schienen ihre bernsteinfarbenen Augen zu sagen, denen sie ihren Namen verdankte.
Frau Neufeld seufzte. »Und ich muss dann wieder die ganzen Katzenhaare … Juhuu!« Triumphierend hielt sie eine Kette hoch, die sie aus einem der Kartons gefischt hatte. »Das ist genau das Richtige für dich, Isi: ein Atlantis-Schutzanhänger!«
Isolde betrachtete das geometrische Muster des länglichen Anhängers. Zwei Dreiecke, eingefasst von sechs kurzen und drei langen Geraden. Weil es so schlicht war, mochte sie das Muster.
Ihre Mutter legte ihr die silberne Kette mit dem Messing-Anhänger um den Hals. »Passt gut zu deinen graublauen Augen. Und er wird dich vor Gefahren und negativen Einflüssen schützen. Selbst wenn du nicht daran glaubst.« Sie zwinkerte verschmitzt.
Der Anhänger fühlte sich schwer und leicht zugleich an. Merkwürdig. Und obwohl Isolde sonst überhaupt keinen Schmuck trug, war es kein unangenehmes Gefühl.
»Danke, Mama«, sagte sie. »Jetzt müssen wir aber wirklich los!«
»Ich sause, ich sause«, trällerte Frau Neufeld wieder vor sich hin.
Während sich Sphinx von ihrer Decke erhob, sich genüsslich streckte und langsam zum Ausgang stolzierte, ließ Isoldes Mutter alle magischen Lichter im Laden erlöschen und schloss ab.
»Tschüss, Sphinx!«, rief Isolde.
Draußen blieb sie kurz stehen. Es war noch immer sehr warm, die Hitze des schwülen Sommertages wollte einfach nicht weichen. Dann folgte sie ihrer Mutter zum Zweitwagen der Familie, einem uralten, klapprigen Panda. Er passte perfekt zum renovierungsbedürftigen Haus der Neufelds neben dem Laden.
Isolde faltete beim Einsteigen ihre langen Beine zusammen. Danach klemmte sie den Rucksack zwischen die Füße, schnallte sich an und krallte sich mit beiden Händen am Haltegriff der Tür fest. Keine Sekunde zu früh, denn schon trat Beatrix Neufeld das Gaspedal durch. Isolde kniff die Augen zu und sagte stumm ein selbst erfundenes Spontan-Mantra auf: »Heil ankommen, bloß heil ankommen!« Denn obwohl ihre Mutter zu Kunden sanft wie ein Engel war, fuhr sie rasant wie der Teufel.
Kurz vor dem Ziel gab sie noch mal richtig Stoff. In einer mörderischen Steilkurve nahm der Panda die Auffahrt zur Schule. Die Reifen drehten auf dem Kies durch. Die Handbremse krachte beim Anziehen und Isolde wurde nach vorne in ihren Gurt geschleudert.
»Wir sind da!« Ihre Mutter strahlte wie eine Formel-1-Siegerin. »Viel Spaß bei der Nachtwanderung. Ich geb Papa Bescheid, dass er dich abholen soll. Ruf einfach an, wenn ihr fertig seid.«
»Mach ich, danke.« Endlich hatte Isolde wieder festen Boden unter den Füßen. Nur der Inhalt ihres Magens brauchte noch etwas Zeit, um sich zu sortieren.
Während Beatrix Neufeld den Rückwärtsgang reinrammte und in einem Affenzahn die Auffahrt hinunterraste, lief Isolde hinüber zum Schulgebäude. Dort standen ihre Mitschüler und spielten gelangweilt mit ihren Taschenlampen herum.
»Beeil dich!« Frau Tengler, die Klassenlehrerin, schwang einen roten Regenschirm über ihrem Kopf. »Du bist die Letzte.«
Prompt richteten sich die eingeschalteten Taschenlampen auf Isolde, dankbar für das neue Ziel. Na, toll! Ihr ganz persönlicher Galaauftritt.
Isolde hielt sich die Hand vor die Augen, murmelte eine Entschuldigung und schloss schnell die Lücke am Ende der Zweierreihe, die sich jetzt langsam in Bewegung setzte.
»Hi!«, sagte sie zu der Person neben ihr.
»Hallo, Giraffe!«, kam als Begrüßung zurück.
Isolde zuckte zusammen. Mist! Warum hatte sie nicht zuerst geprüft, wer da das Schlusslicht bildete?
Hermann Dodinger musste den Kopf in den Nacken legen, damit er ihr in die Augen sehen konnte. Schadenfroh grinsend fragte er: »Na, was hat dich aufgehalten, Giraffe? Wieder ein bunter Regentropfen? Oder war’s diesmal ein Staubkorn aus dem großen, großen Unversum?«
»Du meinst wahrscheinlich Universum«, verbesserte Isolde ihn. Hermann hatte nicht zufällig den Spitznamen Dödel. Er war zweimal sitzen geblieben, was ihn aber nicht störte. Im Gegenteil, er prahlte sogar damit.
Jetzt schlug sich Dödel auf die Oberschenkel. »Haha, habt ihr das gehört? Giraffe Klugscheißerin weiß mal wieder was.«
»Haha, weiß mal wieder was!«, kam es als Echo vom Trio vor ihnen zurück. Dödels Bewunderer Kevin, Linus und Pascal grölten laut.
Isolde ging gar nicht erst auf den dummen Kommentar ein. Erfahrungsgemäß wurde es sonst nur schlimmer. Denn im Gegensatz zu seinem Verstand war Dödels massiger Körper erstaunlich stark. Und diese Masse brachte er immer dann zum Einsatz, wenn ihm keine doofen Sprüche mehr einfielen.
Die Sache mit Dödel hatte gleich am ersten Schultag begonnen, als er neu in die Klasse gekommen war. Isolde hatte Tafeldienst gehabt und gar nicht gemerkt, wie er sich neben sie stellte. Kurz zuvor hatte es heftig geregnet, doch jetzt schien die Sonne ins Klassenzimmer und die Tropfen der Fensterscheibe spiegelten sich auf der grünen Tafel wider. Das sah wunderschön aus. Als ob die schnöde Tafel plötzlich zum tiefen, unergründlichen Teich geworden wäre. Ein Teich, über den halb verschwommene Schriftzeichen aus einer anderen Zeit dahinglitten. Isolde hatte alles um sich herum vergessen.
Gnadenlos holte Dödel sie aus ihrer Träumerei. »Ey, das sieht ja aus wie Schneckenschleim!« Er zeigte auf den tropfenden Schwamm in ihrer Hand und auf die weiße Kreidepfütze am Boden. »Wach auf, Giraffe, und wisch dein ekliges Zeug da weg.«
»Wisch doch selber!«, hatte Isolde zurückgeblafft und ihm den Schwamm vor die Füße geschleudert. Damit waren die Fronten ein für alle Mal abgesteckt gewesen.
Isolde konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart und versuchte Dödel zu entkommen, indem sie sich unauffällig zu den vorderen Reihen durchschlängelte. Leider nicht unauffällig genug für Dödel.
»Pass bloß auf, dass dich kein Vampir beißt!«, rief er ihr nach. »Die tarnen sich als Fledermäuse und saugen dich aus. Hahaha!«
Isolde lief schneller. Dabei pendelte ihre neue Kette hin und her. Von wegen, der Anhänger würde sie vor negativen Einflüssen schützen. Gerade eben hatte er total versagt. Wobei Dödel höchstwahrscheinlich ein Spezialfall war, an dem sich sämtliche Glücksbringer des Universums die Zähne ausbeißen würden.
Fledermäuse, die sich in Vampire verwandelten! Isolde schnaufte. Dödel fiel auch auf jeden schlechten Gruselfilm herein. Sie hätte ihn aufklären können, woher die Idee stammte. Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass die Seele nach dem Tod den Körper in Form einer Fledermaus verließ. Daraus waren dann später die Vampirsagen entstanden.
Zum Glück sah Isolde jetzt ihre Banknachbarin Emmi und schloss erleichtert zu ihr auf.
»Hat Dödel dich wieder genervt?«, fragte Emmi.
»Der hat dich echt auf dem Kieker!« Lena, Emmis beste Freundin, fing plötzlich an zu grinsen. »Kann es sein, dass Hermann sich in dich verknallt hat?«
Isolde schnappte nach Luft. »Quatsch! Nie im Leben!« Und eine Sache musste sie gleich noch klarstellen: »Wenn Dödel denkt, er kann mir die Nachtwanderung vermiesen, hat er sich geschnitten!«
»So gefällst du mir«, rief Emmi fröhlich und hakte sich bei Isolde unter.
Inzwischen hatte die Klasse einen bewaldeten Hügel erklommen und den Höhenweg auf der Kuppe erreicht. Hier gab es keine Straßenlaternen, sondern nur den Nachthimmel, an dem sich gerade düstere Wolkenberge auftürmten. Taschenlampen wurden eingeschaltet und Isolde holte ihre Kamera aus dem Rucksack. Zum letzten Geburtstag hatte sie ein lichtstarkes Objektiv mit Bildstabilisator bekommen. Damit konnte sie nachts ohne Stativ Fotos machen, einfach so mit der freien Hand, und es verwackelte trotzdem fast nichts. Isolde schaltete den Blitz aus und stellte die Schärfe ein. »Hallo, ihr zwei!«
Emmi und Lena lachten in die Kamera und waren verewigt. Isolde schoss noch ein paar Fotos von der hügeligen Landschaft. Plötzlich zuckten Blitze am Horizont, gefolgt von tiefem Donnergrollen.
Frau Tengler trieb die Klasse an. »Da braut sich ein Gewitter zusammen. Wir müssen uns beeilen, damit wir noch trocken zur Höhle kommen. Den Abstecher zur Burg Adlerstein lassen wir besser ausfallen.«
Schon fing es an zu regnen. Ein Windstoß fuhr Isolde so stark in den Rücken, dass sie stolperte. Um ein Haar wäre ihr dabei die Kamera aus den Händen gerutscht. Rasch verstaute sie sie im Rucksack, zog ihre Regenjacke an und rannte den anderen hinterher. Der Weg wurde wieder steiler. Nach einer Biegung tauchte am höchsten Punkt des Rundwegs die Ruine von Burg Adlerstein auf.
BRATZ! Ein Blitz jagte über den Himmel und schlug im nächsten Moment in den eingefallenen Wehrturm neben der Höllenschlucht ein. Eine Sekunde lang konnte Isolde sehen, wie einzelne Gesteinstrümmer in die Tiefe stürzten.
Ihr wurde eiskalt. Nicht auszudenken, wenn sie dort oben gewesen wären!
»Ha!« Eine Hand packte sie an der Schulter, heißer Atem streifte ihren Hals. »Jetzt beiß ich dich!«
»Lass mich in Ruhe!«, brüllte Isolde und gleichzeitig ertönte ein ohrenbetäubender Donnerschlag.
GRAWUUUUUHM!
Dödel zog erschrocken seine Hand zurück, als ob sie vom Blitz getroffen worden wäre. Stolpernd suchte er das Weite.
Isolde sah ihm wütend hinterher. »Das wirst du noch bereuen«, murmelte sie.
BRATZZZZ! … GRAWUUUUUHM! … BRATZZZZ!
Die Abstände zwischen Blitz und Donner wurden immer kürzer. Der Regen prasselte jetzt wie Streuselkuchen vom Himmel. Alle kreischten panisch und rannten noch schneller. Kurz darauf war ein gleichmäßiges Rauschen zu hören. Dann standen sie vor einer Wand aus Wasser, die von einem gezackten Felsvorsprung bis zum Boden reichte. Ein Wasserfall.
»Wir sind gleich da!«, brüllte Frau Tengler. »Da vorne ist der Eingang.«
Sie hetzten weiter. Inzwischen waren alle nass bis auf die Knochen.
»Rein mit euch!« Die Lehrerin trieb ihre Schützlinge in die Höhle.
Dödel war der Letzte. Mit knallrotem Kopf taumelte er in den Schutzraum, während über ihm zwei verschreckte Fledermäuse tiefer in die Höhle hineinflatterten.
»Das … ist ja … die HÖLLE da … draußen!«, japste Dödel in die Runde. Dann gingen ihm die Worte aus, weil er mit heftigem Sauerstoffmangel zu kämpfen hatte.
Isoldes Mitleid hielt sich in Grenzen. Sie wandte sich von Dödel ab und leuchtete mit der Taschenlampe in die Höhle. Zerklüftete Felswände auf allen Seiten. Die Decke hatte massive Ausbuchtungen und wirkte, als könnte sie mit ihrem Tonnengewicht jederzeit herabstürzen.
Die Lehrerin scharte die Klasse um sich. »Alles klar bei euch? – Schön. Hier sind wir sicher. Wir können in aller Ruhe das Gewitterende abwarten und ich erzähle euch währenddessen etwas über Fledermäuse. Lasst bitte nur ein paar Taschenlampen an. Wir wollen die Tiere nicht zu sehr stören.«
»Aber hier sind ja gar keine Fledermäuse«, bemerkte Lena.
Frau Tengler lächelte. »Das liegt daran, dass die meisten Tiere zwischen April und September auf Beutejagd sind. Aber keine Sorge. Weiter drinnen werden wir Fledermäuse sehen, die auch im Sommer die Höhle zum Ausruhen und Schlafen nutzen. Bitte bleibt immer in meiner Nähe. Hier gibt es unzählige kilometerlange Gänge. In diesem Labyrinth kann man sich leicht verlaufen.«
Die Lehrerin führte ihre Klasse zu einem schmalen Durchgang. Dahinter öffnete sich eine beeindruckende Halle mit einer Kuppel, die Isolde an eine Kirche erinnerte. Dort oben kuschelte sich eine Gruppe von Fledermäusen aneinander und ließ sich lässig kopfüber hängen.
»Kriegen die davon kein Kopfweh?«, fragte Pascal.
»Nein«, antwortete Frau Tengler. »Für sie ist es sogar sehr bequem. Ihr Blutkreislauf ist darauf eingestellt und pumpt das Blut problemlos wieder aus dem Kopf zum Herzen zurück. Und ihre Fußkrallen rasten praktisch von alleine ein. Das kostet gar keine Kraft.«
Isolde hörte gebannt zu, was Frau Tengler erzählte. Ihre Kamera hatte sie wieder hervorgeholt und ihr gelang ein Schnappschuss von einer Fledermaus, die sich gerade putzte, während das Tier daneben seelenruhig weiterschlief.
Nach einer knappen Stunde war die Führung zu Ende und sie kehrten wieder zum Eingang zurück.
»Das Gewitter ist zwar vorbei, aber wir bleiben trotzdem noch ein bisschen hier«, verkündete die Klassenlehrerin. »Ihr könnt gerne eure Brote herausholen.«
Prompt fing Isoldes Magen an zu knurren. Mist! Sie hatte vergessen, sich Essen mitzunehmen.
Ganz im Gegensatz zu Dödel natürlich. Der packte Vorräte aus, die für eine Woche gereicht hätten: Wurst- und Käsebrote, Kekse, Schokolade, Bananen und eine große Tüte mit Fruchtgummi. Die Tüte riss er zuerst auf und schob sich gierig einen Gummi-Schnuller in den Mund.
Isolde grinste. Das Bild musste sie für die Ewigkeit festhalten. »Da hat das Dödel-Baby aber einen süßen Schnuller«, feixte sie und drückte auf den Auslöser.
Dödel spuckte den Schnuller in hohem Bogen aus. »Spinnst du? Gib sofort die Kamera her!«
»Kannst du vergessen. Das ist meine«, stellte Isolde klar.
»Aber nicht mehr lange.« Dödel gab seinen Kumpels ein Zeichen. »Schnappt sie euch!«
Sofort sprangen Kevin, Linus und Pascal auf die Füße.
Aber Isolde war schneller. Sie schlug einen Haken und rannte aus der Höhle.
Die Bande stürmte hinterher und Frau Tengler starrte ihnen verdutzt nach. »Stopp!«, rief sie. »Wo wollt ihr hin?«
Gute Frage, dachte Isolde. Bloß weg von diesen fiesen Typen. Bergauf war gut. Da kam Dödel nicht so schnell hinterher.
Also folgte sie dem Höhenweg. Doch der schlängelte sich scheinbar endlos aufwärts. Nach viel zu vielen Kehren erreichte sie doch noch den höchsten Punkt und die Burgruine lag vor ihr.
Der Anblick war so überwältigend, dass es Isolde den Atem verschlug. In dieser Nacht sah Burg Adlerstein aus, als hätten die Jahrhunderte keinerlei Spuren hinterlassen: die Steine frisch gewaschen vom Regen. Das Gras im Burghof saftig grün. Funkelnde Sterne über der Wehrmauer und der Mond als krönende Haube über dem Turm. Fehlten nur noch ein paar Ritter in schimmernden Rüstungen, die auf ihren edlen Pferden aus dem Tor herausgaloppierten.
Isolde lief durch den Burghof zur Wehrmauer. Zwischen den Steinen wuchs Moos. Sie strich mit der Hand darüber. Wie kühle, weiche Kissen fühlte sich das an. Kissen, auf denen man sich ausruhen könnte …
»Hallo, Giraffe!«, riss eine heisere Stimme sie aus den schönen Gedanken. »Du träumst ja schon wieder mit offenen Augen.«
Isolde fuhr herum. Dödel. Sein Gesicht viel zu nah an ihrem. Sein klebrig-süßer Fruchtgummi-Atem unerträglich. Und seine Augen ganz schmal, als er ruhig sagte: »Gib mir die Kamera.«
»Nein!«, wehrte sich Isolde. »Die gehört mir.«
Dödel schnaufte. »Du tust, was ich dir sage, Giraffe, oder –«
Bevor er ausreden konnte, gab Isolde ihm einen Schubs und versuchte sich rechts vorbeizuquetschen. Doch da war schon Linus. Sie probierte es links, aber Kevin und Pascal schnitten ihr auch diesen Fluchtweg ab.
Die Bande drängte sie zurück gegen die Wehrmauer. Isolde saß in der Falle. Schmerzhaft bohrten sich die rissigen Steine in ihren Rücken. Aber der Schmerz war gar nichts gegen die Riesenwut in ihrem Bauch. Vier Jungs gegen ein Mädchen. Das war so was von gemein!
»Haltet ein, ihr Taugenichtse!«, rief plötzlich jemand. »Lasst das Fräulein in Ruhe, oder ich werde euch eine Lektion erteilen.«
Die Stimme kam von weiter hinten aus dem Burghof.
Zusammen mit den anderen wandte Isolde sich in Zeitlupe um. Dann rieb sie sich ungläubig die Augen.
Ein Junge in Kettenhemd und Beinschienen stand am Rand einer Grube, schwankend und bleich wie der Tod. Kalt funkelte das Mondlicht auf der Klinge des Schwertes, das schlaff an seiner Hand herabhing …
Stöhnend erwachte Tristan. Dreifach vermaledeite Krötenkacke! Tat das weh! Jeder einzelne Knochen. Als wäre sein Körper in Tausende Teile zerfetzt und anschließend wieder zusammengestopft worden, wie Wurstmasse in einen Schweinedarm. Mit zitternden Fingern tastete er seine Gliedmaßen ab. St. Georg sei Dank! Wenigstens schien noch alles dran zu sein.
Aber was war eigentlich passiert? Fieberhaft durchforstete Tristan sein Gedächtnis. Dabei erwies sich St. Georg, der Schutzheilige aller Ritter, als wankelmütiger Helfer. Denn die Erinnerung wollte einfach nicht kommen. Egal, immerhin wusste er noch, wer er war. Da hatte so mancher Ritter weniger Glück gehabt.
Entschlossen reckte er sich. Und bereute es auf der Stelle. Ein stechender Schmerz explodierte in seinem Schädel zu einem grellbunten Sternenwirbel. Ihm wurde schlecht und er musste sich übergeben. Reglos wartete er ab, bis die ärgste Pein verebbte. Dann öffnete er die Augen einen Spalt.
Na, primos! Dunkler als in einem Bärenarsch, wie Reik von Aragon, sein Waffenlehrer in der Ritterschule, zu sagen pflegte.
Angestrengt starrte er in die Finsternis und ganz langsam begann er etwas wahrzunehmen. Kein Zweifel, da war ein Licht, matt und bleich wie Gevatter Tod. Von irgendwo über ihm schien es herab und er selbst lag am Fuß eines Hanges aus frischer Erde und Geröll.
Leider konnte er nicht viel von seiner Umgebung erkennen. Reihen wuchtiger Steinsäulen verloren sich in der Dunkelheit. Sie waren mit feucht schimmernden Gewächsen befleckt, die den Stein wie Wunden überzogen, und sie trugen eine Decke aus alten Steinquadern.
Wie es aussah, war er in einem Keller gelandet.
Nein, nicht bloß ein Keller. Denn irgendwo in der Finsternis tropfte Wasser herab und dem Hall nach zu schließen befand er sich in einem riesigen Gewölbe.
Erkenntnis und Erinnerung trafen ihn wie ein Hammer. Natürlich! Das Kellergewölbe von Burg Adlerstein! Der Kampf gegen Knut und Kumpane. Der zum Greifen nahe Sieg nach 777 Jahren! Dann der weiße Ball … und die bittere Niederlage.
Knut! Verdammt! Bestimmt steckte der auch hier irgendwo. Jeden Augenblick konnte er hinter einer der Säulen hervorstürzen, um Tristan den Rest zu geben.
Mit einer fahrigen Bewegung griff Tristan nach dem Schwert, doch die Scheide war leer. Hektisch flog sein Blick über den Boden. Nichts.
Nun gut, erst mal musste er hier weg.
Er wollte aufstehen, aber ein übler Schwindel fegte ihn gleich wieder von den Beinen. Tristan krachte mit solcher Wucht gegen einen Stein, dass ihm die Luft wegblieb und sein Blick sich erneut vernebelte. Die Schmerzen in seiner Brust waren unbeschreiblich. Doch auf merkwürdige Art so vertraut, dass sie im Grenzreich zwischen Wachen und Ohnmacht eine weitere Erinnerung lebendig werden ließen …
Eine Waldlichtung an einem warmen Sommertag. Herzog Max von Adlerstein inmitten seiner ritterlichen Jagdgesellschaft. Fröhliche Worte, Lachen, Scherze. Nicht weniger als sieben erlegte Wildsauen liegen im Gras. Die erfolgreiche Treibjagd neigt sich dem Ende zu. Herzog Max rüstet sich zum Aufbruch, während Tristan das Pferd seines Onkels bereithält und die letzten Treiber aus dem Wald kommen.
Sie scheuchen ein braunschwarzes Monstrum auf: einen Keiler mit riesigen Hauern. Wütend bricht das Tier aus dem Unterholz. Prescht auf Herzog Max zu. Schreie hallen, Speere sausen, Pfeile sirren und reißen der Bestie blutende Wunden, die sie nur noch wilder machen.
Hilflos fliegt Tristans Blick umher. Gleich wird Herzog Max von den spitzen Hauern durchbohrt werden, doch keine Waffe in Reichweite. Nur der herzogliche Schild, der am Sattel hängt … Der Schild! Ohne nachzudenken, packt Tristan zu und wirft sich dem Keiler entgegen, den schützenden Stahl vor der Brust.
Ohrenbetäubendes Scheppern, ein titanenhafter Schlag, Finsternis …
Dann das Gesicht seines Onkels. Gerührt blickt es auf ihn hinab. »Mein lieber Tristan, wo Speer und Pfeil versagten, warfst du dich der Bestie mit bloßem Schild entgegen«, hört er Herzog Max’ Worte. »Tristan Treuherz sei nunmehr dein Name und Herzoglicher Schildhüter dein Ehrentitel.«
Tristan wurde es warm ums Herz, als er an seinen Onkel dachte. Aus Dankbarkeit hatte Herzog Max ihn außerdem vom Pagen zum Knappen erhoben. Bei seinen Gefährten in der Ritterschule galt Tristan fortan als Held – sah man einmal vom ewig neidischen Knut ab.
Knut!
Jeden Augenblick konnte der hier aufkreuzen!
»Auf mit dir, Hornochse«, knurrte Tristan und stemmte sich auf die Ellbogen. Dabei spürte seine Hand etwas in der Erde. Vorsichtig betastete er den Gegenstand. Lang, hart, kalt … Hastig scharrte er die Erde beiseite. St. Georg sei Dank! Sein Schwert! Und gleich daneben der Streithelm.
Höchste Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Ächzend rappelte er sich auf.
Diesmal klappte es besser. Zwar tat immer noch alles weh und die Knie waren weich wie Brei, aber zumindest blieb der Schwindel aus. Nur das Schwert bereitete wider Erwarten Probleme, arge Probleme.
Denn als Tristan es vom Boden heben wollte, erlebte er eine faustdicke Überraschung. Das Ding war schwerer als sieben Maltersäcke! Irgendwie schaffte er es schließlich doch noch, die Klinge in der Scheide zu verstauen. Nach dem sperrigen Helm griff er erst gar nicht. Sollte der doch bis zum Sankt-Nimmerleinstag hier unten bleiben.
Auf wackeligen Beinen begann Tristan den Hang hinaufzukraxeln, wobei ihm immer wieder die Knie einknickten.
»Teufelsschiss und Krötenkacke«, schimpfte er. »Was bist du nur für ein elender Jämmerling!« Aber bald schon hatte er nicht einmal mehr Energie zum Fluchen.
Eine Ewigkeit verging, während er sich aufwärtsschleppte. Tristan fürchtete schon, in irgendeiner Hölle gelandet zu sein, dazu verdammt, wie ein Käfer durch den Dreck zu krabbeln, als sich plötzlich etwas veränderte. Er hielt inne und starrte nach unten zu seinen Füßen: Gras! Er hatte es geschafft!
Bäuchlings ließ er sich auf den Boden plumpsen.
Doch zum Ausruhen blieb keine Zeit. Er hörte laute Geräusche: Keuchen, schnelle Schritte. Jemand war in den Burghof gekommen. Nein, nicht jemand, mehrere Menschen.