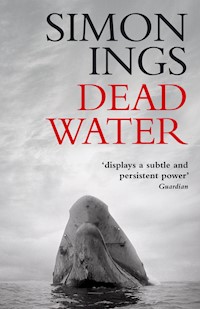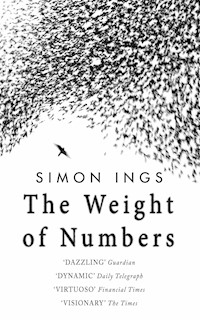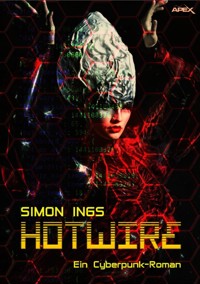27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Sozialismus ist Wissenschaft«, proklamierte Joseph Stalin, der sich selbst zum ersten Wissenschaftler des Landes stilisierte. Unter seiner Herrschaft entstand der weltweit am besten finanzierte Forschungsapparat, gleichzeitig mussten Wissenschaftler um ihr Leben fürchten. Gestützt auf zahlreiche Dokumente zeichnet Simon Ings die Vereinnahmung der Wissenschaft durch den Sowjetstaat nach. Er erzählt von brillanten Forschern und ruchlosen Scharlatanen, von Visionären und Karrieristen, von großem Mut und ebenso großer Feigheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 890
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Simon Ings
Triumph und Tragödie
Stalin und die Wissenschaftler
Aus dem Englischen von Brigitte Döbert
Hoffmann und Campe
Meinen Kindern –
Leo, der mehr oder weniger jedes Weihnachtsfest mit einem Christbaum verbrachte, auf dem ein selbstgebastelter Papp-Stalin thronte,
und Natalie, die den Klebstoff für selbigen besorgte.
Vorwort
Kommt, Brüder, lasst uns in das Grab voll Asche und Staub blicken, aus denen wir gemacht sind.
Aus einer orthodoxen Totenmesse
Dieses Buch über Wissenschaft in der Sowjetunion von ihren Anfängen bis Mitte der fünfziger Jahre entstand nicht, weil mich Josef Stalin fasziniert hätte.
Mich fasziniert Alexander Romanowitsch LurijaLurija, Alexander Romanowitsch.Lurija, Alexander RomanowitschKleines Porträt eines großen Gedächtnisses Mit seiner neuropsychologischen Fallstudie Kleines Porträt eines großen Gedächtnisses[1] prägte er ein neues Genre. Der schmale Band über die seltsame Welt des Solomon SchereschewskiSchereschewski, Solomon, der an seinem extrem guten Gedächtnis zugrunde ging, war eines der ersten populärwissenschaftlichen Bücher überhaupt.
Vor einigen Jahren dachte ein anderer Lurija-Fan in meinem Beisein laut darüber nach, ob es nicht Zeit wäre, eine neue Biographie über diesen ungewöhnlichen Wissenschaftler zu schreiben. Ich recherchierte ein bisschen und kam nicht weit. LurijaLurija, Alexander Romanowitsch hat in seinem Leben ungeheuer viel geleistet und dabei ein ganz normales Leben geführt. Ein glücklicher Ehemann und Familienvater, einer, der regelmäßig mit ausländischen Kollegen und Freunden korrespondierte und ebenso brillante wie bodenständige Arbeiten verfasste, nirgends der Hauch eines Skandals. Wissenschaftlich ist er unendlich aufregend, doch für einen Biographen gibt er nichts her. Über sein Leben kann man nichts Neues erzählen.
Doch immerhin hat er sich, obwohl Jude in einem Land mit staatlich gefördertem AntisemitismusAntisemitismus, immer wieder politisch exponiert, er wurde mehrfach verhört, entlassen und abgemahnt, und sein Werk stand auf dem Index. LurijasLurija, Alexander Romanowitsch Karriere illustriert Winston ChurchillsChurchill, Winston Bonmot, Erfolg heiße, von Fehlschlag zu Fehlschlag zu eilen, ohne den Mut zu verlieren.
Um diese Dimension seines Lebens zu verstehen, musste ich in seine Welt eintauchen, und je mehr ich mich mit seinem Leben und Werk befasste, desto größer wurde meine Achtung vor seiner Generation. Die Revolution erlebten sie als Jugendliche oder junge Erwachsene, und sie ließen sich von Stalin nicht in die Knie zwingen.
Da wuchs sich mein Plan aus: Ich erzähle von einer Handvoll verarmter, unter- oder prekär beschäftigter Hochschulabsolventen, Professoren, Initiatoren und Sammler, die der Sowjetunion trotz unfähiger Regierung zum Status einer Supermacht verhalfen. Und ich erzähle von Scharlatanen.
Russlands politische Eliten umgarnten sie, dirigierten sie, vergötterten sie, wollten gar selbst Wissenschaftler sein. Diese Entwicklung gipfelte 1939 in der Auslobung des StalinpreisesStalinpreis, eines Staatspreises, dem der oberste Patron der sowjetischen Wissenschaft seinen Namen gab. Die Akademie der Wissenschaften der UDSSR, die wichtigste Wissenschaftsinstitution des Landes, wählte ihn im Gegenzug zum Ehrenmitglied.
Verdächtigt, beneidet und ängstlich beäugt vom Möchtegern-Wissenschaftler Stalin kämpften Forscher verschiedenster Disziplinen – von der Physik über Psychologie und Genetik bis hin zur Gerontologie (einer sowjetischen Erfindung) – gegen die zahlreichen Katastrophen, mit denen das Land konfrontiert war: Hungersnöte, Dürren, Bodenerschöpfung, Krieg, Alkoholismus, Seuchen, unzählige Waisen, eine Lebenserwartung, die zeitweise bei dreißig Jahren lag. Ihre Leistungen, Schriften und Fehden, die sie untereinander und mit den Mächtigen austrugen, prägten den globalen Fortschritt mehr als ein Jahrhundert lang.
Zar Alexander II.Alexander II., erfolgreicher Kriegsherr und Diplomat, hatte ehrgeizige Pläne. Nach seiner Krönung 1856 reformierte er die Streitkräfte, die Verwaltung und das Steuersystem und förderte die IndustrialisierungIndustrialisierung (Russland). Doch sein Einsatz für Russlands Modernisierung entgleiste 1861, als er zwanzig Millionen Leibeigene »befreite« und sie damit der Armut und Obdachlosigkeit anheimgab. Etliche Mordanschläge auf ihn waren die Folge, mehrmals entkam er knapp, doch schließlich beendete ein Attentat sein Leben.
Nikolaus II.Nikolaus II. trat 1894 seine Nachfolge an, zu einer Zeit, als die zunehmende IndustrialisierungIndustrialisierung (Russland) eine revolutionäre sozialistische Bewegung hervorgebracht hatte. 1905, nach einer Reihe beschämender militärischer Niederlagen, war das Vertrauen in die ohnehin schon unbeliebte Regierung aufgebraucht. In Sankt Petersburg schossen Soldaten in eine friedlich demonstrierende Menge: der Beginn der »liberalen« Revolution.
Der Erste Weltkrieg und die folgende Krise legten schonungslos offen, wie wenig Russland seine natürlichen Ressourcen unter Kontrolle hatte. Aufgrund von Kriegsverlusten und Missernten brach die Wirtschaft zusammen; in Sankt Petersburg, inzwischen hieß die Stadt Petrograd, gingen die Menschen wieder auf die Straße.[2]
Nikolaus II.Nikolaus II. dankte am 2. März 1917 ab, eine schwache provisorische Regierung übernahm die Staatsgeschäfte. Am 7. November[3] ergriffen die BolschewikiBolschewikiBolschewikiMachtübernahme unter Führung von Wladimir Ilitsch Uljanow, genannt LeninLenin, Wladimir Ilitsch, die Macht, waren aber weit davon entfernt, das ganze Land zu beherrschen. Es kam zum Bürgerkrieg. 1922 war Russland vom Kriegsgeschehen, von Massenhinrichtungen und einer ungeheuren Hungersnot verwüstet. Diese Erfahrung prägte viele der im Folgenden vorgestellten Wissenschaftler.
LeninsLenin, Wladimir Ilitsch Neue Ökonomische Politik lockerte ab 1921 den Griff, mit dem die revolutionäre Regierung die Wirtschaft gelenkt hatte, und ließ in begrenztem Rahmen wieder privatwirtschaftliche Unternehmen zu. Das war der Auftakt zu einer Phase außerordentlichen sozialen und kulturellen Wandels. So besuchte Stalins Sohn eine experimentelle Schule, die von den Psychoanalytikerinnen Sabina SpielreinSpielrein, Sabina und Wera SchmidtSchmidt, Wera Fjodorowna geleitet wurde. Der Lyriker und Ingenieur Alexej GastewGastew, Alexej Kapitonowitsch, eine Leitfigur während Russlands IndustrialisierungIndustrialisierung (Russland), bildete Zehntausende in der subtilen Kunst der Fließbandfertigung aus. Isaak SpielreinSpielrein, Isaak, SabinasSpielrein, Sabina Bruder, gründete einen »psychotechnischen« Verein, der sich die physische und psychische Emanzipation sowjetischer Arbeiter zum Ziel setzte. Lew Semjonowitsch WygotskiWygotski, Lew Semjonowitsch, Alexander Romanowitsch LurijaLurija, Alexander Romanowitsch und Alexej Nikolajewitsch LeontjewLeontjew, Alexej Nikolajewitsch stellten die Psychologie auf neue Grundlagen – ein ambitioniertes, ja schwindelerregendes Projekt. Dabei konnten sie auf ihren Erfahrungen mit Hirnverletzten oder Waisenkindern, auf Erkenntnisse, die mittels des LügendetektorsLügendetektor (den sie erfanden) gewonnen wurden, oder etwa auf Expeditionen ins tiefste Usbekistan aufbauen.
Nach LeninsLenin, Wladimir Ilitsch Tod im Januar 1924 wurde die Kommunistische Partei von internen Machtkämpfen zerrissen. Sämtliche Anwärter auf die Führungsposition wie etwa TrotzkiTrotzki, Leo wurden von einem Mann an den Rand gedrängt und letztlich vernichtet, der in der Oktoberrevolution kaum eine Rolle gespielt hatte, allerdings im Kaukasus ein wichtiger bolschewistischer Kader gewesen war. Josef Stalin hatte Kampftrupps aufgebaut, Streiks angezettelt, die Werbetrommel gerührt und mit Banküberfällen, Kidnapping und Erpressung Geld organisiert. Seine Konkurrenten unterschätzten die Möglichkeiten, die sich ihm durch seine Wahl zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei 1922 eröffneten. Stalin erkannte sofort, dass er in dieser Position andere Posten mit seinen Leuten besetzen konnte. So baute er eine Gefolgschaft auf, mit der er den Machtkampf für sich entschied. Ein Vierteljahrhundert lang herrschte er über die Sowjetunion und wurde einer der mächtigsten, mörderischsten Diktatoren der Geschichte.
Stalin stellte LeninsLenin, Wladimir Ilitsch Neue Ökonomische Politik ein und ersetzte sie durch von oben dirigierte Fünfjahrespläne. Einigen Wissenschaftszweigen sicherte die Planwirtschaft schier unbegrenzte Mittel. Für andere war sie eine Katastrophe.
Die IndustrialisierungIndustrialisierung (Russland)Stalin, Josef WissarionowitschIndustrialisierung (Russland) des großen Landes wurde in einem mörderischen Tempo durchgesetzt, und dabei spielte als ein Motor dieses Prozesses das berüchtigte Gulag-System eine wichtige Rolle, riesige Lager, in denen oft aus politischen Gründen verschleppte Häftlinge zu schwerster Fronarbeit gezwungen wurden. Rund achtzehn Millionen Menschen waren im Gulag interniert, eine Art schwarzer Spiegel des Staates, der sich seiner Wirtschaft und Wissenschaft rühmte. Mehrere Wissenschaftler von Weltrang verbrachten ihr Berufsleben in »Forschungsgefängnissen«.
Letztlich zählte Willfährigkeit. Stalin sah die Wissenschaft als Magd des Staates. Nicht unmittelbar anwendungsorientierte Forschung war nicht bloß überflüssiger Luxus, sie galt als Sabotage. Stalin investierte in die Wissenschaft, sorgte aber gleichzeitig für die Entlassung, Verhaftung und Ermordung einzelner Wissenschaftler. Ergonomieberater und Betriebspsychologen verschwanden spurlos. PsychoanalysePsychoanalyse wurde verboten. Genetiker, Botaniker und Agrarwissenschaftler wurden in Arbeitslager deportiert.
Auch auf der Verwaltungsebene wütete der Staat, legte willkürlich Institute zusammen und zentralisierte so lange, bis sich Kollegen an die Gurgel gingen, weil jeder um seine berufliche Existenz bangte. Dabei dachte niemand daran, ein Höchstalter einzuführen, bis zu dem gearbeitet werden durfte. Männer, die auf Machthunger und Ehrgeiz getrimmt waren, klammerten sich an ihre Lehrstühle. Ganze Disziplinen waren miteinander verfeindet. Physiologen attackierten Psychologen. Pathologen denunzierten Kliniker.
Zur Zeit von Stalins Tod am 5. März 1953 verfügte die Sowjetunion über den größten, bestausgestatteten wissenschaftlichen Betrieb der Geschichte. Er sorgte für den Ruhm und gab den Gebildeten zugleich Anlass zu Hohn und Spott.
Triumpf und Tragödie ist die Geschichte von Politikern, Philosophen und Forschern, die ein halbes Jahrhundert lang, zum Teil gezwungenermaßen, jeweils im Gebiet des anderen wilderten. Wir schütteln über solche Praktiken gern den Kopf. Priester haben in der Tagespolitik nichts verloren. Wissenschaftler sollten sich nicht über Religion lustig machen. In den Industriestaaten kennen wir klare Grenzen zwischen verschiedenen Diskursen und reagieren mit Unverständnis, wenn jemand die Wege verlässt und quer über den Rasen läuft.
Das war nicht immer so. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts erschien es Europäern noch möglich, dass sich Religion, Philosophie, Psychologie, Naturwissenschaften und Politik vereinen könnten. Selbst die BolschewikiBolschewiki waren sich nicht zu schade, Religion psychologisch zu interpretieren und in ihre Vorstellungen vom guten Leben zu integrieren.
Doch die Disziplinen konnten sich erst treffen, wenn die Dinge sich vollständig in ihre Bestandteile zergliedern ließen. Der Traum der Gelehrten Mitte des neunzehnten Jahrhunderts sah ungefähr so aus: Psychologie wird auf Physiologie reduziert, die auf Biologie reduziert wird, die auf Chemie reduziert wird, die auf Physik reduziert wird.
Friedrich EngelsEngels, Friedrich, der sich den dialektischen Materialismus als marxistische Variante des kritischen Denkens hat einfallen lassen, glaubte an die EinheitswissenschaftEinheitswissenschaft, glaubte, dass irgendwann in der Zukunft alle Einzeldisziplinen zu einer Wissenschaft zusammenfänden und dass diese eine Wissenschaft der Menschheit einen riesigen gesellschaftlichen Fortschritt bringen würde. In dieser Hinsicht ist sein Denken gähnend langweilig und konventionell.
Der Traum von der EinheitswissenschaftEinheitswissenschaft erodierte dank neuer Entdeckungen, und was dann passierte, ist Thema dieses Buches. Triumpf und Tragödie beschreibt, was dieser geplatzte Traum in einem Staat bedeutete, der sich auf die Wissenschaft als sein Fundament berief und seine eigene Wissenschaft, den MarxismusMarxismus, für den Höhepunkt der geistigen Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert hielt: eine allumfassende Wissenschaft. Es ist die Geschichte von ungeduldigen Gläubigen, die von Wissenschaftlern verlangten, dass die Zukunft sofort beginne.
Kein Wunder, dass sie ungeduldig waren. Kein Wunder, dass sie dachten, sie könnten damit durchkommen. Das frühe zwanzigste Jahrhundert war eine traumatische Zeit des Übergangs. Damals nahm das Universum Dimensionen an, die sich dem menschlichen Vorstellungsvermögen entziehen. 1917 wies der amerikanische Astronom Heber CurtisCurtis, Heber nach, dass eine Nova in einem bestimmten Spiralnebel hundertmal weiter entfernt ist als eine Nova in unserer eigenen Galaxie. 1924 bezifferte sein Zeitgenosse Edwin HubbleHubble, Edwin die Distanz zur nächstgelegenen Spiralgalaxie: zwei Millionen Lichtjahre. Und sie fanden heraus, dass das Universum expandiert. 1922 und 1924 errechnete der russische Physiker und Mathematiker Alexander Alexandrowitsch FriedmannFriedmann, Alexander Alexandrowitsch, einer der Begründer der modernen Kosmologie, dass das Universum nicht, wie bis dahin allgemein angenommen wurde, statisch sein muss und der Raum sich ausdehnen könnte: Ideen, die später zur Urknalltheorie führten.
Die sichtbare Welt entpuppte sich als winziger Ausschnitt des Ganzen. 1895 hatte Guglielmo MarconiMarconi, Guglielmo ein paar Kilometer weit langwellige Radiosignale gesendet, und seitdem war kaum ein Jahr vergangen, in dem nicht Wissenschaftler irgendeine Art von Wellen entdeckt hatten. Doch all das wurde 1933 von Fritz ZwickyZwicky, Fritz in den Schatten gestellt: Er erkannte, dass ein erheblicher Teil der Masse des Universums unsichtbar ist. Die fehlende Masse wurde als dunkle Materie bekannt, deren Existenz sich anhand von Gravitationseffekten nachweisen ließ.
Das war der Moment, in dem endgültig klar wurde, dass das Universum schwer durchschaubaren, ja sogar unheimlichen Gesetzen folgt. Die Physik entwickelte neue Gebiete wie RelativitätstheorieRelativitätstheorie und QuantenmechanikQuantenmechanik. Die Biologie ließ ihre deskriptiven Anfänge hinter sich und kämpfte jahrelang um die Vereinbarkeit von natürlicher Auslese und Genetik. Überall erkannte man unerwartete Beziehungen zwischen dem Lebenden und dem Unbelebten, dem ganz Großen und dem ganz Kleinen. 1917 entdeckte William HarkinsHarkins, William, dass leichte Elemente durch Kernfusion zu schweren Elementen werden und dass unsere ganze Welt buchstäblich aus Sternen besteht. Ein Jahr später wies der französische Biologe Paul PortierPortier, Paul nach, dass Mitochondrien, die »Kraftwerke« von Zellen, direkte Nachfahren von Bakterien sind.
Die Welt wurde komplex. Der englische Biologe Ronald FisherFisher, Ronald wollte, ebenfalls 1918, mittels statistischer Methoden die Veränderungen großer Populationen verstehen. Seine Kollegen zerbrachen sich jahrzehntelang den Kopf, um die seinen Thesen zugrunde liegende Mathematik nachzuvollziehen. Ab 1920 experimentierte Hermann StaudingerStaudinger, Hermann mit Makromolekülen und warf damit einen ersten Blick in die unvorstellbar komplizierte Welt der Polymere, eine Arbeit, für die er später den Nobelpreis bekam.
Die Welt wurde reich. Wissenschaftliche Forschung, die einst in privaten und universitären Laboratorien stattgefunden hatte, wurde nun von der Industrie finanziert. Die Massenproduktion entwickelte sich. Wir lernten, über Kabel miteinander zu kommunizieren. Wir lernten das Fliegen.
Die Welt wurde gesund. Menschen leben seither besser und länger. Die Medizin veränderte sich grundlegend durch neue Möglichkeiten der Schmerzbekämpfung, das Wissen um Keime und Bakterien, chemische Laboranalysen, neue diagnostische Instrumente und Medikamente.
Die Welt wurde beseelt. 1894 zog der spanische Mediziner Santiago Ramón y CajalRamón y Cajal, Santiago die Verbindung zwischen neuronalem Wachstum und Lernen: Einsichten, die die Physiologie unendlich bereicherten, während gleichzeitig die von FreudFreud, Sigmund, JungJung, Carl Gustav und SpielreinSpielrein, Sabina entwickelte PsychoanalysePsychoanalyse einen ganz anderen, faszinierenden Zugang zu geistigen und seelischen Prozessen eröffnete.
Zu diesem Nährboden steuerten sowjetische Wissenschaftler jene Neuerungen, Erkenntnisse und Entdeckungen bei, die Gegenstand meines Buches sind. Sie begannen als Zoologen, Psychologen, Geologen und Botaniker, waren tief in den klassisch-deskriptiven Traditionen der »Lebenswissenschaft« des neunzehnten Jahrhunderts verwurzelt und gelangten über verschlungene Wege zu ganz neuen Forschungsfeldern. Meine Protagonisten sind Helden – vom Biologen, der die physiologischen Auswirkungen der Ursache seines eigenen Todes festhält, bis zum Botaniker, der in einem dunklen Verlies wissenschaftliche Vorträge hält, während seine Frau, weil sie es nicht besser weiß, Lebensmittelpakete ans falsche Ende Russlands schickt; vom Biologen, der sich mittels Diebstahl, Betrug und Entführung einen Arbeitsplatz einrichtete, bis zu dem dichtenden Experten für Ergonomie und seinem allen Ernstes in Angriff genommenen Projekt, eine Maschine – eine richtige Maschine mit Strippen und Knöpfen – zu bauen, die neue Formen menschlichen Seins ausspucken sollte; von der Psychoanalytikerin, die den Begriff »Todesinstinkt« prägte, zum Zoologen, der in Guinea Menschen und Schimpansen miteinander kreuzen wollte. (Der Film King Kong wurde ein Jahr später gedreht.)
Diese Pioniere arbeiteten daran, die menschliche Lebenserwartung zu erhöhen, erforschten Sprache, Hirnfunktionen und die kindliche Entwicklung, gründeten die erste Managementberatung, erkundeten die Auswirkungen lebender Materie auf Felsen und Mineralien und entwickelten daraus ein Evolutionsmodell der Biosphäre; sie zeigten, wie sich DarwinsDarwin, Charles These von der natürlichen Auslese mit genetischen Befunden vereinbaren ließ, erfanden die moderne Naturschutzbewegung und sammelten jahrzehntelang auf weltweiten Expeditionen Pflanzen für eine Saatgutbank, die zu den wissenschaftlichen Wundern ihrer Zeit gehört. (Während des Zweiten Weltkriegs setzte Adolf HitlerHitler, Adolf eine Sondereinheit auf diese Samensammlung an, in der Hoffnung, die weltweite Nahrungsmittelversorgung unter seine Kontrolle zu bringen.)
Der Preis, den sie für die erstaunliche, sonderbare und letztlich tragische Ehe zwischen Staat und Wissenschaft zahlten, war immens. Umso wichtiger ist es mir, zu zeigen und zu würdigen, was sowjetische Wissenschaft für die Menschheit geleistet hat.
Prolog: Die Lunte brennt
(1856–1905)
Seit Jahrhunderten betrachtet die Regierung Wissen als notwendiges Übel.[1]
Wladimir WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch
Zwischen 1550 und 1800 eroberten die Zaren Jahr für Jahr im Schnitt ein Gebiet von der Größe der Niederlande; erst im neunzehnten Jahrhundert dämmerte »Besuchern aus Westeuropa, dass ihr Patrimonium an Größe die Oberfläche des Vollmondes übertreffe«.[2]
Mangels nennenswerter natürlicher Grenzen konnte sich Russland nur durch die Unterwerfung der Nachbarvölker schützen, es nutzte sie als Puffer gegen potenzielle Angriffe. Zu diesem Zweck baute es im neunzehnten Jahrhundert das mit Abstand größte stehende Heer Europas auf, eine Armee, die schon in Friedenszeiten zwei Drittel des Staatsbudgets verschlang. (Auf Bildung und Gesundheit entfielen sieben Prozent.)
Mit seiner gewaltigen Anhäufung rückständiger Kolonien, die nur von militärischer Gewalt und Alkohol zusammengehalten wurden, stand das Imperium auf tönernen Füßen.[3] Für einen Ausbau der Verkehrsverbindungen gab es kein Geld, geschweige denn für Hospitäler oder Schulen. Darunter litt auch die Armee: Da es kein strategisch durchdachtes Schienennetz gab, war eine Truppenverlegung per Eisenbahn nicht möglich. 1875, anlässlich des letztlich per Vertrag beigelegten Konflikts um die Kohlevorkommen auf Sachalin, teilte das Kriegsministerium in Sankt Petersburg dem Befehlshaber mit, er könne gern mehr Männer haben, müsse allerdings ein Jahr auf die Verstärkung warten, weil sie von Europa nach Asien laufen müssten.
Ohne eine funktionierende Verwaltung lässt sich schlecht Politik machen. In Russland gab es keine Institutionen, die Reformer hätten reformieren können, weder Ratsversammlungen noch Gewerkschaften, noch Gilden, noch Standesvertretungen, es gab wenige Schulen und kaum ein Krankenhaus, das den Namen verdient hätte, vielerorts existierten noch nicht einmal Straßen. Peter der GroßePeter der Große wollte die Modernisierung mit einer »preußischen Lösung« vorantreiben, um das riesige, weit verstreut lebende, unkultivierte Volk regierbar zu machen. Er schickte die Söhne des Adels zum Studium ins westliche Ausland und erwartete, dass sie seine Untertanen im immer noch feudalen System an die Kandare nahmen. Für die große Masse der Bevölkerung bedeutete Modernisierung Einschüchterung, Reglementierung, Ausgangssperren und drakonische Strafen zur Abschreckung.[4]
Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts war die russische Gesellschaft vielschichtiger geworden, es gab zarte Ansätze eines politischen Lebens. Doch die Hoffnung, die Obrigkeit möge das Land per Gesetz modernisieren, blieb – selbst die Anarchisten teilten sie. Von den Zaren bis zu deren erbittertsten Gegnern traute niemand den ungebildeten, argwöhnischen Massen zu, dass sie eigene Regierungsformen entwickeln könnten. LeninsLenin, Wladimir Ilitsch gouvernantenhaftes Staatsverständnis speiste sich aus diesem Misstrauen. Die von Stalin durchgepeitschte Kollektivierung der LandwirtschaftLandwirtschaftLandwirtschaftKollektivierung übertraf die Megalomanie der Zaren bei weitem, und unter Leonid BreshnewBreshnew, Leonid Iljitsch nahm der staatliche Größenwahn, der sich berechtigt sah, Dissidenten kurzerhand in Nervenkliniken zu sperren, gespenstisch surreale Züge an. Die kommunistische Idee ist nicht gescheitert, sie wurde nie ausprobiert, und der lange Schatten der preußischen Lösung lag – und liegt noch immer – über allem.
Das ist schade, zumal Russland nie arm war. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts exportierte das Land so viel Getreide wie kein anderes, es stand unter den führenden Industrienationen an fünfter Stelle. »In Bezug auf die Bevölkerungsgröße nimmt Russland den ersten Rang unter den zivilisierten Ländern der Erde ein«, prahlte ein amtliches statistisches Jahrbuch 1905.[5] Nach fast allen anderen Maßstäben bildete Russland allerdings das Schlusslicht. 1913 hatte das Zarenreich das zweitniedrigste Pro-Kopf-Einkommen Europas, nur im Osmanischen Reich verdiente die Bevölkerung noch weniger. Und auch in puncto Lebenserwartung – dreißig Jahre – lag es weit abgeschlagen zurück, in Großbritannien und den Vereinigten Staaten wurden die Menschen seit 150 Jahren deutlich älter.
Russlands Rückständigkeit erklärt sich durch seine Regierungsform. Jahrhundertelang hatten die Zaren das Leben der Nation bis ins kleinste Detail bürokratisch geregelt – ein gutes Mittel, um riesige Territorien zu erobern und dem eigenen Herrschaftsgebiet einzuverleiben, aber hoffnungslos ineffizient beim Aufbau einer Volkswirtschaft.
Westliche Beobachter führten die Entwicklungshemmung auf Russlands Unfähigkeit zurück, den Kapitalismus zu übernehmen: Wie sollte es sich ohne freie Marktwirtschaft aus dem dunklen Zeitalter befreien? Das ist nicht falsch: Der Kapitalismus hätte Russland genauso stark verändert wie den übrigen europäischen Kontinent und eine Insel zwischen Nordsee und Atlantik, die dank seiner zum Zentrum eines Imperiums wurde, in dem die Sonne nie unterging.
Doch der Kapitalismus scheiterte an der ehernen Natur des Landes selbst, er holte sich bei jedem Versuch, ins russische Kernland vorzustoßen, schlicht einen Schnupfen und starb.
Kapitalismus braucht Mehrwert. Bauern produzieren Nahrungsüberschüsse, um die Städter zu ernähren, und die Fabriken in den Städten bauen Maschinen, mit denen die Bauern noch mehr Nahrung produzieren können. Dieser Kreislauf ist das Schwungrad kapitalistischen Wirtschaftens. Aber russische Bauern haben niemals derartige Überschüsse produziert. Ihre LandwirtschaftLandwirtschaft war nicht darauf ausgerichtet, die Städter mit Lebensmitteln zu versorgen. Sie sollte verhindern, dass die Landbevölkerung verhungerte. Wir haben gutes Datenmaterial zu Landwirtschaft und Klima in Russland vom Jahr 873 an. In diesen gut tausend Jahren erlebte das Reich hundert Mangeljahre und über 120 Hungersnöte.
Russland ist groß, kalt und unwirtlich, je weiter östlich, desto kälter. Wenn der frierende Epichodow in TschechowsTschechow, Anton PawlowitschKirschgarten seufzt: »Unser Klima kann einfach nicht zuträglich sein«, ist das kein Witz – ein Drittel Russlands hat der Permafrost fest im Griff. Russlands Flüsse fließen fast alle Richtung Norden ins Polarmeer, weg von den eigentlich fruchtbaren Böden in Zentralasien. Drei Viertel der russischen Bevölkerung und Industrie haben nur zu einem Sechstel der Wasservorkommen direkten Zugang. Und Ackerland war und ist knapp. Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Ein Reich, größer als die sichtbare Fläche des Mondes, hat nicht genug fruchtbaren Boden, um seine Menschen zuverlässig zu ernähren. Es hängt von einem schmalen Band fetter schwarzer Erde ab, das sich von der Donau durch den Nordosten der Ukraine und das Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres bis Akmolinsk (heute Astana) im Osten zieht. Südlich davon ist die Niederschlagsmenge mit 250 Millimeter pro Jahr zu gering für ertragreichen Ackerbau, nördlich davon stimmt zwar die Niederschlagsmenge, aber die Böden sind zu karg, die Wachstumsperiode ist zu kurz und der winterliche Frost streng. In den 1880er Jahren konnte der fruchtbare Gürtel nicht einmal mehr ansatzweise den Bedarf decken, der mit der Bevölkerungsexplosion wuchs. (Zwischen 1890 und 1913 schoss die Getreideproduktion um ein Drittel in die Höhe, wurde aber sofort verbraucht.)
Studenten und Agrarreformer machten sich voller Enthusiasmus an die Neuzüchtung von Getreide, Früchten und Gemüse, neue Sorten, die auf ärmeren Böden, in kälteren und trockeneren Regionen gediehen und auf die Russland dringend angewiesen war. Leider war keiner dieser im Westen ausgebildeten Akademiker ein echter Landwirt, keiner hatte den politischen Status, um Millionen halb verhungerter Bauern zu überzeugen. Die verbesserten Getreidesorten waren Ladenhüter, die Leute bevorzugten ihr eigenes Saatgut, auch wenn es stark mit Unkrautsamen verunreinigt war.
Die LandwirtschaftLandwirtschaft in Russlands Norden war nicht eigentlich primitiv, war keine reine Subsistenzwirtschaft. Sie war ein kommunales Geschäft, eine Angelegenheit der Dorfgemeinschaft – und die brauchte keine nennenswerten Überschüsse.
In Mittel- und Südrussland herrschte hingegen eine feudalistische LandwirtschaftLandwirtschaft vor, Leibeigene unterstanden dem direkten Befehl adliger Grundherren. Das hemmte den nationalen Fortschritt so offensichtlich, dass sogar der nicht gerade für liberale Ansichten bekannte Nikolaus I.Nikolaus I. Ausschüsse bildete, die Reformvorschläge ausarbeiten sollten.
Aber erst Alexander II.Alexander II., erfolgreicher Feldherr und gewiefter Diplomat, packte den Stier bei den Hörnern. 1861 entließ er 22 Millionen Menschen, nahezu die Hälfte der Gesamtbevölkerung, aus der Sklaverei, indem er die Leibeigenschaft verbot. Riesige Flächen wechselten die Besitzer, denn viele Adlige stießen ihre Landgüter ab und verschwanden ins Ausland. Nur wenige nutzten die großzügigen staatlichen Entschädigungen, um ihre Güter zu modernisieren. Gleichzeitig war die Abschaffung der Leibeigenschaft damit verbunden, dass den Bauern dreizehn Prozent weniger Land zugesprochen wurde, als sie vordem bewirtschaftet hatten. In den fruchtbareren Landesteilen mussten die Landbewohner sogar auf fast die Hälfte der bislang bebauten Fläche verzichten.
Auf Grundbesitz wurden Steuern erhoben, und in die Bemessung wurden die Löhne der gerade befreiten jungen Männer einbezogen, die in die Städte abwanderten. Das Problem war, dass diese frischgebackenen Fabrikarbeiter es vorzogen, ihr sauer verdientes Geld in Kneipen und Läden auszugeben, anstatt es den Lieben daheim zu schicken. Insbesondere Moskau mit seiner wilden Mischung aus modernen Häusern und abbruchreifen Bretterbuden, Palais und Fabriken, schmalen Gassen und breiten Straßen, Plätzen und Boulevards zog junge Männer aus dem Umland an. Die Dorfgemeinschaften bluteten aus: Nur noch Frauen und alte Leute blieben, die landwirtschaftlichen Erträge sanken. Ein zeitgenössischer Bericht aus Klin, einem Rajon nordwestlich von Moskau, lässt erahnen, wie dramatisch die Lage war: »Die in Moskau lebenden Männer schicken so wenig Geld, dass es nicht einmal für die Hälfte der fälligen Steuern reicht, und die Familien kommen mit Ach und Krach halb verhungert übers Jahr. Und die Männer, die zu Hause geblieben sind und den Niedergang mitansehen müssen, betrinken sich lieber, als die Felder zu bestellen – die Zahl der Schenken hat massiv zugenommen, seit einigen Jahren gibt es in fast jedem Dorf mindestens zwei.«[6]
Als Maßnahme, um die Landflucht (und die Nahrungsmittelknappheit, die sich in den Städten zum Dauerzustand entwickelte) einzudämmen, wurde 1861 das Passgesetz verschärft. Väter straffällig gewordener Söhne hatten nun ein legales Mittel an der Hand, die schwarzen Schafe auf den Hof zurückzuholen: »Wenn du nicht antrittst, du Kanaille, verlängere ich deinen Pass nicht. Ich lasse dich von der Polizei nach Hause bringen, und wenn sie dich hier abliefern, verprügle ich dich im Distriktbüro vor den Augen anständiger Menschen eigenhändig mit der Birkenrute …«[7] Infolge des Passgesetzes hinterließ jeder Russe sein Leben lang aktenkundige Spuren.
Dann bekamen die Dorfgemeinschaften weitgehende Selbstverwaltungsrechte – mehr oder weniger ein Eingeständnis der Regierung, dass die ländlichen Gebiete unregierbar waren. Das war eine Neuerung, die besonders für junge Männer nichts Gutes verhieß. Ländliche Gemeinden standen traditionell in dem Ruf, ihre soziale Kontrolle mit recht drastischen Mitteln durchzusetzen. Öffentliche Auspeitschungen waren keine Seltenheit.
Die Erfahrungen mit der Aufhebung der Leibeigenschaft nährten in der winzigen liberalen Oberschicht die Überzeugung, dass einzig und allein demokratische Strukturen den Karren aus dem Dreck ziehen könnten. Unter den in städtischen Elendsvierteln zusammengepferchten unterernährten, unterbezahlten, unterbeschäftigten jungen Männern braute sich indes eine revolutionäre Stimmung zusammen.
Am 13. März 1881 fuhr Zar Alexander II.Alexander II. durch Sankt Petersburg zur Michaelsmanege, einem neoklassizistischen Gebäude, das seiner Leibgarde als Reithalle diente. Wie jeden Sonntag wollte er dort den Appell abnehmen. An diesem Tag stürzte sich Nikolai Iwanowitsch RyssakowRyssakow, Nikolai Iwanowitsch ins Menschengewühl auf den engen Bürgersteigen. Der junge Mann gehörte der Narodnaja Wolja (Volkswille) an, einer Gruppe, die mit allen Mitteln eine Revolution entfachen wollte. Sein Mittel war ein kleines, in ein Taschentuch gewickeltes weißes Päckchen.
Nach kurzem Zögern warf ich die Bombe den Pferden zwischen die Hufe, in der Annahme, dass sie unter der Kutsche hochgehen würde … Die Explosion drückte mich in den Zaun.[8]
Die Bombe demolierte nur die gepanzerte Kutsche des Zaren, ein Geschenk von Napoleon III. Der Herrscher stieg schockiert, aber unverletzt aus – und eine Sekunde später warf Ignati Ioachimowitsch GrinewizkiGrinewizki, Ignati Ioachimowitsch sein Päckchen Alexander II.Alexander II. vor die Füße.
Die Narodnaja Wolja hatte Russland vor der Autokratie des Monarchen bewahren wollen, aber ihr Attentat sicherte die Herrschaft der Zarenfamilie eher und führte dazu, dass die Unterdrückung noch verschärft wurde. Der Thronfolger verwand den schrecklichen Tod seines Vaters – die Beine weggerissen, der Bauch aufgeplatzt, das Gesicht entstellt – zeitlebens nicht. Die Hoffnung, die zaristische Regierung sei zu Reformen fähig, war von Anfang an gering gewesen. Unter Alexander III.Alexander III. zerstob sie endgültig.
Erster TeilKontrolle
(1905–1929)
Sowjetische Bürgerwissenschaft: ein Aero-Veloziped, erfunden von einem Moskauer Arbeiter. Bei Versuchen kam es auf durchschnittlich 140 Stundenkilometer.
Und es schien, nur noch ein bisschen – und die Lösung würde gefunden, und dann würde ein neues, wunderbares Leben beginnen; und … [es] war doch klar, dass es bis zum Ende noch weit, sehr weit war und dass das Komplizierteste und Schwierigste gerade erst begann.
ANTON TSCHECHOWTschechow, Anton Pawlowitsch, »Die Dame mit dem Hündchen«, 1899
1. Gelehrte
»Fremde Bedürfnisse wie eigene behandeln«: Wladimir WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch (sitzend, rechts) und seine idealistischen Freunde 1884 an der Universität von Sankt Petersburg.
Ende des neunzehnten Jahrhunderts entstand in Russland eine fundamental wichtige Gesellschaftsgruppe: eine starke, gut ausgebildete Intelligenzija mit unerschütterlichen Prinzipien, die auf geistigen Werten beruhten. Dieses Milieu brachte Revolutionäre, Lyriker und Ingenieure hervor, die überzeugt waren, man müsse etwas aufbauen, etwas Nützliches tun.[1]
Der Physiker Jewgeni FeinbergFeinberg, Jewgeni über seinen Doktorvater Igor TammTamm, Igor
Wenn man in Moskau morgens Richtung Südost losfährt, erreicht man bei Einbruch der Dunkelheit Tambow. Nahe der Stadt steht mitten im Wald ein hübsches, einstöckiges Holzhaus, das, abgesehen von den modernen Schildern, einem Roman TurgenjewsTurgenjew, Iwan Sergejewitsch entsprungen sein könnte und als Museum genutzt wird. Drinnen sind Wladimir Iwanowitsch WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch Arbeitszimmer, Bibliothek und Wohnzimmer zu besichtigen, man erfährt Rudimentäres über sein Leben und seine Politik, etwa, dass er James LovelocksLovelock, James Gaia-Hypothese, der zufolge Lebewesen und Geologie ein dynamisches System bilden, um ein Jahrhundert vorweggenommen habe. Über seine Rolle als Pate der russischen Atomenergie schweigen sich die Tafeln weitgehend aus.
Sein Vater Iwan WernadskiWernadski, Iwan, Lehrer für Wirtschaft und Statistik am Elite-Lyzeum Zarskoje Selo nahe Sankt Petersburg, heiratete nach seiner Ehe mit einer frühen Feministin des Reiches – Russlands erster Wirtschaftswissenschaftlerin Marija SchigajewaSchigajewa, Marija, die viel zu jung an Tuberkulose starb – 1862 die Musiklehrerin Anna Petrowna KonstantinowitschKonstantinowitsch, Anna Petrowna, WladimirsWernadski, Wladimir Iwanowitsch spätere Mutter, eine entfernte Verwandte seiner ersten Frau, lebhaft und warmherzig, allerdings ohne deren intellektuelle Ambitionen.
1868 erlitt Iwan WernadskiWernadski, Iwan während einer hitzigen Debatte in der Kaiserlichen Freien Ökonomischen Gesellschaft einen Hirnschlag, gab seine Stelle am Lyzeum auf und zog mit der Familie nach Charkiw (russisch Charkow), wo er die örtliche Niederlassung der Nationalbank leitete. Hier verlebte der 1863 geborene WladimirWernadski, Wladimir Iwanowitsch eine glückliche Kindheit, und seine Erinnerungen an sie beginnen nicht in den frühen Sankt Petersburger Jahren, sondern in der ukrainischen Bezirkshauptstadt, wo er stundenlang den Ausführungen seines eigensinnigen Onkels Ewgraf KorolenkoKorolenko, Ewgraf lauschte, eines im Haus der Familie lebenden alten Herrn mit weißem Rauschebart.
Viele Jahre später, 1886, schrieb Wladimir WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch seiner Braut:
Ich erinnere mich an kalte, klare Winternächte. Onkel ging vorm Schlafengehen gern spazieren, wann immer möglich, begleitete ich ihn. Ich liebte es, in den Himmel zu schauen. Die Milchstraße faszinierte mich, und an diesen Abenden hörte ich ihm gebannt zu, wie er von den Sternen erzählte. Danach lag ich lange wach. In meiner Phantasie wanderten wir immer weiter durch die endlose Weite des Weltalls … Seine Geschichten hatten so großen Einfluss auf mich, dass ich mich bis heute nicht davon befreit habe … Manchmal denke ich, ich bin es ihm und nicht nur mir schuldig, Großes zu leisten, denn sonst wäre auch sein Leben vergebens gewesen.[2]
1876 kehrte die Familie nach Sankt Petersburg zurück. Dort durchforstete der inzwischen dreizehnjährige WladimirWernadski, Wladimir Iwanowitsch die Buchhandlungen, trug alles zusammen, was er über die verlorene Heimat finden konnte, brachte sich selbst Ukrainisch bei und lernte obendrein Polnisch, weil viele Bücher über die Ukraine in dieser Sprache verfasst waren.
Als Student an der Universität Sankt Petersburg war er – so beschreibt ihn Wladimir Alexandrowitsch PossePosse, Wladimir Alexandrowitsch, ein Kommilitone – »eine sehr zarte Erscheinung, aber äußerst zielstrebig, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte«. Laut PossePosse, Wladimir Alexandrowitsch, damals angehender Mediziner, später ein führender marxistischer Journalist, waren WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch und dessen engster Freund, Sergej Fjodorowitsch OldenburgOldenburg, Sergej Fjodorowitsch, »bereits fest entschlossen, nicht nur Professoren, sondern darüber hinaus auch Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu werden«.[3]
WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch und sein Freundeskreis an der Universität waren reicher als die meisten ihrer Kommilitonen. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch hatte von seinem Vater eine Liegenschaft mit 750 Hektar in Wernadowka nordöstlich von Tambow im Süden Russlands geerbt. Die jungen Männer diskutierten ganze Nächte durch. Einmal schlug einer von ihnen den gemeinschaftlichen Erwerb eines Landguts vor. Es sollte »prijut«, »Heimstatt«, heißen. Der Plan wurde verworfen, aber die Gruppe hatte einen Namen: die Heimstatt-Bruderschaft. Man spürt den Einfluss TolstoisTolstoi, Lew Nikolajewitsch – die jungen Männer wollten ihr Leben dem russischen Volk widmen und dafür, so OldenburgsOldenburg, Sergej Fjodorowitsch Formulierung, »so viel wie möglich arbeiten und schaffen, so wenig wie möglich konsumieren und fremde Bedürfnisse wie eigene behandeln«.[4]
Die Gruppe zog viele gleichaltrige Frauen an, die von höherer Bildung ausgeschlossen waren und sich geistige Anregungen holten, wo immer sie konnten.[5] Deshalb engagierten sie sich gern in der Alphabetisierungskampagne der Bruderschaft, suchten geeignete Lesestoffe aus, stellten Lektürelisten zusammen und organisierten einen Buchverleih.
Nicht nur WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch fand in diesem weit mehr als geistigen Miteinander seine Frau, allerdings führten sich seine Heimstatt-Kumpel bei seiner Heirat recht schnöselig auf – sie blieben ihr fern. Wladimir IwanowitschWernadski, Wladimir Iwanowitsch und Natalja StarizkajaStarizkaja, Natalja gaben sich mit dem ganzen Programm von verschnörkelten Einladungskarten über Frack und Hochzeitskleid bis zur Musikkapelle das Jawort.
WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch, der Mineraloge in spe, studierte zur richtigen Zeit am richtigen Ort: In Sankt Petersburg lehrten Dmitri Iwanowitsch MendelejewMendelejew, Dmitri Iwanowitsch, Alexander Michailowitsch ButlerowButlerow, Alexander Michailowitsch und Wassili Wassiljewitsch DokutschajewDokutschajew, Wassili Wassiljewitsch. DokutschajewDokutschajew, Wassili Wassiljewitsch, Professor für Mineralogie, schickte seinen Schüler auf spannende, manchmal auch gefährliche Expeditionen in die exotischsten Ecken Russlands. ButlerowButlerow, Alexander Michailowitsch war ein Vorreiter der modernen Chemie. Rund zehn Jahre bevor BecquerelBecquerel, Henri1896 die Radioaktivität entdeckte, widersprach ButlerowButlerow, Alexander Michailowitsch der Ansicht, Atome seien unteilbar, und stritt darüber mit MendelejewMendelejew, Dmitri Iwanowitsch. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch wurde Zeuge so mancher lebhafter Diskussion. MendelejewMendelejew, Dmitri Iwanowitsch hatte das Periodensystem entwickelt. Hielt er Vorlesungen, war der Hörsaal immer gerammelt voll. Seinen Gedanken zu folgen, bedeutete, so WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch, »eine neue, wundersame Welt zu betreten … ein Gefühl, als werde man aus der Umklammerung eines eisernen Schraubstocks befreit«.[6] Seine drei Mentoren prägten WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch Verständnis des Planeten: Alles ist im Wandel, auch die chemischen Elemente, die sich in geologischen Zeiträumen ihren Weg durch die Erdkruste bahnen.
Wie in seiner Generation üblich, führte WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch sein Studium im Ausland fort. In Neapel musste er allerdings feststellen, dass der weltweit anerkannte Kristallograph Arcangelo ScacchiScacchi, Arcangelo senil wurde, und wechselte daraufhin nach München ins Labor des Mineralogen Paul GrothGroth, Paul Heinrich von. Aus WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch Korrespondenz wissen wir, dass er sich dort wie im intellektuellen Schlaraffenland fühlte.
1887 wurde ihm ein Sohn, Georgi, geboren (der sich als George VernadskyVernadsky, George in den USA einen Ruf als Historiker erwarb). NataljaStarizkaja, Natalja zog sich mit dem Säugling nach Finnland in die Datscha ihrer Familie zurück, WladimirWernadski, Wladimir Iwanowitsch blieb in München, knüpfte und pflegte Kontakte, die seiner späteren Karriere sehr förderlich waren. Im Sommer 1888, beim Wandern in den Alpen, hatte er ein für ihn entscheidendes Heureka-Erlebnis: Betreibt man, überlegte er, Mineralogie auf die richtige Weise, nämlich als Wissenschaft vom Wandel und Energietransfer, ließe sich durch sie die Geschichte des Weltalls mit der des Lebens verbinden. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch blieb von der Idee der Entwicklung der Erde im kosmischen Maßstab zeitlebens fasziniert, obwohl er befürchtete, Wissenschaftler wie GrothGroth, Paul Heinrich von würden ihn dafür als Phantasten abstempeln.[7]
1889 wechselte er ans Collège de France in Paris (»die herrlichste Stadt, die ich je gesehen habe«). Auf einen Russen musste das Collège tiefen Eindruck machen: keine eingeschriebenen Studenten, nur Professoren (die trotzdem verpflichtet waren, Vorlesungen zu halten), kleine Laboratorien und eine unglaublich gut sortierte Bibliothek. Hier herrschten optimale Bedingungen für Wissensvermittlung und Forschung. Die Wissenschaftler waren gut ausgestattet, und ihre Ideen wurden ernst genommen. Man konnte ungeschützt reden, ohne Gefahr zu laufen, ins Visier der Obrigkeit zu geraten. Es war eine Stätte von anderer Lebensart.
In WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch Heimat waren Universitäten Unterrichts-, keine Forschungseinrichtungen und schon gar keine intellektuellen Schmelztiegel. (Die zaristische Verwaltung rekrutierte ihren Nachwuchs aus einer Handvoll teurer Institute, die nur Kindern des Adels zugänglich waren: der Kadettenschule genannten Militärakademie, dem Alexander-Lyzeum Zarskoje Selo und der Reichsakademie für Rechtswissenschaften.)
In den dreißig Regierungsjahren von Nikolaus I.Nikolaus I. war die Bildungspolitik ausgesprochen repressiv. Inspektoren überwachten die Studenten und stellten unordentliche Uniformen oder lange Haare unter Strafe. In Kiew wurde beispielsweise ein Student, der unangemessen gekleidet zum obligatorischen Gottesdienst erschienen war, der Kirche verwiesen und am nächsten Tag exmatrikuliert.
Nach dem Tod von Nikolaus I.Nikolaus I.1855 wurden die Vorschriften gelockert. Prompt marschierten in Kiew begeisterte polnische Studenten in Nationaltracht durch die Straßen. Studenten an der Kasaner Universität streiften sich Tierfelle über. In Moskau und Sankt Petersburg wurde es unter Kommilitonen Mode, bäuerliche Kleidung zu tragen, aus Solidarität mit den damals noch nicht befreiten Leibeigenen. Fassungslos über diese von ihr ausgelösten Auswüchse, zog die Regierung die Zügel sofort wieder an, erhöhte die Studiengebühren, verbot studentische Versammlungen, führte die alten Benimmregeln und Uniformen wieder ein. Die neuerliche Repression hatte über Jahrzehnte Bestand. Jedweder Zusammenschluss von Studenten, ob sie Lesestuben, Mensen, Imbissstände, Theateraufführungen, Konzerte oder Bälle organisierten, alles, was nicht akademischen Charakter hatte, war untersagt, und wehe dem, der in der Vorlesung Beifalls- oder Missfallensäußerungen von sich gab. All das konnte Verwarnungen, bis zu vier Wochen Karzer, einen befristeten Verweis oder den Ausschluss vom Lehrbetrieb nach sich ziehen.
Als WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch, einem Ruf an die Moskauer Universität folgend, nach Russland zurückkehrte, stellte er rasch fest, dass sich während seiner Abwesenheit wenig geändert hatte. Die Stadt stank, war staubig und provinziell, die staatliche Überwachung allgegenwärtig. Trat WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch morgens aus dem Haus, standen stets einige Männer mittleren Alters, bekleidet mit Trenchcoat und Melone, in der Nähe. Er begann, sie freundlich zu grüßen, bis er eines Tages, als er eine Auslandsreise antreten wollte, bemerkte, wie ihm einer der Herren am Bahnhof hinterherschlich, und ihm klar wurde, dass es sich um Spitzel handelte. In seiner Polizeiakte heißt es:
Anfang der Neunziger verlegte WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch seinen Lebensmittelpunkt … nach Moskau, wo er weiterhin seine dubiosen Bekanntschaften pflegte und aktiv an von Studenten der Moskauer Universität organisierten Abenden teilnahm und diese nutzte, um Vorträge über die Notwendigkeit zu halten, dass Lehrende und Lernende zum Zwecke der politischen Jugendbildung und des Kampfes gegen die gegenwärtige Regierung zusammenarbeiten müssten.[8]
Der Fachbereich war erbärmlich ausgestattet, selbst Grundlagenliteratur nicht zugänglich, die mineralogische Sammlung seit 1850 nicht abgestaubt, geschweige denn katalogisiert worden. Korruption trieb üppige Blüten, nachgeordnete Verwaltungsbeamte vermieteten unter der Hand Räume, die für Laboratorien vorgesehen waren, als Studentenunterkünfte. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch konnte sich offenbar recht konkret vorstellen, wie das enden würde, und brachte Wernadowka für den Fall der Fälle auf Vordermann.
Falls es hart auf hart kommen und er aus der Universität fliegen sollte, wollte er mit seiner Familie ganzjährig bequem auf und von seinem Landgut leben können. Doch der Herbst 1891 erschütterte WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch und trieb ihn in die Politik. Die Ernte im lebenswichtigen schmalen Gürtel fruchtbaren russischen Ackerlandes fiel aus. In Tambow und an vielen anderen Orten wütete eine Hungersnot.
Die Krise kam nicht über Nacht. Der Herbst 1890 war zu trocken gewesen, um die Saat für das Wintergetreide rechtzeitig auszubringen, der Winter setzte früher ein als sonst, und zu allem Überfluss schneite es kaum. Die ungeschützten Samenkörner erfroren.
Ganz Osteuropa litt unter Missernten, aber die anderen Länder hatten Geld und konnten den Mangel durch Einfuhren ausgleichen. In Russland dagegen war die Sommergetreideernte unverzüglich für den Export beiseitegeschafft worden, und die Bevölkerung darbte.
Sogar in Moskau und Sankt Petersburg wurde das Getreide knapp. LeninLenin, Wladimir Ilitsch beschrieb das Hungerbrot jener Zeit als »einen Klumpen harter schwarzer Erde, umgeben von einer Schimmelkruste«. Die Landbevölkerung streckte ihr Brot und ihren Brei mit Spreu und Gras.
Im weiteren Verlauf des Jahres wuchs sich die schlimme Lage zur Katastrophe aus: 1891 fiel fünf Monate lang kein Tropfen Regen, der Sommer war zu heiß für Gemüsesetzlinge, aber den Bauern blieb keine Wahl, sie mussten es versuchen, und die Pflänzchen verdorrten auf den Feldern. Im Herbst goss es wie aus Kübeln, sintflutartige Regenfälle spülten die Wintersaat fort.
Im Frühjahr 1892 blies der Wind den Bauern die kostbare Krume vom Acker, Sandstürme verdunkelten die Sonne und ließen den Tag zur Nacht werden. Zeitzeugen – wie der Bodenkundler Per SemjatschenskiSemjatschenski, Per – berichten einhellig, das Phänomen habe die Menschen so erschreckt, dass die Angst vorm Weltuntergang umging.[9] Züge konnten wegen Sandverwehungen auf den Schienen nicht fahren, Feldfrüchte verfaulten unter Staubschichten. In manchen Gegenden starb die gesamte Flora ab, nicht einmal Gräser überlebten. Die Bauern schlachteten ihr Vieh, sie wären sonst verhungert.
Es war eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Nach einer Schätzung des britischen Wirtschaftsattachés in Sankt Petersburg, E.F.G. Law, stand die russische Regierung vor der Aufgabe, Maßnahmen gegen die Hungersnot von über 35 Millionen Menschen in sechzehn Rajons zu ergreifen. Selbst in der Oblast Tambow, die relativ gut dastand, halbierte sich der Viehbestand. WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch Gutsverwalter schrieb seinem Dienstherrn, die Bauern würden ihre Tiere zu Spottpreisen an den Landadel verkaufen, ein Viertel nage bereits buchstäblich am Hungertuch, die Frauen streckten die schwindenden Roggenmehlvorräte mit Heu und Ziegelstaub. Sie stünden in Wernadowka vor der Tür und bettelten um Hilfe.
WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch blieb in Moskau, überzeugt, dort mehr bewirken zu können. Er war ein begnadeter Organisator und rief mit seinen Freunden eine Hilfsaktion ins Leben. Ein pensionierter Tambower Nachbar, W.W. KellerKeller, W.W., erkundete die Lage vor Ort und hielt ihn auf dem Laufenden. KellerKeller, W.W. und L.A. OboljaninowOboljaninow, L.A., auch er ein Freund WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch, informierten sich bei Lew TolstoiTolstoi, Lew Nikolajewitsch über dessen Maßnahmen und übertrugen die von ihm erprobte Organisationsform auf Wernadowka. Der Historiker Alexander KornilowKornilow, Alexander kündigte in Moskau seinen Beamtenposten und beteiligte sich. Iwan GrewsGrews, Iwan, ein Mittelalterspezialist, schloss sich an. Weitere Männer, unter Wahrung strikter Anonymität sogar der Onkel des Zaren, Großherzog Nikolai, folgten dem Beispiel. Später wechselten sie allesamt in die Politik. Ihre spontane Hilfe erreichte mehr, als sie sich hätten träumen lassen, und bestärkte diese liberalen Köpfe. Im Juli 1892 war die akute Krise beigelegt, in Tambow versorgten 121 Hungerküchen 6000 Menschen, tausend Pferde wurden vor dem Abdecker bewahrt, 220 weitere per Los Familien ohne Pferd kostenlos zugeteilt.
Daraus ergab sich eine Frage: Wenn all das einer Handvoll Professoren gelang, warum nicht der Regierung?[10]
Die Hungersnot 1891 verschaffte der liberalen Opposition – jenen erschlafften Intellektuellen, die TurgenjewTurgenjew, Iwan Sergejewitsch und TschechowTschechow, Anton Pawlowitsch in ihren Erzählungen gern aufs Korn nahmen – das kurze Vergnügen, politische Macht auszuüben. Sie genossen die Zeit, machten das Beste daraus, bewiesen sich selbst, dass sie etwas bewirken konnten: Sie hatten Blut geleckt. Ihre vorbildliche Reaktion auf die Hungersnot – rational, wissenschaftlich, bürokratisch im besten Sinne – gab den gebildeten Schichten Russlands Hoffnung. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch und seine Freunde hatten exemplarisch gezeigt, wie es aussehen könnte, wenn fähige Leute in der Regierung säßen. Die Idee zog weite Kreise. Aber um sie in die Tat umzusetzen, musste man sich organisieren.
Der im Juli 1903 gegründete »Bund der Befreiung« warb in aller Öffentlichkeit friedlich für ein Ende der Alleinherrschaft der Zaren. Die wenigen Mitglieder, rund zwanzig Liberale und Radikale, trafen sich in WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch Moskauer Wohnung. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch schrieb seiner FrauStarizkaja, Natalja: »Für mich ist wissenschaftlicher Fortschritt untrennbar mit Demokratie und philanthropischer Gesinnung verbunden – und umgekehrt.«[11]
Jenseits der gut betuchten liberalen Enklaven in Moskau und Sankt Petersburg war es schwer, für solche Ideen Unterstützer zu gewinnen.
Am 22. Januar 1905, einem Sonntag, marschierten mehr als hunderttausend streikende Arbeiter mit ihren Familien zum Petersburger Winterpalais. Sie hielten Ikonen hoch und sangen Kirchenlieder, wollten den Zar um eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen bitten, um den Achtstundentag. Soldaten schossen in die Menge, töteten und verwundeten Hunderte. An diesem Tag starb ein junger Geologe, B.A. LuriLuri, B.A., WernadskisWernadski, Wladimir Iwanowitsch begabtester Schüler, der mit einem Köfferchen im Alexander-Garten unterwegs war und von zwei Kugeln in den Rücken getroffen wurde. Außer sich vor Wut schrieb WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch an eine der führenden liberalen Zeitungen Russlands, »ein weiteres Opfer in der langen Märtyrergeschichte der russischen Intelligenzija« sei zu beklagen. Doch die Zeit für erboste Leserbriefe war längst abgelaufen.
Nach dem Massaker streikten die Studenten, was dazu führte, dass die Regierung – eine ganz untypische Geste – bei den Fakultätsräten anfragte, ob die Lehrtätigkeit fortgesetzt werden sollte oder nicht. Vielleicht wollten sie den Professoren das Gefühl vermitteln, man lege Wert auf ihre Meinung. So oder so, die Antwort fiel eindeutig aus. Keine einzige Universität plädierte für Wiederaufnahme der Vorlesungen. Die Räte erklärten, ohne politische Reformen käme das akademische Leben nicht zur Ruhe. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch appellierte an seine Kollegen, mit der Tradition zu brechen. Sie seien nicht Handlanger der Obrigkeit, sondern unabhängige, freie Menschen, die sich nicht herumschubsen ließen, als würden sie »auf einer gottverlassenen Philippinen-Insel lehren«.[12]
Und so taten die Ordinarien etwas ganz und gar Illegales: Sie schlossen sich zusammen und erklärten, die Freiheit der Alma Mater sei mit der derzeitigen russischen Regierungsform unvereinbar. Bis August trat mehr als die Hälfte der Universitätsprofessoren Russlands dem AkademikerbundAkademikerbund bei.
Ihnen fehlte nur ein nationales Ereignis, das ihnen Raum ließ, Mut zu beweisen. Es trat vier Monate später in Gestalt der Seeschlacht im Japanischen Meer ein, in deren Verlauf Admiral Tōgō Heihachirō am 27. und 28. Mai 1905 die halbe russische Kriegsflotte in der Koreastraße versenkte. Das war die Chance für den Akademikerbund – und die Herren Gelehrten vergeigten sie komplett.
»Alle Mittel sind jetzt erlaubt, um die Gefahr abzuwenden, die ein Fortbestehen unserer derzeitigen Regierung darstellen würde«, hieß es in dem dramatischen Appell des Zusammenschlusses verschiedener Professorenverbände, zu der auch der AkademikerbundAkademikerbund gehörte, und weiter: »Die Verbrecherbande, die die Macht an sich gerissen hat, muss aus dem Amt gejagt und durch eine gesetzgebende Versammlung ersetzt werden … die den Krieg und das gegenwärtige Regime schnellstmöglich beendet.«[13]
Und wo war der AkademikerbundAkademikerbund? Seine Mitglieder saßen brav zu Hause. Ihnen war ihr Dachverband zu radikal geworden, sie boykottierten dessen Versammlungen.
Dann machten die Studenten etwas völlig Unerwartetes und lösten damit eine Kettenreaktion aus, die Mitte Oktober 1905 zum Generalstreik und zur Revolution führte: Sie kehrten in die Alma Mater zurück.
Allerdings nicht allein. Nach einer Reihe öffentlicher Kundgebungen schauten sich neugierige Arbeiter in den Universitäten um. Keiner wusste so recht, was man mit ihnen anfangen sollte. »Wir hatten keine Tagesordnung und keine Rednerliste«, erinnert sich ein Zeitzeuge. »Ich sprach einige Willkommensworte und eröffnete die Diskussion dann für alle Anwesenden. Die Aussprache war total chaotisch. Einige, die sich zu Wort gemeldet hatten, konnten sich überhaupt nicht artikulieren.«[14]
Die Polizei hielt sich zurück, eine Nachricht, die sich bei den Arbeitern schnell herumsprach. Aus einigen Neugierigen wurden Menschenmassen. Ganze Fabrikbelegschaften belagerten die Hörsäle. So mancher erhob sich und las selbstgeschriebene Gedichte vor. Im Oktober war es so weit, dass die Statik der Gebäude dem Ansturm nicht mehr gewachsen schien.
Der Moskauer Polizeichef ließ verlautbaren, wenn die Versammlungen auf die Straße übergriffen, werde scharf geschossen. Der Rektor der Moskauer Universität, Fürst Sergej Nikolajewitsch TrubezkojTrubezkoj, Sergej Nikolajewitsch, veranlasste die Schließung: »Die Universität ist kein Ort für politische Versammlungen. Sie kann und soll kein öffentlicher Platz sein, und umgekehrt kann ein öffentlicher Platz keine Universität sein. Jeder Versuch, die Universität zu einem öffentlichen Versammlungsraum zu machen, wird sie zerstören.«[15]
Angesichts der Verantwortung konnte Fürst TrubezkojTrubezkoj, Sergej Nikolajewitsch kaum anders handeln. Aber er schickte die Arbeiter damit faktisch direkt vor die Gewehrläufe der Moskauer Sicherheitskräfte. Die Gewalt auf der Straße eskalierte.
Am 4. Oktober fasste kein Geringerer als LeninLenin, Wladimir Ilitsch die Zwickmühle, in die sich die Professoren manövriert hatten, ohne sonderliches Mitgefühl in einem Artikel zusammen:
Sie schlossen die Universität in Moskau, weil sie ein Gemetzel in der Universität befürchteten. Sie riefen dadurch nur noch rascher ein viel größeres Gemetzel auf der Straße hervor. Sie wollten die Revolution in der Universität ersticken und entfachten nur die Revolution auf der Straße. Sie sind gehörig in die Klemme geraten …[16]
Im Juni 1905 entartete in Odessa ein Generalstreik zu Kämpfen zwischen Streikenden, Reaktionären und Ordnungskräften, und im Hafen meuterte die Besatzung des Panzerkreuzers »Potemkin«. Die Bilanz: zweitausend Tote, dreitausend Verwundete.
Am 8. Oktober legten die Eisenbahner in Moskau die Arbeit nieder. Andere schlossen sich an, am 13. Oktober ging in Russland nichts mehr. Zwei Tage später rief der Zar seine engsten Berater zu sich. Er stand vor einer haarsträubenden Wahl: umfassende Reformen gestatten oder die Regierungsgeschäfte an Militärs abtreten. Zwei Tage später versprach Nikolaus II.Nikolaus II., als zweite Kammer neben dem Reichsrat eine gewählte Nationalversammlung – die Duma – zu schaffen und sie mit legislativen Befugnissen auszustatten. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch und einige weitere Aktivisten unter den Intellektuellen gründeten in aller Hast die Konstitutionell-Demokratische Partei, genannt die KadettenKadetten, als Sprachrohr liberaler Politik. (Kritiker bezeichneten sie auch spöttisch als Professorenpartei.)
Doch der schwache, verspätete Versuch einer parlamentarischen Demokratie funktionierte nie richtig. Die Kluft zwischen Großgrundbesitzern und Volk, Reaktionären und Radikalen, Jungen und Alten war zu groß, und außerdem hatte die »liberale Revolution« mit einem Blutbad angefangen. 1905 kamen weit mehr Menschen ums Leben als bei der Revolution 1917. Eine Woche der Pogrome folgte auf den Zarenerlass, in deren Verlauf am Erhalt des Status quo interessierte Bürger – Tagelöhner, kleine Händler und Handwerker – jene angriffen, die sie ihrer Meinung nach ruiniert hatten. Dazu zählten insbesondere Studenten, Liberale und Juden.
Um die Ordnung wiederherzustellen, rückte die Armee in Moskau ein. Im Dezember 1905 nahm sie die Stadt unter Beschuss, über tausend Menschen starben.
Die Bauern revoltierten. Um die Aufstände der Landbevölkerung niederzuschlagen, wurden Unzählige standrechtlich abgeurteilt und rund 14000 Menschen hingerichtet. Strafexpeditionen durchkämmten brandschatzend, plündernd und mordend weite Gebiete des Baltikums, Polens und entlang der transsibirischen Eisenbahnstrecke. »Spart nicht an Munition«, hatte man den Soldaten aufgetragen, »und macht keine Gefangenen.«
Der Landadel sah zu, dass er seine Ländereien losschlug. Immobilienpreise und Pachteinnahmen befanden sich im freien Fall.
Im Winter 1905 herrschte eine Hungersnot, nicht in dem Ausmaß wie 1891/92, aber bedrohlich genug, um das politische Chaos noch weiter zu verschlimmern. WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch organisierte mit seinem Ältesten und dem Gutsverwalter von Wernadowka Hilfe für die Hungernden und wies bei der Gelegenheit die Bauern auf die anstehenden Parlamentswahlen hin. Prompt wurde das Trio verhaftet. Der Sohn kam nach einer Woche frei, aber WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch musste beim Premierminister, Graf Sergej WitteWitte, Sergej, vorsprechen, bevor der Verwalter und dessen Familie aus der Haft entlassen wurden.
In der Hauptstadt Sankt Petersburg »drang ein eisiger Schauder des Verdrusses über Parteien, Politiker und Verbände wie ein Messer in die Herzen der Menschen. Bitterer Zank entbrannte, und am Ende scherte sich niemand um irgendetwas … Jeglicher Glaube und jegliches Vertrauen waren erloschen.«
Der Lyriker und politische Aktivist Alexej Kapitonowitsch GastewGastew, Alexej Kapitonowitsch, der im Frühjahr 1906 aus Schweden zurückkehrte, zeichnete ein düsteres Bild der Stadt:
Verzweifelte, erschöpfte Menschen taumeln den herrlichen Newa-Prospekt hinunter. In ihrem Elend, dem Gefühl der Sinnlosigkeit ertränken sie sich in der Newa, in den Kanälen der Fontanka und der Mojka, werfen sich von hohen Gebäuden aufs Trottoir, erschießen sich, schlucken Gift oder erhängen sich an Grabkreuzen. Selbstmord ist so üblich geworden, dass die Zeitungen nur noch über die »interessantesten« Fälle berichten.[17]
Die erste Duma konstituierte sich im April 1906. Sie war nur ein Schatten dessen, was der Zar versprochen hatte, und als die KadettenKadetten dagegen protestierten, wurde sie umgehend aufgelöst. Der zweiten Duma setzte Premierminister Pjotr Arkadjewitsch StolypinStolypin, Pjotr Arkadjewitsch in seinem erbitterten Kampf gegen radikales Gedankengut 1907 ein Ende. Jeder sah zu, wo er blieb, die KadettenKadetten kämpften auf verlorenem Posten. Die dritte Duma war eine vom Landadel dominierte Jasagerfraktion. Zar Nikolaus II.Nikolaus II. pochte zunehmend auf seine royalen Vorrechte, warf sämtliche verlässlichen Berater hinaus und umgab sich mit Speichelleckern und Scharlatanen wie RasputinRasputin, Grigori Jefimowitsch.
Untergangsstimmung machte sich breit. Die zeitgenössischen Romane, Gedichte und Theaterstücke zeugen von bleierner Hoffnungslosigkeit. Autoren wie Blok, Bjely und Brjussow schrieben, als nahte das Ende der Zeit oder als wäre es bereits angebrochen. Jahre vor seinem dystopischen Roman WirSamjatin, Jewgeni IwanowitschWir (Roman) verfasste der Satiriker Jewgeni SamjatinSamjatin, Jewgeni Iwanowitsch Erzählungen, die Katastrophen als schnellsten Ausweg aus Russlands politischer Sackgasse preisen.
Am 20. November 1910 starb Lew Nikolajewitsch TolstoiTolstoi, Lew Nikolajewitsch. Seine politischen Auffassungen waren überholt, aber die jungen Leute liebten ihn. Studenten an Universitäten im ganzen Reich hielten Gedenkstunden ab und verabschiedeten Resolutionen, in denen sie versprachen, sich im Geiste TolstoisTolstoi, Lew Nikolajewitsch gegen die Todesstrafe einzusetzen. In Sankt Petersburg demonstrierten Tausende Kommilitonen auf dem Newski-Prospekt und liefen der Polizei in die Arme. Als Iwan AndrejewAndrejew, Iwan, der Prorektor der Staatlichen Universität, versuchte, sie davon abzuhalten, hoben sie ihn einfach hoch und trugen ihn auf den Schultern zu ihrer Kundgebung.
Ende November saßen über vierhundert Studenten im Gefängnis. Die liberale Moskauer Zeitung Russkije Wedomosti (Russische Nachrichten) berichtete:
Zahlreiche Polizisten patrouillieren mit Gewehren und Bajonetten in den langen Fluren der Universität; Professoren werden zusammen mit einer Handvoll Studenten zu Vorlesungen eskortiert. Bewaffnete Ordnungshüter sichern die Hörsäle. Diese werden von Studenten gestürmt, die versuchen, die Vorlesungen mit Trillerpfeifen, Reizgasen und dem Absingen von Revolutionsliedern zu stören.[18]
Ein Professor brach unter den Anfeindungen eines Studenten in einem Anfall von Hysterie zusammen und musste fortgetragen werden.
Die Polizei besetzte die Moskauer Universität. Der Rektor und seine beiden Stellvertreter legten ihr Amt nieder. Ein Drittel des Lehrkörpers, darunter auch Wladimir WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch, gab den Lehrauftrag zurück. Die Hochschule war kompromittiert und schien am Ende. Aber das bereitete weder den Professoren noch den Studenten viel Kopfzerbrechen, denn sie wussten Besseres mit ihrer Zeit anzufangen.
Warum sollte man sich für ein marodes staatliches Bildungssystem verausgaben, wo sich doch die Möglichkeit bot, es einfach durch andere Einrichtungen zu ersetzen? Wie das geht, hatte Deutschland mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-GesellschaftKaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihrer großzügig geförderten Forschungsinstitute vorgemacht. Konnten betuchte russische Unternehmer nicht etwas Ähnliches auf die Beine stellen?
Die meisten Moskauer Professoren kamen aus Kaufmannsdynastien oder hatten zumindest gute Beziehungen zu Kaufleuten und Industriellen der Stadt. Sie gründeten nach deutschem und britischem Vorbild eigene unternehmerisch ausgerichtete Organisationen, für die sie Gelder einwerben konnten, und lehrten, finanziert von liberal gesinnten, philanthropischen Großbürgern, an Privatuniversitäten oder renommierten Frauenseminaren. Viele der Professoren, die aus Protest gekündigt hatten, kehrten nie an die Moskauer Universität zurück. Außerhalb des Systems boten sich ihnen mehr Freiheiten, etwa in der Städtischen Volksuniversität, 1908 gestiftet von Alfons SchanjawskiSchanjawski, Alfons, einem polnischen General a.D. und Goldbaron, der zuvor schon die medizinische Ausbildung von Frauen mit riesigen Summen gefördert hatte.
Absolventen solcher Hochschulen konnten nicht mit einer Anstellung beim Staat rechnen, jedenfalls nicht auf derselben Ebene wie die Inhaber »richtiger« Abschlüsse, aber was machte das? Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass das Zarenreich den nächsten Winter überstehen würde. Seminare in Verwaltungslehre, für Kooperativen, öffentliche Gesundheitsvorsorge und Bildung bereiteten eine neue Generation auf eine neue Ära vor.
Nach seinem Rückzug aus der Universität Moskau wurde Wladimir WernadskiWernadski, Wladimir Iwanowitsch in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen und zog nach Sankt Petersburg. Als fähiger Administrator hegte er ehrgeizige Pläne, insbesondere was die Ausbildung in Naturwissenschaften betraf. Gemeinsam mit seinem Lieblingsschüler Alexander FersmanFersman, Alexander Jewgenijewitsch antichambrierte er bei Regierungsstellen, sie sollten die Erschließung russischer Bodenschätze fördern. Seit Jahren hatte er mit seinen Studenten auf Expeditionen in abgelegene Regionen des Landes reichhaltige Aluminiumvorkommen kartographiert. Doch er mühte sich vergebens ab. Von einem internationalen Geologenkongress in Kanada, den er im Sommer 1913 besuchte, schrieb er seiner Frau:
Im letzten Jahrzehnt sind die Vereinigten Staaten in den Naturwissenschaften gewaltig vorangekommen. Amerika ist nicht mehr auf die Unterstützung deutscher Universitäten angewiesen, die bis vor kurzem noch als unverzichtbar galt. Mir drängt sich der Vergleich mit Russland auf, das Treiben von Kasso und Konsorten, der ganzen Bande, die unser Reich regiert, und das macht mich traurig und bange.
Als mitten im Krieg eine ergiebige Wolfram-Lagerstätte in Turkestan nicht genutzt werden konnte, weil das Gebiet einem Großherzog gehörte, äußerte sich ein anderer Wissenschaftler, der Mathematiker Alexej KrylowKrylow, Alexej, noch deutlicher. Wenn Russland den Krieg verliere, giftete er, verlören nicht nur die Großfürsten all ihren Besitz, sondern die ganze Dynastie werde dann zum Teufel gehen.[19]
Nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz FerdinandFranz Ferdinand von Österreich, das Russland mit in den Krieg riss, zeigte sich eine entscheidende Schwäche des Zarenreiches: seine Abhängigkeit von guten Handelsbeziehungen zu Deutschland. Seine Wissenschaft, seine Industrie, seine ganze Wirtschaft kamen nicht ohne das Land aus, das jetzt zum Kriegsgegner geworden war.
Einer der später führenden Genetiker der Sowjetunion, Alexander Sergejewitsch SerebrowskiSerebrowski, Alexander Sergejewitsch, brachte die hoffnungslose Lage in bewegenden Worten auf den Punkt. Am 18. Juli 1914, mitten in den Kriegsvorbereitungen, schrieb er in sein Tagebuch:
Ich bin jetzt Soldat. Die Stadt ist geschmückt mit Fahnen und so weiter. Gott, wie ist das nur alles verlogen … Viele meiner Bekannten warteten auf eine Erklärung zur Gleichberechtigung der Nationalitäten. Juden marschierten mit der Thora und sangen »Gott, schütze den Zar«. Einige Intellektuelle riefen Hurra, als der Zar vorüberfuhr.
All diese Erwartungen waren für die Katz. Der Zar besaß nicht genug staatsmännische Weitsicht. Mit einem Federstrich hätte er seinen Thron auf Jahre hinaus sichern können, Russland hätte ihm vertraut, er hätte die Menschen hinter sich gehabt, auch die Intelligenzija. Er hätte Volk und Regierung zusammenschweißen können. Oh, ich weiß, ich wäre dann mit einem ganz anderen Gefühl, einer ganz anderen Geisteshaltung an die Front gezogen … Sie haben die Erwartungen bis zum Äußersten hochgetrieben, haben selbst Straßenbahnfahrer an Paraden beteiligt – und nichts gegeben …
Ich liebe Russland zu sehr, um ihm den Sieg zu wünschen. Wenn Russland den Krieg gewinnt, fällt es um Jahrhunderte zurück. Verliert es ihn, liegt eine glänzende Zukunft vor ihm.[20]
2. Revolutionäre
Am Ende einer Freundschaft: Wladimir LeninLenin, Wladimir Ilitsch und Alexander BogdanowBogdanow, Alexander Alexandrowitsch spielen Schach während eines Aufenthalts bei Maxim GorkiGorki, Maxim auf Capri, April 1908.
Rund um den Erdball, von einem Ende der Welt zum anderen, ertönt das Geheul der Revolution. Der Krieg, begonnen zum Vergnügen der Könige, Zaren, Präsidenten, ist zum Wirbelsturm angeschwollen, der kaiserliche Schlösser hinwegfegt, königliche Mäntel ins Feuer bläst, Kronen in den Staub schleudert und gekrönte Häupter zu Asche verbrennt. Ihre Welt, in der alles wundervoll geordnet schien, liegt in Trümmern … Und wir werden die Erneuerer sein, werden den Vorhang von den Städten, den Straßen, den Werkstätten, den Basaren ziehen … Wir sollten unsere Kunstfabrik unverzüglich zum Summen bringen.[1]
Alexej GastewGastew, Alexej Kapitonowitsch
Karl MarxMarx, Karl und Friedrich EngelsEngels, Friedrich betrachteten ihre Arbeit gern als wissenschaftlich oder doch zumindest als wissenschaftsphilosophisch. Im Gegensatz zum Englischen, wo es eine klare Unterscheidung zwischen »science« und »humanities« gibt, ist das im Deutschen (wie auch im Russischen) möglich: Jeder, der in einer akademischen Disziplin forscht – egal, ob zum Beispiel als Physiker oder als Kunsthistoriker –, kann mit Fug und Recht von sich behaupten, er betreibe Wissenschaft.
Diese sprachliche Gepflogenheit – sie trifft auch auf das russische Wort »nauka« zu – ist ein Erbe der kulturellen Blüte im Europa des neunzehnten Jahrhunderts. Damals konnte man noch die Auffassung vertreten, das ganze Universum sei grundsätzlich erkennbar und jede Art von Erkenntnis lasse sich, zumindest im Prinzip, mit jeder anderen Art von Erkenntnis in Einklang bringen. Das Universum, so glaubte man, dulde keine Widersprüche.
Der Traum, sämtliche Wissenszweige unter einem Dach zu vereinen, motivierte Friedrich EngelsEngels, Friedrich, auf ihm ein ganzes Gedankengebäude zu errichten, den »neuen Materialismus«. (Später führte der Philosoph Georgi PlechanowPlechanow, Georgi den etwas verwirrenden Begriff des »dialektischen MaterialismusMaterialismus, dialektischer« ein.)
Der »neue« Materialismus sollte den »alten« Materialismus von NewtonNewton, Isaac ablösen. Natürlich lässt sich nicht ernsthaft bestreiten, dass seine Mechanik ein wissenschaftlicher Triumph war und ein erhellendes, leistungsfähiges Modell physikalischer Abläufe liefert. Das Problem ist: Je mehr wir die Bereiche ausweiten, auf die wir dieses Modell anwenden, desto fremder kommt uns die Welt vor, die wir uns mit seiner Hilfe erklären wollen. NewtonsNewton, Isaac Erfolg setzte eine Religion voraus, die bedeutende Lücken seiner Weltbeschreibung füllte. (Isaac NewtonNewton, Isaac war – selbstverständlich – ein tiefgläubiger Mensch.)
Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts häuften sich allerdings die Erkenntnisse, die gegen das »offenbarte Wissen« der Bibel sprachen, in einem Ausmaß, das es unmöglich machte, sie länger zu ignorieren. Naturforscher und Philosophen mussten sich anderweitig nach einer Erklärung für Vorgänge umschauen, die NewtonsNewton, Isaac Mechanik nicht abdeckt: Phänomene wie Liebe, Trauer, Erinnerungen, die Farbe Grün.[2]
EngelsEngels, Friedrich’ Philosophie ist »materialistischMaterialismus, dialektischer«, weil sie solcherart subjektive Erfahrungen im Physischen verortet; sie braucht keine vom Materiellen abgelöste geistige Sphäre. »Dialektisch« ist sie in dem Sinne, dass Wissen mittels rationaler Erörterung und Nachforschung erworben wird. Unser Wissen ist vorläufig, weil wir selbst in jedem Moment nur vorläufig sind. Niemand ist heute derselbe Mensch wie gestern, und keiner von uns lebt ewig. Wissen wird somit permanent neu überprüft, bestätigt, geglaubt.
Der dialektische