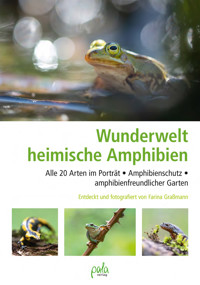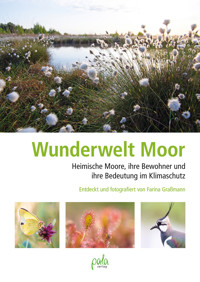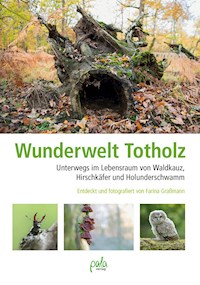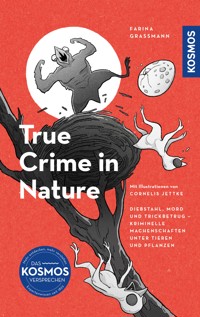
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Können Tiere von Natur aus böse sein? Überlebens- und Fortpflanzungsstrategien in der Natur sind das Ergebnis evolutionärer Anpassung. Somit sind die Beteiligten nicht wirklich Verbrecher. Die Verbrechen im Tier- und Pflanzenreich gehen weit über das Fressen und gefressen werden hinaus. Dieses Buch geht auf die wahren Verbrechen in der Natur ein, deckt aber auch die Hintergründe auf. Farina Graßmann geht raffinierten Täuschungsmanövern, hinterlistigen Fallen und dreisten Dieben in der Tier- und Pflanzenwelt auf den Grund und zeigt, welche Strategien dahinterstecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
True Crime in Nature
Diebstahl, Mord und Trickbetrug - Kriminelle Machenschaften unter Tieren und Pflanzen Mit Illustrationen von Cornelis Jettke
Farina Graßmann
KOSMOS
Impressum
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sorgfalt bei der Umsetzung ist indes dennoch geboten. Verlag und Autoren übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien und Methoden entstehen könnten. Dabei müssen geltende rechtliche Bestimmungen und Vorschriften berücksichtigt und eingehalten werden.
Distanzierungserklärung
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Wir behalten uns die Nutzung von uns veröffentlichter Werke für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Unser gesamtes Programm finden Sie unter kosmos.de.
Über Neuigkeiten informieren Sie regelmäßig unsere Newsletter kosmos.de/newsletter.
Umschlagsabbildung: © Cornelis Jettke
© 2025, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Pfizerstraße 5–7, 70184 Stuttgart
kosmos.de/servicecenter
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-440-51155-8
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Leichen im Keller
Der Feind in meinem Nest
Der Kuckuck – Zeitbombe im Vogelnest
Die Kuckuckshummel – Kronenklau im Hummelreich
Die Kuckucke unter den Insekten
Der Ölkäfer – blinde Passagiere mit Enterhaken
Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling – vom Falter, der vorgab eine Ameise zu sein
Die Untermieter der Ameisen
Schöner wohnen im Körper der Anderen
Die Schlupfwespe – Schurken mit Röntgenblick
Die Raupenfliege – wie Kriminelle Wälder schützen
Die Flussperlmuschel – von Perlen und Parasiten
Rettet die Parasiten
Wenn die Vorratskammer lebt
Der Bienenwolf – Wolf im Bienenpelz
Der Langhals-Schabenjäger – eine Schabe an der Leine
Der Maulwurf – Köpfung mit Happy End
Schnipp Schnapp Körperteil ab
Die Schwarze Wegameise – Tierhaltung auf Bäumen
Das Meerneunauge – Strandausflug mit Blutsaugern
Nicht gefressen werden, ist tödlich
Der Kleine Leberegel – vom Kuhfladen ins Ameisenhirn
Die Kohlweißlings-Brackwespe – Bodyguard bis in den Tod
Die Marienkäfer-Brackwespe – Viren – die Partner in Crime
Der Feldwespen-Fächerflügler – wie Parasiten ihre Wirte unsozial machen
Forensische Entomologie
Toxoplasma gondii – Verliebt in einen Killer
Der Plattwurm Diplostomum spathaceum – Blinde Fische sind leichte Beute
Der Kratzwurm Polymorphus paradoxus – See verdrehter Sinne
Der Kratzwurm Pomphorhynchus laevis – der Duft der Raubfische
Der Bandwurm Schistocephalus solidus – Gruppenzwang im Fischschwarm
Das Baculovirus Lymantria dispar nucleopolyhedrovirus – Virenschleudern in den Baumwipfeln
Die Tollwut – mit Sex und Gewalt zum Erfolg
Bauanleitung für ein Opfer
Die Gallwespen – Klau am Bau
Das Bakterium Wolbachia – weil Männer überflüssig sind
Der Wurzelkrebs Sacculina carcini – die Mutterschaft der Krabbenmännchen
Der Saugwurm Leucochloridium paradoxum – feindliche Übernahme der Schneckenfühler
Wer Fallen baut, rennt nicht
Der Ameisenlöwe – wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst nicht rein
Die Dreiecksspinne – alle Fäden in der Hand
Die Speispinne – Revolverheld auf acht Beinen
Der Buckelwal – mit der Luftnummer zur fetten Beute
Die Falle bin ich
Der Anglerfisch – mit falschem Köder ins Verderben
Der Sonnentau – glitzernde Fallen
Der Wasserschlauch – Klappe zu, Wasserfloh tot
Der Aronstab – Odeur de Gully
Der Fliegentöter – nekrophile Fliegen
Der Schopftintling – der Mörder im Pilzkörbchen
Von Dieben und Klaukreisläufen
Die Erdhummel – der Nektarraub des Jahrhunderts
Die Vogelnestwurz – Diebstahl auf Umwegen
Der Basstölpel – beklaute Diebe
Die Silbermöwe – die Meisterdiebin der Strandpromenade
Über Totgeglaubte und tanzende Killer
Der Rotfuchs – Totgeglaubte essen besser
Der Kolkrabe – rabenschwarze Tricks
Die Veränderliche Krabbenspinne – die unsichtbare Spinne
Der Steinmarder – tödlicher Tanz
Der Zweihöcker-Spinnenfresser – Klopfsignale in den Tod
Die Fliegen-Ragwurz – die Sexfalle
Der Angriff der Pflanzen
Die Buche – in den Schatten gestellt
Der Apfelbaum – unsichtbarer Tod auf der Obstwiese
Die Knoblauchsrauke – Giftkrieg im Waldboden
Unfreiwillig treu
Der Apollofalter – ein Schmetterling mit Keuschheitsgürtel
Der Wasserfrosch – stille Frösche sind erfolgreich
Die Rauchschwalbe – Fehlalarm am Liebesnest
Schwarze Witwen
Die Wespenspinne – über abgebrochene Penisse und verspeiste Partner
Die Gottesanbeterin – kopfloses Liebesglück
Vom Täter zum Opfer
Von Gottesanbeterinnen und Pferdehaarwürmern – eine Männerfresserin wird zur Marionette
Von Spinnen und Schlupfwespen – ein Versteck für den Feind
Von Bohnen und Blattläusen – Killerkommando auf Bestellung
Von Raubameisen und Büschelkäfern – Sklaven und geliebte Feinde im Nest
Mit Lug und Trug einem Verbrechen entkommen
Faszination des Bösen
LEICHEN IM KELLER
Um Sie herum werden pausenlos Verbrechen begangen. Dafür müssen Sie nicht einmal in einer Großstadt wohnen. Es genügt, einen Schritt in den Garten oder einen Spaziergang durch den Wald zu machen. Die dort lebenden Tiere (und Pflanzen!) nehmen es mühelos mit den Fällen aus den True Crime Podcasts auf.
Sind Sie bereit für einige Schauergeschichten? Eine Warnung vorab: Nach dem Lesen dieses Buches werden Sie flauschige Hummeln, urige Bäume und am Himmel kreisende Schwalben für immer mit anderen Augen betrachten. Denn auch die vermeintlich Unschuldigen haben Leichen im Keller. Auf den folgenden Seiten werden Ihnen Kriminelle begegnen, die klauen und Kriege führen, die sich ins gemachte Nest setzen und ihre Opfer in willenlose Marionetten verwandeln. Und einige der kriminellen Gestalten sind obendrein so klein, dass sie für unsere Augen unsichtbar sind. Es sind wahre Verbrechen, von denen manche sogar uns Menschen treffen.
Ich lade Sie ein auf eine Spurensuche durch unsere Natur. Hin zu den verrücktesten Kriminalfällen und den gruseligsten Vergehen! Sie glauben mir nicht? Dann sollten wir über Ameisen sprechen. Und ich meine nicht die eifrigen Tiere, deren Straßen zum Gartentisch führen, wo sie einer Putzkolonne gleich die Krümmel davonschaffen. Nein, ich meine Raubameisen. Richtig fiese Gesellen, die Raubzüge unternehmen, fremde Ameisennester überfallen und Sklaven nehmen. Und absurderweise bringen sie die versklavten Leidtragenden nicht nur dazu, für sie zu arbeiten, sondern auch für sie zu kämpfen – wenn es sein muss, gegen die eigene Verwandtschaft!
Die Natur ist ein hartes Pflaster. Deswegen kann man den Kriminellen im Grunde genommen noch nicht einmal einen Vorwurf machen. Denn die Evolution besitzt kein Mitleid und sortiert gnadenlos aus. Weil natürlich niemand Lust hat, auszusterben, ist ein Wettrüsten zwischen Tätern und Opfern entbrannt. In den Jahrmilliarden irdischen Lebens haben sich primitive Einzeller in Lebewesen verwandelt, die einen Koffer vollgestopft mit heimtückischen Tricks mit sich herumschleppen. Aber machen Sie nicht den Fehler, die Einzeller zu unterschätzen! Toxoplasma gondii ist der beste Beweis: Der Parasit unterwandert das Gehirn seines Opfers und sorgt dafür, dass es sich urplötzlich zu seinen schlimmsten Feinden hingezogen fühlt. In deren Magen will der Einzeller nämlich landen.
Klar, fressen und gefressen werden ist ein alter Hut. Während Sie das hier lesen, werden um Sie herum unzählige Tiere um die Ecke gebracht. Uns behagt der Gedanke nicht, aber damit haben die sogar noch Glück, man kann nämlich genauso gut als lebende Vorratskammer enden und Stück für Stück von innen heraus aufgefressen werden. Sie merken schon, in der Natur reiht sich ein Konflikt an den nächsten. Das macht auch vor ehelichen Meinungsverschiedenheiten nicht halt. Da kommt es schon einmal vor, dass ein Penis abbricht oder einer der Beteiligten den Kopf verliert. Bis wir auf diese Schlüpfrigkeiten zu sprechen kommen, müssen Sie sich aber noch etwas gedulden.
Um eine Sache möchte ich Sie noch bitten: In diesem Buch werden Sie in Verbrechen eintauchen, die genauso in den Schlagzeilen der Zeitungen oder den True Crime Podcasts landen könnten. Auch wenn mir die menschlichen Verbrechen als Vorbild dienten, herrscht in der Natur doch ein anderes Rechtssystem und keiner der Täter hat sich mit seinen Taten schuldig gemacht. Deswegen verstehen Sie dieses Buch bitte als tiefe Verneigung vor dem Einfallsreichtum der Kriminellen, die Ihnen hier begegnen.
Lasset die Spurensuche beginnen!
© Farina Graßmann
Fleischfliegen mögen keinesfalls nur Fleisch.
DER FEIND IN MEINEM NEST
Hören Sie es ticken? Natürlich nur im sprichwörtlichen Sinn, denn im Nest der Rohrsänger herrscht Stille – noch. Fünf Eier liegen in dem Körbchen, das die Eltern aus trockenen Gräsern zwischen die Schilfhalme geflochten haben.
© Cornelis Jettke
Jedes der Eier trägt ein individuelles Muster aus braunen Sprenkeln. Doch eins sticht heraus, etwas zu groß, etwas zu ungefleckt. Eine tickende Zeitbombe im Nest: das Kuckucksei.
Der Kuckuck – Zeitbombe im Vogelnest
„Kuckuck-kuckuck“ ertönte es im Frühling in der Teichlandschaft. Der Gesang der Kuckucks-Männchen kündigt den Nistvögeln der Umgebung nichts Gutes an. Nach der Paarung kundschaftet seine Partnerin die fremden Nester aus. Stundenlang verharrt sie reglos, observiert und wartet auf den richtigen Moment. Die Zeit drängt, denn die Rohrsänger haben die ersten Eier bereits gelegt. Wartet das Kuckucks-Weibchen zu lange, riskiert es das Überleben seines Nachwuchses. Endlich ist es soweit: Als die Schilfbewohner ihr Nest einen Augenblick unbewacht lassen, nutzt das Weibchen die Gelegenheit, verschlingt eines der Eier und legt stattdessen innerhalb von Sekunden ihr eigenes hinein. Das Kuckucksei besitzt eine robuste Schale, und das aus gutem Grund: Das kleine Rohrsängernest bietet dem Kuckuck kaum genug Platz zum Landen. An ein Hineinsetzen ist nicht zu denken und so plumpst das Ei beim Legen von oben in das Nest hinein.
Bei der Rückkehr bemerken die Rohrsänger den Schwindel nicht und gehen ihrem Brutgeschäft ganz unbekümmert weiter nach. Zwölf Tage vergehen, bis das Kuckuckskind schlüpft. Obwohl es als Nachzügler ins Nest kam, ist es früher dran als seine Stiefgeschwister. Dafür hat seine Mutter gesorgt: Bereits bevor sie das Ei legte, begann sie es zu bebrüten. Ihr eingebauter Inkubator verschafft dem Nachwuchs einen Vorsprung von mehr als einem Tag.
Nackt und blind liegt der kleine Kuckuck im Nest. Nach dem kräftezehrenden Schlüpfen benötigt er einen Ruhetag, an dem er seine Kräfte sammeln kann. Dank des Tricks seiner Mutter bleibt seinen Stiefgeschwistern oftmals keine Zeit, um zu schlüpfen. Denn schon bald lässt das hilflos wirkende Küken seine Maske fallen und zeigt sein grausames Gesicht.
Der kleine Kuckuck hat es auf die Eier abgesehen. Ohne sich mithilfe seiner Augen orientieren zu können, drückt er sich unter sie und platziert sie mithilfe der Stummelflügelchen auf seinem Rücken. Es braucht Kraft und Geschick, doch innerhalb von Minuten hat er rittlings schiebend das erste Ei über den Rand des Nestes gehievt. Unter den Augen der Zieheltern entledigt er sich eines Eis nach dem nächsten. Der Rohrsänger-Nachwuchs hat selbst dann kaum Überlebenschancen, wenn ihm der Schlupf gelingt – und das gleich aus zwei Gründen: Einerseits wirft der Kuckuck auch Küken aus dem Nest, die schwerer sind als er selbst. Andererseits ist er ein außerordentlich geschickter Betrüger. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein leibliches Kind der Pflegeeltern überlebt, werden diese es gegenüber dem Kuckuckskind vernachlässigen. Denn das wirkt durch sein überdeutliches Betteln auf die Elternvögel schlichtweg attraktiver und bekommt deswegen mehr Futter.
So brutal, wie das Verhalten wirkt – für den Kuckuck ist es überlebenswichtig. Im Laufe der Evolution verlor er die Fähigkeit, selbst Nester zu bauen und zu brüten. Damit hat er sich in eine Abhängigkeit manövriert, in der er ohne seine Wirtsvögel nicht mehr überleben kann. In seiner Lage führt kein Weg an der Beseitigung der Stiefgeschwister vorbei. Würde das Kuckuckskind sie nicht aus dem Nest werfen, würde es Gefahr laufen, zu sterben. Denn die Wirtsküken werden früher flügge und die Wirtseltern würden wahrscheinlich mit ihnen das Nest verlassen und das Kuckucksküken zurücklassen.
Einen Kuckuck aufzuziehen, ist für die Eltern ein Kraftakt. Bis zu 24 Tage hockt er im Nest, doppelt so lange, wie es bei ihren leiblichen Kindern üblich ist. Schnell ist aus dem hilflosen Küken ein lärmender, stets hungriger Gast geworden, der das gesamte Nest ausfüllt. Mit nicht enden wollenden Rufen sichert er sich die Gunst seiner Zieheltern und animiert sie, ständig mehr Nahrung heranzuschaffen. Zwar müssen sie nur ein Küken versorgen, doch das frisst über die Nestlingszeit hinweg doppelt so viel Nahrung, wie es alle eigenen Küken zusammen getan hätten. Sogar dann, wenn der Kuckuck bereits das Nest verlassen hat und laut bettelnd in der Nähe sitzt, schaffen die Eltern weiter regelmäßige Mahlzeiten heran. Ein aberwitziger Anblick, wie die Rohrsänger das riesenhafte Kuckuckskind füttern – fast als würden sie jeden Moment selbst verschlungen werden.
© Farina Graßmann
Ihm wird gern ein Ei ins Nest gelegt.
Die Kuckuckshummel – Kronenklau im Hummelreich
Kuckucke lauern nicht nur den Nistvögeln auf. Die Masche ist längst kopiert und kursiert im Insektenreich. Bienen haben es ohnehin schwer. Hinter jeder Ecke wartet ein hungriger Vogelschnabel (der Bienenfresser ist ein dermaßen professioneller Bienen-Killer, dass er sie sogar im Namen trägt). Ganz zu schweigen von Spinnen, die in einen Tarnumhang gehüllt auf Blüten lauern und nur darauf warten, dass ihnen eine Biene in die Fänge fliegt (von denen hören wir später noch). Und zu allem Überfluss sind die Bienen sogar in ihren eigenen vier Wänden nicht sicher.
Hummeln (die gehören auch zur Bienenfamilie) bauen Nester, manchmal im Boden und manchmal in Baumhöhlen – da sind die Vorlieben verschieden. Und diese Nester werden von fremden Hummelarten gekapert und für deren Eiablage zweckentfremdet. Kommt Ihnen bekannt vor? Der Vergleich zum Kuckuck drängt sich geradezu auf und hat den „Kuckuckshummeln“ ihren Namen eingebracht. Dass ein Kuckucksei im Hummelnest liegen kann, ist allerdings ein Kampf, ganz wortwörtlich.
Angesichts der kriminellen Tiere fragt man sich doch: Wie wurden sie überhaupt kriminell? Schließlich ist wohl keines von ihnen eines Morgens mit der Idee erwacht: „Mir reicht's, mich selbst um die Kinderbetreuung zu kümmern – ich zwinge ab sofort anderen Tieren die Care-Arbeit auf.“ Bei den Hummeln bekommen wir eine Ahnung, wie das abgelaufen sein könnte. Auch die Kuckuckshummeln sind nicht kriminell auf die Welt (oder besser gesagt auf die evolutionäre Bühne) gekommen. Aber lassen Sie mich erst einmal eine von ihnen vorstellen: Die Dunkle Erdhummel zum Beispiel unternimmt dann und wann Versuche, die Nester der Hellen Erdhummel zu unterwandern. Im Gegensatz zu ihrer Verwandten ist sie eine Langschläferin. Während die helle Königin bereits mit dem Frühlingsbeginn einen Ort für das Nest gesucht und eine Schar von Arbeiterinnen erschaffen hat, verlässt die dunkle erst gemächlich ihr Winterversteck. Nun könnte man sich selbst an die Arbeit begeben. Oder man versucht einfach, das fremde Nest zu übernehmen. Die feindliche Übernahme bietet neben dem offensichtlich geringeren Arbeitsaufwand noch weitere Vorteile (dazu gleich mehr). Der große Nachteil bei der Geschichte: Kein Hummelvolk gibt sein Nest kampflos her und die Angreiferin kostet der Versuch oftmals das Leben.
Zumindest bei neun heimischen Hummelarten scheinen die Vorteile überwogen zu haben. Die Kuckuckshummeln sind im Laufe der Evolution über den einfachen Nestraub hinausgegangen und spezialisierten sich auf das Leben als Sozialparasit. Als solche machen sie sich die soziale Lebensweise und die Brutfürsorge ihrer Wirte zunutze, sind allerdings zugleich ebenso abhängig von den Wirtshummeln geworden wie der Kuckuck von den Wirtsvögeln.
© Cornelis Jettke
Bei der Suche nach einem Hummelnest geht es der Nase nach. Korrekterweise müsste ich sagen: den Antennen nach. Denn Hummeln haben selbstverständlich keine Nase im Gesicht sitzen (ich bitte vielmals um Entschuldigung für das Bild, das Sie jetzt im Kopf haben), sondern erriechen die Umgebung mithilfe ihrer Fühler. Jede Art besitzt ihr individuelles Parfüm. Über ihre Füße verteilen die Hummeln den Geruch überall und hinterlassen eine richtiggehende Duftspur, die von den besuchten Blüten bis ins Nest verläuft. Die Zeitungen haben diese Erkenntnis ihrerseits mit Begeisterung aufgenommen und machten den „Fußgeruch“ der Hummeln zur Schlagzeile. Dank dieser Markierungen erkennen die Hummeln direkt, ob eine Blüte bereits besucht wurde. Doch leider ist es für die Kuckuckshummeln so auch ein Leichtes, der Spur bis zum Nest ihrer Wirte zu folgen. Erstaunlicherweise hat die Kuckuckshummel nicht nur ihre Gestalt an die Wirte angepasst, sondern auch ihren Geruch. Ein Trick, um möglichst wenig Gegenwehr beim folgenden Manöver zu erhalten.
Die Kuckuckshummel hat das Nest genau beobachtet. Der richtige Zeitpunkt entscheidet über ihren Erfolg. Erst wenn sich genügend Arbeiterinnen im Nest versammelt haben, startet sie ihren Angriff. Ruppig drängt sich die Kuckuckshummel an den Arbeiterinnen vorbei, die ihr den Eingang zum Nest versperren. In bester Kneipen-Schlägerei-Manier poltert sie hinein und hält angriffslustig nach der Königin Ausschau. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt und obwohl die Arbeiterinnen der Königin zu Hilfe eilen, hat die Kuckuckshummel die besseren Karten. Ihr Körper ist größer und mit einem stärkeren Außenskelett versehen, dem die Stiche der Verteidigerinnen wenig anhaben können. Für die Angreiferin geht es um alles: Ohne ein fremdes Nest gehen ihre Gene verloren. Vermutlich ist es am Ende weniger Erbarmen als ein Einsparen der Kräfte: Sie lässt der Königin die Möglichkeit, zu fliehen oder sich zu ergeben. Doch der Preis dafür ist hoch: Sie muss ihre Position auf dem Thron aufgeben und fortan ein Leben als Arbeiterin führen.
Die Krone erkämpft, vertilgt die neue Königin einen Teil der Eier und jüngeren Larven des Volkes. Die älteren Larven verschont sie und sichert damit den Nachschub an neuen Arbeiterinnen. Trotz ihrer Kraft: Ihre Macht ist begrenzt. Zwar wird sie selbst Eier legen, eigene Arbeiterinnen kann sie aber nicht erschaffen. Sie muss auf die Loyalität der unterworfenen Arbeiterinnen setzen, die bis zu ihrem Tod die Kuckuckskinder pflegen und Nahrung herbeischaffen werden. Weder die Kuckucks-Königin noch ihre Nachkommen beteiligen sich an diesen Aufgaben. Die Fähigkeit dazu haben sie schon vor langer Zeit verloren. Während ihr Körper größer und stärker wurde, verschwanden die Pollenkörbchen an ihren Hinterbeinen, die ihren Verwandten zum Sammeln von Nahrung dienen.
Mit dem Leben der letzten Dienerinnen endet auch das Leben im Hummelnest. Die Kuckuckshummel stellt das Eierlegen ein und stirbt. Ausgestattet mit dem Potenzial, die nächste Königin zu werden, treten die Jungköniginnen die Überwinterung an, um im nächsten Jahr ihrerseits ein Volk zu erobern.
Die Kuckucke unter den Insekten
Die Kuckuckshummel ist mit ihrer Lebensweise nicht allein im Insektenreich. Fast jede vierte Bienenart in Deutschland lebt parasitisch. Eine Spielart der Natur, die vermutlich vor 95 Millionen Jahren ihren Ursprung fand. Heute reichen die Tatbestände parasitischer Bienen von der Plünderung der Vorratskammer über das Besetzen des Nestes bis hin zum Leben im oder auf Kosten des Wirtsnachwuchses.
Eine der Kuckucksbienen ist die Wespenbiene. Genauer gesagt handelt es sich aktuell gleich um 67 Wespenbienen-Arten, die in Deutschland eine Heimat haben. Spärlich behaart, ausgestattet mit einer waschechten Wespentaille und einer bunten Bänderung machen sie ihrem Namen alle Ehre. Blüten suchen sie nur zum Stillen ihres eigenen Appetits auf. Das Anlegen von Vorräten für den Nachwuchs überlassen sie anderen.
Auf Patrouillenflügen inspiziert das Wespenbienen-Weibchen die Umgebung. Sie hält nach den Nestern von Sandbienen Ausschau. Jede Wespenbienen-Art ist auf eine einzige Wirtsart spezialisiert. Sandbienen stehen dabei besonders hoch im Kurs. Ein Nest im Boden ausgemacht, legt sich die Wespenbiene wenige Zentimeter vom Eingang entfernt auf die Lauer. Es scheint, als prüfe sie (freilich schwebend, nicht liegend), ob sie unbemerkt ins Innere gelangen kann. Dann schaufelt sie den Eingang frei, den die Eigentümerin zuvor sorgsam mit Sand verschlossen hat. Ihr Ziel sind die Zellen, in denen die Sandbienen ihre Eier abgelegt und mit reichlich Proviant für die Zeit nach dem Schlupf ausgestattet haben. Dort hinein legt das Wespenbienen-Weibchen ihr eigenes Ei. Bald wird daraus das Kuckucksbienenkind schlüpfen und das artfremde Geschwisterkind töten, um sich die Vorräte zu sichern.
Das Platzieren der Eier braucht seine Zeit. Manchmal nach wenigen Minuten, manchmal erst nach einer halben Stunde erscheint das Parasiten-Weibchen wieder am Eingang. Trifft sie auf eine gleichsam am Nest interessierte Artgenossin, führt das unweigerlich zum Kampf. Die Unterlegene muss den Platz räumen und sich ein anderes Wirtsnest suchen. Überraschender als Meinungsverschiedenheiten unter Wespenbienen ist das Zusammentreffen mit den Wirten: Die Nesteigentümerinnen sind gegenüber den Eindringlingen nämlich friedfertig gestimmt. Klingt nach einem kuriosen Verhalten? Der Grund ist noch kurioser. Die Wespenbienen verschleiern ihre Identität nämlich mithilfe einer duftenden Tarnkappe. Die männlichen Wespenbienen produzieren den Duft in ihren Kopfdrüsen und übertragen ihn bei der Paarung auf die Weibchen. So ist ihr Geruch, den übrigens auch wir Menschen wahrnehmen können, kaum unterscheidbar von dem der Sandbienen. Und weil die Eindringlinge für die Sandbienen-Weibchen riechen wie ihresgleichen, sehen sie scheinbar keinen Grund für einen Verteidigungsschlag.
Weitaus weniger friedfertig geht es bei anderen Kuckucksbienen zu. Die Buckelbienen sind auch als Blutbienen bekannt. Wenngleich ihr roter Hinterleib dafür verantwortlich ist: mit Blick auf ihr Verhalten ist dieser Name nicht weniger passend. Beim Aufspüren fremder Nester halten es die Blutbienen wie die Wespenbienen. Ohne den Schutz einer Tarnkappe kommen die Nestinhaberinnen den Parasiten allerdings schnell auf die Spur. Wie es auch die Kuckuckshummeln tun, versuchen sie, ihr Nest zu verteidigen. Wir erinnern uns: Bei den Hummeln wird allenfalls die Königin des überfallenen Volkes getötet. Die Untertanen verschont die Kuckuckshummel ganz eigennützig, um ihre Arbeitskraft zu nutzen. Die Blutbienen hingegen haben es nur auf die Übernahme der Brutzellen abgesehen. Und da die Bienen diese Arbeit bereits erledigt haben, sind sie, nunja, abkömmlich. Wenig überraschend also, dass Forschende bereits vor über hundert Jahren die blutigen Überfälle von Blutbienen beobachteten und beschrieben, wie diese kurzerhand in die Nester spazierten und alle Bienen darin töteten.
Die Gefahr für Bienen geht aber bei Weitem nicht nur von der Verwandtschaft aus der Bienenfamilie aus. Auch Wespen (diesmal sind es wirklich Wespen und nicht wieder Wespenbienen!) lehren Bienen das Fürchten. Wer sich vor einer Wildbienen-Nisthilfe auf die Lauer legt, begegnet über kurz oder lang den Goldwespen. Farbenfroh schillernd kundschaften sie die Nistgänge aus und suchen die bereits von Bienen besiedelten Behausungen. Dort legen sie ihre eigenen Eier dazu. Schlüpfen die Goldwespen-Larven, haben sie es (Sie ahnen es sicherlich schon) nicht nur auf die Vorräte abgesehen, die die Biene emsig für ihren Nachwuchs herbeigetragen hat, sondern auch auf den Bienennachwuchs selbst. Die Goldwespe Chrysura hirsuta ist ein Spezialfall: Sie ist die Gegenspielerin von Mauerbienen, deren Nistgänge sie erobert. Die Nahrungsvorräte verschmähen die Goldwespen-Larven allerdings. Stattdessen schauen sie geduldig zu, wie die Bienenlarven sich daran dick und rund gefuttert haben – und fressen sie dann auf.
Und kennen Sie den Wollschweber? Genau, die kleinen Flauschkugeln, die pausenlos von einer Blüte zur nächsten schwirren. Die sehen harmlos aus, oder? Doch der Eindruck täuscht! Der Große Wollschweber und einige seiner Verwandten ziehen sogar mithilfe von Wurfgeschossen in den Kampf. Dafür sammeln sie zunächst Sand auf und heften ihn an ihre Eier. Wie mit Wasserbomben bewaffnet, fliegen sie dann über die Wildbienennester hinweg (die meisten unserer Wildbienenarten nisten praktischerweise im Boden) und lassen die wertvolle Fracht herabfallen. Gutes Zielen wird belohnt: Die aus den Eiern geschlüpften Wollschweberlarven krabbeln (fast ebenso flauschig wie ihre Eltern) schnurstracks ins Bienennest. Dort tun sie sich erst an den Vorräten gütlich und später an den Bienenlarven.
Sie dachten, das war’s? Dann warten Sie mal ab. Die Bienen haben noch weit Schlimmeres zu fürchten, als einfach „nur“ gefressen zu werden. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal gehen wir einer Frage auf den Grund: Was tun, wenn die eigenen Eltern es mit der Fürsorge nicht so eng sehen und kein „Eltern-Taxi“ spielen?
Der Ölkäfer – blinde Passagiere mit Enterhaken
„Ölkäfer befallen 370-Seelen-Dorf“
„Vorsicht giftig! Ölkäfer macht Urlaubsregionen in Deutschland unsicher“
„Hochgiftiger Ölkäfer lebt unter uns – er kann sogar Menschen töten“
Spätestens im Sommerloch erobert der Ölkäfer alljährlich die Schlagzeilen. Es liest sich, als würden Scharen gigantischer Käfer Städte und Strände überrollen und jedem den Garaus machen, der nicht schleunigst die Beine in die Hand nimmt und die Flucht antritt. Doch was steckt hinter diesen reißerischen Überschriften? Wie es sich für Sommerloch-Themen gehört, nicht allzu viel. Tatsache ist: Seit Jahrtausenden ist der Ölkäfer Teil unserer Kultur und schaut als „Heiltier“ auf eine lange Tradition zurück. Sein Gift namens Cantharidin wurde zur Behandlung einer Fülle von Krankheiten eingesetzt – und zur Potenzsteigerung. Klar, es gibt doch nichts Besseres als einen giftigen Käfer, um Schwung unter die Bettdecke zu bringen. Die antiken Griechen verwendeten das Gift allerdings noch auf ganz andere Weise: zur Hinrichtung. Und Giftmörder machten sich dieses Wissen noch Jahrhunderte später zunutze. Giftig genug, um einen Menschen zu töten, ist der Ölkäfer also. (Wenngleich die Einschätzungen auseinandergehen, ob ein Käfer genügt oder es doch eines Nachschlags bedarf.) Also: Essen Sie bitte keinen Ölkäfer. Vorgesehen ist das Gift übrigens ohnehin nicht für uns. Der Ölkäfer möchte nämlich gerade verhindern, im nächsten Magen zu landen. In brenzligen Situationen drückt er deshalb an seinen Kniegelenken gelbe, giftige Tröpfchen heraus. Sein Gift ist also keine Angriffswaffe, sondern dient dem Käfer schlichtweg zur Selbstverteidigung. Was der Ölkäfer dann in diesem Buch zu suchen hat? Diese Geschichte beginnt im Frühling:
© Cornelis Jettke
Der Schwarzblaue Ölkäfer ist unsere häufigste Ölkäferart. Den Schlagzeilen zum Trotz ist er nicht scharenweise unterwegs, sondern sogar gefährdet. Menschen für seinen Schutz zu gewinnen, ist leider kein leichtes Unterfangen. Erst recht nicht, seitdem das Gerücht kursiert, er sei eine tödliche Bedrohung. Dabei ist er ein richtiger Hingucker. Gut, seine Gestalt wirkt eher gedrungen als grazil und fliegen kann er mit seinen winzigen Flügelchen auch nicht. Dafür schimmert sein Panzer nachtblau und mit einer Körperlänge von teils mehr als drei Zentimetern ist er auch ohne Lupe leicht zu entdecken.
Bei der Partnerwahl entscheiden die inneren Werte. Denen geht das Weibchen auf den Grund und beißt dem Männchen in die Flügeldecken. Damit testet sie seine Giftausstattung. Je giftiger das Männchen, desto größer sind seine Aussichten bei den Weibchen. Die haben keine Vorliebe für Bad Boys, sondern suchen schlichtweg den größtmöglichen Schutz für ihre Nachkommen. Mit dem Gift ausgestattet sind die Eier, Larven und Puppen nämlich für Fressfeinde schwer bekömmlich.