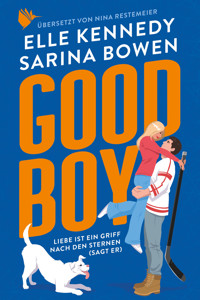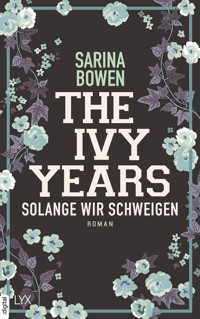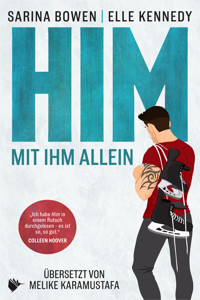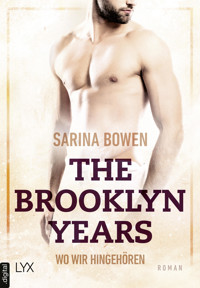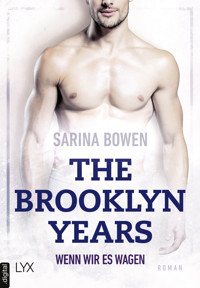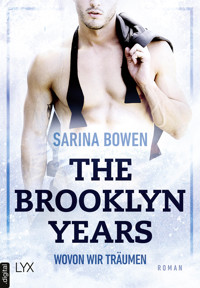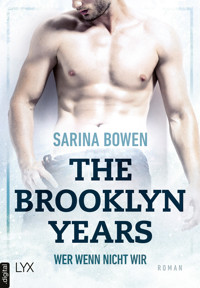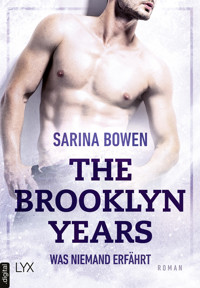9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vermont-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn wir zusammen sind, gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Diesen Moment
Als Jude in seinen Heimatort in Vermont zurückkehrt, will er nicht mehr daran denken, was vor drei Jahren geschehen ist, als er alles verloren hat: seinen guten Ruf, seine Chance auf eine Zukunft - und Sophie. Seine große Liebe, deren Leben er in einer einzigen tragischen Nach zerstört hat. Sophie ist geschockt von Judes Rückkehr, denn der Mann, der für den Tod ihres Bruders verantwortlich ist, bringt ihr Herz auch nach all den Jahren noch gefährlich aus dem Takt. Und so sehr sie sich dagegen wehrt, spürt sie bald, dass diese Liebe keine Gesetze kennt ...
"Wer nach einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte und Figuren mit Tiefgang sucht, wird an Jude und Sophie nicht vorbeikommen!" City and Book
Band 2 der gefeierten True-North-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Sarina Bowen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmung123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536LeseprobeDie AutorinImpressumSARINA BOWEN
TRUE NORTH
Schon immer nur wir
Roman
Ins Deutsche übertragen vonWanda Martin
Zu diesem Buch
Als Jude Nickel nach drei Jahren wieder in seinen Heimatort in Vermont zurückkehrt, ist er ein gebrochener Mann. Er hat alles verloren, was ihm einmal wichtig war: seinen guten Ruf, seine Chance auf eine Zukunft, seinen liebevoll restaurierten Oldtimer. Doch nichts davon wiegt so schwer wie der Verlust von Sophie, seiner großen Liebe, deren Leben er in einer einzigen tragischen Nacht zerstört hat. Dass sein Neuanfang hart werden würde, stand außer Frage. Dass ihn seine Vergangenheit aber derart schonungslos einholt, als er Sophie plötzlich wieder gegenübersteht – und so heraus- findet, dass sie tatsächlich immer noch in Colebury lebt –, hatte er nicht erwartet. Auch Sophies Welt gerät erneut ins Wanken, als sie Jude begegnet. Ihrem Jude, dem einzigen Mann, den sie jemals geliebt hat. Dem Mann, der für den Tod ihres Bruders verantwortlich ist, ihre Familie zerstört und all ihre Briefe ins Gefängnis ungeöffnet zurückgeschickt hat. Doch während ihr Verstand ihr sagt, dass sie sich von ihm fernhalten muss, spürt sie, dass ihr Herz seinen lang verlorenen Seelengefährten wiedergefunden hat. Und Sophie muss erkennen, dass diese Liebe sich an kein Gesetz der Welt hält.
Für alle, die eine Sucht bezwungen haben. Ihr seid für mich Helden und Heldinnen aus dem wahren Leben.
1
Jude
Grad des Verlangens: 5
Das letzte Mal, als ich durch Colebury, Vermont fuhr, saß ich am Steuer eines restaurierten 1972er Porsche 911, der aussah wie neu und in einem schicken Aubergine-Ton frisch lackiert worden war.
Verglichen damit war jetzt alles anders. Drei Jahre später rumpelte ich in einem ramponierten 1996er Dodge Avenger, den ich gerade für neunhundert Flocken gekauft hatte, die Hauptstraße entlang. Der vordere Kotflügel hielt nur durch Klebeband zusammen.
Das hässliche Auto hätte mir nichts ausgemacht, wenn der Avenger und ich nicht so verdammt viel gemeinsam gehabt hätten. Wir waren beide in der Gosse gelandet, Körper und Geist geschunden. Der Schalldämpfer am Auspuff des Wagens war hinüber. Unter dem Armaturenbrett schauten lose Kabel hervor – ein perfektes Abbild meiner blank liegenden Nerven. Ich war vor fünf Monaten aus der Entzugsklinik entlassen worden und konnte noch immer nicht länger als fünf Stunden am Stück schlafen.
Mein arrogantes Teenager-Ich hätte niemals so eine Schrottkarre gefahren, aber was dieser Vollidiot dachte, war inzwischen egal. Ich hasste diesen Typen. Und da ich schon dabei war, mir alle Unterschiede zwischen jetzt und damals vor Augen zu führen, sollte ich noch erwähnen, dass ich das letzte Mal, als ich durch Colebury, Vermont gefahren war, völlig mit Opiaten zugedröhnt gewesen war.
Heute war ich stocknüchtern. Das zumindest sprach für mich.
Gegen mich sprach, dass ich inzwischen ein verurteilter Straftäter war. Wegen Drogenbesitzes und fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr hatte ich sechsunddreißig Monate gesessen. Ich hatte kaum Geld und noch weniger Freunde. Das einzige Glück in meinem Leben – ein Job auf einer Obstplantage im benachbarten County, der mir das Leben gerettet hatte – war gerade zu Ende gegangen. Im November gab es keine Äpfel mehr zu pflücken oder zu verkaufen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als nach Hause zurückzukehren.
Wie immer herrschte in Colebury keinerlei Verkehr. Die Kleinstadt in Vermont, in der ich groß geworden war, kannte keine Rush Hour. Es war eher eine Rush Minute, und die hatte noch nicht angefangen. Ich bog ein letztes Mal ab, und die Häuser wurden kleiner, die Gehwege holprig. Auch nach drei Jahren kannte ich diesen Ort noch wie meine Westentasche.
Ich wäre niemals nach Hause zurückgekehrt, wenn es sich hätte vermeiden lassen. Ich bog auf das Grundstück meines Vaters ein und stellte den scheißlauten Motor ab. In einer Ecke befand sich Nickels Karosseriewerkstatt. Links stand unser altes Häuschen mit der schiefen Veranda, rechts war die Werkstatt mit zwei Stellplätzen.
Als Teenager fand ich, dass über dem Tor der Werkstatt eigentlich »Nickel & Sohn« hätte stehen sollen. In dem Jahr nach der Highschool hatte ich mindestens genauso viel dort gearbeitet wie mein Vater. Aber ich hatte ihn nie gebeten, das Schild zu ändern, denn dafür hätte ich mit ihm reden müssen. Mein Vater redete nicht. Er lobte mich auch nicht. Er schimpfte nicht einmal mit mir.
Stattdessen trank er.
Ich hatte die Klapperkiste in der Einfahrt zwischen Haus und Werkstatt abgestellt. Meine Ankunft lockte meinen Vater aus dem Dunkel der Garage hervor. Ich sah, wie er zum Tor hinausschlich und das unbekannte Auto misstrauisch beäugte. Wahrscheinlich hoffte er, dass ich kein Geldeintreiber war.
Ich stieg aus und schaute, ob sich im Gesicht meines Vaters irgendeine Reaktion zeigte.
Er blinzelte zweimal. Das war alles, was ich bekam.
»Hey«, sagte ich und griff nach den beiden Reisetaschen, die auf der Rückbank lagen und meine gesamte derzeitige Habe enthielten.
»Du bist draußen«, sagte er.
Besten Dank auch, Blitzmerker. »Ich bin seit sechs Monaten draußen«, entgegnete ich. »Ich hab in Orange County bei der Apfelernte geholfen.«
»Oh.« Er sprach schon mein ganzes Leben lang in Ein- oder Zweiwortsätzen. Ich hatte immer angenommen, er sei bloß kein Freund vieler Worte. Jetzt, da ich viel Zeit in Suchthilfegruppen verbracht hatte, war ich zu dem Schluss gekommen, dass er schwieg, um nicht zu lallen. Es war fast zwei Uhr nachmittags, was bedeutete, dass er seinen Flachmann wahrscheinlich schon zur Hälfte geleert hatte.
»Also …« Ich räusperte mich und fragte mich, was wohl als Nächstes passieren würde. »Bis zum Frühjahr gibt es auf der Farm keine Arbeit mehr. Ich hab gehofft, dass ich vielleicht in meinem alten Zimmer unterkommen könnte, falls es frei ist.« Ich legte den Kopf in den Nacken und schaute hinauf zu den schmalen Fenstern über der Werkstatt. Dort hingen immer noch dieselben verblichenen gelben Vorhänge.
Da sah ich, wie er die Augen zusammenkniff und mich von oben bis unten musterte. »Ja«, meinte er nach einer Pause. »Okay.«
»Ich bin clean«, fügte ich hinzu, falls es das war, was ihn zögern ließ. Anders als viele Drogenabhängige, die ich kennengelernt hatte, war ich wegen meiner Sucht noch nie mit meinem Vater aneinandergeraten. Er hatte sie ignoriert. Er hatte mich ignoriert. Das letzte Mal hatte ich ihn während des ersten Monats meiner Haftstrafe gesehen. Mein Vater hatte mich genau ein einziges Mal im Gefängnis besucht. Das waren zwanzig lange, peinliche Minuten gewesen, in denen wir einander über einen abgenutzten Tisch hinweg angeschaut hatten, während wir krampfhaft überlegten, was wir sagen sollten. In den ganzen drei Jahren, die ich meine Haftstrafe abgesessen hatte, war er mein einziger Besuch gewesen.
Fairerweise musste ich zugeben, dass eine andere Person versucht hatte, mich zu besuchen. Doch sie hatte ich nicht sehen wollen.
»Also …«, ich wühlte in meiner Reisetasche nach meinem Schlüsselbund. Es waren nur ein paar: der Autoschlüssel für den Dodge, der Werkstattschlüssel, der Schlüssel für mein Zimmer und noch ein vierter, den ich jetzt vom Schlüsselbund zog, indem ich den Fingernagel unter die Drahtwindungen schob. Als ich den Schlüssel gelöst hatte, hielt ich ihn meinem Vater hin.
Zögernd nahm er ihn mir aus der Hand. »Warum?«, fragte er nur.
Ich warf einen Blick auf mein Elternhaus. »Du hast im Haus bestimmt Alkohol. Ich trinke nicht mehr. Es wird mir leichter fallen, wenn ich da nicht reingehe.«
Wieder kniff er die Augen zusammen und betrachtete mich, aber dieses Gespräch verlief gar nicht mal so schlecht. »Ich kann auch arbeiten«, bot ich an. Natürlich musste ich arbeiten. Durch den Kauf des Dodge und der Ersatzteile, die nötig waren, um ihn am Laufen zu halten, würden meine Ersparnisse bedenklich dezimiert werden.
Das meiste von dem Geld, das ich auf der Obstplantage verdient hatte, hatte ich sparen können, da Kost und Logis inklusive gewesen waren. Aber es reichte nicht, um woanders ein neues Leben anzufangen. Noch nicht.
Ich wäre dennoch für immer auf der Farm geblieben. Hier über der Werkstatt zu wohnen, umgeben von den Geistern der Vergangenheit, in einer Stadt, in der ich ganz genau wusste, wo ich mir Drogen beschaffen konnte – das würde das Härteste sein, was ich je durchzustehen hatte.
»Gibt nicht viel zu tun derzeit«, sagte mein Vater. »Heute hatte ich nur einen Kratzer auszubessern, mehr nicht.«
Das überraschte mich nicht. In der schlechten alten Zeit, sogar auf dem Höhepunkt meiner Sucht, hatte ich jede Menge Reparaturen erledigt, während mein Vater die Werkstatt »gemanagt« hatte. Er hatte sicher Kunden verloren, als ich ins Gefängnis gekommen war. Nie im Leben hätte er sich nach meiner Festnahme so steigern können, dass er mit mir hätte mithalten können.
Ich schlug einen neutralen Ton an, weil ich ihn nicht verärgern wollte. »Ich dachte mir, ich könne ein Schild aufstellen und anbieten, dass ich für vierzig Mäuse Winterreifen aufziehe.«
»Könnte klappen«, murmelte er.
»Ich werd’s versuchen«, sagte ich schnell.
Einen Augenblick starrten wir uns an. Ich hatte erwartet, dass er viel älter aussehen würde. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich mich selbst wie hundert fühlte.
Nachdem das geklärt war und mein Dad das Gespräch offenbar als beendet betrachtete, zeigte er zur Werkstatt. »Muss wieder an die Arbeit«, erklärte er.
»Ja klar.«
Während er davonging, wies er auf den Dodge. »Das ist ’ne Schrottkarre.«
»Ist mir auch aufgefallen.«
Und das war’s. Das eigenartigste Wiedersehen zwischen Vater und Sohn, das man sich vorstellen konnte, war vorüber. Während ich erleichtert aufatmete, sah ich zu, wie sein Overall in der Werkstatt verschwand. Wahrscheinlich hatte das Ding keine Waschmaschine mehr von innen gesehen, seit ich im Gefängnis gelandet war.
Aber er hatte mich nicht abgewiesen. Wenigstens etwas.
Mit meinen Reisetaschen über der Schulter ging ich die Auffahrt zwischen dem Haus und der Werkstatt entlang. Auch hier hatte sich nichts verändert. Noch immer blätterte die Wandfarbe ab, und vertrocknetes Gras schaute durch die Risse im Asphalt.
In Vermont nannten wir den November die »Zeit der Stöcke«. Ein dunkler Monat, nachdem die Farben des Herbstes von den Bäumen verschwunden waren. Die Sonne ging jeden Tag um halb fünf unter, und es gab noch nicht den sauberen weißen Schnee, der unsere Sünden verdeckte.
Die Auffahrt mündete in eine Sackgasse, von der seitlich ein kleiner Weg abging. An dessen Ende befand sich die verwitterte Außentreppe zu meinem Zimmer. Aber ich kam nicht ganz bis dorthin. Als ich ums Eck bog, stieß ich fast gegen ein kleines, flaches Auto, das dicht an der Rückwand der Werkstatt geparkt war. Es war von Stoßstange zu Stoßstange mit einer schweren schwarzen Plane abgedeckt.
Bei seinem Anblick schnürte sich mir die Kehle zu, und mein Herzschlag beschleunigte sich. Mein Körper reagierte, als hätte ich gerade eine Leiche entdeckt.
In vielerlei Hinsicht hatte ich das auch.
Ich beugte mich vor, packte einen Zipfel der schwarzen Plane und hob sie nur ein paar Zentimeter an. Darunter sah ich genau das, was ich befürchtet hatte – ein Aufblitzen auberginefarbenen Lacks. Bei Porsche war das 1972 eine gängige Farbe gewesen.
Ich ließ die Plane wieder fallen und wich einen Schritt zurück, als hätte man mich dabei erwischt, wie ich etwas Verbotenes tat. Ich hatte keinen blassen Schimmer, warum dieses Mahnmal meiner Dummheit hier stand. In meiner Vorstellung war es einfach verschwunden, zusammen mit dem Leben, das es vor drei Jahren genommen hatte. Wenn ich tatsächlich mal einen Moment überlegt hätte, wo es wohl abgeblieben sein könne, hätte ich angenommen, dass mein Vater den Porsche hatte verschrotten lassen. Er wählte immer den einfachsten Weg.
Doch er war hier, genau an der Stelle, wo ich mehrere Male am Tag vorbeikommen würde. Ich würde versuchen müssen, nicht auf die zerquetschte Beifahrerseite zu achten, dort, wo das Auto den Baum gerammt hatte.
Wenigstens verbarg die Plane die fehlende Windschutzscheibe, durch die ein hundert Kilo schwerer Lacrosse-Spieler in den Tod geflogen war und sich beim Aufprall das Genick gebrochen hatte.
Alleine dass ich dort stand und die zerstörte Hülle meines früheren Lebens betrachtete, machte mich schon kribbelig. Nicht kribbelig im wörtlichen Sinne, es juckte mich nirgends. Aber »kribbelig« war die passendste Bezeichnung, die ich für das Verlangen nach Drogen hatte. Ich spürte eine Art rastloses Zittern in den Gliedern und eine Leere in der Brust. Manche beschrieben es als eine Art Hunger oder Durst. Aber das war auch nicht ganz zutreffend.
Wie auch immer man es nennen mochte, in mir war ein schmerzliches Verlangen, und ich sehnte mich danach, es zu lindern. Und jeden Tag ging ich ein wenig verloren durchs Leben und versuchte, eine Leere in meiner Seele zu füllen. Aber sie verschwand nie. Ich war seit fünf Monaten raus aus dem Entzug und spürte sie noch immer die ganze Zeit. Sie meldete sich, wenn ich gestresst oder gelangweilt war. Wenn ich müde war oder nicht genug zu essen gehabt hatte. Manchmal sogar dann, wenn eigentlich alles gut lief.
Das würde nie, niemals aufhören. Es gab dagegen kein Heilmittel. Man musste eben einfach damit leben. Ende aus.
Die Ränder der Plane bewegten sich im Wind, als würden sie mich verspotten.
In der Entzugsklinik hatten sie uns immer gesagt: »Beweg dich, denk an was anderes.« Also tat ich das. Ich zog mir die Riemen meiner Reisetaschen ein Stück höher über die Schulter. Dann ging ich um den Porsche herum, ohne ihn noch einmal zu berühren, und lief die wacklige Holztreppe, zwei Stufen auf einmal nehmend, hinauf in mein Zimmer.
Ich war seit über drei Jahren nicht mehr hier gewesen, aber dennoch fühlte es sich merkwürdig vertraut an, meinen Schlüssel ins Schloss zu stecken und die Tür aufzudrücken.
Muffig. Das war das Erste, was mir auffiel. Das Zweite die Unordnung. Ich besaß nicht viel, aber alle meine Besitztümer waren im Zimmer verstreut, als hätte sich nur an dieser Stelle ein Erdbeben ereignet.
Jemand hatte mein Zimmer durchsucht, und die Person, die das getan hatte, war dabei nicht eben rücksichtsvoll vorgegangen.
Kommodenschubladen standen offen, ihr Inhalt war herausgeworfen worden. Die Matratze lag schief, weil jemand darunter etwas gesucht hatte. Die Gegenstände in meinen Bücherregalen bildeten ein einziges Chaos.
Ich ließ meine Taschen auf das zerwühlte Bett fallen und ging geradewegs ins Bad. Mein Blick blieb an einer rosa Flasche Shampoo hängen, die drei Jahre lang in meiner Dusche auf mich gewartet hatte.
Es war ihre. Sophies.
Ich streckte den Arm aus, nahm die Flasche von der Ablage und klappte den Deckel auf. Und sofort hatte ich den Geruch in der Nase – grüner Apfel. Als ich dort stand und mich an Sophies Geruch erinnerte, fühlte es sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Von allen Dingen, die ich verloren hatte – meinen guten Ruf, die Chance auf einen anständigen Job, mein sorgsam restauriertes Auto –, war nichts so bedeutend wie Sophie. Sie war aus meinem Leben verschwunden, und zwar für immer. Es gab keine Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen.
Etwa eine Minute später wurde mir bewusst, dass ich noch immer dort in meinem Schlachtfeld von Zimmer stand und wie ein Trottel an einer Shampooflasche aus Plastik schnüffelte. Aber man brauchte sich nicht dafür zu schämen, jemanden zu vermissen. Glaubt mir, mit Scham kenne ich mich aus. Der Haufen Dinge, für die ich mich schämte, war so hoch wie der Mount Mansfield, der höchste Berg hier in Vermont. Sie zu vermissen, war allerdings kein Verbrechen. Das würde jedem so gehen.
Ich schloss die Flasche wieder und stellte sie zurück. Dann wandte ich meine Aufmerksamkeit der Toilette zu, denn das hier war die wahre Herausforderung. Zuerst betätigte ich die Spülung, nur um mich zu vergewissern, dass sie noch funktionierte, weil ich gleich etwas haben würde, das ich hinunterspülen musste.
Jetzt kam der schwierige Teil.
Ich betrachtete die Abdeckung des Spülkastens und fragte mich, was ich darin finden würde. Wahrscheinlich nichts. Es war kein sonderlich originelles Versteck. Doch als ich meine Pillen weggepackt hatte, hatte ich nicht versucht, sie vor der Polizei zu verstecken, die ohnehin genau wusste, wo sie suchen musste. Ich hatte sie lediglich vor Sophie versteckt.
Damals war ich so stolz darauf gewesen, wie ich meine beiden großen Lieben voneinander getrennt hielt – meine Drogen und meine Freundin. Selbst als ich unfassbar große Mengen Oxi konsumiert hatte, hatte ich in der Werkstatt funktioniert und war immer noch ein guter Liebhaber gewesen. Was für eine Leistung!
Bis eines Nachts alles schiefgelaufen war.
Seitdem hatte ich viele, viele Male das »Was wäre wenn«-Spiel gespielt. Was, wenn sie davon gewusst hätte? Was, wenn ich gezwungen gewesen wäre, mein Problem früher zuzugeben? Was, wenn mir bloß ein kleiner Fehler unterlaufen wäre, der die Katastrophe am Ende verhindert hätte?
»Was wäre wenn« war sinnlos. Jeder Süchtige konnte ein Lied davon singen.
Langsam hob ich die staubige Abdeckung des Spülkastens an und spähte hinein, als säße darin eine Schlange, die mich beißen könnte. Und tatsächlich waren die Pillen, die ich in den vergangenen Monaten aus meinem Leben herausgehalten hatte, schlimmer als jede Schlange.
Doch da war nichts. Jemand hatte mein altes Versteck entdeckt, und alles, was in der schlimmsten Nacht meines alten Lebens dort versteckt gewesen war, war schon lange verschwunden – von der Polizei entdeckt und in einem Asservatenschrank sichergestellt, wo die verbotene Ware, die sie bei Losern wie mir fanden, aufbewahrt wurde.
Gott sei Dank. Heute würde ich nicht wirklich auf die Probe gestellt werden wollen.
Klar, ich hätte die Pillen wahrscheinlich sofort heruntergespült. Aber das weiß man nicht sicher, bis man sie in der Hand hält. Vielleicht hätte ich mir doch eine in die Tasche gesteckt, für den Notfall. Doch für einen Süchtigen wie mich wäre dieser Notfall unweigerlich innerhalb derselben Stunde eingetreten.
In der Entzugsklinik hatte ich erfahren, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit für Opiatabhängige bei über fünfzig Prozent lag. In letzter Zeit ging mir diese deprimierende kleine Statistik den ganzen Tag durch den Kopf. »Aber das bedeutet, dass fast die Hälfte von uns nicht rückfällig wird«, hatte irgendein Optimist in der Gruppentherapie betont. »Ihr könnt euch dafür entscheiden, zu dieser Hälfte zu gehören.«
Leichter gesagt als getan.
Zum ersten Mal, seit ich in die Stadt gekommen war, verspürte ich echte Erleichterung. Ich legte die Abdeckung des Spülkastens wieder an ihren Platz. Dann machte ich mich ans Aufräumen. Als ich das Bett abzog, erhob sich eine Staubwolke, die mich zum Husten brachte. Also öffnete ich trotz der Novemberkälte das Fenster. Ich musste mein Zimmer lüften. Meine Lungen lüften. Und mein ganzes gottverdammtes Leben.
Ich brauchte mehrere Stunden, um die Bude wieder halbwegs bewohnbar zu machen. Ich schleppte den Staubsauger die Treppe hoch, um damit dem Dreck den Kampf anzusagen. Ich fuhr zum Waschsalon, und während meine Bettwäsche und meine Handtücher im Trockner waren, hielt ich bei einem Fastfood-Drive-in und aß in meinem Schrottauto. Es kam nicht annähernd an das selbst gekochte Essen, das ich auf der Shipley Farm bekommen hatte, heran, aber es erfüllte seinen Zweck.
Als es Abend wurde, konnte ich das Bett frisch beziehen und mich dann darauffallen lassen. Ich knipste die Lampe aus und wartete, bis meine Augen sich an die Schatten in meinem alten Zimmer gewöhnt hatten. Zurzeit war das Einschlafen immer schwierig und Durchschlafen völlig unmöglich. Auf der Shipley Farm hatte ich mir mit drei anderen Typen eine Schlafbaracke geteilt. Für gewöhnlich hatte ich nachts wach dagelegen und ihnen beim Schnarchen zugehört.
In meinem Zimmer hier zu Hause war es sehr viel ruhiger – gerade ruhig genug, um all den Dämonen in meinem Kopf Raum zu geben. Als ich hier lag, musste ich auch an sie denken.
Sophie.
Ich fragte mich, wo sie inzwischen lebte. Wahrscheinlich in New York. Vielleicht hatte sie dort irgendwo eine kleine Wohnung, als Sängerin verdiente man am Anfang ja kaum etwas. Bestimmt hatte sie mehrere Mitbewohner.
Oder einen Freund.
Ich zwang mich, mir vorzustellen, was für einen Partner sie sich wohl aussuchen würde. Er würde das glatte Gegenteil von mir sein müssen, da Sophie sicher nicht an ihre schlechte Wahl erinnert werden wollte. Demnach wohl ein dunkelhaariger Typ, vielleicht auch dunkelhäutig, mit einem schicken italienischen Anzug. Hoffentlich hatte er einen gut bezahlten Job – entweder in der Finanz- oder Immobilienbranche. Er würde genug Geld verdienen, um in einem sicheren Viertel zu wohnen und Sophie in teure Restaurants einzuladen.
Natürlich würde die Sophie, die ich kannte, nicht mit einem Banker zusammen sein wollen. Das klang eher nach jemandem, den ihr Vater für sie aussuchen würde. Aber vielleicht hätte sie diesen Typen ja während der Pause in der Metropolitan Opera kennengelernt. Ihr Banker hatte was für Kunst übrig und ein Abo für eine Privatloge. Wahrscheinlich hatte er sie eingeladen, sich die Oper von seinem Platz aus anzusehen, weil man von dort die beste Sicht hatte. Und da Sophie nur einen Stehplatz hatte, hatte sie die Einladung angenommen …
Eine Einzelheit machte mich stutzig. Hatten Theater überhaupt noch private Logen oder gab es so was nur in alten Filmen?
Im Gefängnis hatte ich mir stundenlang mit solchen Gedanken die Zeit vertreiben müssen. Wenn ich niemanden zum Reden gehabt hatte, hatte ich meine Gedanken auf Reisen geschickt. Früher hatte ich immer viel geredet, man hätte mich wohl auch als Schwätzer bezeichnen können. Aber in den letzten drei Jahren hatte ich mich nur selten mit jemandem unterhalten können. Sogar auf der Shipley Farm, wo es immer jemanden zum Reden gab, sagte ich nicht viel. Die Shipleys waren so eine nette, normale Familie. Ich hörte ihnen lieber zu. Wer wollte schon Geschichten aus dem Gefängnis hören?
Genau. Niemand.
Ein einzelnes Paar Scheinwerfer wanderte von links nach rechts über die Schräge meiner Zimmerdecke. Dann war es wieder dunkel. Die Geräusche der Nacht waren hier anders. Ich war an die Rufe der Streifenkäuze auf der Shipley Farm gewöhnt, die in manchen Nächten vom Heulen der Kojoten in der Nähe untermalt wurden.
Ich vermisste die Schlafbaracke. Für mich war Privatsphäre kein Luxus. Wenn ich jetzt aus dem Bett aufstehen und mich irgendwo auf die Suche nach einer Dröhnung machen würde, würde es niemanden geben, der es mitbekommen oder den es kümmern würde. Ich brauchte es, morgens um sechs die Kühe melken zu müssen, damit ich nicht wieder vom Weg abkam. Ich brauchte Griff Shipleys wachsamen Blick auf mir, wenn wir am Stand auf dem Bauernmarkt arbeiteten.
Das hier würde richtig hart für mich werden – jede einzelne Minute. In Colebury waren Drogen immer in Reichweite. Ein paar meiner Junkie-Freunde waren gerade wahrscheinlich weniger als eine Meile entfernt. Dröhnten sich immer noch zu. Dealten immer noch. Colebury stank nach all meinen alten Fehlern und Lastern.
Die kribbelnde Leere in meiner Brust pochte, und ich drehte mich auf die andere Seite, um das Gefühl zu unterdrücken. Doch das erinnerte mich nur an etwas anderes, das mir fehlte. Jemanden. Ich vergrub die Nase im Kissen und atmete tief ein, fragte mich, ob noch ein Rest Sophie darin steckte.
Doch sie war schon lange fort.
2
Sophie
Innerer DJ spielt: »You Keep me Hangin’ On« von den Supremes
»Mom?«, rief ich von der Küche aus. »Hast du eine Einkaufsliste geschrieben?« Nachdem ich mein Portemonnaie in meine Handtasche gestopft hatte, warf ich meinen Trenchcoat über. Ich war ein wenig spät dran für die Arbeit, so wie immer. »Mom?«
Stille.
Einen Seufzer unterdrückend, ging ich durchs Haus ins Wohnzimmer, wo meine Mutter in ihrem Sessel saß und aus dem Fenster starrte. Die Tasse Tee, die ich ihr vor einer halben Stunde gebracht hatte, stand unangetastet neben ihr.
»Mom? Die Einkaufsliste?«, sagte ich noch einmal.
Sie drehte mir den Kopf zu, doch ihr Blick war immer noch ausdruckslos. »Ich bin nicht dazu gekommen«, sagte sie.
Natürlich bist du das nicht. Sie kam nie zu irgendwas. In der Zeit, wenn mein Vater zu Hause war, erschien sie wenigstens zum Essen und antwortete auf einfache Fragen.
Doch er war vor einer halben Stunde zur Arbeit gefahren, und sie hatte sich bereits in sich zusammengekauert und darauf eingestellt, einen ganzen langen Tag aus dem Fenster zu starren, so sinnvoll wie ein Briefbeschwerer.
»Wir brauchen wahrscheinlich Kaffee«, schlug sie vor. »Dein Vater wird so unangenehm, wenn er uns ausgeht.« Danke für die Info. »Geht klar. Den Rest werd ich einfach spontan mitnehmen«, versprach ich. »Tschüss.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte ich zurück in die Küche, schnappte mir meine Handtasche und rannte raus zur Garage. Ich stieg in meinen Rav4 und ließ den Motor an. Dann zählte ich bis sechzig, denn Jude hatte immer gesagt, ein Motor brauche eine Minute, um warm zu werden.
Mir gefiel die Tatsache nicht, dass ich drei-, viermal am Tag, jedes Mal wenn ich meinen Wagen anließ, an Jude dachte. Oder jede Nacht, wenn ich allein im Bett lag.
Vieles an meiner momentanen Situation gefiel mir nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit zweiundzwanzig noch bei meinen Eltern wohnen würde. Aber nachdem ich mein Studium am College zur Hälfte absolviert hatte, war ich wieder zu Hause eingezogen. Meine Mutter hatte sich nach Gavins Tod in einen Zombie verwandelt, und ich hatte helfen wollen. Doch ich hatte angenommen, das wäre nur vorübergehend. Wer hatte ahnen können, dass sie auch drei Jahre später noch kaum zurechtkommen würde?
Vor dem Unfall war meine Mutter wie eine kraftvoll instrumentierte Darbietung von Beethovens Fünfter gewesen – mit jedem Atemzug versprühte sie Ehrgeiz und Aktionismus. Sie zog zwei Kinder groß, während sie in Vollzeit für die Bibliotheksverwaltung von Vermont arbeitete. Sie führte fünfzehn Jahre in Folge die Regie beim Weihnachts-Festumzug unserer Kirche. Sie sammelte Spenden für die Brustkrebsforschung, für die Alphabetisierung und für sauberes Wasser in Afrika.
Heute? Tat sie nichts mehr von alledem. Heute war sie ein düsteres Klagelied, das einhändig auf einer verstimmten Orgel gespielt wurde.
Als die sechzig Sekunden um waren, setzte ich rückwärts aus unserer Einfahrt und fuhr zur Arbeit.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich meiner Mutter helfen sollte, darüber hinwegzukommen. Ich hatte für sie Termine beim Therapeuten vereinbart, doch sie weigerte sich, hinzugehen. Also übernahm ich die Lebensmitteleinkäufe. Und das Kochen. Solange jeden Abend eine Mahlzeit auf unserem Esstisch stand, konnte mein Vater so tun, als wären wir keine komplett gestörte Familie.
Und da sich meine Mutter nie in der Lage dazu zeigte, waren Einkaufen und Kochen zu meiner Angelegenheit geworden.
Niemand wollte, dass mein Dad einen Wutanfall bekam, das war mal sicher. Damit wäre keinem geholfen. Er war ein Tyrann, und es schien ihm egal zu sein, dass sich meine Mutter nie von dem Schlag erholt hatte. Die Lage zu Hause war schlimm, aber ich hatte einen Job, der mir gefiel, und es waren nur noch sechs Wochen, bis ich meinen Collegeabschluss machen würde.
Gedanklich auf Autopilot, fuhr ich durch unsere Nachbarschaft in Richtung des State Highways, der meine kleine Heimatstadt mit Montpelier verband. Da ich bereits etwas spät dran war für die Arbeit, hatte ich nicht die Zeit, bei der neuen Bäckerei anzuhalten, um mir einen Caffè Latte zu holen.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung zu überschreiten, kam nicht infrage. Wenn man einen Polizeichef zum Vater hatte, gehörte es sich nicht, Verkehrsvorschriften zu missachten. Nicht dass mich ein paar kleine Regelverstöße gekümmert hätten, nur brachte mir so was hinterher zu viel Ärger ein. Die Deputys verpfiffen mich nur zu gern bei Daddy.
Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als ich am Stoppschild an der Kreuzung Harvey und Grove Street bremste. Aus den Augenwinkeln nahm ich eine Bewegung dicht hinter dem offenen Garagentor von Nickels Karosseriewerkstatt wahr.
Ich schaute hin. (Natürlich schaute ich hin. Jeder würde das tun.) Allerdings rechnete ich nicht wirklich damit, ihn dort neben einem ramponierten Dodge stehen zu sehen, der sich auf der Hebebühne befand.
Und selbst als mein Hals sich bei dem einen, schockierenden Wort zuschnürte, das zu meinen Lippen flog – Jude –, glaubte ich es dennoch nicht richtig.
Denn er konnte unmöglich dort stehen, mitten in der Werkstatt, und mit ruhiger Hand über die zerbeulte Stoßstange eines hässlichen Autos fahren. Doch diesen Arm, der zu dem Wagen hochgereckt wurde, ich kannte diesen Arm. Ein dorniger Rosenzweig war auf den Bizeps tätowiert. Und diese Hand hatte meinen Körper überall berührt.
Ich vergaß mich, saß einfach nur da, einen Fuß fest auf der Bremse, und starrte auf das, was nur eine Jude-Fata-Morgana sein konnte. Einige Details stimmten nicht. Judes Haare hätten nie und nimmer diese aufgehellte, sonnengeküsste Farbe. Und nie im Leben würde er sich in so einem Flanellhemd sehen lassen. Wir haben uns früher immer über diese typische Vermont-Tracht lustig gemacht. Fata-Morgana-Jude war außerdem zu massig, mit einer breiten Brust und Muskeln am Rücken, die sich deutlich abzeichneten, wenn er den Arm bewegte. Mein Jude war immer hager gewesen, regelrecht dürr, als er aus meinem Leben ging.
Damals hatte ich nicht begreifen wollen, warum.
Am ausschlaggebendsten war aber, dass Jude unmöglich an einem ganz normalen Novembermorgen mitten in Colebury drei Meter entfernt von mir stehen und eine Schrottkarre inspizieren konnte. Wenn er tatsächlich hier wäre, wüsste ich das. Ich würde es tief in meinem Innersten spüren, so wie der Bass eines guten Songs einem in der Brust vibriert.
Hinter mir hupte ein Auto, doch ich registrierte es kaum. Ich nahm immer noch den Anblick seines glänzenden, zu hellen Haars und seines muskulösen Unterarms in mich auf. Als das Hupen zu einem vollen Dröhnen wurde, riss mich das endlich aus meiner Träumerei. Vermonter hupten nie, was nur bedeuten konnte, dass ich Jude eine ganze Weile lang angestarrt hatte. Nach einem hastigen Blick in jede Richtung nahm ich den Fuß von der Bremse und trat das Gaspedal durch.
Irgendwie kam ich zehn Minuten später bei der Arbeit an, was wundersam war, denn ich konnte mich kein Stück an die Fahrt erinnern. Aber hier war ich, auf einem Parkplatz hinter dem Krankenhaus, und stellte den Motor ab. Mit einem Ruck riss ich den Schlüssel aus dem Zündschloss und warf ihn in meine Tasche, aber ich stieg noch nicht aus dem Wagen aus.
Tief durchatmen, redete ich mir gut zu. Ich umfasste das Lenkrad und legte eine Wange auf dessen kühle Mitte. Mein Herz flatterte im Discotakt, während ich versuchte, mich von dem Schock zu erholen. Ich wusste, dass Jude aus dem Gefängnis raus war. Man hatte uns informiert, als er entlassen worden war. Aber das war sechs Monate her. Letztes Frühjahr war ich einige Wochen lang extrem angespannt gewesen, doch er war nicht aufgetaucht. Danach hatte ich aufgehört, mir Sorgen zu machen, dass ich ihn hier in Colebury sehen könnte. Mein Herz glaubte, er wäre genauso vollständig aus Vermont verschwunden wie aus meinem Leben.
Offensichtlich war mein Herz ein gottverdammter Idiot.
Ein Klopfen gegen die Fensterscheibe erschreckte mich so fürchterlich, dass ich mich ruckartig aufsetzte.
»Tut mir leid«, formte der Mann vor meinem Auto die Worte mit dem Mund.
»Jesus, Maria und Josef.« Ich tastete nach dem Türgriff. »Denny, deinetwegen wäre mir fast das Herz stehen geblieben.«
»Es tut mir leid«, sagte er noch einmal. »Aber du warst vornübergesackt wie jemand, dem eine Ader im Hirn geplatzt ist. Wie jemand, der den Heimlich-Griff braucht.«
»Den wendet man bei Erstickungsgefahr an.« Mein Tonfall klang etwas harscher als beabsichtigt. Denny war zwar linkisch, aber ein guter Kerl, und er hatte keine Schuld daran, dass ich am Rad drehte. Ich stieg aus meinem Wagen aus und folgte meinem Kollegen mit zittrigen Knien zum Gebäude.
»Ernsthaft, bist du okay?« Er hielt mir die Tür zum Krankenhaus auf, und ich nahm einen ersten Lungenzug von dem typischen Geruch, den wir den ganzen Tag einatmeten.
»Mir geht’s gut«, log ich. »Ich hatte bloß einen schwachen Moment.«
»Ist es wegen deiner Mom?« Denny war total fürsorglich. Er wusste ein bisschen was über meinen Frust zu Hause. Und alle kannten meine Familientragödie. Als es passierte, war der Tod meines Bruders zwei Wochen am Stück Thema in den Zeitungen gewesen. Erst gab es die traurigen Geschichten – Polizeichef verliert Erstgeborenen. Dann folgten die unschönen Details aus der Untersuchung des Unfallhergangs und die Enthüllung, dass der arme Sohn des Polizeichefs aus einem Auto geschleudert worden war, das ein mit Schmerzmitteln zugedröhnter Junkie gefahren hatte.
Die Presse erzählte allerdings nicht die ganze Geschichte. Sie deckte nicht auf, dass besagter Junkie der Freund der Tochter des Polizeichefs war, der man wiederholt verboten hatte, sich mit ihm zu treffen. Dieser kleine Skandal erschien nicht in den Zeitungen – aus Respekt vor der trauernden Familie.
Wir waren wochenlang in den Schlagzeilen gewesen, und trotzdem blieben einige der wirklich wichtigen Fragen ungestellt. Als da wären: Wo wollten der Goldjunge und der Junkie bloß in jener Nacht hin?
»Sophie?«
Ich stellte fest, dass ich wie eine Schlafwandlerin vor meinem Schreibtisch stand. Und ich hatte gar nicht auf Dennys Frage geantwortet. »Ja?«
»Kann ich deinen Mantel aufhängen?«
Hastig zog ich meinen Trench aus. »Sicher. Danke!« Neben meinem Verstand verlor ich auch noch meine Manieren.
Als er ging, trat ich auf die andere Seite meines Schreibtischs und ließ mich auf den Stuhl fallen. Reiß dich zusammen, Soph, befahl ich mir selbst. Doch das würde nicht leicht werden. Mit siebzehn glaubte ich, der Himmel hätte mir Jude geschickt. Mit achtzehn ließ ich mich von ihm in himmlische Höhen tragen. Mit neunzehn machte er mein Herz kaputt und meine Familie.
Er war jetzt seit dreieinhalb Jahren weg. Ich hatte seinetwegen ein Meer von Tränen vergossen. Das erste Jahr war am härtesten gewesen. Meine Familie befand sich in einem Strudel der Trauer, und da Jude der Grund dafür war, verbarg ich meinen Herzschmerz. Niemand hätte mich sagen hören wollen, dass Jude nie die Absicht gehabt hatte, jemanden zu verletzen. Niemanden kümmerte es, dass er offensichtlich Hilfe gebraucht hatte. Sie wollten nicht hören, dass er (die meiste Zeit) wundervoll zu mir gewesen war.
Dass er der Einzige gewesen war, der mir zugehört hatte, wenn ich redete.
Mein Vater konnte Jude schon nicht ausstehen, bevor der meinen Bruder tötete. Als es mit meiner jugendlichen Jude-Besessenheit losging, hatte es meine Eltern überrascht, dass aus der braven Sophie ein rebellischer Teenie werden konnte. Ich hatte mir die Haare schwarz gefärbt und mir ein Tattoo auf den Hintern stechen lassen. Alles ganz normaler Kinderkram, aber mein Vater tobte und stieß wüste Drohungen aus.
Er schnüffelte auch in meinem Zimmer herum. Als er eine Quittung für Kondome fand, verbot er mir, auch nur noch einmal mit meinem Freund zu sprechen. Er hatte geschimpft, dass Jude nur Ärger bedeutete, aber mein Herz wollte nicht hören. Stattdessen log ich nur noch mehr und schlich mich nachts raus.
Die Lage entspannte sich ein wenig, als ich zu Beginn meiner Collegezeit ins Wohnheim der University of Vermont zog. Mein Vater nahm an, dass die fünfundvierzig Meilen zwischen Colebury und Burlington Judes Einfluss auf mein Leben mindern würden. Aber wir machten nur noch viel ungehinderter weiter. Judes Porsche grub Fahrrillen in den Highway 89, und ich verbrachte jedes Wochenende mit ihm.
Dann, an einem scheußlichen Frühlingsabend kurz nachdem mein erstes Collegejahr zu Ende gegangen war, standen Bundespolizisten vor unserer Tür, ihre Schirmmützen in den Händen. An jenem Abend bewies Jude auf einen Schlag, dass mein Vater mit allem recht gehabt hatte. Als unsere Haustür aufging und den Blick auf die Mützen in den Händen der Polizeibeamten freigab, gewann mein Vater jeden Streit, den wir je geführt hatten.
Dieser Abend wird mir immer nur verschwommen in Erinnerung sein. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter aufschrie und dann ohnmächtig im Wohnzimmer zusammenbrach.
»Aber was ist mit Jude?«, hatte ich in jenen schrecklichen Augenblicken der Verwirrung gefragt. Niemand antwortete mir. Es sollte zwölf Stunden dauern, bis ich überhaupt erfuhr, dass er lebte. Als sich die schreckliche Geschichte abzuzeichnen begann, tat er mir leid. Zu wissen, dass man jemanden umgebracht hatte, selbst auf so eine schreckliche, unvorsichtige Weise, musste entsetzlich sein. Das alles war so furchtbar traurig.
Natürlich behielt ich meine mitfühlenden Gedanken für mich. Bei mir zu Hause sprach niemand auch nur Judes Namen laut aus. Der einzige Name, den alle auf den Lippen hatten, war Gavin. Armer Gavin. Gavin der Tolle. Lacrosse-Champion. Geliebter Sohn.
Nach außen hin machte ich alles richtig. Ich schleppte mich taumelnd durch die Totenwache für meinen Bruder und dann durch seine Beerdigung.
Aber insgeheim zerriss es mir wegen Jude das Herz. Nachdem er dem von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagenen Strafmaß zugestimmt hatte und still und leise ins Gefängnis gegangen war, hatte ich versucht, ihm zu schreiben. In kurzen Abständen schickte ich mehrere Briefe. Alles verschiedene Varianten von »Warum?« und »Was ist passiert?«. Ich bin nicht stolz darauf, aber sie enthielten auch jede Menge »Ich liebe dich« und »Warum redest du nicht mit mir?«.
Erst Wochen nach Judes Verurteilung erhielt ich einen großen Umschlag vom Staatsgefängnis in Nord-Vermont, der alle meine Briefe enthielt. Ungeöffnet. Auf einem einzelnen Blatt Papier darin stand: »Annahme verweigert.«
Zu dem Zeitpunkt hatte ich begriffen, dass Jude krank und abhängig war und dass er litt. Und ich wusste, dass er etwas Schreckliches getan hatte. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass er sich von mir abwenden würde. Erneut heulte ich Rotz und Wasser wegen der zurückgesandten Briefe. Ich war einfach so was von wütend darüber gewesen, dass er seine ganzen Untaten noch toppte, indem er mich zurückwies. Wie konnte er es wagen.
Verdammt, ich war immer noch wütend. Mit geballten Fäusten saß ich an meinem aufgeräumten Schreibtisch im Sozialdienstbüro des Krankenhauses. Ich war überhaupt nicht auf sein Wiederauftauchen vorbereitet. Ich wusste, wenn ich heute Abend nach der Arbeit in den Lebensmittelladen ging, würde ich in jedem Gang nach ihm Ausschau halten. Ich würde an der Zapfsäule der Tankstelle über meine Schulter blicken, ebenso wenn ich in der Bäckerei in der Schlange stand. In unserer Neuntausend-Einwohner-Stadt war es unausweichlich, dass ich ihm irgendwann über den Weg laufen würde.
Ich würde niemals bereit dafür sein.
Etwas landete mit einem dumpfen Geräusch auf meinem Schreibtisch. Es war ein verschlossener Kaffeebecher aus der Krankenhauscafeteria. »Vielen Dank«, sagte ich sofort und blickte hoch in Dennys ernste braune Augen.
»Gern geschehen. Du sahst einfach so aus, als könntest du heute Morgen eine kleine Aufmunterung gebrauchen.«
DuhastjakeineAhnung. »Danke«, wiederholte ich und zog den Becher zu mir. Auch ohne den Deckel anzuheben, wusste ich, dass ein Caffè Latte mit fettarmer Milch und ein bisschen Zimt obendrauf darin war. Denny kannte mich. Denny beobachtete mich. Und ungefähr einmal im Monat fragte er mich nach einem Date. Ich formulierte mein Nein immer freundlich, aber bestimmt. Ich hoffte, er würde aufhören zu fragen. Dabei war er so nett. Wenn ich ihm einen Korb gab, kam ich mir wie eine Diva vor.
»Du weißt doch, dass gleich die Mitarbeiterbesprechung losgeht?« Er deutete mit dem Kopf in Richtung des Besprechungsraums.
Als ich dort hinsah, versammelten sich bereits Leute um den Tisch. Scheiße! Ich sprang von meinem Stuhl auf und nahm meinen Caffè Latte mit.
Erst nach zwei Schritten merkte ich, dass Denny mir nicht folgte. Als ich über meine Schulter blickte, sah ich ihn lächeln. »Du bist mit dem Bericht zur Fallauslastung dran, oder?«
Mit einem weiteren gemurmelten Danke an Denny schnappte ich mir den Ordner von meinem Schreibtisch und ging in das Meeting.
Reiß dich zusammen, Haines, befahl ich mir selbst. Denny sollte mir nicht den Arsch retten. Er und ich konkurrierten um denselben Job. Wir würden beide Ende des Semesters unseren Abschluss machen, und das Krankenhaus hatte nur eine Vollzeitstelle zu vergeben. Vermutlich würde er sie bekommen, denn er machte einen Master und ich nur einen Bachelor. Im Januar würde ich sie wahrscheinlich anbetteln, mein Praktikum zu verlängern, während ich mich abmühte, einen richtigen Job zu finden.
Angesichts von Tagen wie diesen würde es schwer werden, Denny seinen Sieg zu missgönnen.
Wir beide setzten uns als Letzte. Unsere Abteilung war klein, und es ging ziemlich locker zu, aber da ich es auf eine Festanstellung abgesehen hatte, war es keine gute Idee, irgendwie neben der Spur rüberzukommen. Es gab fünf Sozialarbeiter mit Vollzeitstellen, dazu Denny und mich als Teilzeit-Aushilfen, während wir beide unsere Abschlüsse machten. Unser Chef, Mr Norse, ein freundlicher, zerknitterter Mann Mitte sechzig, eröffnete das Meeting mit einer Besprechung der Budgetplanung für das kommende Jahr.
Natürlich drifteten meine Gedanken sofort wieder zu Jude ab. Diese Budgetpläne hatten keine Chance gegen meinen problembeladenen Ex mit seinen stechend grauen Augen und den engen Jeans.
Wir waren in meinem ersten Highschooljahr ein Paar geworden. Aber schon bevor wir uns je miteinander unterhalten hatten, war mir Jude aufgefallen. Er war der Typ, der immer zu spät in die Klasse geschlichen kam, wenn ihm danach war. Die Lehrer gingen ihn deswegen nicht mal an, denn das hätte nichts gebracht. Er besaß so eine gewisse »Mir doch egal, was Sie denken«-Ausstrahlung.
Ich hatte ihn wahnsinnig attraktiv gefunden. Das lag gar nicht nur an seinen megalangen Wimpern. Ich stand total auf seine Art. Ich war ein zurückhaltendes, braves Mädchen, das immer zu viel Respekt vor Autoritätspersonen hatte, um auszusprechen, was mir durch den Kopf ging.
Ihn zu beobachten, wurde mein Hobby. Aber die Vorstellung, dass Jude Nickel jemals in meine Richtung schauen würde, war ziemlich lächerlich.
Eines Nachmittags in der Schule versuchte ich in heller Aufregung, ein Konzert der Schulband vorzubereiten. Beim Drucken der Programme hatte es einen Papierstau im Kopierer gegeben, und die Hefte zu falten, hatte länger gedauert als gedacht. Ich lief also schon mächtig dem Zeitplan hinterher, als ich in die Turnhalle kam.
Jemand hatte schon ein paar Hundert Klappstühle in Reihen aufgestellt, und ich war gebeten worden, auf jeden davon ein Programm zu legen. Ich war also dabei, Programmhefte auf die Stühle zu klatschen, als die Brandschutztür aufging und ein kalter Windzug durch die Halle wehte, sodass die Programme durch die Luft wirbelten und dann zu Boden segelten.
Hektisch hob ich sie wieder auf und legte alles erneut so hin, wie es sein sollte. Und dann passierte es ein zweites Mal! Mein Blutdruck stieg, als ich erneut einigen Programmen nachjagte und sie vom Boden aufsammelte. Ich stampfte rüber zum Notausgang, kickte gegen den Türstopper, und die Tür fiel langsam zu.
In letzter Sekunde schoss ein tätowierter Arm vor und hielt sie offen. »Macht’s dir was aus?«, fragte eine Stimme rau wie Schotter. »Ich rauch hier nur schnell eine.« Ein nervöses Kribbeln durchzuckte meinen Bauch, als Jude Nickel durch den Türspalt zu mir lugte.
»Im Ernst?«, blaffte ich. »Das verstößt so ungefähr gegen zehn Schulregeln.«
Er zog eine Augenbraue hoch, als hätte er Zweifel an meiner geistigen Gesundheit. Bei diesem lässigen, wortlosen Statement wurde mir durch und durch heiß. Jude hatte das immer geschafft. Wann immer er mir einen Blick zuwarf, wusste ich gar nicht, wo ich hingucken sollte. Und jetzt betrachtete er mich zum ersten Mal richtig.
»Die Tür muss zu«, sagte ich und besann mich wieder. »Ich hab nur noch zehn Minuten, um fertigzuwerden.«
Er blockierte immer noch die Tür und hob eine Hand, als wolle er mich zum Schweigen bringen. Dann nahm er einen letzten Zug und blies den Rauch aus. Schließlich zertrat er die Zigarette mit seinem Stiefel.
Ich wedelte heftig mit einer Hand vor meinem Gesicht rum, um den Rauch zu vertreiben. Zigarettenqualm wäre nicht gut für meine Stimmbänder.
Da hatte Jude gegrinst und mich damit noch mehr aus dem Konzept gebracht. Sein Einhundert-Watt-Lächeln machte alle Mädchen verrückt. Es auf mich gerichtet zu erleben, überraschte mich dermaßen, dass ich wie eine Idiotin stirnrunzelnd zurückguckte.
Langsam, so als hätte er alle Zeit der Welt, schob er sich an mir vorbei in den Zuschauerraum. Ich schloss beleidigt die Tür, und der erneute Luftzug jagte weitere zehn Programme von den Metallstühlen.
Er begutachtete das Durcheinander mit einem Stirnrunzeln. »Brauchst du Hilfe?«
Brauchte ich? Wahrscheinlich schon. Aber ich würde nicht darum bitten. Jude machte mich nervös. »Ich schaff das schon«, sagte ich, hechtete auf die nächstgelegene Stuhlreihe zu und packte Programme auf die leeren Stühle, als hinge meine Abschlussnote davon ab.
Während ich hektisch war, bewegte Jude sich wie eine Katze – voller Selbstvertrauen und ohne jede Eile. Mit seinem geschmeidigen Körper glitt er in die Stuhlreihe, in der ich angefangen hatte. Er präsentierte einen sehr hübschen Hintern, als er sich vorbeugte, die Programmhefte vom Boden aufhob und wieder auf die Stühle legte.
Ich versuchte, ihn möglichst unauffällig aus den Augenwinkeln zu beobachten.
Er hielt inne, um sich die Vorderseite eines der Programme anzuschauen. »Ein Konzert der Schulband? Ich wusste nicht, dass du in der Band bist.«
»Bin ich auch nicht.« Mein Hirn blieb an der Feststellung hängen, dass Jude mich wahrgenommen hatte. Irgendwie. Also, die Band wahrgenommen und dass ich nicht dazugehörte. Ich speicherte es ab, um mir später Gedanken darüber zu machen.
»Warum ist das dann dein Problem?«, fragte er und hielt das Programm hoch.
»Gute Frage«, raunzte ich. »Wenn man will, dass jemand was erledigt, der sich nie beschwert, dann fragt man, schätze ich, das liebe gute Mädchen aus dem Chor.«
»Aha«, machte Jude und legte langsam ein weiteres Programm auf einen der Plätze. »Das Ding ist, ich glaube nicht, dass du so ein braves Mädchen bist, wie alle denken.«
»Das ist lächerlich«, erwiderte ich sofort. Denn ich war genauso brav, wie alle dachten. Und ich hatte es echt verdammt satt.
Da er mich nicht ansah, wären mir seine nächsten Worte beinahe entgangen. »Nee. Ich hab gesehen, wie du diesen Zettel von Mr H’s Pult genommen und weggeworfen hast.«
Meine Hand erstarrte über dem nächsten Klappstuhl. Ich hatte nicht gedacht, dass jemand mich dabei beobachtet hatte. »Mr H ist ein Arschloch«, sagte ich schnell. Es stimmte auch. Der Lehrer hatte den Zettel einem Mädchen aus unserem Geometriekurs abgenommen, auf dem er immer herumhackte. Sie war rot geworden, als er ihn auf sein Pult gelegt hatte, deshalb wusste ich, dass ihr peinlich war, was darauf stand.
Als ich aufgestanden war, um meinen Bleistift anzuspitzen, hatte sich Mr H am anderen Ende des Raums befunden und einem Basketballer bei seinen Hausaufgaben geholfen. Mit einem schnellen Fingerschnipsen hatte ich den Zettel im Vorbeigehen in Mr H’s Papierkorb befördert.
Jude schenkte mir wieder das Einhundert-Watt-Lächeln. »Siehst du? Doch nicht so ein braves Mädchen.«
Bei der Vorstellung, dass er das wirklich dachte, wurde mir prickelnd heiß. Und zwar nicht auf unangenehme Weise.
Nach dieser seltsamen kleinen Unterhaltung hatten wir zwei Monate nichts miteinander zu tun gehabt. Aber jedes Mal, wenn er einen Raum betrat, fühlte sich mein Gesicht ganz heiß an, und mein Nacken kribbelte alarmiert.
Jude ignorierte mich bis zu einem Nachmittag, als ich allein in einem der kleinen Übungsräume des Musikflurs war. Ich probte ein Gesangsstück für das Vermont All-State Musikfestival und wollte bei dem Wettbewerb unbedingt gewinnen. Ich hatte die alberne Vorstellung, dass mein Vater meine musikalischen Ambitionen ernster nehmen würde, wenn ich ihm zeigte, dass ich Potenzial hatte. Ich bereitete »Green Finch and Linnet Bird« aus Sweeney Todd vor, weil es die ganze Bandbreite meiner Sopranstimme zeigte.
Ich hatte es bereits eine Million Mal gesungen und kannte das Stück gut. Aber meine Darbietung war nicht zufriedenstellend, und ich kam nicht dahinter, warum. Die Tonart zu ändern, hatte auch nichts gebracht. Ich steckte in einer kreativen Krise und war total gefrustet deswegen. Ich erinnere mich daran, dass ich mit einem Finger auf das iPod-Rad eintippte, um die Musik anzuhalten, und dann aus vollem Hals »FUUUUCCCCCCKKKK« schrie.
Das passte gar nicht zu mir. Ich wusste überhaupt nicht, wo diese ordinäre Ausdrucksweise so plötzlich herkam. Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das F-Wort laut ausgesprochen hatte.
Lachen drang durch die Tür des Übungsraums. Ich riss sie auf, denn ich fragte mich, wer mich gehört hatte.
Als ich den Kopf zur Tür herausstreckte, sah ich Jude im Flur an der Wand lehnen und mich angrinsen. »Gibt’s ein Problem?«, fragte er mit seiner rauchigen Stimme.
Ich schaute in beide Richtungen den Flur entlang, bevor ich antwortete. »Bin nur frustriert.«
»Eeeeeecht«, sagte er in einem vielsagenden Ton. »Vielleicht kann ich da helfen.«
Sofort wurde ich rot, denn er hatte beinahe eine sexuelle Anspielung gemacht. Und Jude verströmte Sex, was ein Thema war, wovon ich keine Ahnung hatte. »Das bezweifle ich, es sei denn, du bist ein Experte für Gesangsdarbietungen.«
Er spielte zwischen zwei Fingern mit einer unangezündeten Zigarette. »Die Nummer, die du da singst, ist furchtbar verschnörkelt. Da wäre jeder frustriert.« Er schenkte mir ein langsames, irritierendes Lächeln.
Judes schnelle Diagnose des Problems nervte zwar, aber es war eine verschnörkelte Nummer. Man brauchte dafür jede Menge Stimmkontrolle und ein sattes Vibrato. Aber was dabei herauskam, hörte sich … gepresst an.
Er hatte recht, verdammt.
»Vielleicht«, sagte er und steckte die Zigarette in ein Etui, das er in der Hand hatte, »geht es in dem Lied um nicht genug? Die Vögel sind also in ihren kleinen Käfigen gefangen. Na und? Die haben Gehirne so groß wie ein Fingernagel. Das ist ein Lied über ein braves Mädchen. Es packt einen nicht.«
Es erstaunte mich, dass er beim Text so genau hingehört hatte. Denn Jude schien nie irgendjemandem zuzuhören. Das gehörte zu seiner »Too cool for school«-Ausstrahlung. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.
Also diskutierte ich mit ihm. »Es ist eine Metapher, okay? Die Sängerin ist im Haus ihres lüsternen Vormunds gefangen und sehnt sich nach Freiheit. Und er will ihren Körper. Wie kann es da nicht um genug gehen?«
Jude verdrehte die Augen. »Siehst du, es ist ein Lied über ein braves Mädchen. Die verängstigte Jungfrau singt zu den Vögelchen. Den Song kann man nicht rocken. Also, wenn sie ihren Vormund wollen würde, dann wär das eine Nummer, die ich gern hören würde.«
Wow. Ich musste diese Unterhaltung sofort beenden, denn ich hatte Probleme, Judes sturmgrauem Blick standzuhalten. Meine Augen wanderten immer wieder zu der Stelle, wo sein sanft gewölbter Bizeps unter seinem schwarzen T-Shirt hervorschaute. Ich konnte nur halbe Tattoos erkennen und wollte das komplette Bild sehen. »Also …« Ich räusperte mich. »Ich glaube nicht, dass der Jury deine Version gefallen würde.«
Er grinste nur und richtete seine dunkelgrauen Augen auf mich. Und ich glotzte. Schon wieder! »Na gut. Aber was singt denn das böse Mädchen in dem Stück? Was auch immer es ist, die Nummer solltest du singen.«
Ich starrte immer noch, als er mir zuzwinkerte und davonging.
Eine Woche später hatte ich das sehr ungezogene »Defying Gravity« aus Wicked gesungen und eine »Picket Fence«-Wertung (durchweg makellose Einser) dafür bekommen. Es war ein Lied von einem zutiefst bösen Mädchen. Ich hatte Judes Rat angenommen, und das hatte den entscheidenden Unterschied gemacht.
Unter dem Konferenztisch trat mir jemand gegen den Fuß.
Ich brachte mich ruckartig in die Gegenwart zurück, wo alle mich ansahen. Neben mir guckte Denny demonstrativ hinunter auf den Ordner zur Fallauslastung.
Mein Gesicht brannte, als ich den Deckel aufklappte. »Tut mir leid«, stammelte ich. »Letzte Woche haben wir vier Fälle abgeschlossen und sieben neue dazubekommen, sodass wir einen Zuwachs von drei haben. Einer davon ist eine Wiederaufnahme, die in Lisas Zuständigkeit fällt. Zwei sind ganz neu. Einer davon ist pädiatrisch.«
Am anderen Ende des Tischs nickte unser Leiter. »Berichten Sie mir von dem pädiatrischen Fall.«
Zum Glück brauchte ich die Einzelheiten nicht nachzuschlagen. »Achtzehn Monate altes Mädchen, bei dem vor Kurzem hochgradige Schwerhörigkeit festgestellt wurde.«
»Wieso brauchen Eltern so lange, um das zu merken?«, wunderte sich Denny laut.
Ich hatte die Familie kennengelernt und hatte deshalb eine Theorie. »Es handelt sich um eine alleinerziehende Mutter, die bei ihren Eltern lebt. Sie scheint wirklich eine tolle Mutter zu sein.« Obwohl sie erst neunzehn war, hatte mich ihre Hingabe beeindruckt. »Sie ist jung, und es ist ihr erstes Kind. Sie hatte also keine großen Vergleichsmöglichkeiten. Außerdem verbringt sie sehr viel Zeit mit ihrem Kind, sodass ich vermute, sie ist einfach an die nonverbale Kommunikation gewöhnt. Nachdem einige wichtige Sprachentwicklungsschritte bei dem Mädchen ausblieben, begann der Kinderarzt Fragen zu stellen.«
»Sophie, wären Sie gern die Hauptansprechpartnerin?«, fragte mich unser Leiter.
»Liebend gern«, sagte ich schnell. Dass er mich bat, den Fall zu übernehmen, war ein gutes Zeichen. Und was für ein toller Fall! Niemand war tot oder lag im Sterben. Es ging nur um ein süßes, fröhliches Kleinkind, das nun mal eben taub war. Meine Aufgabe würde sein, der Familie bei der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten und jenen Hilfsangeboten,die sie sich leisten konnten, zu helfen.
Er nickte mir zu. »Sehr schön. Kommen Sie bei Problemen zu mir. Und in unserer nächsten Besprechung kommende Woche werden Sie uns den neuesten Stand berichten.«
»Ja, Sir.« Selbst nach den Jahren mit Jude waren meine guten Umgangsformen von früher noch vorhanden, sie schimmerten dicht unter der Oberfläche. Und manchmal waren sie echt verdammt nützlich.
Wir vertagten uns auf nächste Woche, und ich ging zurück zu meinem Schreibtisch, fest entschlossen, wegen Jude nicht wieder in Panik zu verfallen. Doch ich war immer noch durcheinander. Musste es sein, sonst hätte ich den Fehler, den ich gleich begehen würde, nicht gemacht.
»Sophie, bist du wirklich okay?« Denny beugte sich mit besorgtem Blick über meinen Schreibtisch.
Ich vermied es, in seine schokoladenbraunen Augen zu schauen. »Jepp. Versprochen.« Wenn ich ihm erzählen würde, wen ich heute Morgen gesehen hatte, wüsste er, was gerade in meinem Kopf vor sich ging. Aber ich wollte kein Mitleid, und ganz bestimmt wollte ich nicht darüber reden. Der einzige Weg, auszuhalten, dass ich in einer Kleinstadt mit Jude lebte, war, meine Angelegenheiten für mich zu behalten.
»Wie wär’s, wenn du es beweist, indem du morgen Abend mit mir zum Bowling gehst?«
»Zum Bowling? Bist du gut darin?« In dem Moment guckte ich hoch und erkannte all die üblichen Anzeichen – nervöser Blick und ein schüchternes, hoffnungsvolles Lächeln.
Fuck.
»Ich kann’s überhaupt nicht«, sagte er ruhig. »Aber das macht es nur umso spaßiger.«
Oh. Ich wollte ihm keine falschen Hoffnungen machen. Aber wir waren Freunde. Und es war ja nur Bowling. »Geht klar«, sagte ich und wusste gleichzeitig, dass das keine gute Idee war.
Dass er übers ganze Gesicht strahlte, als ich zusagte, bereitete mir schon jetzt Schuldgefühle. »Super. Ich hol dich um sieben ab.« Dann haute er ab, bevor ich meine Meinung noch mal ändern würde. Kluger Kerl.
Ich warf den leeren Kaffeebecher in den Müll und lehnte mich auf meinem Bürostuhl zurück. Verdammt, Jude Nickel. Siehst du, wozu du mich gebracht hast?
3
Sophie
Innerer DJ spielt: »Crazy« von Aerosmith
Am Donnerstag eilte ich nach Hause, um eine Lasagne zum Abendessen zu machen. So würde etwas übrig bleiben, und ich könnte die Früchte meiner Arbeit genießen, obwohl ich heute Abend nicht mit meinen Eltern essen würde. Denny hatte mir vorhin eine SMS geschickt und gefragt, ob es auch schon um halb sieben ginge, dann könnten wir vor dem Bowlen noch in Max’s Tavern essen gehen.
Das machte es noch date-mäßiger, als mir lieb war. Aber ich sagte Ja, denn wegen einer halben Stunde herumzudiskutieren, wäre bloß zickig von mir gewesen.
Ich hatte die Lasagne bereits aus dem Ofen geholt, aber sie war immer noch heiß wie ein Vulkan. Also sauste ich ins Esszimmer, um den Tisch zu decken. Ich hatte schon meine Mutter gebeten, das zu übernehmen, aber sie hatte keine Anstalten dazu gemacht. Riesenüberraschung.
Mom kam ins Esszimmer geschlendert, als ich gerade die passende Anzahl Servietten aus dem Geschirrschrank holte. Nach drei Stück musste ich mich selbst stoppen. Auch nach drei Jahren war ich noch regelmäßig versucht, eine vierte für Gavin herauszunehmen. Eine Zeit lang erwähnte ich solche Dinge immer gegenüber meiner Mom, in der Hoffnung, dass es leichter für sie wäre, über ihre Trauer hinwegzukommen, wenn wir offen darüber redeten.
War es aber nicht. Und heute Abend konnte ich es nicht gebrauchen, dass sie, kurz bevor ich losmusste, einen Heulkrampf bekam. »Hier«, sagte ich und reichte ihr die Servietten. »Was möchtest du trinken?«
Sie nahm die Servietten, ignorierte die Frage aber.
Das millionste Seufzen unterdrückend, ging ich in die Küche, um ihr ein Glas Eistee einzuschenken und meinem Vater einen Wein. Mir selbst goss ich auch einen Schluck Wein ein, bevor ich alles auf den Tisch stellte.
Mein Vater kam die Treppe herunter, als ich gerade anfing, die Lasagne zu portionieren. Wie schafften Männer das immer? Es brauchte schon besondere Fähigkeiten, immer exakt dann aufzutauchen, wenn alles fertig war.
»’n Abend, Sophie«, sagte er und setzte sich auf seinen Platz am Kopfende des Tisches. Obwohl er seit zwanzig Jahren nicht mehr beim Militär war, hatte er immer noch den Haarschnitt und das passende Benehmen am Leib. Und etwas anderes als eine steife Begrüßung bekam ich nie von meinem Vater. Nach drei Jahren wurde ich immer noch für meinen Anteil an Gavins Ableben bestraft.
»’n Abend«, murmelte ich und setzte mich hin, um nur an meinem Wein zu nippen.
»Isst du nichts?« Er tat meiner Mom ein Stück Lasagne auf den Teller und beäugte dann den leeren Platz vor mir auf dem Tisch.
»Ich habe eine Verabredung.«
Mein Vater versteifte sich. »Mit wem?«
Wow.Sieh mal einer an, Daddy kriegt Panik. Offenbar war ich nicht die Einzige, die mitbekommen hatte, dass Jude wieder in der Stadt war. Nur um ihm einen mitzugeben, wartete ich einen Tick zu lange mit meiner Antwort, während sich sein Blick in mich bohrte. »Mit Denny vom Krankenhaus«, sagte ich beiläufig. Ehrlich gesagt war es schwer, mir ein Grinsen zu verkneifen. Denn sein Gesichtsausdruck war einmalig.
»Ich hoffe für dich, dass das stimmt«, sagte er und legte den Servierlöffel hin.
»Warum sollte ich lügen?«, fragte ich ruhig.
»Warum hast du früher immer gelogen?«, erwiderte er.
Gut, touché. Eins zu null für Dad. Während der Highschool hatte ich mich oft heimlich mit Jude herumgetrieben und war mehr als einmal beim Lügen erwischt worden.
Kurz nach unserer Diskussion über Musik vor dem Übungsraum fingen Jude und ich an uns zu treffen. An einem verregneten Tag im Oktober bot er mir an, mich in seinem Auto mitzunehmen. Statt mich nach Hause zu fahren, brachte er mich in ein Café im Nachbarort. Drei Stunden lang hatte ich vor Nervosität schweißnasse Hände, während er mir lustige Anekdoten darüber erzählte, wie man lernte, Autos zu reparieren. Ich lachte zu laut über die Geschichte, wie er einmal einen Reifenheber auf einem Wagendach liegen gelassen hatte und in der Nachbarschaft herumfahren musste, um jenes Auto zu finden und sich den Reifenheber wiederzuholen.
Während ich in seine silbergrauen Augen starrte, versuchte ich, meinen Teil zu der Unterhaltung beizutragen. Seine Aufmerksamkeit war wie ein Laserstrahl – grell und unmöglich zu ignorieren.
Als es an der Zeit gewesen war zu gehen, hatten wir über den Parkplatz durch den Regen zu seinem Auto rennen müssen. Sobald die Türen zu waren, ließ Jude den Motor an. »Der Wagen braucht eine Minute, um warmzulaufen«, hatte Jude gesagt. »Was machen wir in der Zeit?«
»Fingerhakeln?«, schlug ich vor. Ich streckte ihm eine Hand hin. (Ich erinnere mich, dass ich mir unfassbar mutig vorkam, weil ich ihm das vorschlug.) Ich hatte keine Erfahrung mit Jungs, denn keiner wollte was mit der verklemmten Tochter des Polizeichefs anfangen.
Also sah ich es nicht kommen. Er umfasste meinen ausgestreckten Arm, beugte sich dann über die Gangschaltung und streifte meine Lippen mit seinen. »Du bist so verdammt süß«, flüsterte er. Und dann neigte er seinen Mund, senkte ihn geradewegs auf meinen und küsste mich.
Noch immer im Schockzustand, stieß ich das unerotischste Geräusch der Welt aus – so was wie »Errf!«.
Offenbar musste jeder Motor erst warmlaufen. Meine erste Reaktion war also Schock. Ich konnte kaum glauben, dass Jude Nickels Mund verführerisch auf meinem lag. Beim ersten Kuss konnte ich den Pfefferminztee schmecken, den er getrunken hatte, und kratzige Bartstoppeln an meiner Haut spüren. Aber seine Lippen waren ganz weich, und als er sich dichter an mich drückte, verschmolz ich mit ihm. Und als er mich dazu brachte, den Mund für ihn zu öffnen, war ich einfach verloren. Unser erster Kuss dauerte eine halbe Stunde.
Als Jude mich schließlich nach Hause fuhr, waren meine Lippen geschwollen und rau. Ich war noch nie zuvor so geküsst worden. Nachdem er vor unserem Haus angehalten hatte, stolperte ich beinahe die Einfahrt entlang. Ich kam zu spät zum Abendessen, und mein Vater lugte schon aus dem Fenster, als ich die Tür von Judes Auto zuschlug.
Ich war froh über den Regen, denn mein Höschen war so nass, dass ich Angst hatte, man könnte es durch meine Jeans sehen. Aber der Rest von mir wurde auf dem kurzen Weg ins Haus ebenfalls pitschnass.
»Wo warst du?«, brüllte mein Vater, als ich in die Küche kam.
»Die Chorprobe hat länger gedauert«, sagte ich.
Das war meine erste Lüge wegen Jude gewesen. Aber nicht meine letzte.
»Sophie«, holte mich mein Vater in die Gegenwart und aus meinen Tagträumen zurück. Davon hatte ich diese Woche jede Menge. »Wusstest du, dass dieser Dreckskerl wieder in der Stadt ist? Hat er versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen?«