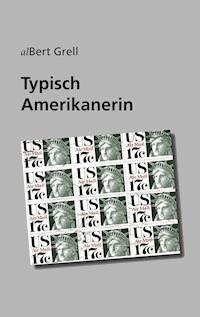
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein ehrlicher und authentischer Blick auf das Leben in den USA. In den in zahlreichen Begegnungen geht es um die lauten und leisen Töne, Leichtsinn und Schwermut, Liebe und Tod aber auch um Heimtücke und andere niedere Motive in den Lebenslinien von Amerikanerinnen, dies läßt den Leser nachdenklich verweilen. Herausragend besonders positiv die Freundschaft des Autors zu seiner Freundin und Mentorin in New York. Dem entgegen steht die grausame Lebenserfahrung eines der Protagonisten, seine Ehefrau, eine gefährliche Psychopathin, deren zerstörerische Kräfte alle anderen Lebenslinien verblassen läßt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im vorliegenden Buch „Typisch Amerikanerin“ schreibt der Erfolgsautor über seine Begegnungen mit amerikanischen Frauen, deren Denkweise und Verhalten in den USA und insbesondere in New York, so wie über vielseitige Begegnungen und Eindrücke auf einer Zugfahrt durch die USA.
Beeindruckend der dramatische crash von zwei Gedankenwelten mit Unheil und Verhängnis, einer in Deutschland lebenden Amerikanerin.
Albert Grell, geb.1945, von Beruf Diplom Sozialarbeiter (FH) emigrierte 1971 in die USA und kam wieder zurück nach Deutschland, arbeitete als Sozialarbeiter, Dolmetscher und freier Journalist.
Durch seinen Aufenthalt, zahlreiche Besuche in den USA und der Ehezeit mit einer Amerikanerin ist ihm die Gedanken- und Lebenswelt der Amerikaner vertraut, die er in seinen Büchern thematisiert.
2011 veröffentlichte er sein erstes Buch, seitdem hat er weitere erfolgreiche Bücher geschrieben.
Inhalt
Intermezzo in New York
Good Morning, New York!
Dinner in New York
In alter Freundschaft
Wiedersehen in Brooklyn
„Assholes“ - Arschlöcher
Der große Amerikanische Traum
You have to be smart!
Kein Job für Couch-Potatos
Zwischen Balzritual und Liebesakt
Savoir vivre
Lebenswandel
Spötter in Halbschuhen mit Bömmel
Eigenleben im Jüdisches Glauben
Kumpelhafte Wunderfrau
Finis origine pendant
Bizzares Szenarium
Lüsterne Hallodri
Eine Kakophonie von Bluff
Der geltungsbedürftige Prolet
Mißbehagen
Jetzt oder nie!
Keine Zukunft mehr in Sicht
Auch das noch
Einschlägige Perspektiven
Perfide Konversation
Trugbilder und Spuren
Pessar und Ellbogen
Verlorene Lebensperspektive
Backroom-Bar in Brooklyn
Denunzianten
Beglückendes Wiedersehen
Gedankendschungel
Déjà - vu
Strandleben in New York
Auf Wiedersehen in New York
NACHWORT
Ödön von Horváth
und dem möchte ich mich anschließen
„Ich habe nur zwei Dinge, gegen die ich schreibe,
das ist die Dummheit und die Lüge. Und zwei
wofür ich eintrete, das ist die Vernunft und die Aufrichtigkeit“.
„I‘ve only got two things against which I write
and this is stupidity and lying. And two which I
defend; this is reason and truthfulness“.
Der Buchautor, Dezember 2017
Intermezzo in New York
Die Fliegerei kann schon fast zu einer Sucht werden. Das aufregend erhebende Gefühl setzt bereits am Flughafen ein. Grund zur Beunruhigung besteht nicht. Dem Reisenden bleibt nichts anderes übrig als dem Flugkapitän und seinem Copiloten und der Computertechnik zu vertrauen. Worüber sollte man sich auch Sorgen machen? Entspanne dich und mach dir nicht so viele Gedanken. Ich liebe den „Stallgeruch“, der kurz vor dem Start eines Flugzeuges durch die Passagierkabine zieht: eine Mischung aus Kerosin und frisch gebrühtem Kaffee – der Geruch von Freiheit.
Steil zieht der Pilot die Maschine vom Flughafen weg in die grauen tiefhängenden Wolken. Schon einmal hat dieses Bild mich auf den Gedanken gebracht, daß es umgekehrt viel besser wäre: gutes Wetter auf der Erde und schlechtes hoch oben in den Wolken, aber nur dann wenn man nicht im Flieger sitzt. Doch leider hat man darauf keinen Einfluß. Der Kapitän fabuliert etwas von einem angenehmen Reiseflug und den vorausgesagten guten Bedingungen in 11 000 Meter Höhe, empfiehlt dennoch freundlich den Anschnallgurt die ganze Zeit geschlossen zu halten, falls mal unvorhergesehene Turbulenzen auftreten sollten. Die Passagiere fühlen sich wohler, wenn die Voraussage ein wenig ins Schöne manipuliert wird. Wenn es einmal richtig heftig wird überlassen sie es der Crew, die schlechten Nachrichten per Lautsprecheranlage zu übermitteln. Die meisten Piloten melden sich gerade noch wenn es zu verkünden gibt, daß wir leider gerade ein kleineres Gebiet turbulenter Luftschichten durchfliegen.
Aus alter Gewohnheit hatte ich einen Sitz ganz hinten im Flugzeug gebucht und genieße nun das Gefühl, wie in einem Aufzug in die Wolken zu fahren. Aber schon wird es heller und Sekunden später fällt gleißendes Sonnenlicht durch die Fenster.
Die Maschine steigt auf die vorgesehene Reisehöhe von elftausend Meter, das Display über den Köpfen der Passagiere zeigt die Höhe, einschließlich der unwirtlichen Außentemperatur an. Die Außentemperatur betrug häufig mehr als minus 40 Grad. Jeder, der damit in Berührung kommen würde, wäre früher oder später gefriergetrocknet. Hier draußen - somewhere over the rainbow way up high - gibt’s die grenzenlose Freiheit, wie sie von Reinhard Mey besungen wurde. 6720 Km und 9 Stunden Flug bis NY.
Daß man überhaupt fliegt bemerkt man eigentlich nicht, kein rütteln oder flattern und keine Vibration. Nur gelegentlich ein seltsamer Ruck, den man beinahe nicht bemerkt hätte. Die Stewardessen und ihr Kollege bringen die ersten Getränke. Seltsamerweise fragen nicht wenige nach einem Tomatensaft, den trinken sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Hause aber nie. Vielleicht ist dies der Anfang von Schrulligkeit oder einfach auch nur Fantasielosigkeit. Für die Nacht über den Atlantik, zur Ablenkung und Bekämpfung der Schlaflosigkeit, gab es später die Bordunterhaltung. Zur Auswahl standen diverse Filme oder Musik sobald die hygienisch verpackten Kopfhörer vom Personal verteilt waren. Oder man hat wieder einmal Glück und es befindet sich ein interessanter und gesprächsbereiter Mitreisender im Nebensitz. Die wenigsten Passagiere reden miteinander. Die meisten sehen, bestückt mit ihrem Kopfhörer, nur vor sich hin. Die menschliche Vielfalt, die dem Alltag seine Würze gibt, kann im Flieger aber auch lästig sein, denn man sitzt bekanntlich hautnah nebeneinander. Da wackelt einer, ein zappeliges Wesen, wie ein Perpetuum mobile so schnell mit dem Bein, daß man Strom für ein ganzes Dorf erzeugen könnte. Andere erzählen langatmig ihre komplette Lebensgeschichte, ob man sie hören will oder nicht. Am Wenigsten erfreulich sind die, von denen man den Eindruck hat sie hätten sich wochenlang nicht gewaschen und von einem Deo noch nie etwas gehört. Wobei die Überparfümierung bei einigen Damen, mit dem gerade im Duty Free Shop erstandenen Parfüm, dessen Duft an der Grenze zur Körperverletzung liegt, auch so ein Thema wäre. Wenigstens überdeckt es den Geruch der zum Essen servierten langweiligen und seltsam nach Analogkäse riechenden Pasta.
Wie heißt die häufigste Frage einer Stewardess an die Flugreisenden?
Antwort: „Lasagne oder Chicken?“. Welcher Vielflieger kennt diese Frage nicht.
Einige sind ganz erpicht auf einen Platz am Fenster. Ich bevorzuge einen Platz am Gang, dann muß ich nicht ständig über die Nebensitzer steigen, wenn ich zur Toilette muß. Auch halbiert sich dadurch das Risiko, daß man versehentlich vom Getränk des Nachbarn überschüttet wird. Nicht, daß ich etwas gegen andere Menschen hätte, das natürlich nicht. Es wäre nicht nur langweilig, sondern eine Katastrophe wenn alle gleich wären. Aber es kommt eben auf die Situation an.
Diesmal wurde ich angesprochen: „Hi, I‘m Frank!“.
Vielleicht ist ihm später aufgefallen, daß ich in einem deutschen Buch las. Und er fragte noch „Where do you come from?“.
Ein Geflügelzüchter und Eierproduzent, der geschäftlich in NY zu tun hatte, zwei Tage in NY übernachten wollte, um dann nach Ohio zu seiner Schwester weiterzufahren. Das Auto habe er in einem sündhaft teuren Parkhaus abgestellt. Seine Frau würde während seiner Abwesenheit den Betrieb in Kansas managen. Frank, der deutsche Wurzeln hat, schwärmte vom nach seiner Meinung deutschen Vorbild.
Er erzählte, daß er bereits mit 19 Jahren, im Durchschnittsalter der amerikanischen Soldaten, in Vietnam in der Hölle gewesen war und behauptete deshalb viel von der Welt gesehen zu haben, fühlte sich emotional und intellektuell mit Deutschland verbunden. Mit Bewunderung in den Augen schwärmte er vom deutschen Bildungssystem und besonders von der in den USA völlig unbekannten dualen Ausbildung. Als Geschäftsmann mit politischem Engagement in der Republikanischen Partei, interessiere ihn was Deutschland am Laufen hält und wie man es schafft trotz hoher Lohnkosten wirtschaftlich erfolgreich zu sein. „Wie macht ihr das, was kann Amerika vom deutschen Beispiel lernen?“ Alles Fragen bei denen ich zugegebenermaßen etwas in Verlegenheit geriet. Schließlich rettete er mich aus meiner Verlegenheit indem das Gespräch auf die ideellen Werte in Deutschland, Friede, Verläßlichkeit, Vertrauen, Wohlstand und für einen Amerikaner besonders wichtig, die Freiheit zu sprechen kam.
Nachdem es in dieser Nacht nichts von Interesse mehr zu fragen und zu reden gab, sind wir beide noch ein wenig eingenickt, um schließlich wohlbehalten auf dem JFK-International Airport zu landen.
Dort mußte ich mich wie üblich in die Schlange zur Paßkontrolle einreihen, in der Hoffnung mit meinem Laptop nicht aufzufallen. Eine zeitraubende Einreise in ein Land, das von seinen Gästen das Maximum an Freigabe persönlicher Daten fordert, ohne selbst transparent zu sein. Das allein ist für einige abschreckend. Die Paßkontrolle kann ein bis zwei Stunden dauern. Hier wird jeder irgendwie arabisch wirkende Mann ausgesondert und noch genauer als alle anderen untersucht, die Reisenden ringsum sehen ängstlich oder auch beschämt zu Boden. Als ich mich das letzte Mal im Flughafen von NY der Paßkontrolle stellte, da winkten sie mich aus der Warteschlange. Sie wollten die Kontakte in meinem Handy prüfen und den Laptop nach mutmaßlichen „Staatsgefährdungen“ durchforsten. Vermutlich waren es die Stempel in meinem Paß, darunter aus Ägypten, China und Australien, auch weil ich schon des öfteren ein- und ausreiste, daß ich verdächtig war und möglicherweise war mein Name im Computer der Grenzschützer besonders markiert. Selbst wenn einem keine Straftat vorgeworfen wird, kann man in ihr Kontrollnetz geraten.
Auch diesmal ist der Zugriff ins Leere gelaufen. Die Kontrolleure sahen sehr unglücklich aus, als sie sahen, daß ich nichts Verdächtiges gespeichert hatte. Vielleicht hätten sie die Ladys mit Kopftuch vor und nach mir genauer filzen sollen, aber von Terroristinnen haben die noch nicht viel gehört.
Good Morning, New York!
Hier ist einer der Plätze in der Welt, die eine magische Anziehungskraft haben. In der Sommerzeit das eisgekühlte Flughafengebäude zu verlassen, ist wie die Türe eines Backofens nach dem Kuchenbacken zu öffnen, so stark ist die Gluthitze.
Jahreszeitlich bedingt war die Stadt jedoch gut abgekühlt. Vielleicht hatte es auch ein wenig geregnet. Kühl ist NY am erträglichsten. Das Erwachen der Stadt ist ein Rausch der Sinne. Mit meinem gelben Taxi mußte ich zuerst wenig einnehmende Viertel und Slums durchqueren, dies ist der Weg nach Brooklyn wenn man, wie die meisten Besucher, mit dem Flugzeug auf dem JFK-Flughafen einschwebt. Später standen links und rechts ordentliche rote Backstein-Apartmenthäuser mit markisenüberdachten Eingängen und Namen, die wie mondäne Orte in Europa klangen: The Monaco, The Ravenna Terrace, Bellamy Drive, Sunshine Gardens. Prächtige Kronleuchter sah man durch den Eingang leuchten. Die Eingangshallen dieser Apartmenthäuser können sehr prächtig sein, kompromisslos mit neuestem Chichi: Marmorfliesen, Velourtapeten, rießigen Plastikpalmen und anderem Grünzeug aus Plastik, mit ledernen Couchgarnituren, alles in allem für Europäer etwas seltsam anzusehen. Wichtig sind scheinbar auch die Hinweisschilder in der Eingangshalle, wo es zum Fitneßraum, der Sauna, dem Swimmingpool oder gar der Dach- und Sonnenterrasse geht. Möglicherweise will man so bereits beim Eintreten zeigen was den Bewohnern alles an Einrichtungen zur Verfügung steht.
Angie konnte mich nicht abholen, da sie nicht in der Stadt war, ihr Angebot den Schlüssel des Apartments zu hinterlegen wollte ich nicht annehmen, dies hatte ich nur einmal getan und auf einem Futon in ihrem Wohnzimmer, das nicht sonderlich groß ist, geschlafen. (Ich weiß, ich hätte ihr damit einen Gefallen getan, weil der Gedanke es könnte jemand bei ihr einbrechen ein ständiger Alptraum ist).
Sie benötigt keinen Wecker, schon bei Sonnenaufgang steht sie auf. Ihre Selbstdisziplin ist beeindruckend. Jede Sekunde zählt. Beiläufig wird der Schlachtplan für den Tag ausgearbeitet.
Angie sagte mir einmal „Ich will immer etwas tun, was mir Spaß macht und Sinn hat. Oder was mich herausfordert“.
„In dieser Stadt kannst du tun was dir paßt. Sie ist dazu da um Rahmen für dich zu sein, egal was du tust. Das was sich vor den Häusern und in den Straßen abspielt, ist all das was sich Starke ausdenken können und Schwächlinge bewundern werden. Bis in die 1990er Jahre war NY ein Sehnsuchtsort, eine Aufbruchstimmung lag in der Luft. Und die Subkultur in manchen Stadtvierteln war ein Sammelbecken für Außenseiter, für Leute, die nirgendwo anders heineinpaßten. Vieles hat sich aber in den vergangenen Jahren geändert und immer deutlicher spürt man die Gegensätze von Offenheit und Rassismus, Freiheit und Hass. Wie überall in den USA gibt es auch hier ein paar Probleme mit Rassismus und der Aufarbeitung der Vergangenheit“.
Sie ist in jeder Beziehung selbstbestimmt.
Wie die meisten New Yorkerinnen ist Angie auf Dauerdiät. Zum Frühstück gibt es ein ungesüßtes Müsli, das in meinen Augen aussieht wie Katzentrockenfutter. Sie hat kaum etwas Eßbares in der Wohnung, geht sehr sorgsam mit Nahrungsresten um, das Wichtigste ist ihr riesengroßes Glas Vitamine als Nahrungsergänzung. Sie arbeitet hart daran in Form zu bleiben. Je nach Bedarf erhöht oder vermindert sie ihre Kalorienzufuhr. Sie fährt viel mit dem Rad und zweimal in der Woche ist sie als Fitneßtrainerin unterwegs. Fahrradfahren ist der neue Trend nicht nur in NY erzählte sie mir. Für viele jüngere Amerikaner sind Autos kein Statussymbol mehr. Für sie sind Autos nur ein Klotz am Bein, ein erstaunlicher Trend. Die „Millenials“ wie sie in den USA heißen, weichen damit gravierend von den älteren Amerikanern ab.
„So will ich aussehen“, sagte sie mir an jenem Morgen bei ihrem Katzenfutter-Frühstück und zeigte mir ein Bild in einer ihrer Frauenzeitschriften, eine langhaarige Göttin umweht von einem luftigen Kleidchen, die aussah wie die Venus von Botticelli, gerade der Venusmuschel entstiegen. Das Thema an jenem Morgen war, wie kurzlebig Gefühle seien und daß es vielmehr auf die richtige Überzeugung ankomme. Nach ihrem Verständnis ist es bei der großen Liebe wie bei einem Hurrikan: man erreicht das Zentrum nie, aber man kann ihm nahe kommen. Wenn man das verstanden hat, meinte sie, ist man nie frustriert.
Kaum mehr als eine halbe Stunde nach dem Erwachen war gefrühstückt, die Toilettensitzung erledigt, der Fön aus, das Geschirr stand im Spülbecken und nach einem Uhrenvergleich war sie für den Vormittag gerüstet.
Von ihrer Mutter habe sie nicht kochen gelernt erzählte sie mir einmal. Von ihr hat sie aber die Freude an Champagner, gutem Käse und Patisserie. Kochen findet sie äußerst anstrengend, denn die einzigen Kochkünste, die ihre Mutter an sie weitergegeben hatte, bestanden darin, Tiefkühlgemüse oder Fertiggerichte heiß zu machen. Deshalb war sie immer hoch erfreut, wenn ich etwas kochte, nicht zu vergessen mit dem steten Hinweis meinerseits „Kochen ist Liebe“.
Dieses Mal hatte ich mir schon vorab ein Hotelzimmer im Wythe Hotel in Brooklyn gebucht. Ich wollte auch ein wenig allein unterwegs sein, Mittags eine Kleinigkeit essen, einen Kaffee trinken, abends etwas ausgiebiger essen.
Mal sehen was es Neues gab. NY lebt von seinen Kontrasten und in NY ändert sich ständig alles rasend schnell. Jährlich eröffnen rund 1000 neue Gastronomiebetriebe. Von fünf Betrieben soll es nur einem gelingen, länger als fünf Jahre durchzuhalten.
Die Wolkenkratzer-Avenues machten jedes Mal denselben Eindruck auf mich. NY ist die Stadt schlechthin, die wirklichste und unwirklichste Stadt zugleich, in der alles zu schweben scheint und wo alles unverwüstlich ist; ein gewaltiger Schrei des Menschen zum Himmel.
Hektik und Lärm, das ständige Hupen der Taxis, jene Kakophonie aus Huptönen, die den durchschnittlichen Lärmwert der restlichen industrialisierten Welt um ein vielfaches an Dezibel übersteigt. Dazu die Sirenen und das Jaulen der Polizeiautos auf den schnellen und gleichzeitig lauten Avenues, und auch die gestreßten Bewohner scheinen konstant zu bleiben. Geschäftsleute schießen aus ihren Hotels heraus in wartende Limousinen. Scheinbar ein ständiger Wettlauf gegen die Zeit. Bis heute habe ich nicht ergründen können, warum die Leute in NY ständig, selbst auf den meist ruhigeren Nebenstraßen, rennen. Besonders aufgefallen ist mir dies im hektischen Midtown Manhattan. Dort erwecken eigentlich alle ständig den Eindruck als würden sie die Chance ihres Lebens verpassen, wenn sie sich nicht beeilten. Leute, die aus Langeweile herumstehen oder trödeln, die gibt es nicht!
Sind die Gehwege voller Leute muß man sich dem Verhaltenskodex anpassen. Wer in der Menge geht, darf nicht schneller gehen als die anderen, darf nicht hinter seinem Nächsten zurückbleiben, darf überhaupt nichts tun, das den menschlichen Verkehrsfluß stören könnte. Wer sich an diese Spielregeln hält, wird von den Leuten kaum wahrgenommen. Besonders ätzend sind jene, die unendlich langsam exakt vor einem auf dem Gehweg laufen, weil sie gerade auf ihrer Geocache-App etwas nicht finden. Oder jene Touristen, die in Gruppen mitten auf dem Gehweg ratlos zusammenstehen und sich nicht sicher sind, ob es zur gesuchten Straße jetzt rechts oder links geht.
Wenn die New Yorker durch die Straßen gehen, legt sich ein eigenartiger Blick über ihr Gesicht, nämlich eine dort natürliche und vielleicht auch notwendige Form der Gleichgültigkeit den anderen gegenüber. Den Leuten ist es absolut egal wie man aussieht. Ausgefallene oder schäbige Kleidung, bizarre Frisuren, seltsame Barttracht, T-Shirts mit obszönen Aufdrucken z.Bsp. „Would you like to suck my dick?“ - „Class 69“ - auf so etwas achtet kein Mensch. Aber es ist wichtig wie man sich verhält. Irgendwelche Gebärden werden sofort bemerkt und als bedrohlich empfunden. Laut mit sich selbst oder ins Handy sprechen, herumfuchteln und sogar jemand in die Augen sehen sind Abweichungen, die feindliche oder manches Mal sogar heftige Reaktionen auslösen können. Man darf weder torkeln, noch darf man, wenn es einem übel ist, sich an einem Geländer festhalten. Man darf nicht laut lachen oder singen, da jeder mit spontanem und auffälligen Verhalten sofort böse Blicke auf sich zieht. Als ich einmal im Supermarkt in der Schlange vor der Kasse zu nahe hinter eine Frau aufrückte, wurde ich mit einer Kaskade übler Beschimpfungen überschüttet. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, denn enges hintereinander stehen war für mich völlig normal. Ganz konträr verhalten sich die New Yorker aber wenn sie ihre Mittagspause im Central Park verbringen. Dieselben Dinge, die sie auf der Straße beunruhigt hätten, werden hier als ungezwungener Zeitvertreib betrachtet.
Auffällig in Manhattan ist die Mittagsstunde vor dem Lunch mit ihrer Parade all der braungebrannten selbstbewußten Büroangestellten in dunklen Anzügen, die sich auf den Weg zu ihrem Lunch begeben. Ein deutscher Immigrant hat hier eine Marktlücke entdeckt und bietet an einem Straßenstand deutsche Bratwürste an. An seinem Stand stehen sie zu jeder Mittagszeit Schlange für eine Wurst, bevorzugt mit echtem deutschen Sauerkraut.
Eindrucksvoll auch die eilenden Massen nachmittags um fünf in Manhattan. Dies ist Wochentags für viele Büroschluß und Arbeitsende. Dieselbe Szenerie wie Morgens, nur läuft der Film jetzt rückwärts ab. Nach der Arbeit, in einem letzten heftigen Ausbruch von Energie, strömen die Massen vom frühen Morgen aus ihren Büros in die U-Bahnschächte hinunter, als wären deren Eingänge der Mund der Erde, der tausend Menschen in der Minute verschlingen und wieder ausspucken kann. Sie trotten wie eine Schafherde hintereinander her. Man sieht es ihnen an, wie entleert, erschöpft sie sind, wenn sie zu Tausenden nach Hause streben, um sich dort neu zu sammeln und ihre Energie aufzuladen. Der morgige Tag kommt gewiß! In NY ein ständiges an den Nerven zehrendes Hochjagen des Energielevels in den roten Bereich. Selbst wenn sie ruhen, reden sie in einem kehligen Maschinengewehr-Stakkato und einem New Yorker Akzent, der deutschem Alltagsenglisch nicht unähnlich ist. Der Alltag wühlt die New Yorker auf und läßt sie kaum zur Ruhe kommen.
Einige kann man auch in der harten Stadt NY, wenn es fünf Uhr geschlagen hat, in verschwiegenen düsteren, anonym angezeigten Bars antreffen, mißmutig, in spröder, öder, mißmutiger weiblicher Gesellschaft, wo sie lustlos einen harten Martini nach dem anderen bestellen, in dem ein, zwei Oliven zappeln oder einen Whiskey nach dem anderen in sich hineinschütten. Ebenso mißmutig von einem Barkeeper ausgehändigt mit einem Gesichtsausdruck den man sich merken soll, denn er wartet darauf, daß das in seiner hinteren Hosentasche steckende Smartphone vibriert und sich endlich seine neueste Bekanntschaft meldet oder sonst ein sehnlichst erwarteter Anrufer.
Alles Anzeichen einer gewissen Einsamkeit, von verborgener, vergrabener Hoffnungslosigkeit, die man in NY überall und immer wieder antrifft. Da sitzen sie nun in ihrem besten Anzug, und ich wette, sie hausen in irgendeiner dreckigen, oder vielleicht sogar feuchten Kellerwohnung oder einem Miniapartment und haben nicht viel, leben von der Hand in den Mund. Die einen müssen bei „Wasser und Brot“ im Souterrain darben, während es die anderen in der Beletage krachen lassen dürfen. Himmel oder Hölle, der Kontrast ist groß in NY; die einen haben alles und die anderen fast nichts. An keinem vergleichbaren Ort gibt es eine derartige Ansammlung von Reichtümern, sozialen Kontrasten, von geistigen und künstlerischen Möglichkeiten. Viele sind der Meinung, sie lebten in dem Land mit dem höchsten Lebensstandart in der Welt. Eine bizarre Sicht auf die Welt. Nur leider waren diese noch nirgendwo außerhalb der USA. Man läßt sich besser nicht in eine Diskussion mit ihnen ein, denn mit dieser Weltanschauung wollen sie nichts anderes wahrhaben.
Eines ist sicher, die Lebenshaltungskosten in NY sind nicht gerade die geringsten im Vergleich zu anderen Großstädten in der Welt. Die Kosten bestehen nicht nur in Dollars und Cents, sondern auch in Schweiß und Blut, Enttäuschung, häufig fehlender Lebensperspektive, verlorenen Idealen, Arbeitslosigkeit und fehlender staatlicher Hilfe. Dagegen gibt es die besten Krankenhäuser, wenn man das Geld dafür hat, und jede Menge Gefängnisse. In Shakespeares Hamlet heißt es: „Es ist etwas faul im Staate Dänemark!“ Dies scheint mir auch hier zutreffend. Ich hatte nie eine Auseinandersetzung gescheut, wenn es darum ging, das Land gegen Vorurteile zu verteidigen und ein komplexes Bild von Amerika zu zeichnen, das an kulturellen Reichtum, die Energie und die Vielfalt des Landes erinnerte. Doch mittlerweile fällt mir dies schwer.
Anstatt staatlichen Hilfen für die Bürger gibt es eine große Armee in den USA mit vielen Bombern einschließlich einer stattliche Ansammlung von Atombomben und es gibt mehr Autos als man zählen kann. Wo sonst in der westlichen Welt gibt es so etwas?
Jene, die sich alles leisten können was sie nur wollen, müssen nur einen Telefonhörer abheben. Oberkellner sind entzückt, wenn sie sich im Restaurant sehen lassen. Ihre Unterschrift auf einer Restaurantrechnung ist über jeden Zweifel erhaben. Benötigen sie einen Anzug, so kaufen sie ihn, egal was der kostet. Sie sind nie mit der Miete im Rückstand, und wenn sie sich entschließen morgen mal schnell nach Europa zu fliegen, kostet es nur einen Anruf bei ihrem Reiseagenten. Sind sie berühmt und mächtig, arbeiten sie trotzdem, und wie sie behaupten, sehr hart. Für ihre ausschweifenden Vergnügungen können sie sich einen erstklassigen Harem halten. Sie müssen nur ihre Visitenkarte dem Objekt ihrer Wahl geben – und fertig. Derart angebetet und mächtig können sie mit jeder machen was sie wollen und sie auch mit Sicherheit halten so lange bis sie ihr überdrüssig sind.
Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit hatte ich am Flughafen statt den A-Train oder Bus das Taxi genommen, weil ich heute einfach keine Lust hatte in einem Kleinbus und schon gar nicht mit der U-Bahn zu fahren. Man muß wissen, unter den Taxifahrern in NY gibt es wie überall auf der Welt, üble Beutelschneider, die den Touristen ein mehrfaches des Fahrpreises abknöpfen, aber ich wollte auf der Hut sein. Am Steuer saß ein älterer Herr, so um die 60, der sah mit seiner von der Sonne gegerbten Haut allerdings aus wie 80. Ein sehr großer Mann, der fast beide Vordersitze einnahm. Der gute Mann hatte seine Klimaanlage auf gefühlte 10 Grad minus eingestellt. Als ich eingestiegen war, zog ich den Pulli zu, die Kapuze über den Kopf und nahm den Rucksack auf den Schoß, für etwas mehr Wärme. Der Fahrer begann sofort mit seiner angenehmen tiefen Stimme eine Unterhaltung. Seine amerikanische Aussprache klang zunächst wie ein Arbeiterslang in meinen Ohren, doch dann verleugnete das rollende Rrr nicht mehr seine Herkunft aus Texas.
Immerhin sprach er die Landessprache, nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit bei Taxifahrern. Es soll Taxifahrer geben, die beherrschen weder die amerikanische Sprache noch kennen sie sich in NY aus. Jene zum Beispiel, die, so hat man den Eindruck, scheinbar gerade eben aus Port-au-Prince oder Karatschi angekommen sind, mit viel Glück eine Fahrerlaubnis ergattern konnten und schon verbotenerweise mit 70 mph über rote Ampeln fahren, um im Konkurrenzkampf, dem Wettlauf mit der Zeit und den anderen Taxifahrern, die unersetzlichen Sekunden und Minuten in denen Geld verdient werden kann, nicht zu verlieren. Ein Tourist ist dann schlecht dran, wenn er die Fahrtroute nicht kennt. Diese Herren müßen im Zweifel ständig in ihrer Leitstelle nachfragen wie und wohin sie fahren sollen. Im extremsten Fall fahren sie in die verkehrte Richtung und drehen auf Kosten des Fahrgastes wieder um. Über ein Navi verfügen die wenigsten Fahrer.Trotzdem kommt es gar nicht gut an, wenn einer mit einer Straßenkarte in der Hand einsteigt und evtl. noch Anweisungen geben will.
Es herrschte starker Verkehr, aber er war leidlich flüssig. Das Taxi ruckte unablässig, wich aus, es bremste, holte wieder auf, schaffte es aber nicht anzuhalten.
„Was gibt es an Neuigkeiten?“ wollte ich wissen und lenkte das Gespräch auf den amerikanischen Präsidenten.
Ich dachte, er wäre auf Seiten des gegenwärtigen US-Präsidenten und erwiderte „Es sieht so aus als mache diese einen guten Job“.
„Ha!“ sagte er und drehte sich nach mir um, während er weiterfuhr, der ist für mich erledigt. Sir ich war Demokrat, aber mit dem bin ich fertig. Nichts als vollmundige Versprechungen. Viele die keinen Job haben sind jetzt gegen ihn. Ich hätte ihn manchmal sonst wo hingetreten. Er ist ein … und hier benutzte er ein wenig erfreuliches Wort südlich der Gürtellinie, welches an dieser Stelle leider nicht mehr zitierbar ist.
„Genau was ich auch denke“, stimmte ich schnell zu und hoffte, er werde wieder auf die Straße sehen.
Das tat er für einen Augenblick, und ich atmete auf und versuchte nicht nach vorne zu sehen.
Er sah wieder nach vorn, aber nur so lange wir bei einer roten Ampel anhielten.
Dann rief er „Wir Amerikaner haben uns den ganzen Salat selbst angerichtet“. Er schaute mich an und verfehlte einen Bus nur um Zentimeter.
„Dasselbe habe ich schon immer gesagt“, behauptete ich und versuchte einen schweren Lastwagen zu übersehen, auf den wir geradewegs zusteuerten.
Mein Taxifahrer bog gerade noch rechtzeitig ab. Mir wurde ganz heiß, meine Halsschlagadern spürte ich deutlich.
Mein Taxifahrer kam immer mehr in Fahrt und ich entschied mich besser kein Sterbenswort mehr zu sagen. Die Taxifahrt ging ohnehin bald zu Ende.
Der vom Taxifahrer genannte Fahrpreis von 45 Dollar war o.k. Vor dem Hotel reichte ich dem Fahrer fünfzig Dollar in Scheinen nach vorne und sehe gerade noch, wie er blitzschnell einen Schein gegen eine Ein-Dollar-Note austauschte, sie mir nach hinten hält und milde lächelnd meinte, ich hätte den Schein wohl für eine Zehn-Dollar-Note gehalten, weil ja die Dollarscheine auf den ersten Blick alle gleich aussehen.
Während der Fahrt und dieser durchaus üblichen kurzen Unterhaltung, möglicherweise auch an meiner Kleidung und dem Gepäck hatte er bemerkt, daß ich nicht aus den Staaten komme und einer der Touristen bin, den er mit einem seiner erfolgreichen Tricks hereinlegen kann. Über meine Reaktion und die weiteren Sprachkenntnisse war er dann aber mehr als überrascht als ich ihn ziemlich sauer und mit Bestimmtheit aufforderte, gefälligst auf meine 50 Dollar herauszugeben, ansonsten würde ich mit meinem Handy sofort die Polizei rufen.
Wenigstens kenne ich nun auch diesen Trick.
Einen kurzen Augenblick dachte ich daran ihn trotz seines Betrugsversuches mit einem Trinkgeld, welches man üblicherweise gibt, zu beschämen. Aber dann dachte ich, er bekommt nichts extra, so frech wie der ist, hätte er das Trinkgeld sicherlich ungeniert genommen. Es wäre gewesen als würde man „Perlen vor die Säue werfen“.
Mittags im Bakery Café „to go“ lagen die Hot-dog-Würstchen bereit. Was soll ich essen? Was soll ich bestellen? Mit Sicherheit kein Stück von einer der rosa Torten oder von den rosafarbenen Muffins mit Glitzertopping, die für meinen europäischen Gaumen übertrieben gesüßt sind und die es auch hier, wie in nahezu jeder amerikanischen Bäckerei, zu kaufen gibt. Ich bestellte einen Kaffee und entdeckte neue Back-Kreationen. Keiner sollte denken die New Yorker wären nicht kreativ.
Bei den geschäftlichen Interessen und Ideen geht es meist knallhart um‘s Überleben, nämlich „to stay in business“, auch wenn es nur um die Produktion und den Verkauf von neuen Backwaren geht.
Meine Liebe gilt den Cafés in NY. Weil kein Bier, kein Wein und keine Spirituosen ausgeschenkt werden, bleibt ein bestimmtes Publikum unter sich, die Suffköpfe mit ihrem Gelabere findet man hier nicht.
Ich bestellte keinen der altbekannten und in den verrücktesten Varianten angebotenen Donuts, keinen der allgegenwärtigen Bagels, ein Sauerteig Kringel, urspünglich ein jüdisches Gebäck, einst eine New Yorker Spezialität, die zum Frühstück oder auch zum Mittagessen gegessen wird.
Diese Bagels gibt es furztrocken oder essbar aufgeschnitten und mit allem Denkbaren bestrichen oder belegt, zum Beispiel mit Frischkäse oder Lachs, auch bestellte ich keines meiner geliebten Croissants. Als neueste Kreation bot sich der Cronut an, eine Mischung aus Croissant und Donut, und der Cragel, so nennt sich die Mischung aus Croissant und Bagel, der mit Butter oder Creamcheese bestrichen für die Amerikaner zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Leckerbissen ist. Der neuste Trend ist statt Milch oder Sahne, ein Stück Butter im Kaffee. Bisher kannte ich nur aus China, Tee mit ranziger Butter.
In NY ist die Butter im Kaffee natürlich nicht ranzig.
Angie erklärte mir später diese neuen Kreuzungen aus den Backstuben wären für die, die sich nicht entscheiden könnten was sie nun genau essen wollen. „Anything goes“ - nichts ist unmöglich in NY, deshalb gibt es mittlerweile auch den Brookie, das ist eine Mischung der beliebten, und mittlerweile auch in Deutschland bekannten, Brownies mit einem Cookie oder Donuts mit Bacon. In den New Yorker Backstuben wird scheinbar gekreuzt was das Zeug hält.
In jeder Ecke des hippen jungen Coffee Shops sind Lautsprecher versteckt, sogar auf der Toilette. Der Lärmpegel ist so hoch, daß ihn ein gewissenhafter deutscher Arbeitsschutz beanstandet hätte, die US-Angestellten scheint dies aber nicht zu stören. Die Gäste, die miteinander reden wollen, müßen sich anschreien und weil dies so anstrengend ist, unterhält sich fast niemanden mit seinem Gegenüber. Links neben mir versuchen es zwei. Einer von den beiden ist ziemlich dick und sieht in seinen unförmigen Jeans von hinten aus wie ein Nashorn, einer dieser rastlosen in-sich-Hineinstopfer und Dauersäufer. Egal wo die sind, ob sie sitzen, gehen oder kurz mal stehen, sie müssen ihren Body ständig mit Brennstoff versorgen, ihren Energiespeicher scheinbar ständig auffüllen. Weil sie keinen Wasserspeicher wie ein Kamel haben, rennen sie auch ständig mit einer Wasserflasche oder einem Kaffeebecher durch die Gegend. Überall kommt man ihnen geschäftstüchtig mit dem „Coffee to go“ entgegen. Die moderne Medizin ist sich darin einig, daß der Mensch zwei, drei Stunden ohne flüssige oder feste Nahrung problemlos auskommen kann. Die beiden lamentieren über Preise und den Niedergang der USA, eines der Lieblingsthemen der Amerikaner. Es gibt noch ein anderes Lieblingsthema, besonders in NY, dort erzählt jeder jedem, ob er es hören will oder nicht, wie viel er im Monat verdient und was für eine Karriere er zu machen gedenkt.
Ein Musikgenuß ist die Beschallung nicht, es ist nichts als Lärmbelästigung. Ich denke kein Mensch wird in ein Café gehen wegen der tollen und lauten Hintergrundmusik, trotzdem findet man selten Cafés, die nicht durchgestylt und vollbeschallt sind. Die wenigen Cafés in denen ein Gespräch mit dem Gegenüber geführt werden kann, ohne daß die Gäste sich anschreien müssen, muß man mit der Lupe suchen.
In diesem Café kleiden sich etliche der anwesenden Hipster nach deren neuester Mode, diesmal sind es rot- oder grünkarierte Holzfäller- und Flanellhemden, Trucker-Baseballmützen und grobe Cordhosen und natürlich männliche Bärte. Gerne bartmäßig dekoriert als leicht verwilderter Bursche, der ohne Hemmungen zu seinen Überzeugungen steht. Vor Jahren war ein solches Outfit in NY undenkbar, man hätte das Ansehen eines ewig gestrigen, rückständigen Hillbillys gehabt, gleichbedeutend mit einem Stallburschen vom Lande, ein Hinterwäldler der von der Welt keine Ahnung hat und somit in NY völlig deplatziert ist.
Hinter der Theke der Bakery eine andere „Sorte“ Hipster, damit meine ich die wie geklont aussehenden 20- oder 30-jährigen, sehr muskulös mit kantigem Kinn, die ausgefallene Brillen tragen, derzeit sind es meist große schwarze Kunststoffbrillen mit extra dicken Rahmen, dies fällt besonders auf wenn jemand einen kleinen Kopf hat. Eine solche Brille macht fassungslos. Genaugenommen wer durch eine in über alle Maßen große Brille sieht, von dem kann man sich gut vorstellen, daß er die Welt ziemlich schrill und mit leicht verklärtem Schimmer betrachtet, aber aus seiner Perspektive natürlich auch wiederum gestochen scharf.
Weitere Auffälligkeiten sind ihre eigenartig gestylten und skurrilen Teilbärtchen. Wer zu den besonders „Coolen“ dazu gehören will hat fast immer irgendwo ein Tattoo; ein Tribal, also ein verschnörkeltes Fantasie-Ornament. Oder chinesische Schriftzeichen, deren Bedeutung oder Doppeldeutigkeit ihnen hoffentlich richtig übersetzt wurde. Das verleiht dem Tätowierten neben einer ordentlichen Portion Verwegenheit auch gleich etwas Mystisches, Geheimnisvolles. Diese Jungs tragen auch den ganzen Tag, Sommer wie Winter, Strickmützen. Diese Mützen nehmen sie vermutlich erst im Bett ab, wenn sie überhaupt bemerken, daß sie eine Mütze auf dem Kopf haben. Begrüßen tun sich diese coolen Jungs, wie inzwischen überall auf der Welt, mit ihrem Fist-Bump.
Anläßlich meiner Bestellung wurde seine amerikanische Neugier angeregt und er fragte mich
„Where are you from?“.
Er hatte natürlich bemerkt, daß ich nicht aus NY bin. Nicht gerade einer meiner Lieblingsfragen, eine Frage die ich eigentlich schon nicht mehr hören kann. Während er den Kaffeeautomaten bediente musterte er mich und lächelte mir aufmunternd zu, er wollte, wie es von allen Angestellten überall in den USA verlangt wird, freundlich und nett sein. Im Job war eine liebenswürdige Stimme gefragt.
„Germany“ sagte ich kurzangebunden.
„Oh, Scheiße!“ ruft er.
„Wie bitte“ sagte ich.
„The only german word I know“ sagte er.
„Ach so“ sagte ich.
Der junge Mann fügt hinzu „and Arsch!“
Er reichte mir meine Bestellung über die Theke, weiterhin mit seinem antrainierten freundlichen Lächeln. Manche sehen darin auch ein trinkgeldgeiles Kellnergrinsen.
„Vielen Dank!“ sagte ich.
Später beim Gehen ruft er mir „Tschüss!“ hinterher, das 3. deutsche Wort in seinem Vokabular oder waren es noch mehr, weitere, die ich gar nicht hören will?
Was hätte sein Chef zu seinem Vokabular gesagt? Finale Nettigkeit und Freundlichkeit am Arbeitsplatz mit dem richtigen Vokabular mußte auch ich in den USA lernen. Über die, wenn auch antrainierte, Freundlichkeit konnte ich mich also nicht beklagen.
Amerikaner lernen von Kindesbeinen an die permanente (leider auch vorgespielte) Freundlichkeit und das überschwängliche Lob. Sie äußern sich gegenüber Kunden niemals kritisch, sonst riskieren sie den Verlust ihres Jobs, da es kaum Vorschriften zum Kündigungsschutz gibt, die beachtet werden müssen. Frisch eingereiste Europäer, die in den USA Geschäfte machen wollen und dies nicht glauben wollen haben es schwer, sie tun gut daran einen Amerikaner im Verkauf zu beschäftigen. Eine zu deutsche Aura kommt gar nicht gut an. Das ewige „ Nice to see you; How are you? Great to see You!“ den Kunden gegenüber muß man beherrschen. Ausnahmen von dieser Regel findet man nur in NY. Kundenfreundlichkeit ist dort in einigen Geschäftsbereichen nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.
Denn eigentlich sind unter den Amerikanern die New Yorker bekannt für ihre Griesgrämigkeit. Ein Lächeln mag vielleicht ein Gegenlächeln hervorzaubern, aber sich in NY im Alltag durchsetzen kann man besser mit einem Knurren. Deshalb finden sich mindestens genauso viele, die der Meinung sind, daß gute Manieren Zeitverschwendung sind, ebenso wie Höflichkeit und Wohlerzogenheit. Ihrer Meinung nach sind diese Eigenschaften etwas für die faulenzenden Dorfdeppen von San Francisco oder sonst irgendwo in der amerikanischen Pampa, wo es nichts Dringlicheres gibt als nett zueinander zu sein. Wenn man dort durch die Straßen geht nicken einem die Leute zu und sagen „good morning“. Anders in NY, nach ihrer Meinung ist es eine Dummheit in NY zu Fremden freundlich zu sein.
In NY habe ich die Erfahrung gemacht, es kommt auf das eigene Verhalten und das subjektive Erleben an, ob das Gegenüber es an Höflichkeit fehlen läßt, ob die angebliche Unfreundlichkeit eine häßliche Verleumdung und nichts anderes als die blanke Unwahrheit ist. Ich habe immer wieder unvermittelt spontane Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit erlebt. Wo in Europa wird man überrascht von einem kurzen freundlichen Gruß im Vorübergehen, obwohl man sich noch nie zuvor gesehen hat. Am schönsten ist, wenn eine Frau, die mir schon aus zwanzig Meter Entfernung gefällt, wie ein Maikäfer strahlt. Und wenn wir auf gleicher Höhe sind, ein höflicher Gruß zu hören ist, das unverbindliche „Hi!“
Noch so ein Typ im Café soll nicht unerwähnt bleiben, der Arbeitskollege des Strickmützen Hipsters, ein Typ wie der Ken von der Barbiepuppe mit rabenschwarz gefärbtem stylischen Bart und mit einer Frisur, die aussah als wäre es eine Perücke im Ken-Style. Ein unwirklicher Typ dieser Zeit, im Aussehen wie eine lebendige Puppe oder auch Marionette. Ein solcher Typus, nur um einiges älter, sollte mir noch einmal begegnen.
NY, mein Blick ist offen für skurrile Gestalten, absurde Szenen, die Schönheit, das Häßliche, diese ganze irre Veranstaltung hier, die man nur erträgt, wenn man über eine Prise Selbstironie verfügt. Sehe ich die Shoppingschlampen in Manhattan auf der Straße, droht mir angesichts der modischen Überfütterung in NY so etwas wie Karies am Sehnerv. All die roten Herzchen, die parfümierten Ladys, deren Gesichter mit dem Gesicht bemalt sind, das sie gerne hätten. Mit gestylten Minihunden, bevorzugt die Chihuahua und Yorkshire-Terrier-Hündchen, die bunten Haare, auffallende Maniküre. Die Designerkleidung und Schuhe der Luxusnixen, die ein halbes Dutzend Gucci-Taschen am Leib hängen haben. In die eigene Schönheit verliebte Luxus-Schnepfen.
Manhattan verkommt immer mehr zu einem Einkaufszentrum für reiche Leute. Sie alle sind vermutlich fleißige Abonnenten von bekannten Frauenmagazinen und Opfer der Werbestrategen und der Modeindustrie, die zum Geldausgeben verführen und die eine oder andere frustrierte Lady zum Glauben verführen, Geld ausgeben sei besser als Sex.
Später am Nachmittag ging ich ein paar Blocks die Fifth Avenue hinunter und entdeckte eine tristes kleines „Restaurant“ mit der Fensteraufschrift: Great British Cooking. Die Bude war schmuddelig, aber es gab dort nur echte englische „Spezialitäten“: Fish and Chips, Dumplings, Würstchen mit Kartoffelbrei und Shepherd‘s Pie, den ich einst für meine Familie ab und zu selbst zubereitet hatte. Das einzige Zugeständnis an die regionale Küche waren vor Fett triefende frittierte Zwiebelringe, möglicherweise weil sie beliebt waren und sich, gemessen am Materialeinsatz und Kosten, damit Gewinn erzielen läßt. England liebt es herzhaft und deftig. An den Fish and Chips konnte ich nicht vorbeigehen. Ich hatte inzwischen tatsächlich einen Bärenhunger, war doch das Mittagessen etwas dürftig ausgefallen, und was gibt es da besseres als sich mit diesem fetten Zeug den Magen vollzuschlagen. Das ganze fette Essen lag mir aber später wie ein Stein im Magen, ein Underberg hätte da sicherlich geholfen.
Positiv in diesem „Restaurant“ war die fehlende Hintergrundmusik, daraus ergab sich die unterhaltsame Möglichkeit dem Volk auf‘s Maul zu schauen, die Diskussionen und schrägen Dialoge an den Nebentischen mitzuhören und die Gesichter zu studieren. Dort gab es eine Gruppe von drei Frauen, der Sprache nach, mit britischem Migrationshintergrund in schrägem Outfit, übertrieben geschminkt und mit wilden Frisuren, die an Amy Winehouse erinnerten. Die drei zeichneten sich vor allem durch ihre Rüpelhaftigkeit aus, hatten was den Alkoholkonsum angeht trinkfeste Männer mit Sicherheit mittlerweile eingeholt und waren, was ihre Sauferei betrifft, von Männern nicht mehr zu unterscheiden. Aus Kalifornien weiß ich, daß dieser Typ von Frauen auch in Table-Dance-Bars und in Porno-Bars zu finden ist. Nach ihren kaltschnäuzigen Bemerkungen über Männer waren die drei in sexueller Hinsicht eindeutig promisk. Und mit ihren rüpelhaften Dialogen, waren sie unter Mißachtung aller Erwartungen längst aus dem üblichen Standardprogramm weiblichen Verhaltens ausgebrochen - female pigs -. Ein Erlebnis der besonderen Art.
Am Abend war ich auf dem Weg ein kleines Restaurant zu suchen, nicht unbedingt ein extravagantes oder „Fusion Cuisine“, um entweder ein Steak oder Chinesisch zu essen. Mein Weg führte mich durch die 50. und 40. Straße, mal East mal West, da plötzlich riß der Himmel auf, ein Blitz schlängelte sich über den Himmel, gefolgt von einem ungeheuren Donnerschlag und unter ohrenbetäubendem Lärm schoß, mit monumentaler Wucht, eimerweise das Wasser herab. Gnadenlos fing es an in Strömen zu regnen, eine wahre Sintflut schoß die Straße hinab, es war der reinste Zorn, was aus den Wolken herabstürzte.
Ein richtig heftiger Platzregen, attackierte mich, und das ohne Schirm und Regenbekleidung, undenkbar weiterzugehen. Ich stand unter um abzuwarten, bis sich der Regen etwas legen würde.
Später, als der Regen bis zu einem Nieseln nachgelassen hatte, und aus Furcht es könnte wieder heftiger werden, ging ich schließlich in Richtung meiner U-Bahn Haltestelle. An den Gebäuden hingen ziemlich viele Leute herum, die mir nicht vertrauenswürdig vorkamen, sie schien der Regen nicht sonderlich zu berühren. Es waren armselige Penner, kaputte alte Männer, arm wie Kirchenmäuse, die den ganzen Tag in Abfallkörben nach Dosen angeln, fünf Cent die Dose, nebenbei ernähren sie sich von dem was sie in den Abfalleimern finden: Pizzaränder, Stücke von Hot Dogs, Reste von belegten Baguettes, Restinhalt von Getränkedosen. An manchen Tagen platzen ihre Eßwundertüten regelrecht aus den Nähten, so gewaltig sind die weggeworfenen Nahrungsmengen in NY. Trotzdem ein hartes Leben in harten Zeiten. Manchmal taumelte einer herum oder saß in einer dunklen Ecke, die nach Urin und Erbrochenem stank und trank Bier versteckt aus einer braunen Papiertüte. Eigentlich hatte ich gedacht solche Begegnungen gibt es nicht mehr, seit die letzten Bürgermeister ihre rigorosen Regelungen eingeführt haben.
Nach Angies Meinung laufen eine Menge geistig gestörter Leute in NY herum. Auf meine Frage „Warum?“, meinte sie die Immigration wäre schuld daran, das Fremdsein würde ihnen den Verstand rauben. Studien hätten den Nachweis erbracht, daß Städter doppelt so gefährdet sind an Schizophrenie zu erkranken, wie Menschen auf dem Land, vermutlich hat es etwas mit dem Streß in der Stadt zu tun. Bekannt sei auch, daß psychisch auffällige Menschen mit Vorliebe in größere Städte ziehen.
Nach einer meiner alten Gewohnheiten ging ich in NY den auffälligen Leuten auf der Straße aus dem Weg, deshalb lief ich öfters im Zickzack von einer Straßenseite zur anderen, sobald es der Verkehr erlaubte, als plötzlich ein Auto anhielt und mich ein gut gekleideter freundlicher Herr fragte: „Kennst du mich?“
„Ich bin Frank, kann ich dir ein ride geben!“ - ob er mich ein Stück mitnehmen kann.
Es war der Eierproduzent aus dem Flugzeug, der mich trotz der schummrigen Beleuchtung der Straße sofort erkannt hatte. Ich erzählte ihm, daß ich auf der Suche nach einem Restaurant war.
Frank fragte „Darf ich dich zum Essen einladen, ich habe noch nichts gegessen und würde mich freuen, wenn du mir Gesellschaft leistest“.
Hierzu muß man wissen, daß man in den USA ungern allein in ein gutes Restaurant geht, es soll nicht der Eindruck entstehen man kenne niemanden, wäre gewissermaßen ein schräger Vogel oder es würde sonst etwas in der Lebensgeschichte nicht stimmig sein. Jemanden sollte es immer geben, mit dem man in ein angesagtes Restaurant zum Essen gehen kann. Die Restaurantbetreiber mögen es auch nicht, wenn ein Einzelner einen Tisch belegt. Anders als in Deutschland ist es absolut unüblich eine Einzelperson zu anderen Gästen an den Tisch zu setzen. In einem Restaurant sich selbst an einen Tisch zu setzen wird überhaupt nicht erlaubt, erst recht nicht zu fremden Gästen.
Während der Fahrt kam mir der Gedanke, daß ich diesen Herrn eigentlich nicht wirklich kenne und recht sorglos in sein Auto eingestiegen bin. Schließlich beruhigte ich mich, denn ich hatte mir nichts vorzuwerfen was zu irgendeinem Mißverständnis führen könnte. Schließlich hatte ich nicht wie einst Lili Marleen am Laternenpfahl gelehnt und war mutmaßlich nach unserer Begegnung im Flieger von seiner Seite richtig einzuschätzen.
Dinner in New York
Wir sind in eine Art Bistro gegangen und setzten uns an die Theke. Dort wurde Craft Beer von der bereits kultisch verehrten New Yorker Brooklyn Brewery ausgeschenkt, ein Bier das wegen seiner speziellen Hopfensorten nach Pfirsich oder Zitrone schmecken soll. Ein amerikanischer Trend, sie lieben auch Biere mit Erdbeergeschmack und ähnlich eigenwillige Geschmacksrichtungen. Dies ist der allgemeine Trend, aber auch zum guten Bier. Die urbanen Eliten in den USA haben schon lange keine Freude mehr an der labbrigen dünnen Brühe der großen Brauereien Budweiser oder Miller. Junge pfiffige Leute fingen nicht nur in Brooklyn an, ihr Bier selbst zu brauen. Ein Trend, der sich inzwischen auch in Deutschland ausbreitet.
Als ich die erstaunlich schöne und aufwendig gestaltete Speisekarte studierte wurde aus dem Staunen schnell ein leichtes Schaudern. Es gab nicht wie in China erlebt, geschälte und gebratene Hühnerfüße oder Hahnenkämme im Angebot, jedoch den kompletten Mist, der einem von der Ost- bis zur Westküste also auf zehn Millionen Quadratkilometern Fläche begegnet. Wieder einmal hatte sich bewahrheitet, je einfallsloser die angebotenen Speisen, desto aufwendiger die Speisekarte. Die Speisekarte bestand aus drei Sorten von sandwichartigen Gebilden und drei Salaten, dazu vier Salatsoßen zur Auswahl. Weiter gab es Clam Chowder, dies ist eine in USA beliebte mit viel Speisestärke angedickte Suppe aus Miesmuscheln. Außerdem Schnitzel, oder was sie dort so nennen, in einem halben Dutzend Variationen, die immer als „entrées“ angeboten werden, womit seltsamerweise die Hauptspeise gemeint ist – frankophile Amerikaner haben da scheinbar etwas falsch verstanden.
Dies war nun die Essensauswahl anläßlich der Einladung. Wobei Franks Gedanke an Schnitzel möglicherweise meiner deutschen Herkunft zuzuschreiben war. Denken doch viele in Deutschland ernährt man sich hauptsächlich von Schnitzel, Sauerkraut und Bratwurst. Die Herkunft bindet an das Heimatland und sofort wird eine Bilderwand aktiviert, wobei für die Differenzierung kein Platz mehr ist. Meistens wollen die Fragenden die Bilderwand in ihrem Kopf bestätigt sehen. In Begegnungen sehen wir in den anderen immer nur unsere Vorstellungen, die wir von diesen haben, nicht den Menschen selbst.
Weil alles Deutsche gerade hip ist, kann man sich in NY in dem als hip geltenden Stadtteil Williamsburg bis zum East Village und sogar in Harlem an deutschem Bier, Bratwurst und Schnitzel erfreuen.
Mein Gedanke anläßlich der Essenseinladung war: ist der sparsam oder vielleicht doch kein Geschäftsmann wie vorgegeben? Es war eine Einladung und ich wollte eigentlich nicht unhöflich sein, trotzdem sagte ich zu Frank
„Eine Essenseinladung habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, denn eigentlich wollte ich in ein richtiges Restaurant“.
Meine Kritik an der Lokalität beinhaltete gleichzeitig eine gewisse Undankbarkeit, dies war mir bewußt. Frank erwiderte zunächst „Ich komme immer hierher!“
Schließlich hat er es verstanden und wir gingen in ein schickes Restaurant, ins Marriot Marquis, das einzige sich drehende Dach-Restaurant in New York. Eine Absicht, die ohne vorherige Reservierung schnell in eine Warteschlange, mit der Wartezeit von einer Dreiviertelstunde, hätte einmünden können – Please wait to be seatet – Bitte warten sie bis man sie hinsetzt.





























