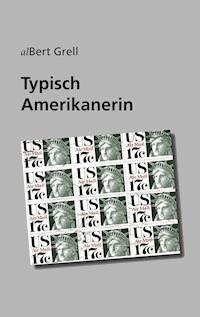Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein scharfsichtiger Blick auf die Realität, aus über 40 Jahren vielfältigen USA-Erfahrungen des Buchautors. Weg von Schwärmerei und Oberflächlichkeit. Manches aus der Gedanken- und Lebenswelt der US-Amerikaner läßt die Leser nachdenklich verweilen. Ein Schatz an Wissen für alle, die sich ernsthaft für die USA interessieren. Nicht nur für USA-Fans empfehlenswert, sollte aber unbedingt vor einer Reise gelesen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Verlag Monsenstein & Vannnerdat
2011 < Onkel Sam tickt anders >
2013 < USA – Jeden Tag viel Schlechtes
und wenig Rechtes >
2013 bei Books on Demand (BoD)
<Onkel Sam tickt anders>
2014 bei Books on Demand (BoD)
<USA - Illusion und Realität>
2015 bei Books on Demand (BoD)
< Tapetenblumen>
2017 vorliegende überarbeitete Neuauflage
<USA – Illussion und Realität> (BoD)
Neuerscheinung Anfang 2018
bei Books on Demand (BoD)
<Typisch Amerikanerin>
Das Buch <Illusion und Realität>,
sowie das Buch <Typisch Amerikanerin>
ist zu einem erheblich reduzierten Preis auch als E Book lesbar.
Inhalt
Wir sind das freieste Volk
Ich grüße mein New York
Der König von New York
Tick tack in Amerika
Die Hoffnung der schwarzen Bevölkerung
Im Hafen der Toleranz
Zuviel Recht hat manchen Herrn gemacht zum Knecht
Money, money
Opfer der Immobilienkrise
Immobilienfinanz
Auf die Karriereleiter mit der Todesstrafe
No money for the school
Mahlzeit!
In einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist
Das auserwählte Volk in „God‘s Own Country“
Hanky Panky neulich in Amerika
Out of this world in the greatest nation on earth
Sportlicher Eiertanz
Petri Heil und anderes Glück
Nachwort zu dieser Neuauflage
ANHANG
Albert Grell geb. 1945 von Beruf Diplom Sozialarbeiter (FH) emigrierte 1971 in die USA und kam wieder zurück nach Deutschland, arbeitete als Sozialarbeiter, Dolmetscher und freier Journalist.
Er kennt durch zahlreiche Aufenthalte, die Vereinigten Staaten bestens. Als außenstehender Beobachter schreibt er aus der nötigen Distanz über die oft außergewöhnlichen Verhaltensweisen und die für Europäer faszinierende Mentalität der Amerikaner. Berufsbedingt sieht er vieles im Verhalten der Amerikaner kritischer und in Ergänzung zu sonnigen Reiseberichten beschreibt der kompetente Autor, ungeschminkt, die wenig bekannten Seiten der Amerikaner. 2011 veröffentlichte er sein erstes Buch, seitdem hat er weitere erfolgreiche Bücher geschrieben.
Wir sind das freieste Volk
Auf der USA-Reise mit den berühmten Greyhoundbussen durch den Kontinent offenbart sich ein Großteil der amerikanischen Seele und man bekommt eine Ahnung von den Gegensätzen, die das einfache Leben dieses Kontinents bestimmen. Hier trifft man die, die nicht mit einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt kamen und auch heute noch nicht auf Rosen gebettet sind. Lebenskrisenstolperer und Gegenwartsverweigerer. Vom Leben angepisste, Liebessüchtige, Untergangspropheten, die zwischen Zuversicht und Zweifel meistens zum Zweiten neigen, aber auch hintersinnig philosophische Träumer mit der Sehnsucht nach einem dicken Klecks Azurblau im Leben und vor allem, dank phänomenalen Luftpolstern um und unterhalb der Gürtellinie, hüftig daher schwankende Frauen und Männer. Nicht nur einmal drückte mich ein geschätztes Körpergewicht von vier Zentnern in Richtung Seitenfenster. Reichte der Fußraum nicht, streckte man mit raumgreifendem Ego unkompliziert und ohne Umschweife das linke oder rechte Bein in meinen Fußraum. Warum auch nicht, beim schmalbrüstigen Spargeltarzan daneben hat es ja noch Platz. Auf der ganzen Busfahrt hatte ich mehr intensiven Körperkontakt als in meiner gesamten Teenagerzeit, leider weniger freiwillig. Wer einmal, notgedrungenerweise, längere Zeit mit der Nase an der von einem Deodorant bisher nie berührten Achselhöhle eines fettleibigen Mannes verbrachte, weiß wovon die Rede ist. Auf einer langen Strecke ist dies so entspannend wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Dicke Sitznachbarn sind GAP; das G rößte A nzunehmende P ech. Zu allem Überfluß dampften die Herrschaften wie heiße Suppe, nur nicht so appetitlich. Man geht davon aus, daß in den USA ab 2030 mehr als 40 % Fettleibige leben dürften. Nach anderen Prognosen sogar 75 % der Bevölkerung.
Leider war es nicht möglich mit Verzögerung einzusteigen, um vielleicht einen Sitzplatz neben einer bestimmten Person oder der duftumwaberten Bordtoilette zu vermeiden. Auf dem Logenplatz vor der Bordtoilette zu sitzen und Nasenzeuge zu sein, wie sich die Mitreisenden dem Wunder Bordtoilette widmen, ist eine entbehrliche Lebenserfahrung.
Wer nicht im Bus ist, wenn alle Plätze vergeben sind, muß trotz Fahrkarte draußen bleiben. Platzreservierungen gibt es ohnehin nicht. Wer sind diese Amerikaner? Was sind sie für Menschen?
Ich hatte gehört, die Fahrt mit dem Greyhound würde mich um Erfahrungen mit der amerikanischen Seele reicher machen und ich hatte einige tausend Kilometer Busreise vor mir, die sich, wie sich später herausstellen sollte, anfühlten als wäre ich auf löchrigen Straßen und holprigen Highways Jahre unterwegs. Die Fahrten durch eine Stadt dauerten ewig, man hatte den Eindruck der Bus fährt im Kreis herum, es scheint sich endlos lang zu ziehen. Manche Fahrten durch die verfallenden Innenstädte, die Straßen älterer oder gar abgestorbener Viertel erweckten den Eindruck man befinde sich auf einer Reise durch die Dritte Welt, so trostlos war der Anblick. Das Ausmaß an Verwahrlosung, die abgeblätterte Farbe der Häuser, die morschen und zerbröckelnden Holzveranden, teilweise hatten sie den größten Teil ihres Geländers verloren, hölzerne Stufen die zur Veranda hinaufführten fehlten ganz oder teilweise, die blinden Fenster und deren Anblick muß einen vorurteilslosen Betrachter traurig stimmen, andere mag es deprimieren. Hinter einigen wohnten Schwarze. Die Leute, die dort in den verkommenen, windschiefen Hütten lebten waren sicherlich arbeitslos und lumpenarm, lebten mit unzulänglichen staatlichen Beihilfen oder Almosen der Kirche ein armseliges menschenunwürdiges Leben. Das einzige was sie im Überfluß hatten, waren ganz offenkundig ihre Kinder. Wie ich erfahren habe, liegt in den amerikanischen Armutsgebieten das Schulwesen besonders im Argen. Die High-Schools sind für diese Kinder meistens unerreichbar und die Elementarschulen in den Armutsbezirken so schlecht und unzulänglich, daß die Kinder kaum richtig schreiben und lesen können, wen sie mit der achten Klasse oder schon vorher, die Elementarschule verlassen. Annähernd ein Viertel der amerikanischen Bewerber bei der Armee kann nicht Soldat werden, weil ihr Bildungsstand nicht dazu ausreicht. Um trotzdem die Grenzwertigen in der Armee verwenden zu können, ist man dazu übergegangen die Gebrauchsanweisung für militärische Gerätschaften, z.B. die Bedienungsanleitung für Panzer, in Form von Comics abzufassen.
Wer in den Bereichen der Armut und Unbildung geboren wird, der hat nur sehr geringe Aussicht diese Bereiche je zu verlassen. Diese Realität ist genau das Gegenteil des „American dream“, durch Fleiß und der Hände Arbeit aufzusteigen. Wer in den USA als Farbiger geboren wird, hat es besonders schwer, dem ist meist die Anwartschaft auf Armut mit der Hautfarbe in die Wiege gelegt. 44 % der nichtweißen Amerikaner zählen zu den Armen. Der Lohn der Farbigen (Schwarze, Latinos, etc.) liegt im allgemeinen unter dem der Weißen. Die Farbigen werden zuletzt eingestellt und zuerst entlassen. Durch neue Bürgerrechtsgesetze hat man versucht die Benachteiligung der Farbigen zu beseitigen. Die Frage, ob sie auch bildungsfähig und so leistungsfähig wie die Weißen sind ist damit aber noch nicht entschieden. Dies wird erst dann entschieden sein, wenn die meist versteckte Diskriminierung der amerikanischen Farbigen ein wirkliches Ende gefunden hat.
Wenn man einen Amerikaner des Mittelstandes auf die Armut anspricht, wird er sie entweder leugnen oder schon beinahe stereotyp antworten: „Bei uns gibt es keine Armen, Arme, wieso Arme?“. Wer wirklich arbeiten will, der findet auch Arbeit. Über die Bedingungen spricht man nicht. Wer keine Arbeit und kein richtiges Einkommen hat, der ist nach ihrer Meinung eben arbeitsscheu und erwartet, daß die anderen für seinen Unterhalt sorgen.
Besonders tragisch ist die Altersarmut in Amerika. Jung zu sein und zu bleiben ist das amerikanische Ideal. Wer nicht mehr jung ist, wer der ständig mit allen Mitteln betriebenen Verlockung erlag, mehr auszugeben als er verdiente, wer alt wird, ohne vorgesorgt zu haben, und dann noch arbeitslos oder arbeitsunfähig ist, der hat es sich selbst zuzuschreiben wenn er den Rest seiner Tage in kümmerlichen Verhältnissen verbringen muß. Fast die Hälfte aller Menschen in den Vereinigten Staaten, die über fünfundsechzig sind, sind verarmt. Dies sind Millionen von Menschen. Arme in erschreckender Zahl hat es immer gegeben. Der Großteil der Bevölkerung hat es stets gewußt, und man sah darüber hinweg. Erst neuerdings beginnt die Öffentlichkeit mit Appellen an die Empathie in „God‘s own country“ die Armut, wenn auch zögerlich, zur Kenntnis zu nehmen. Die übrige Welt muß sich an die Vorstellung erst noch gewöhnen, daß für ein Fünftel bis ein Viertel der Amerikaner das Schlagwort vom „reichen Amerika“ nichts anderes ist als Hohn.
Die Hölle, das sind die anderen, heißt es bei Sartre, was damit zu ergänzen wäre, daß die anderen nicht Fremde, sondern allzu oft die Nächsten sind, die bittere Armut erleiden müßen.
Anderen Ortes wechselten sich verwahrloste Viertel und löchrige Straßen mit hübschen Wohnblocks ab. Im krassen Gegensatz dazu die exklusiven Vororte, in die sich die wirklich reichen Leute zurückgezogen haben, mit ihren endlosen Reihen von beeindruckenden Bürgerpalästen und Villen, selbst die einfachsten Häuser erweckten noch den Eindruck von Gediegenheit und bürgerlichem Wohlstand. Amerika ist ein Land der Gegensätze.
Beim ersten Halt an einem Burger King hatte ich noch keinen Appetit auf Fast Food und sah den anderen zu, wie sie mit ihren vollgefüllten braunen Tüten hereinstürmten und wie die Aasgeier in Windeseile die Burger mit Pommes und Muffins oder ihren Double Cheese- and Bacon-Burger in sich hineinstopften. Bald miefte es, neben anderen Düften, wie in einer Pommesbude. Wer auf diese Art von Geruch steht, hätte wie beim Bonbonlutschen an übermäßigem Speichelfluß gelitten. Gab es berechtigte Hoffnung auf etwas Eßbares, das meiner europäischen Vorstellung entsprach?
Am nächsten Halt meinte ich zunächst ich hätte Glück; mein dicker Nebensitzer, der Schwabbeladonis stieg aus, nicht ohne zuvor in schnoddrigem Ton über den Bus zu schimpfen, nachdem er die ganze Fahrt wortkarg neben mir saß. Er meinte die Sitze wären wohl aus Sparsamkeitsgründen zu eng und die durchgesessenen Sitze zu unbequem für normale Menschen. Dickleibigkeit ist ein heikles Thema in den USA. Die Amerikaner vermeiden es dieses Thema anzusprechen, sie wollen niemanden „embarress“ d.h. in Verlegenheit bringen. Überhaupt werden sehr persönliche Dinge nicht gerne angesprochen, dazu gehören auch Fragen zu Religion und Politik, dies wäre in ihren Augen nicht korrekt. Trotzdem müssen dickleibige Passagiere, die nicht in ihren Flugsitz passen, bei der Fluggesellschaft United Airlines, ein zweites Flugticket kaufen. Es ist schon vorgekommen, daß ein Fettwanst das Flugzeug wieder verlassen mußte, weil er sich wegen seiner Leibesfülle nicht anschnallen konnte. Die Fluggesellschaften bleiben jedoch bei ihren schmalen Sitzen. Sie müssen in wirtschaftlich harten Zeiten knapp kalkulieren und jede Verbreiterung bedeutet Reduktion der maximalen Besetzung also Verteuerung der Tickets. Einige Airlines lobbyieren für Gewichtszuschläge. Es ist nur ein schmaler Grad in der Debatte zwischen Diskriminierung im Lebensstil oder Behinderung. Die Fluglinien tun sich schwer damit, denn die meisten Fluggesellschaften sind angesichts der ausufernden Personalkosten eigentlich pleite und befinden sich unter Gläubigerschutz. Den Übergewichtigen bleibt alternativ das Auto, denn es gibt nur wenige Züge, die zudem teuer sind, oder der unbeliebte Bus.
Sollte es auf der Busfahrt so weitergehen, bliebe mir mein MP3-Player mit diversen Songs von Bob Dylan, dem einstigen Robert Zimmermann, der vor Jahren sang: „The answer, my friend, is blowin‘ in the wind...“. Ein cooler Hund, kratzig, knarzig und wunderbar verquer. Oder Johnny Cash, die Wahnsinnsstimme mit sägendem Ziegenbocktimbre: „I‘m on the road again“.
„On the road“ zu sein bedeutet nicht nur auf der Straße zu sein, sondern vielmehr unterwegs in Bewegung zu sein, auf seinem Weg nach oben sein, auf dem richtigen Weg in Richtung des persönlichen amerikanischen Traumes, an dessen Ende man es zu etwas gebracht hat. Mittlerweile ist Cash schon über 70 und konnte bereits sein 50. Bühnenjubiläum feiern. Ein Alles-auf-den-Kopf-Steller, der dafür sorgt daß wir ein wenig werden wie er: sperrig, rätselhaft, frei. Nebenbei ein Rebell für den Hausgebrauch.
Zu bestimmten Zeiten war der Bus fast vollkommen leer, dann wieder überfüllt und stickig. Radio oder gar TV im Bus, Fehlanzeige. Eine lange, langweilige Fahrt über zahllose Stunden mit drei Dutzend Unterbrechungen von zehn Minuten bis zu einer Stunde. Und von einer Etappe zur nächsten saßen auf dem Platz neben mir, eine dicke kurzatmige Schwarze mit einem Gesicht so rund wie ein Pfannkuchen, gekleidet in viel Lila und Puffrot. Ein seltsam duftender Inder oder Pakistani. Eine dünne weißhaarige Alte und ein sich ständig räuspernder spitznasiger langhaariger Mensch von so undefinierbarem androgynem Aussehen, daß mir nicht klar war, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Der stellte sich schlafend, kletterte jedoch bei jedem Halt aus dem Bus um zu telefonieren. Ein zugestiegener schweigsamer junger Snob verschlang neben mir seinen neuesten Sex-Thriller. Später kam eine ältere Dame, mit einem Buch, das ich nicht bei ihr erwartet hätte, es war ein Mathematikbuch! Studenten auf den vorderen Reihen waren fleißig dabei ihre Handbücher mit dem Stift zu markieren und nicht nur einer der wortlos stummen Einzelgänger las in der Bibel, dies scheint eine beliebte Lektüre zu sein. Bei einem Schwarzen auf dem Sitz vor mir hatte das Buch den Titel: „Wie halte ich eine Predigt?“. Vielleicht war er auf dem Weg zu einem Predigerseminar.
Dann hatte ich noch einmal Glück, der neu zugestiegene unrasierte Mann mit dem fettigen Haar, übersah mich, vielleicht war ich ihm auch unsympatisch, er verschwand nach einem kräftigen Furzgeräusch, schnell im hinteren Teil des Busses. Unter den anfänglichen Geruch nach frischem Kaffee und Aftershave mischte sich nun sein unangehmer Gestank. Nach einer Weile übertönte er mit schnarrender Altweiberstimme und wichtigtuerischem Gerede jeden und alles; wieder einmal gutgegangen dachte ich. Ich bevorzuge das Gespräch mit intelligenten Leuten, die wirklich etwas zu sagen haben und nicht nur irgendwie durch den Tag dümpeln; das ist eine faszinierende Sache.
Weite Ebenen, seltsame kleine Orte, die Holzhäuser mit ihren landesüblichen Veranden, möbliert mit Hollywoodschaukel oder Schaukelstuhl. Orte die grau und verlassen aussehen, dazwischen verstreute, einsame Farmen mit Pferdekoppeln und Silos. Die landschaftlichen Reize in diesem Mittelwesten waren keine aufregende Sache. Meile auf Meile, nur Mais- und Kornfelder in einer Landschaft, die flach und glatt war wie ein Küchenbrett. Die Müdigkeit übermannte mich und ich versuchte zu schlafen. Die aufgerissene Armlehne war, wie der Sitz, kaum gepolstert, folterte meine Armnerven bis schließlich mein Sweatshirt statt als Nackenstütze zu meiner Lenition als Armpolster Verwendung fand.
Irgendwann in dieser Nacht stieg Frank ein, sein wunderschön verzierter breiter Ledergürtel mit einer mächtig großen silbernen Gürtelschnalle in die vier Türkise eingesetzt waren, fiel jedem ins Auge, die Gravur „Johnny Cash“ war unübersehbar. Ein schwergewichtiger Hüne von einem Mann, der in seiner knorrigen Individualität im besten Südstaatenslang und seiner volksnahen Sprache, reichlich gewürzt mit „wow“, von der Freiheit in Amerika schwärmte. Mit seinen Argumenten wie die meisten in den ländlichen Gebieten ein echter Republikaner, weiße Hautfarbe, Ex-Infanterist und Patriot, angiffslustig und bärbeißig, mit einem hellwachen Geist. Wir sind das freieste Volk, in einer Freiheit wie er sie verstand. Freiheit bedeutete für ihn unbehelligt die Straße hinunterlaufen zu können ohne dabei gleich erschossen zu werden. Er und seine Ansprache erinnerte mich sehr an die Fuzzi Wildwestfilme, die ich einst in meiner frühen Jugend in Stuttgart in einem kleinen Kino namens Flohkiste sah. Ein für mich sehr seltsamer Begriff von Freiheit als ob man außerhalb Amerikas gleich erschossen wird, wenn man sich zu Fuß auf die Straße begibt. Auf die weitere Nachfrage was noch, meinte er das Recht sich einen großen Pick-Up zu kaufen, selbstverständlich mit Achtzylinder und Vierradantrieb „The bigger, the better“ – Je größer, desto besser. Dies war sicher nur ein Traum, wäre er denn sonst im Greyhound unterwegs? Es gibt im Mittleren Westen ziemlich viele Amerikaner, die mit Pick-Up-Trucks über die Highways rattern und die Luft verstänkern. Diese monströsen Pritschenwagen mit vergleichsweise hohem Verbrauch liegen voll im Trend. Die meistverkauften Modelle sind alles andere als energiesparende Öko-Fahrzeuge. Die Freunde dieser Vehikel bezeichnen Anhänger eines ökologischen Lebenswandels, wie ihn die Grünen propagieren, geringschätzig und fast abfällig als „tree huggers“. Grüne sind in ihren Augen Spinner mit Neigung zur hochtrabenden Phrase, zur Anhimmelung der Natur, die gern in den Wald gehen und Bäume umarmen, als ob die Natur nur etwas liebliches sei. Sie sind gegen jegliche Ökologiebewegung und haben kein Verständnis für die Sorge um die natürlichen Lebensgrundlagen. Sie bezeichnen dies in einer neuen Wortkreation als „German Angst“. Ein Liter Superbenzin kostet an ihren Tankstellen immer noch zwischen 70 und 80 Cent, wesentlich weniger als in jedem europäischen Land, trotzdem beklagen sich alle über zu hohe Spritpreise. Weil politisch nicht gefördert gibt es, im Verhältnis zur Größe des Landes, kaum Dieselfahrzeuge, ein Tankstellennetz hierzu fehlt. Die Diesel hatten bei ihnen schon immer einen schlechten Ruf als Stinker und der Abgasskandal in 2016 hat sein Übriges dazu beigetragen. Allerdings hat diese Nation nicht nur den Pick-Up hervorgebracht, sondern auch seine profundesten Kritiker. Man muß sich auch hier wieder einmal an die Faustregel erinnern, daß jedes Klischee über Amerika stimmt, während das Gegenteil ebenso zutrifft.
Einige Zeit später, anläßlich eines längeren Aufenthaltes in der Provinz, in einem kleinen idyllischen Kaff mit Bürgersteigen, die im Nichts enden, erinnerte ich mich an das Gespräch bezüglich der großzügigen Freiheit, unbehelligt die Straße herunter laufen zu können, fühlte mich nahe am Leben, wie es gelebt wird. Dort wurde mir gesagt, ich könne hier nicht einfach zu Fuß herumlaufen, um mir die Häuser und vielleicht die Gegend anzusehen, sonst würde mich sofort die Polizei, der Sheriff anhalten. Falls ich keine plausible Antwort hätte, warum ich hier in der Gegend herumlaufe, würde er mich im schlimmsten Fall verhaften. Erschießen jedoch nicht sofort. Die Frage warum man denn nicht so einfach herumlaufen dürfe und ob es wirklich verboten wäre, ergab fassungsloses Erstaunen und die Rückfrage, ob ich noch nie etwas vom muslimischen Terror gehört hätte. Anderen Ortes, in einem geruhsamen Dorf mit Wildwestflair, griff ich diese für mich wundersame Anweisung in einem Gespräch nochmals auf und es wurde mir gesagt, es sei auch schon vor der Zeit des Terrors so gewesen; es wäre die Angst vor Einbrechern und Dieben. Wer zu Fuß unterwegs ist, ist entweder gestrandet oder verdächtig. Bürgersteige dienen nur noch der Erinnerung daran, daß es vor langer Zeit Fußgänger gegeben hat. Man geht nicht mehr zu Fuß. Zu Fuß unterwegs ist der Amerikaner allenfalls für kurze Strecken in den Zentren der Städte vom Parkplatz zum Shoppingcenter oder in sein Büro, allenfalls noch einige wenige junge beim Wandern im Nationalpark. In den Ritzen der Bürgersteige wächst Unkraut und Gras. Und auf weiten Strecken hin sind die Gehwege völlig verschwunden.
Überall gibt es Verbotsschilder, nach ihren Aufschriften ist kein Durchgang – no trespassing, weil gegen das Gesetz – unlawful – against the low, prohibited – verboten oder prosecuted – strafbar, als harmloseste Variante ein schlichtes „keep out“. Offensichtlich ist jeder Weg in Privatbesitz. Wo bleibt die viel gepriesene Freiheit?
Vor einiger Zeit wurde ein 17-jähriger Junge mit schwarzer Hautfarbe von einem paranoiden selbsternannten Nachbarschaftsschützer mitten auf der Straße, wie in einem Wild-West-Film, kaltblütig erschossen. Der völlig harmlose junge Schwarze kam zu Fuß vom Einkauf im Supermarkt und war auf dem Weg nach Hause und unbewaffnet. Der Täter, ein 28-Jähriger ging auf eigene Faust Streife in der Nachbarschaft, verfolgte den Jungen und erschoß ihn nur, weil er ihn nach seiner späteren Aussage für einen Typen hielt, der nichts Gutes vorhat.
Der Todesschütze blieb zunächst unangetastet und in Freiheit. Er hat bei der Polizei glaubhaft eine verlogene Notwehrgeschichte aufgetischt, die ihm von der Polizei abgenommen wurde. So kam es zu keiner Festnahme und Untersuchung des Falles. Er war gewissermaßen sein eigener Vollstrecker, Schöffe und Richter. In den Medien wurde jedoch davon ausgegangen, daß der Vorfall auf einem rassistischen Hintergrund zu sehen ist.
Ein extrem großzügiges Selbstverteidigungsgesetz in Florida macht es möglich, auf eine gefühlte Bedrohung von Leib und Gut mit tödlicher Waffengewalt zu antworten und ohne Anklage davonzukommen. Nach dem Gesetz müssen Floridas Bürger nicht versuchen der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Sie dürfen sich sofort mit allen Mitteln wehren – bis hin zur Tötung des mutmaßlichen Angreifers. Diese Regelung gibt es unter dem Begriff „Stand-Your-Ground-Law“ auch in anderen Bundesstaaten.
Der brutale Vorfall wurde über Fernsehen und die Zeitungen in den ganzen USA bekannt. Ein Teil der Amerikaner, die sich Gedanken über den Zustand ihrer Gesellschaft und die zunehmende Brutalisierung machen, war zutiefst empört und der Täter wurde doch noch inhaftiert. Durch einen im Internet eingerichteten Solidaritätsfond, der in Kürze 200 000 $ erreichte, wurde er gegen eine Kaution von 150 000 $ freigelassen. Alles übrige Geld floß zunächst auf das Privatkonto des Täters. Schließlich wurden ihm Abhörprotokolle zum Verhängnis und er wurde erneut inhaftiert. Der Vorgang zeigt, daß die Solidarität der Bevölkerung nicht nur auf Seiten der Opfer ist, besonders wenn diese eine schwarze Hautfarbe haben. Für Konservative ist der Täter längst zum Helden geworden und das Spendenkonto, es wird mittlerweile von einem Treuhänder verwaltet, soll sich auf mehrere hunderttausend Dollar vervielfacht haben.
Offensichtlich angefeuert von der Waffenlobby, haben sich inzwischen die Hälfte der 50 Bundesstaaten, ähnliche großzügige Gesetze zur Selbstverteidigung gegeben.
Auf der weiteren Busfahrt mit dem Greyhound: Neben dem dringend reparaturbedürftigen holprigen Highway, ab und zu riesige Maisfelder oder ein paar Rinderherden in der faszinierenden schier unendlichen Weite und hügelige, in der Ferne auch bewaldete Landschaft. Schließlich in einer Senke die zerfallenden Hütten einer ehemaligen Siedlung. Auf dem Asphalt der Zufahrtsstraße saßen Truthahngeier und rissen einen Kadaver in Stücke. Hin und wieder sah ich sogar eine Einzäunung auf einer der unermeßlich großen Farmen, um eine teure Büffelherde vor dem Weglaufen abzuhalten oder einfach nur um ihren Radius einzuschränken. Auf unserem Highway geradewegs ins Nirgendwo trieb der Wind Humble Weeds vor sich her, und wie immer geht es wie mit einem Lineal gezogen immer geradeaus. Später eine Landschaft aus weitem Grasland und offenem Buschland, die wird immer schroffer und es scheint so als kämen jeden Augenblick Winnetou und Old Shatterhand daher geritten. Weit draußen sehe ich einzelne hölzerne Einfamilienhäuser stehen, ohne Auto könnte man hier nicht wirklich leben. Mein Sitznachbar Frank schwärmte von der Freiheit auf dem Land und erzählte mir, es gäbe viele Orte der Einsamkeit und der Stille. Wenn er für seine Verpflegung Nachschub brauche müsse er eineinhalb Stunden zu einer Straßenkreuzung laufen. Dort gibt es das einzige kleine Ladengeschäft weit und breit, „Grocery“ genannt, in dem es alles mögliche zu horrenden Preisen gibt, daneben eine Poststation, eine Tankstelle und angeblich 42 amerikanische Briefkästen. Diese Blechkästen am Straßenrand sind entsprechend der Landessitte unverschlossen und die Post könnte praktisch von jedem der vorbeikommt entnommen werden. Auch bei Regenwetter würde er zweimal pro Woche dorthin laufen. Die ganze Zeit verbringe er glücklich und mit einem Gefühl der Sicherheit in seinem Haus, umgeben nur von Froschquaken und Vogelgezwitscher oder mit dem Trommeln des Regens auf dem Dach. Jeden Morgen wenn er seine zwei Hähne und die vier Hennen füttere, sehe er wie die Sonne aufgeht. Das nächste Starbucks-Café wäre 90 Meilen weit weg und für einen richtigen Supermarkt müßte er eine Stunde fahren. Als er das letzte Mal in der nächst liegenden Stadt war, ging ihm der Verkehrslärm und auch der von den Laubbläsern auf die Nerven. Nach seiner Schilderung verspürte Frank nicht das geringste Bedürfnis seinen Wohnort zu verlassen. Er könnte in einer Stadt wie New York nicht leben. Auf die Frage: „Warum?“ meinte er, so eine Ebene sei Freiheit pur. Gab weiter zur Antwort, man könne schon von weitem sehen wenn jemand kommt und ihn notfalls mit dem Gewehr rechtzeitig erschießen. Er besitze mehrere Pistolen und Gewehre. Darüber hinaus benötige er die Waffen, um jederzeit bereit zu sein, sein „Recht“ zu verteidigen, wenn das Government (die Regierung), seiner Meinung nach, nicht das tut was er für richtig hält. Er meinte diese Art der Verteidigung wirklich und wahrhaftig und hatte es nicht nur aus Imponiergehabe gesagt. Meine Meinung, diese Freiheit wäre doch nur Illusion und man müsse vernünftigerweise annehmen, Menschen die in einer Großstadt wie NY leben, hätten eine etwas andere Lebenseinstellung als die Bewohner einer schier unendlichen Ebene, ließ er nicht gelten. Hierzu bleibt nur zu bemerken, daß eben Dämlichkeit eine Gnade ist, gleichsam ein unbezwingbarer Harnisch, der das Glück und die Zufriedenheit seines Trägers vor jedem Selbstzweifel schützt.
Ist im Greyhound die Welt der Spinner oder nur die Welt der Amerikaner, die sich kein eigenes Auto und kein teures Flugticket leisten können oder wollen, so wie ich?
Im Bus wird der Mief immer stärker, die Ausdünstungen der Menschen, der Geruch nach abgestandenem Fast Food, hinzu kam noch beißender Geruch aus der Bustoilette. Man hatte mir vorweg gesagt, man müsse auch olfaktorische Beleidigungen wegstecken können und mit dem Schlimmsten rechnen. Ich weiß bald nicht mehr auf welcher Backe ich sitzen soll. Meine Füße sind schwer wie Blei und ich bin verstopft und fühle mich aufgebläht. Ein Zustand nach dem ca. zwanzigsten Besuch eines Fast-Food-Restaurants. Selbstverständlich habe ich mich an den bestempfohlenen Burgern versucht. Ich kenne sie nun alle, ob Wendys, Kentucky Fried Chicken, Subway und Co., den Burger King mit seinem Verkaufsschlager dem Whopper oder den Big Mac von McDonald, dessen größter Fan der Expräsident Clinton sein soll. Die Burger waren gar nicht so schlecht, nur täglich oder gar dreißig mal hintereinander, wäre mit mir nicht machbar gewesen. Für die mitreisenden Amerikaner dürfte es jedoch kein Problem gewesen sein, sich jeden Tag mindestens einen saftigen Burger einzuverleiben. Von Hawaiianern wurde mir erzählt, die über 200 Kg auf die Waage bringen und wenn sie in ein Schnellrestaurant gehen, fünfzehn Cheesburger für sich selbst bestellen. Fettleibigkeit und Fast Food ist offensichtlich in der Welt der Hawaiianer überhaupt nicht verpönt und keine Sünde. Im Gegenteil, kolossales Körpergewicht steigert im 50. Bundesstaat das Ansehen der Person.
Zu meinem Glück gab es auch ein paar asiatische und mexikanische Schnellrestaurants, die für meinen europäischen Gaumen einigermaßen akzeptables Essen anboten. Die Burritos oder Faijtas von Taco Bell konnte ich jederzeit essen. Notgedrungen half auch ein Sandwich bei Subway, eine Portion Spagetti oder Pizza vom Pizza Hut den Magen zu beruhigen.
Auf der gesamten Reise mit dem Greyhound habe ich zwei Einladungen zum Übernachten angenommen, die erste kam von einer sehr freundlichen älteren Lady. Lisa, die vor 60 Jahren aus England eingewandert war, hatte offensichtlich keine Angst sich einen Dieb oder Mörder ins Haus zu holen, ganz offenkundig war sie von mir angetan. Mit einem vorbestellten privaten Kleinbus wurden wir vom Busbahnhof abgeholt, um nach einer langen Fahrt an ihrem hölzernen Haus abgesetzt zu werden. Unmittelbar nach der Ankunft bat mich Lisa den Rasen zu mähen, die Gastfreundschaft war also nicht umsonst. Eigentlich war ich hundemüde, konnte aber aus Höflichkeit nicht nein sagen, auch weil ein Essen angekündigt war. Das Essen bestand dann aus einer Fertigsuppe mit Wursteinlage. Das kleine Haus hatte drei Zimmer. In dem mir zugewiesenen Gästezimmer war aber zugleich der Schlafplatz ihres alten, großen fetten Hundes mit struppigem und verfilztem Fell. Ich ignorierte die Gedanken an Hundeflöhe und Milben. Lisa meinte, sie wisse nicht ob mich der Hund im Zimmer akzeptieren würde. Es war dann aber kein Problem für den Hund. Der Hund hatte eine wunde Pfote, und sie beklagte sich der Hund würde die Salbe sofort immer wieder ablecken. Ein Verband war aus meiner Sicht erforderlich, und ich bat Lisa um einen Fetzen Stoff, den sie aber nicht hatte. Schließlich fand sich doch noch etwas, nämlich ein altes Küchentuch aus dem ich Streifen riß und den Hund verband. Möglicherweise war der Hund ob meiner Fürsorge so angetan, daß er mich in seinem Zimmer akzeptierte und am nächsten Morgen die Pfote mit dem losen Verband erneut hinstreckte. Das Frühstück bestand aus Cornflakes mit Milch und popover, als Zugabe wurde mir ein Spiegelei mit Speck angeboten. Leider hatte die betagte Lady, vermutlich aus Sparsamkeit, die Angewohnheit das beim Braten des Specks ausgetretene Fett in einem kleinen Napf zu sammeln, um es wieder zu verwerten. Somit war mein Spiegelei mit dieser uralten und möglicherweise schon ranzigen Mischung aus Altfett zubereitet. Der Hund bekam eine Art Wiener Wurst, es war die mir bekannte Wursteinlage der Suppe. Den Gedanken an billige Hundewurst in der Suppe verdrängte ich schnellstens wieder. Das ganze Haus war völlig verdreckt und ich war froh am nächsten Tag wieder gehen zu können.
Die zweite Übernachtung, die ich angenommen hatte, kam von Peggy, diesmal einer etwas jüngeren Dame mit der ich mich während der Busfahrt angeregt unterhalten hatte. Bei der Ankunft stellte sich heraus, daß sie kein Gästezimmer hatte. Im Wohnzimmer hatte sie eine nackte Luftmatratze deponiert, die sie mir anbot. Zur nackten Matratze gab es ein dünnes Leintuch, vermutlich war es als Zudecke gedacht, dafür habe ich es dann auch benutzt. Ich habe nicht erfahren, ob Peggy der Meinung war, wenn es mich friert könnte ich unter ihre Decke kommen, versucht habe ich es jedenfalls nicht. Mir war die warme Dusche am Abend am Wichtigsten gewesen.
Der eine oder andere erkundigte sich nach meinem Woher und Wohin. Die Floskel „You‘re a long way from home, aren‘t you?“ – Du bist weit weg von zu Hause, nicht war?“ konnte ich schon nicht mehr hören; sie hatte stets den gleichen Tonfall, in dem sich Mitleid, Bewunderung und Mißtrauen mischten. Einer als er erfuhr, daß ich aus Deutschland komme und der selbst einen deutschen Namen hatte, drängte mir seine Adresse und Telefonnummer auf; er lud mich natürlich ein, ihn zu besuchen. Ich hatte inzwischen gelernt, die Einladungen nicht mehr so ernst zu nehmen, um mir weitere peinliche Erfahrungen oder Enttäuschungen zu ersparen.
Selbst die Einladung von jenem frommen Pastorenpaar nahm ich nicht an, bei dem ich einige Tage hätte wohnen können, um wie angekündigt mit ihnen zu beten und zu essen. Da habe ich lieber in einem der zahlreichen und billigen Motels genächtigt.
Frühstücken kann man in einem der meist nahegelegenen Coffee-Shops, in Sitzecken mit abgenutzten hochlehnigen Plastiksesseln, meist in roter Farbe. Dort steigt jedem der unvergleichliche Geruch von Pancakes und Rühreier mit Speck sofort in die Nase, ein Geruch auf den der echte Amerikaner jeden Morgen aufs Neue süchtig ist und deshalb nicht darauf verzichten will. Richtig zubereitet ist der Speck immer herrlich kross gebraten, daß er im Mund sofort zu Krümmeln zerspringt. Ergänzt wird das tägliche kalorienhaltige „Bauernfrühstück“ mit einem Schlag fettiger Bratkartoffeln, in der Version von kleingewürfelten Kartoffeln „Hash Browns“ genannt. Oder dem „French Toast“, das sind in Ei gewendete (panierte) Weißbrotscheiben. Zum Abschluß des Frühstücks darf auch hier etwas Süßes nicht fehlen.
Nach dem ersten Reinfall in einem Motel, welches eher eine Obdachlosenunterkunft als einem Hotelzimmer glich, wird man vorsichtig und besichtigt vor der gewünschten Vorauszahlung zuerst das angebotene Zimmer. Ein untrügliches negatives Anzeichen ist immer, wenn noch alle Schlüßel am Schlüßelbrett hängen. Motels sind nicht immer ihr Geld wert. Mit lauerndem Blick werden sie den Naiven und Doofen auch gerne zum überhöhten Preis angeboten. Entweder man handelt den Preis herunter oder man geht. Eines der miesen Zimmer, in einem der gesichtslosen Motels, hatte zur Begrüßung eine Zimmertüre die klemmte. Der Spalt unter der Türe war riesig, vielleicht zur besseren Belüftung oder damit die Mäuse und Kakerlaken verschwinden konnten, wenn es nichts mehr zu fressen gab. Die Bettdecke hatte Löcher und war nicht sauber, möglicherweise wurde sie nie richtig gewaschen. Auf einer Wandkonsole war ein uralter Fernseher mit auffallend großen Schrauben diebstahlsicher befestigt. Der „Duft“ beim Eintreten war trotz Türspalt geradezu umwerfend. Als ich den Zimmerschlüßel wieder zurückgab, war die Lady an der Theke nicht einmal verwundert und gab mir eine Empfehlung für ein nahegelegenes, und wie sie betonte, teureres Motel. Vielleicht lebte sie in der Hoffnung ich würde schon zurückkehren, wenn mir der Preis zu hoch ist.
In einigen Motels gibt es Bewohnerinnen, die ziehen die Vorhänge an den ebenerdigen Fenstern nicht zu und liegen lasziv und spärlich bekleidet auf dem sparsam beleuchteten Bett, der Grund ist offenkundig, wenn auch wahrscheinlich nicht gerade jeder willkommen ist.
Etliche dieser Motels sind in der Regel jedoch einigermaßen sauber und komfortabel. Je nach Preis ist die Einrichtung aber spartanisch, ein Fernseher fehlt eigentlich nie. Häufig gibt es sogar einen, wenn auch nicht gerade hygienisch anmutenden, Pool auf dem Grundstück. In einem dieser Motels verbrachten die Gäste offensichtlich ihr „Dirty Weekend“. Lüftungs- und Heizungsschächte übertrugen unüberhörbare Geräusche und Gesprächsfetzen. Ein Sprachkurs der besonderen Art, wenn die Damen von den Herren Anweisungen zu diversen Praktiken erhielten. Auch frei nach den kecken Zeilen von Evelyn Kühnnecke: „Allerdings/ sprach die Sphinx/ dreh das Dings/ mehr nach links/: und da gings“.
Eine der realistischen Anweisungen, zugleich jugendfrei: die Dame wurde aufgefordert während der Aktion mit dem Reden nicht aufzuhören. Der Freier sagte unentwegt: „Keep on talking, keep on talking!“. Die Ärmste durfte mit dem Reden nicht aufhören, möglicherweise war ihm das Ganze dann nicht mehr peinlich oder er wollte sie davon abhalten den programmgemäß üblichen lautstarken Orgasmus vorzutäuschen. Das nächste Mal werde ich, auch wenn es mitten in der Nacht ist, den Fernseher einschalten und mich notgedrungen von den Werbesendungen, den „commercials“, berieseln lassen. Die Botschaften dieser Sendungen sind immer die Gleichen, man möge dieses oder jenes Produkt kaufen und somit sparen, ob es nun ein neues Schmuckstück oder eine bestimmte Großpackung Cornflakes ist. Der Preis wird zur Nebensache, greifen sie zum Telefonhörer und bestellen sie jetzt „right now“, es kostet sie nichts, alles wird abgebucht, sie müssen nur ihre Kreditkartennummer nennen.
Eine Dusche gibt es in den Motels immer. Ist es einmal eine Badewanne hat diese so niedrige Seitenteile, daß würde man sie vollaufen lassen und sich hineinlegen, nur der Rücken und die Füße naß wären. Offenkundig sind diese „Badewannen“ nicht für Vollbäder gedacht. Ein Unding sind auch die an manchen Waschbecken angebrachten Wasserhähne für Kalt- und Heißwasser. Entweder kann man sich die Hände, oder was auch immer, kalt oder wahlweise heiß waschen.
Das Zimmer ist immer im Voraus zu bezahlen. Natürlich mit Kreditkarte. Das überaus freundliche Gesicht der Empfangsdame an der Theke friert geradezu ein, wenn man bar bezahlen will. Die in Europa normal erscheinende Zahlungsform ist dort suspekt. Bargeld ist scheinbar wie ein Stigma das Bankrott signalisiert. Wenn man keine Kreditkarte hat, gehört man zu jenen denen niemand mehr Kredit gewährt.Vielleicht denken sie auch das Bargeld komme aus Drogenhandel, Prostitution oder Diebstahl. Kurz gesagt; man ist nicht respektabel. Der Besitz einer Kreditkarte ist der Nachweis, daß man dem Volk der (verschuldeten) Durchschnittsamerikaner angehört. Für den Besitzer selbst mag es die Illusion nähren, gewissermaßen selbst nach belieben Geld erzeugen zu können. Das ist ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Kreditkarten.
Eine Kreditkarte muß man sich übrigens aus Europa mitbringen, denn Ausländer, die weder Wohnsitz noch Bankkonto oder Einkommen in den USA haben, erhalten dort keine Kreditkarte.
Ganz zum Schluß begegnete ich noch Hazel, die meinte sie habe einen besonderen Zugang zu den Engeln im Himmel. Nach der Encyclopedia of Witchkraft glauben 78 % der Amerikaner an die Existenz von Engeln und 70 % an die Existenz des Teufels. Um zu überprüfen, ob bei mir alles in Ordnung sei, legte sie eine ihrer Hände auf meinen Kopf und erhob für kurze Zeit die andere Hand mit der freien Handfläche gegen den Himmel, nuschelte gebetsartige Sätze und sah mir mit rätselhafter Zuversicht und Kraft in die Augen. Die Prüfung bei ihren Engeln ergab, daß bei mir alles in Ordnung sei. Am Ende schloß sie ihre Überprüfung mit dem häufig in den USA verwendeten Satz: „God bless you“. Und dann gab es noch eine Frau, die plötzlich lauthals „Major Tom“ von David Bowie sang, das Poplied einer Weltraum-Odyssee. Pioniergeist und ein kindliches Gemüt schließen einander offenbar nicht aus. Schließlich und endlich unter strikter Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 55 mph, ging es mehrspurig der Metropole zu, vorbei an den Standplätzen der Autohändler mit ihren bunten und glitzernden Girlanden aus Aluminiumfolie, allen voran den Chevy-Händlern. Flüchtig nahm man die Botschaften der Weltunternehmen wahr, allein die Größe der Plakate und ihr Gedränge am Straßenrand ließ ahnen, daß es Getränkehersteller, Tabakunternehmen, Autohersteller und andere Begleiter des amerikanischen Lebens ernst meinten. Endlich erreichte der Bus die City von New York, stolz und groß angekündigt vom amerikanischen Busfahrer mit den glücksversprechenden Worten: „Here we are in NY-City; ladies and gentlemen your dreams come true.“ – Wir sind in NY angekommen; meine Damen und Herren, ihre Träume werden war.
Ich grüße mein New York
New York, faszinierender Moloch der Straßenschluchten, wie ich es kennengelernt habe, ist laut, grell und oberflächlich. Alles Eigenschaften, die ich eigentlich zutiefst ablehne, denn ich bin in Europa zuhause und liebe Deutschland. Aber das wird erst wirklich bewußt, wenn man eine Weile weg war. In den USA lernen die Kinder ein etwas vollmundiges Lied, es heißt: „America the Beautiful“ – Amerika die Schöne. Der Text dieses kitschigen Liedes enthält die romantische Zeile: „Deine Alabasterstädte schimmern ungetrübt von Menschentränen“. In NY kommt einem dies reichlich übertrieben und geradezu abwegig vor, dies gilt auch für die allermeisten Großstädte in den USA. Der Verfasser der Zeilen muß wohl irgendwo auf dem Lande gelebt haben und seine Sinne an zu vielen Sonnenuntergängen berauscht haben. Von amerikanischen Großstädten, insbesondere von NY hatte der gewiß nicht die geringste Ahnung.
Auch ohne Romantik gewöhnt man sich überraschend schnell an NY. Nach einigen Tagen oder Besuchen werden die eigentlich abweisenden Dimensionen fast so vertraut wie ein Dorf in Bayern. Logiert man einige Zeit in Manhattan, hat man schnell gelernt, die allgegenwärtige Hektik hinzunehmen, andere Alternativen wären, sich anstecken zu lassen oder schnell wieder zu verschwinden. Schwer ist es Menschen anzusprechen und nach dem Weg zu fragen, denn jeder denkt er würde angebettelt oder beklaut werden. Besser ist es in einigen anderen Stadtbezirken, jeder von ihnen ist aber selbst eine Millionenstadt.
Große Teile der Stadt haben keine Straßennamen. An den Straßenecken in NY-City sind, für Europäer gewöhnungsbedürftig, die Straßen nummeriert mit dem Zusatz einer Himmelsrichtung, dies erinnert ein wenig an die Seefahrt. Tatsächlich ist es anfänglich ungemein hilfreich zu wissen wo die Sonne auf- und untergeht, um sich zu Fuß oder mit der Untergrundbahn in die richtige Richtung zu bewegen. Schwierig wird es nur um die Mittagszeit, wenn die Sonne im Zenit steht. Bei den U-Bahn-Eingängen ist dies nicht weiter schlimm, aber ein fremder U-Bahn-Ausgang kann die Vorstellung von der Stadtgeografie ziemlich schnell durcheinanderbringen. Als Unterkunft hatte ich mir wieder einmal die Young Men‘s Christian Association, besser bekannt als YMCA, an der 34th Street, ausgesucht. Bestimmt würde man mir wieder ein Zimmer in einer der höchsten Etagen anbieten, dort wo die Luft angeblich besser ist. In einem Brandfall hätte ich Bedenken, weil es mit Sicherheit schwieriger ist aus den oberen Etagen zu flüchten als aus den unteren. Seit dem 11. September 2001 muß man all seine Redekunst aufwenden, um ein Zimmer auf einem der unteren Stockwerke zu erhalten, denn auch andere haben ähnliche Gedanken. Bei der Wahl des Hotels sollte man wissen, daß es nicht nur gute und schlechte, sondern bessere und schlechtere Hotels gibt. Wer wenig ausgeben will, darf nicht zu viel erwarten. Auch wird eine liberale Haltung auf die Probe gestellt, wenn man in einem billigen Hotel zwar zentral logiert, es aber Tür an Tür mit Prostituierten, arbeitsscheuen Kleinkriminellen oder im noch schlimmeren Fall mit Junkies, denen jede Beute recht ist, oder mit Bettwanzen – Bedbugs teilen muß. Dieses Wanzenproblem möge man daran erkennen, daß im NY Fernsehen ständig Reklamespots von Kammerjägern ausgestrahlt werden. Eine Bekannte erzählte mir, sie habe sich nicht mehr ins Bett getraut und deshalb in der Badewanne übernachtet.
Es gibt bessere, fantastische und berühmtere Hotels als das YMCA, wenn man das nötige Kleingeld hat oder wie meine amerikanischen Freunde, die Hotelrechnung sorglos, wie Gummischlangenvertreter, mit Mindestzahlungen über die Kreditkarte abstottert. Die Schuldensucht in den USA ist unausrottbar. „IN GOD WE TRUST“ – Wir vertrauen auf Gott – steht auf jedem Geldschein. Eines dieser alt bekannten und berühmten Hotels ist „Das Chelsea“. Arthur Miller zog nach seiner Scheidung von Marilyn Monroe in „Das Chelsea“. In den 60er Jahren residierten Bob Dylan und auch Jimmy Hendrix in diesem New Yorker Edelhotel. Das Hotel ist heute noch der Treffpunkt skurriler, launischer und berühmter Künstler mit sprühendem Einfallsreichtum, auch der Verpackungskünstler Christo residierte dort, bis er sich einen festen Wohnsitz in NY einrichtete.
„Das Chelsea“, nur um einen dieser berühmten alten Kästen, stellvertretend für zahlreiche andere, zu erwähnen.
Die fiebrige Metropole, die niemals schläft, scheint mir noch schmutziger, noch lärmender, noch hektischer zu sein als bei meinem letzten Besuch. Jeder stöhnt über die horrenden Hotel- und Mietpreise und jetzt wohnen die Freunde und Bekannten nicht mehr à tout prix in Manhattan, dem Ort der wahr gewordenen Architektenträume, eher im schicken New Yorker Szene Bezirk Soho oder drüben in Brooklyn, auch dort ist es mittlerweile in einigen Ekken recht teuer. Kein Mensch will mehr freiwillig zwischen den fürchterlichen Türmen wohnen, umringt von abertausend Fenstern, die sich niemals öffnen, eingekesselt von unzähligen Büros, die Nachts verlassen und schweigend gähnen, die so still sind wie Gräber, denen die Scheintoten entlaufen sind. Man wohnt noch billiger im Stadtbezirk Queens, dem großen Schlafzimmer New Yorks, zwischen ethnischer Vielfalt in einem Apartmenthaus oder bevorzugt in einem der alten Häuser. Vielen Häusern ist noch anzusehen, daß sie einmal gute und noble Bürgerhäuser gewesen sind. Vernünftige Wohnungen werden unter der Hand vermittelt, oft an Freunde weitergereicht. Die Hausmeister kennen alle Tricks um Rassenprobleme zu vermeiden, so daß die Weißen unter sich bleiben können.
In einigen besseren Wohngegenden z. Bsp. an der feinen Upper East Side Manhattans bilden die Wohnungseigentümer eine sog. Coop, diese entscheidet über das Coop-Board, an wen die einzelne Wohnung vermietet wird. Die Bewerber werden zu einem einstündigen Gespräch eingeladen und müssen umfassende Auskünfte über ihre Person geben. Es geht dabei um Nachweise über das Einkommen, einschließlich dem letzten Steuerbescheid, und schriftlicher Referenz vom vorigen Vermieter. Mit den Auskünften soll dafür gesorgt werden, daß es sich bei dem neuen Mieter, dem man im Fahrstuhl begegnet, um einen angenehmen Zeitgenossen handelt oder daß er jedenfalls immer freundlich grüßt. Manchen Boards kommt es, natürlich unausgesprochen, darauf an, daß der Neue in der rassistischen Hausgemeinschaft die richtige Hautfarbe hat. Es finden sich Leute mit etwa gleichem Einkommen zusammen, die mit Leuten geringeren Einkommens nicht verkehren wollen und mit solchen noch höheren Einkommens noch nicht verkehren können, so sehr sie auch danach streben, dies zu tun. Das Haus und das Stadtviertel, in dem es steht, haben also im hohen Maße den Charakter einer jeweils bestimmten Bevölkerungsklasse. Das gleiche gilt für die bevorzugte Automarke. Wenn man darauf achtet, kann man von den Autos zuverlässig auf das durchschnittliche Einkommen der Bewohner schließen.
Die, die in einer besseren Wohngegend nicht so viel Einkommen haben, wohnen im Keller. 1500 $ Miete für eine Kellerwohnung, richtig im Keller mit Kellerabgang und Kellerfenstern, ist keine Seltenheit. Der einzige Trost ist, es ist voll möbliert. Alles was man braucht ist das Geld für die Miete. Noch teurer sind Apartments, meist im Miniformat und größtenteils ohne Balkon, die Fenster können nicht geöffnet werden. Es soll auch innen liegende Apartments geben, die statt Fenster nur einen Entlüftungskanal haben. Diese kleinen Apartments sind öfters ohne Küche, wohlgemerkt nicht ohne Küchenmöbel, sondern gänzlich ohne Küche. Im Fast-Food-Land ist eine Küche nicht unbedingt notwendig. Man kann sich auf dem Weg nach Hause einfach eine Pizza kaufen, oder in einem durchaus ehrenwerten Coffee Shop preiswert eine hastige Mahlzeit einnehmen. Es soll 24 000 Restaurants geben, wo alle Menüs dieser Welt zubereitet werden. Daneben gibt es schätzungsweise ein paar tausend Garküchen, mobile Eßstände und Food-Trucks. Man hat den Eindruck, daß in NY den ganzen Tag in der Öffentlichkeit gegessen wird, auf der Straße und in der U-Bahn, selbst bei Vorträgen, Konferenzen und sogar Gottesdiensten wird etwas zum Essen serviert.
Üblicherweise trifft man sich mit seinen Freunden statt im winzigen Apartment, im Bistro auf ein Glas Bier und eventuell zu des Amerikaners großer Liebe, einem kräftigen außen verkohlten und innen rohen Steak, für einen Teller Pasta am besten beim Pronto-Pronto Italiener, bei dem es menschlich und lautlich so anheimelnd zugeht oder an der japanischen Sushi Theke zum Running Sushi. Eine umfangreiche Speisekarte bringt in den USA so manchen Gast oder seine neue unbedarfte amerikanische Flamme an die Grenzen der Entscheidungsfähigkeit, deshalb sind One Meal Restaurants, in denen nur ein einziges Gericht auf der Karte steht, weit verbreitet. Dort gibt es dann nur eine Sorte Steak mit Pommes und außer Getränken sonst nichts.
Besonders beliebt und häufig findet man auch Angebote für brunch. Sonntags bevölkern zahlreiche New Yorker die Cafés zu ihrem gewohnten Sonntagsbrunch. Dort gibt es auch die allzeit beliebten Bagels und fette pappsüße Doughnuts – fettgebackene Kringel, in allen Variationen. Einige erfreuen sich wie jeden Tag an einem gewaltigen Omelett, wird es für drei Personen zubereitet werden dafür 20 Eier aufgeschlagen.
Eine richtige Eßkultur, mit gemütlichem Beisammensein, einer Flasche Wein und langen Gesprächen am Tisch, kann das Schnellrestaurant sicherlich nicht ersetzen. Die Gespräche sind sehr häufig nur anspruchslose endlose Monologe, selbst das freimütige Geständnis man habe alles vergessen, was man einmal in der Schule gelernt habe, ist nicht ausgeschlossen. Nicht selten sind es Selbstdarstellungen was jemanden mag und gern hat und was nicht. I don‘t like this and I don‘t like that. Oder Klagen über das alltägliche Leben und großspurige Lebensrenovierungspläne. Was sie bewegt ist der Ernst ihres Lebens, das teure tägliche Essen und Klagen über Dinge, die man sich mangels des nötigen Geldes nicht kaufen kann, z.Bsp. eine Pistole! Sie meinen, sie könnten ihre Familie nicht beschützen, wenn sie keine Waffe haben.
Jene die an Deutschland interessiert sind aber selten Gelegenheit haben, deutsche Gesprächspartner zu examinieren und Informationen zu erhalten, stellen Fragen, die schnell den Charakter eines Verhörs annehmen. Fragen aus denen man nicht überhören kann, daß sie nicht gerade besonderes Verständnis oder gar Wohlwollen für deutsche Verhältnisse haben. In einem Gespräch wurde meine Erläuterung der deutschen Sozialgesetze insbesondere der Regelungen in der Krankenversicherung, in die jeder Arbeitnehmer einzahlt, sofort als kommunistisch und unamerikanisch heftig und erregt heruntergebügelt, daß ich mir wie ein armer unwissender Sünder vorkam. Es war schon klar, mein Gegenüber war ein strammer Republikaner. Als Gast hielt ich mich mit der gebotenen Höflichkeit zurück, die mein Gegenüber vermissen ließ. Ich bemühte mich die weiteren Fragen, trotz der offensichtlichen Mißgunst, und ohne daß ich ihn vorsätzlich provozierte, zu beantworten. Als der Herr zu einer Vorlesung über A.H. und den 2.Weltkrieg aus seiner Sicht ansetzte, wäre ich liebsten aufgestanden und gegangenen, leider fiel mir keine passende Ausrede ein. Der Vortrag endete schließlich mit einer Beweihräucherung der großartigen militärischen Taten der Amerikaner in Deutschland, besonders wie die Deutschen von den US-Boys „aus dem Himmel herausgeschossen“ wurden. Jener Amerikaner war sehr von seiner Sachkenntnis überzeugt, wahrscheinlich auch wenig gewohnt, Widerspruch zu erfahren, daß er mit der keineswegs seltenen amerikanischen Naivität annahm, ich müßte wie selbstverständlich seine Auffassung teilen.
US-Amerikaner vergleichen und bewerten gerne. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn sie sich nicht unbeirrbar eingebildet auch noch für das Maß aller Dinge und die Größten in der Welt hielten. Sie sind lüstern und verfressen und rennen ständig dem Geld hinterher. Ein kluger Indianer sagte dazu: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluß vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, daß man Geld nicht essen kann“. Es wurde schon behauptet, das einzige aktive Interesse in Amerika sei die Anbetung des Geldes und die Liebe zum Geld sei das Haupt- oder Nebenmotiv, dem alles was sie tun zugrunde liegt. Jeder Versuch einer Diskussion zu diesem Thema ist, um mit Emanuel Kant zu sprechen, a priori, so sinnlos wie beim Melken der Ziege ein Sieb darunter zu halten. Sajjid Kutb, ein intellektueller Ägypter, besuchte 1948 als Bildungsbürger Amerika. Nach seiner Rückkehr schrieb er, die Vereinigten Staaten wären ein einziges Sodom und Gomorrha, bewohnt von sittlich verwahrlosten und geistig entleerten Menschen, deren Lebenssinn sich im „Kult um den Dollar“ und im einsamen Rasenmähen erschöpft. Dieser Eindruck kann auch heute noch entstehen. Im Alltag geht es nur ums Geld. In der Arbeitswelt mehr denn je, bis zur Ausbeutung der anderen, wenn sie zum wirtschaftlichen Erfolg führt. Leute die viel Geld verdienen erkennt man bereits am Äußeren, sie leisten sich dann den besten Friseur und die teuersten und elegantesten Kleider. Die Herren der Schöpfung sind ab einem bestimmten Alter dazu meist fett, essen dicke Steaks und noch mehr Eiscreme mit Schlagsahne. An den Manieren fehlt es ihnen meist, denn die kann man sich nicht so einfach kaufen. Wenn immer es geht essen sie, statt mit Besteck, lieber mit den Fingern. Einige haben das Essen ohne Besteck geradezu zu einem Kult erklärt und betrachten das Essen einer Pizza mit Besteck als Faux pas und heben zu großem Geschrei an. Welch ein Sakrileg an einer stolzen Spezialität! Jene, die eine Pizza etc. mit Besteck essen sind in ihren Augen versnobte Banausen von denen man sich distanziert. Daran haben sich nach ihrer Meinung selbst Politiker zu halten, wenn sie gewählt werden wollen.