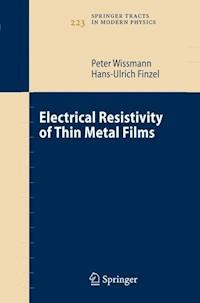Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mabuse-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In der autobiografischen Erzählung "Freunde" lebt der eine mit der Diagnose Alzheimer, der andere beschäftigt sich beruflich mit Altersfragen. Die beiden Männer tun sich für ein Buchprojekt zusammen und wollen die Welt ein wenig "aufmischen". Als die geistigen Fähigkeiten des einen immer mehr nachlassen, nimmt ein gemeinsamer Ausflug eine unerwartete Wendung und stellt die Beziehung der beiden Männer auf eine harte Probe. "Der Stempel" erzählt von der 13-jährigen Mila. Ihr Leben ändert sich von einem auf den anderen Tag, als die Demenzdiagnose ihrer Mutter einen Sorgerechtsstreit auslöst. Die Aussicht, aus ihrer Familie herausgerissen zu werden, veranlasst Mila zu einem riskanten Schritt. Zwei berührende Erzählungen über die Schatten, die Demenz auf Beziehungen werfen kann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Überschattet
Peter Wißmann, geb. 1956, Sozialpädagoge, hat ein Prosastudium sowie weitere Ausbildungsseminare an der Autorenschule Textmanufaktur absolviert. Bisher ist er als Autor von Sachbüchern (Alter), Essays und Haiku-Bänden in Erscheinung getreten. „Überschattet“ ist sein Debüt als Autor literarischer Prosa.
Peter Wißmann
ÜBERSCHATTET
Erzählungen über Demenz
Inhalt
Freunde
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Der Stempel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0
Ein gut gefüllter Raum in der Stadtbibliothek. Glaubenssätze. Mein Vortragsthema an diesem Abend. Wie man negative Glaubenssätze überwinden, sein Leben in eine gute Richtung verändern kann. Ich mag das Thema. Baue viele Beispiele in den Vortrag ein, von Menschen, die ich kenne oder kannte.
So auch von Christian. Als es notwendig wurde, hat er seine hinderlichen Glaubenssätze aufgespürt und sie überwunden.
Das Publikum an diesem Abend ist bunt gemischt, quer durch alle Altersgruppen. Viele Frauen, kaum Männer.
Ich nehme einen Schluck aus dem Wasserglas, setze es auf dem Rednerpult ab, werfe ein Lächeln ins Publikum.
So weit also, sage ich. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
Applaus, die Leiterin der Bibliothek kommt mit schlurfenden Schritten zu mir nach vorne. Sie bittet um Wortmeldungen. Verlegenes Schweigen, dann gehen die ersten Finger in die Höhe.
Sie haben mehrfach von einem Christian gesprochen, sagt eine junge Frau mit blau gefärbtem Haar. Wer ist dieser Christian?
Ich zögere einen kurzen Moment.
Er war wahrscheinlich mein Freund.
1
Kennengelernt habe ich Christian in seiner Heimatstadt. Und das war kein Zufall: Ein kurzer Artikel im Internet über ihn hatte mein Interesse geweckt. Als Experte für Altersfragen hatte ich bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Nun stand ein neues, ein neuartiges Buchprojekt an, für das ich Christian gewinnen wollte. Per E-Mail hatten wir uns für diesen Vormittag in einer Klinik verabredet. Christian war dort zu einer Veranstaltung eingeladen. Ein Arzt würde mit ihm über sein Leben mit der Diagnose Alzheimer sprechen. Vor Publikum.
Schön, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.
Ich streckte dem Mann die Hand entgegen. Er schüttelte sie sekundenlang.
Grüß Gott, sagte er mit bayerischem Akzent. Auf seinem Gesicht erschien ein verschmitztes Lächeln. Ich hab ja genug Zeit, also was soll’s. Wollen wir uns duzen?
Das war also Christian. Ein Architektentyp, dachte ich. Oder ein Künstler. Gekleidet in Schwarz, vom Rollkragen des Pullovers bis zu den Lederschuhen. Kurz geschorenes Silberhaar und ein Dreitagebart. Dazu eine Brille mit Silbergestell und randlosen Rundgläsern.
Er lachte, als ich ihm später das mit dem Architektentypen sagte.
Ein einfacher Handwerker bin ich, antwortete er. War ich, korrigierte er sich schnell.
In der Eingangshalle der Klinik ging es lebhaft zu. Durch die selbstöffnende Glastür schoben sich in beide Richtungen Menschen, ihre Stimmen vermischten sich zu einer raumfüllenden Klangwolke.
Wir beschlossen, uns eine ruhige Ecke zum Reden zu suchen.
Darf ich mich mit dem Herrn zurückziehen, fragte Christian und blickte lächelnd zu einer Frau hinter ihm.
Ich bitte Sie, Sie sind doch ein freier Mann, sagte sie.
Die Frau war mir vorher nicht aufgefallen. Noch jung, vermutlich Anfang dreißig, die braunen Haare zu einem dicken Zopf geknotet.
Meine Aufpasserin, sagte Christian.
Seine Begleiterin, sagte die Frau, sie stellte sich als Mitarbeiterin eines Begleitdienstes vor. Sie hatte Christian zu Hause abgeholt, hierhin begleitet und würde ihn später wieder nach Hause zurückbringen.
Wie der Auftritt mit dem Arzt gelaufen war, wollte ich wissen.
Hat alles geklappt, sagte die Frau. Christian sei erstaunlich locker gewesen und habe alle Fragen offen beantwortet.
Wir haben nur ein wenig geratscht. Wenn’s für den Doktor doch eine Gaudi ist, sagte Christian.
Bevor ich mit Christian aufbrach, vereinbarte ich mit seiner Begleiterin, dass wir in einer Stunde wieder da sein würden, genau dort, wo wir gerade zu dritt standen.
Auch wenn’s mir schwerfällt, mich von Ihnen zu trennen, sagte Christian und zwinkerte der Frau zu, die Pflicht ruft.
Der Winter hatte uns in den letzten Wochen mit eisiger Hand regiert, heute war der erste warme und sonnige Tag seit Langem. Auf dem Vorplatz der Klinik wirkte Christian erleichtert, er atmete tief durch. Ich nickte ihm lächelnd zu.
Krankenhäuser sind Krankenhäuser. Kein Ort, um sich länger als nötig aufzuhalten.
Ich schlug den Weg ein, der von der Klinik hinunter zum Fluss führte, und schwang mich auf die warme Ufermauer. Christian tat es mir gleich.
Erst mal etwas Wärme tanken, sagte ich und streckte mein Gesicht der Sonne entgegen.
Christian nickte und zog seine Jacke aus.
Warum treffen wir uns eigentlich, fragte er mit einem verlegenen Lächeln auf den Lippen.
Ich musste lachen. Machte er Witze? Nein, sagte er, er wisse es wirklich nicht mehr. Sicher hätte ihm jemand den Grund gesagt, aber ...
Ich erzählte ihm von meinem Projekt. Ein Buch, in dem nur Menschen zu Wort kommen sollten, die mit einer bestimmten Behinderung leben. So wie er.
Du meinst: Behinderung im Kopf? Im Gehirn?
Ich nickte.
Hast du auch Ärzte gefragt?
Ich verneinte. Nur Leute, die es aus eigener Erfahrung kennen, kommen da rein, sagte ich.
Das schien Christian zu gefallen, er wiegte den Kopf hin und her und begann, ein Lied zu pfeifen.
Hast du schon viele, die mitmachen?
Bisher nur dich.
Was weißt du über mich? Wieder begann Christian zu pfeifen. Dass bei dir Alzheimer diagnostiziert wurde. Dass du bereit bist, darüber zu sprechen.
Eine junge Frau mit einem Kind an der Hand ging vorbei. Christian zwinkerte dem Mädchen zu und machte mit seinen Händen Hasenohren. Das Mädchen lachte.
Aha, sagte er. Das weißt du also. Und auch, dass ich weder Architekt noch Künstler bin.
Sondern Handwerker.
Stimmt. Ein Handwerker, der mit seinen Händen nichts mehr richtig hinbekommt. Weder mit den Händen noch mit dem Kopf.
Er blickte hinunter auf den Fluss, dessen Oberfläche im Sonnenlicht glitzerte.
Ich habe sogar einen Handwerksbetrieb gegründet. Zusammen mit meiner Frau. Vielleicht zeige ich ihn dir, wenn du mich besuchst.
Wenn ich dich besuche. Heißt das, du bist dabei? Bei meinem Projekt?
Christian zog künstlich die Augenbrauen hoch. Die Ironie in seinem Gesicht war nicht zu übersehen.
Ja, klar. Du hast es also endlich kapiert.
Wir sollten in den nächsten Jahren noch oft zusammen lachen. Ich mochte diesen Mann.
Was hast du vorhin gepfiffen?
Hast du keine Ahnung von Musik? Pink Floyd.
Doch, doch. The Wall. Hatte ich mal. Als LP, meine ich.
Christian war nur ein paar Jahre älter als ich.
In der Klinik erwartete uns die junge Frau schon an der Eingangstür. Wir hatten uns verspätet. Sie wolle nicht hetzen, sagte sie. Aber zu Hause würde Christian sicher schon erwartet werden.
Von Christa, meiner Frau, sagte Christian.
Wir verabschiedeten uns und Christian machte sich mit seiner Begleiterin auf den Heimweg. Bevor sie durch die Eingangstür der Klinik verschwanden, drehte er sich noch einmal zu mir um.
Es gibt noch viel zu tun, sagte er und zwinkerte mir zu. Sein linker Zeigefinger zeigte nach oben.
Ich wollte mir noch eine kleine Pause am Flussufer gönnen und dann mit dem Bus zum Bahnhof fahren. Die Sonne hatte noch nichts von ihrer Kraft verloren.
Im Gepäck hatte ich Christians Telefonnummer und das Versprechen, mich bald bei ihm zu melden.
Ich besuchte ihn einige Wochen später. Einen Vormittag und einen Nachmittag lang unterhielten wir uns. Zuerst schlürften wir am wuchtigen Küchentisch in rauen Mengen Tee. Dann machten wir einen langen Spaziergang. Christian zeigte mir die Läden, in denen er einkaufte, erwiderte die Grüße, die ihm hier und da im Vorbeigehen zugerufen wurden.
Seinen bayerischen Dialekt zu verstehen, bereitete mir kaum Schwierigkeiten. Größere sprachliche Einschränkungen sollten für ihn erst im Laufe der Zeit zum Problem werden.
Die Diagnose Alzheimer haben mir die meisten Leute erst einmal nicht geglaubt, sagte er.
Denn wer sah schon, dass er beim Bäcker vergaß, die Brötchen zu bezahlen. An einfachen Rechenaufgaben scheiterte. Sich nicht mehr an Verabredungen mit Freunden erinnern konnte. Und ohne Begleitung den Weg zu der Veranstaltung in der Klinik nicht gefunden hätte.
Was willst du machen, fragte ich ihn.
Mich nicht hängen lassen, antwortete er.
Zurück in der Wohnung setzte Christian wieder eine Kanne Jasmin Tee auf. Wir steckten die Köpfe zusammen und begannen, Ideen zu spinnen.
2
Ich stelle mir vor, wie Christian eines Morgens einen kleinen Raum in der oberen Etage einer Maisonettewohnung betritt. Von hier aus kann er über die Dächer der Nachbarhäuser schauen. In den Himmel, der um diese Zeit frühlingshaft blau leuchtet.
Vor meinem inneren Auge sehe ich einen schwarzen Tisch, der mit einer Plastikplane abgedeckt ist. Auf ihm liegen ordentlich aufgereiht Arbeitsmaterialien: Farbtuben, Pinsel, Fixierspray, Pigmente und eine Rolle Toilettenpapier. Ein Stillleben im Morgenlicht.
Christian reckte sich. In der Nacht war er mehrmals aus einem Traum aufgeschreckt. Seit der Diagnose plagten ihn immer wieder Albträume, oft konnte er tagsüber kaum die Augen offen halten.
Was soll ich heute malen, fragte er sich. Er war unsicher. In der Therapie hatte er angefangen zu malen, erst mit wenig Begeisterung, dann mit wachsender Lust. Im kleinen Atelier zu Hause hatte er seine Ruhe. Christa ging jeden Morgen früh aus dem Haus.
Sie kümmert sich um unseren Familienbetrieb, hatte Christian erzählt. Zusammen mit der Tochter. Früher sei das seine Aufgabe gewesen.
Christian blickte unschlüssig auf die Leinwand, die auf einem Keilrahmen vor ihm aufgespannt war. Er erhob sich von dem kleinen Drehhocker, goss sich die dritte Tasse Tee an diesem Morgen ein, öffnete das kleine Fenster in der Dachgaube und sah zwei gurrende Tauben auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses umherflattern.
An manchen Tagen verbrachte er den Vormittag an diesem Fenster, auch am Ateliertisch, ohne seine Arbeitsutensilien auch nur einmal anzurühren.
An diesem Morgen war es anders. Christian setzte sich wieder an den Tisch. Eine ungeschickte Handbewegung, die Teetasse kippte um, der Inhalt ergoss sich in einem Schwall über die Leinwand.
Kruzitürken, entfuhr es ihm. Ein hektisches Reiben mit einem Lappen begann, hin und her über die Leinwand. Als hätte ein Hund draufgeschissen, dachte Christian und hob die Hand, um die Leinwand vom Tisch zu fegen. Doch mitten in der Bewegung hielt er inne, ließ von der schmutzigen Leinwand ab. Mit grimmiger Miene öffnete er stattdessen einen Farbtopf. Schwarz. Alles sollte schwarz werden. Schwarz wie seine Wut, schwarz wie die Angst, die ihn in der Nacht aus dem Schlaf gerissen hatte. Mit dem Pinsel peitschte er die Farbe auf die Leinwand, die sich in ein pechschwarzes Rechteck verwandelte.
Warte, ich kriege dich. Christians Atem stockte. Seine Finger tauchten in den weißen Farbtopf, malten Kreise und Striche auf die Leinwand, verwischten sie zu hellen Flächen, unter und zwischen denen das Schwarz bedrohlich hervortrat.
Gleich hab ich dich, rief er laut.
Ich stelle mir vor, dass in diesem Moment in seiner Stimme Spott mitschwingt. Aus einer Tube quetschte er rote Farbe auf die Finger, auf die Innenfläche seiner rechten Hand, holte weit aus, schlug sie flach auf die Leinwand, zog mit den Fingern energisch Striche und Kreise.
Er starrte auf die Leinwand. Ich habe es tatsächlich geschafft, dachte er.
Ich stelle mir vor, wie er ungläubig auf die Hand schaut, die das getan hat.
Erschöpft, aber mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht stand er auf und verließ sein kleines Reich. Das neue Bild würdigte er keines Blickes.
Was hatte ihn an diesem frühlingshaften Vormittag in einen wahren Rauschzustand versetzt? Auf wen hatte er so wütend mit Pinsel und Farbe eingedroschen?
Bei einem meiner Besuche in Christians Wohnung lernte ich das Bild kennen. Aufgeregt hatte er mir am Telefon eine Überraschung angekündigt. Nun zog er das Bild aus einem Stapel an der Wohnzimmerwand.
Heilige Maria, das gefällt dir nicht, rief er. Er schien meinen Blick missverstanden zu haben. Es ging nicht um Gefallen oder Nichtgefallen. Vielleicht hatte er in meinem Gesicht einen Ausdruck des Entsetzens entdeckt, der mir selbst nicht bewusst war.
Das Bild war schrecklich. Vor einem pechschwarzen Hintergrund mit weißen und roten Farbschlieren leuchteten zwei Augen. Sie schienen zu einem Kopf zu gehören, einer Art Totenschädel, den man mehr erahnen als erkennen konnte. Ich fröstelte.
Was ist das, fragte ich, ohne den Blick von dem Bild zu wenden.
Mein Dämon, rief Christian und rieb sich die Hände. Darf ich vorstellen: Das ist Dr. Alzheimer. Der Typ, der mich in meinen Träumen verfolgt und mir Angst macht.
Der kann einem wirklich Angst machen.
Aber jetzt nicht mehr. Christian sagte es mit heiterer Stimme. Jetzt ist er gefangen, jetzt sitzt er fest. Er kann mir keine Angst mehr machen.
An diesem Frühlingsmorgen hatte Christian den Kampf aufgenommen. Gegen seinen Dämon. Mit Pinsel, Farbe, seinen Händen und einer gehörigen Portion Wut. Und am Ende hatte er gewonnen. Keinen vollständigen, keinen ewigen Sieg. Auch später klopfte die Angst immer wieder an die Tür. Die größte Angst: seiner Familie zur Last zu fallen. Wenn Christian davon sprach, legte sich ein Schatten auf sein Gesicht. Doch die Angst, mit der er es jetzt zu tun hatte, war nur noch ein schwacher Hauch der Angst, die ihn bis dahin geplagt hatte. Sein Dämon war auf die Leinwand gebannt. Oft schleppte er ihn ins Atelier, sprach mit ihm, scherzte mit ihm. Akzeptierte ihn als Begleiter seines neuen Lebens.
Und das lasse ich mir von Dr. Alzheimer nicht kaputtmachen, sagte Christian. Nicht nur, wenn sein schreckliches Bild in Ausstellungen gezeigt wurde.
3
Wieder einmal hatte mich mein Weg an Christians Küchentisch geführt. An Christians und Christas Küchentisch müsste es korrekterweise heißen. Aber meistens war Christians Frau bei unseren Treffen nicht dabei.
Soll ich dir meine Stadt zeigen?
Christian sah mich erwartungsvoll an und wippte ungeduldig mit dem Fuß. Unser Ratschen dauerte schon einige Stunden. Ratschen, so nannte Christian unsere Gespräche. Gespräche, die kein konkretes Ziel zu haben schienen, die in den Ohren eines zufälligen Zuhörers sprunghaft klingen mussten. Wie das Spiel eines Kindes, das in einem halb ausgetrockneten Bachbett von Stein zu Stein hüpft.
Jetzt stockte unser Redefluss. Christians Vorschlag kam wie gerufen.
Ich bin dabei, sagte ich und stand auf.
Ich ging gerne mit ihm durch seine Stadt. Ein reizvoller Gedanke: die mir noch weitgehend fremde Stadt durch den Filter von Christians Augen zu sehen. Christian lebte und bewegte sich seit vielen Jahren in ihr. In ihren Straßen und Parks, auf ihren Plätzen und Promenaden. Er lebte gerne hier, wie er immer wieder betonte. Was war ihm wichtig an dieser, seiner Stadt.
Eine Viertelstunde später waren wir in der City. Die Kaufhäuser sahen aus wie überall in den Städten, aber was mir auffiel, waren die vielen gemütlichen Cafés und Restaurants mit Essen für jeden Geschmack.
Hier lässt es sich gut leben, oder, sagte Christian. Weißt du, was wir in dieser Stadt im Überfluss haben, fragte er.
Ich wusste es nicht.
Er zeigte auf einen riesigen Taubenschwarm, der sich vor einem imposanten Gebäude aus der Kaiserzeit niedergelassen hatte.
Tauben und Kirchen, sagte Christian. Aber beides gehört hierher.
Die Straßen und Gassen waren voller Menschen.
Den Sprachkurs an der Volkshochschule kannst du dir sparen, grinste Christian. Englisch, Arabisch, Russisch, auch Undefinierbares: Sprachfetzen aus allen Teilen der Welt zogen an uns vorbei.
Nur gebückt und im Zickzack konnte man den unzähligen Smartphones und Kameras ausweichen.
Jetzt weißt du, warum ich so fit bin, zwinkerte mir Christian zu.
Gibt es hier ruhigere Orte, fragte ich
Klar, sagte Christian. Da laufen sogar Einheimische herum.
Er zog mich in eine Nebenstraße. Wir folgten ihr ein Stück, bogen in eine kleine Gasse ein, von der aus eine weitere abzweigte und so weiter. Die bunten Souvenirläden wurden immer weniger, verschwanden schließlich, nur wenige Menschen waren in dieser Gegend unterwegs. Unsere Schritte wurden zu einem gemächlichen Schlendern. Neben einer mächtigen Kirche mit bunten Fenstern säumten Platanen den Weg. Aus ihren Wipfeln drang aufgeregtes Vogelgezwitscher. Es klang nach einem lautstark ausgetragenen Streit. Christians Versuch, sich pfeifend in das Palaver einzumischen, ging in der Klangwolke aus den Baumwipfeln unter.
Wir setzten unseren Weg fort, wobei Christian etwas Glitzerndes aus der Hand fiel. Instinktiv wollte ich mich danach bücken, doch Christian griff nach meinem Arm, schüttelte den Kopf. Cent-Münzen. Jetzt erkannte ich es. Es waren Cent-Münzen, deren Glitzern mir ins Auge gesprungen war und die nun im Staub des Bürgersteigs lagen.
Kopierte Christian gerade Hänsel und Gretel, die im Wald Brotkrumen streuten, um sich nicht zu verirren?
So schlimm ist es bei mir noch nicht, lachte Christian. Aber man kann anderen Menschen damit eine kleine Freude machen.
Ich zeig’s dir, flüsterte er und zog mich in den Schatten eines nahen Mietshauses. Warte, antwortete er auf meinen fragenden Blick.
Ich wartete. Ein paar Minuten später rüttelte Christian an meinem Ärmel, deutete mit dem Kinn in Richtung Bürgersteig. Eine junge Frau und ein ebenso junger Mann kamen auf uns zu. Ihre Gesichter waren einander zugewandt, ihre Körper eng umschlungen. Kein Wort fiel. Das Paar ging wenige Meter an unserem Versteck vorbei, entdeckte uns nicht, verlor sich im Gegenlicht der Sonne.
Ich warf Christian einen fragenden Blick zu.
Er zog die Schultern hoch. Klappt halt nicht immer, sagte er.
Diesmal war ich es, der die Frau zuerst entdeckte. Eine Joggerin in Trainingshose und Tanktop mit Kapuze, die in unsere Richtung lief. Ihr Pferdeschwanz wippte von einer Seite des Kopfes zur anderen, immer im selben Takt. Auch sie lief unbemerkt an den Münzen und an dem Haus vorbei, in dessen Schatten wir uns versteckt hielten.
Ein plötzlicher Stopp. Die Frau drehte sich auf dem Absatz um, schaute den Weg zurück. Hastig senkte ich den Blick zu Boden. Hatte sie uns bemerkt? Ohne Eile ging sie ein paar Meter zurück. Wieder blieb sie stehen und ging in die Hocke. Ihre Finger griffen nach einer Münze auf dem Asphalt, hoben sie zum Gesicht, betrachteten sie aufmerksam von beiden Seiten. Ein prüfender Blick über den Gehweg. Jetzt entdeckte sie auch die anderen Münzen, legte sie behutsam auf die flache linke Hand. Zu ihrem ersten Fund. Sie richtete sich auf, lächelte und umschloss den Schatz mit ihrer Hand.
Ich schaute zu Christian, der mir lächelnd zunickte. Als ich mich wieder umdrehte, war die Joggerin schon weg.
So, sagte Christian und klatschte in die Hände. Jetzt hast du es gesehen. Lass uns weitergehen. Mehr als einmal ließ er noch Münzen auf den Gehweg fallen. Nicht ohne sich vorher zu vergewissern, dass ihn niemand dabei beobachtete. Außer mir. Von nun an war ich sein Komplize. Die Münzen sprangen, hüpften und rollten über den Asphalt, begannen sich erst langsam, dann immer schneller um die eigene Achse zu drehen, blieben schließlich auf einer der beiden Münzseiten liegen.
Auf einer leicht verwitterten Parkbank legten wir eine Pause ein. Gestiftet von der Stadtsparkasse, wie ein kleines Schild an der Rückenlehne verriet.
Machst du das öfter?
Christian nickte. Ja, schon. Aber nie zu viele auf einmal. Nie mehr als vier, fünf Münzen. Nie welche von hohem Wert, meistens Cent-Münzen.
Beobachtest du immer die Leute?
Er schüttelte den Kopf. Früher schon, sagte er. Heute brauche ich das nicht mehr.
Eine Typologie. Er habe eine Typologie der Reaktionen aufgestellt, die er beobachtet habe.
Eine Typologie? Ich war neugierig geworden.
Die meisten Leute sind in Eile, sie gehen achtlos an den Münzen vorbei, sagte Christian. Er kratzte sich mit den Fingern über die Haarstoppel.
Andere schauen interessiert auf das, was vor ihnen auf dem Boden liegt. Aber sie lassen es liegen oder werfen es weg.
Denn zwei oder drei Cent zählen für sie nicht. Er lachte und schlug die Hände auf die Oberschenkel.
Am lustigsten sind die Heimlichtuer. Die stecken die Münzen in die Hosentasche und sehen zu, dass ihr Begleiter nichts merkt. Ach ja: die Schamhaften. Die würden gerne zugreifen, trauen sich aber nicht. Sie schauen sich tausendmal um, treten vor, schleichen wieder zurück. Manche überwinden sich schließlich.
Und die anderen?
Ziehen enttäuscht ab.
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Christian schien regelrechte Studien auf der Straße durchgeführt zu haben.
Er erhob sich von der Bank und baute sich vor mir auf, die Hände in den Manteltaschen.