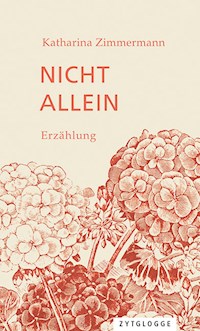24,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Immer wieder schaute ich die Bilder des Gartens an, den das Dichter- Paar* während vieler Jahre zu einem Paradies gestaltet hatte. Dabei kamen mir meine Gärten in den Sinn. In der Schweiz, in Asien, Amerika. Keiner hatte mir je gehört, aber sie gehörten zu mir, und ich hatte sie alle geliebt. Die Lust, sie zu beschreiben, war da. Moment-Aufnahmen aus den ewig- grünen Tropengärten und von den hiesigen Gärten, die in den Jahreszeiten mit immer neuen Farben spielen. Wie Aquarelle sollten sie wirken, hin- geworfen mit leichter Feder. Doch so leicht ging es nicht. Ich sperrte mich selber ein, weilte zu lange bei Pflanzen und Blumen. – Du bist Erzählerin, sagte der Lektor. Geh aus den Gärten hinaus und erzähle. Der Ratschlag war gut. Schon bald fielen mir Erinnerungen von ausserhalb der Gartenumrandung zu. Menschen, die mir nahe standen. In meiner Kindheit, Mutter, Vater, die Geschwister. Freunde, die mir in der Jugend wichtig waren und noch immer sind. Das Leben zu zweit mit Christoph. Die Kinder, die Pflegekinder, die Anvertrauten. Die gemeinsamen Freuden, die Ängste, die Kehrtwendungen. Die neuen Aufgaben in Asien und in der Schweiz. Und der Schutz in mancherlei Gefahren. Die Textseiten bevölkerten sich, es wurden mehr und mehr, und nun liegt plötzlich so etwas wie ein Lebenslauf vor. – Mach es dicks Buech, hatte mir Hugo Ramseyer gesagt, als er mir das dünne Garten-Manuskript zurückgab. Ich bin ihm dankbar. Dankbar bin ich auch Bettina Kaelin Ramseyer, der Co-Leiterin, und dem ganzen Zytglogge-Verlag, der seit dreissig Jahren alle meine Bücher verlegt hat, elf an der Zahl, und sie jetzt mit ‹Umbrüche› zum vollen Dutzend abrundet. K. Zi. «Schmerz und Wehmut haben ihren Platz darin. Aber zugleich tauchen ein ungewöhnlicher Reichtum und eine besondere Fähigkeit des Erlebens, manchmal auch eine abenteuerliche Folge von Schrecken, Strapazen und Gefährdung aus dem Gedächtnis empor. Es ist das Zeugnis eines erfüllten Lebens.» Charles Cornu (zu ‹Und singe dir ein Lied›)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Katharina Zimmermann
Umbrüche
Für
Elisabeth und Kaspar,
Ursula und Heinz
«Ein Buch ist wie ein Garten,
den man in der Tasche trägt.»
Aus Arabien
Katharina Zimmermann
Umbrüche
Aus meinem Leben
Zytglogge
Alle Rechte vorbehalten
Copyright: Zytglogge Verlag 2015
Lektorat: Hugo Ramseyer
Korrektorat: Jakob Salzmann
Coverfoto: Christian Aeberhard (Aarewasser)
ISBN 978-3-7296-0892-4
eISBN (ePUB) 978-3-7296-2038-4
eISBN (mobi) 978-3-7296-2039-1
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
Zytglogge Verlag, Schoren 7, CH-3653 Oberhofen am Thunersee
San Francisco, 2003
Erwartungsvoll versuche ich den Rollladen hochzuziehen. Völlig andere Technik hier.
Nach der langen Reise und der kurzen Nacht möchte ich endlich das Gärtchen sehen. Gestern war es schon finster und die Rollläden unten, als ich ins Zimmer kam.
Ich sehe blauen Himmel, weisse Häuser mit Flachdach, schaue hinunter vom ersten Stock und – von diesem Garten habe ich geträumt, aber die Wirklichkeit übertrifft den Traum.
Diese Farben! Gelb, rosa, orange, rot, ein poppiges Gemisch von Blüten auf einem Gewirr von Stängeln, umtanzt von hellbraunen Schmetterlingen und, kaum grösser als sie, ja, es sind Kolibris, grün schillernde Vögelchen, die wie zierliche Pfeile durch den Garten fliegen.
Ich kann mich kaum lösen vom nie vorher gesehenen Bild.
Hinter mir liegt ein Umzug vom Aussenquartier in die Berner Altstadt, liegt die lange, schwere Krankheit von Christoph, liegt sein Tod.
Ich blieb nur noch halb am Leben und floh.
Viele Flugstunden nordwärts über Grönland, dann nach Westen, nicht nach Osten wie früher. Floh quer über ganz Kanada zum Pazifik, dann der Küste entlang nach Süden. Abends stach das Flugzeug auf die Halbinsel hinunter und landete in San Francisco.
Am Flugplatz umarmte ich meine jüngste Tochter, die einjährige Enkelin und den Schwiegersohn. Während der Fahrt auf der Uferstrasse verstummte ich vor der Unendlichkeit des Wassers, das golden vor der untergehenden Sonne lag.
Im kleinen Breakfast-Room neben der Küche haben wir gegessen und geplaudert bis tief in die Nacht.
Das Baby war längst am Schlafen.
Heute darf ich es hüten und vielleicht auch im Gärtchen etwas tun.
– Ja gern, sagt Eva, die orangegelben Blumen müssen weg.
Was vom ersten Stock aus zauberhaft wirkte, sieht unten, beim näheren Betrachten, etwas anders aus. Die Blumen – nicht Kapuzinerli, wie ich vermutet hatte – liegen auf einer Masse halb vertrockneter Stängel, auf einem verworrenen Unterholz, das die Rosen, die Kamelien, das Zitronenbäumchen erstickt.
Es ist heiss hinter dem schützenden Lattenzaun.
Auf der Strasse, die zum Pazifik hinunterführt, sei das Klima anders, vom Ozean wehe immer ein Wind, und an der Küste sei es beinah kalt.
Den Blütenteppich zerstören mag ich noch nicht. Ich halte mich an den Efeu, der viel zu üppig an der Lattenwand wächst und sich mit kräftigen Trieben in das Gärtchen krallt. Seine Lebenskraft kenne ich von Europa her, ihn zu stutzen, reut mich nicht.
– You walk?
Entsetzt bleibt die Nachbarin vor ihrer Garage stehen, während ich die Kleine in den Kinderwagen setze.
Ohne Auto mit einem Kind hier einkaufen gehen, kann sich nur eine Schweizer Grossmutter leisten. Sie hat Zeit.
So steil hinauf wie an der hiesigen Avenue hat sie in Bern nie einen Kinderwagen gestossen.
Bei jeder abfallenden Querstrasse sieht sie links unten die blaue Wand, und der Atem stockt ihr beinah, höher als die Häuser an der Küste ragt sie in den Himmel. Dunkelblau am Morgen, hell am Mittag, hell und heller, und abends, wenn das Gold aus dem Himmel darüber fliesst, blendet die Wand so sehr, dass die Autofahrer erblinden.
Oben, beim grossen Schulhaus, steht die Lehrerschaft auf der Strasse, ereifert sich vor laufender TV-Kamera gegen Kürzungen im Bildungsprogramm.
Auch hier?
Ich hebe das Kind aus dem Wagen und betrachte das Bild, das sich mir rechts unten bietet.
Die Bucht, verzweigt wie ein Vierwaldstättersee zwischen Hügeln, dahinter die Ketten kalifornischer Berge, vorne, ganz nah, die Golden Gate Bridge. Hat man sie auf dem Einkaufsweg täglich vor Augen, fällt der Glamour des Weltstars etwas von ihr ab, und sie wird zu dem, was sie ist: ein zierliches Meisterwerk, harmonisch in die Landschaft gehängt.
Derweil zieht das Kind winzige Blümchen zwischen den Zementquadern des Trottoirs aus, legt dann den Kopf nach hinten und betrachtet die Vogelschwärme, die sich auf den wirr durcheinander hängenden Stromleitungen versammeln. Lang ists her, seit ich ein so lautstarkes Vogelgezwitscher vernommen habe. War es in den Urwäldern von Kalimantan?
Über Smog haben die Leute hier nicht zu klagen, so nah am Pazifik und umgeben von grünen Lungen; über Nebel schon, der kann tagelang aufliegen, aber an ihm ersticken die Vögel nicht.
Die Hochhäuser von Downtown stehen weit weg, hier wohnt der Mittelstand, Angestellte mit höchstens zwei Wochen Ferien im Jahr. Eine Reise in die Schweiz kann sich keiner leisten, aber daheim hat man es gern schön.
Vor den kleinen Häusern blühen Tulpen, Rosen, Dahlien, reifen Äpfel und Zitronen, alles zur gleichen Zeit. Pflanzen aus Nord und Süd, aus Ost und West, einige halten sich an Jahreszeiten, andere nicht. Sie sind Individualisten wie die Menschen, die von allen Erdteilen hierher kamen und durcheinander gemischt jeden nach seiner Eigenart leben lassen.
So wenigstens empfinde ich es und fühle mich wohl bei den freundlichen Grüssen, die alle dem Baby gelten.
Ich nehme es auf den Arm, wir schauen dem Turnunterricht neben dem Schulhaus zu. Kopftücher sind hier kein Thema, es turnen etliche mit. Ob Kippa am Hinterkopf oder Kreuzchen am Hals, noch tragen die Kinder Symbole, die ihren Eltern wichtig sind.
Niemand regt sich darüber auf.
Die Kleine wird wieder festgebunden im Wagen, Strasse und Trottoir fallen steil ab.
Im Supermarkt gleiten die Finger der Kassiererin rasch über die Tasten, während sie mit dem Baby schäkert, der flinke Einpacker schenkt ihm ein Bildchen, und ich stosse den Kinderwagen mit vollen Taschen wieder hinauf zum Schulhaus auf dem Kamm, jetzt mit Sicht nach Süden, auf die Hügel von Los Altos, den Schutzwall vor dem Ozean.
Dich möchte ich neben mir haben bei diesem Blick in die Weite. Mit dir möchte ich erleben, wie freundlich die Menschen hier sind, so anders, als wir uns die Amerikaner vorgestellt hatten. Könnten wir nur darüber sprechen, aber mein liebster Gesprächspartner in all den vergangenen Jahren ist nicht mehr da.
Das Kind schaut fragend zu mir auf, ich nehme es in die Arme und küsse es. Auch dich hätte er gern noch aufwachsen sehen, hätte Freude an dir gehabt wie an den andern Grosskindern, den etwas älteren in der Schweiz.
Nach dem Mittag, wenn das Baby schläft, liegt das Gärtchen im Schatten des Hauses. Zeit für mich, hinunterzugehen, den Balken von der hintern Garagentür wegzuschieben und in das Rechteck hinauszutreten, dessen Gestaltung die Vermieterin im zweiten Stock meiner Tochter, seis aus Grosszügigkeit oder aus Bequemlichkeit, völlig überlässt.
Hier darf ich wirken, wies mir gefällt. Niemand sagt, mach nicht zu viel, ruh dich lieber ein wenig aus.
Ich entscheide selber und bin trotzdem nicht allein. Touristenattraktionen brauche ich keine, es ist der Alltag der jungen Familie, der mich interessiert. Zwischendurch schreibe ich Erinnerungen an Christoph in ein schwarzes Heft.
Gestern war ich mit dem Baby an einem Brown Bag Concert. Es fand über Mittag in der Privatschule statt, in der Eva Klavier unterrichtet. Eine Villa mitten im grossen Park. Kleine Geigerinnen, kleine Pianisten spielten vor, das Publikum sass am Boden und ass dazu seinen Lunch aus braunen Papiersäcken.
Was mich beeindruckte, waren nicht die Darbietungen. Ausgenommen vielleicht die der kleinen Chinesin mit keck abstehenden Zöpfchen, die voll Temperament durch ein Vivaldi-Konzert raste. Sonst entsprachen die Leistungen etwa denen unserer Schweizer Kinder an einer Vortragsübung. Beeindruckt, wenn nicht gar ergriffen, war ich vom Publikum.
Da sassen diese Erst- bis Fünftklässler auf dem Parkettboden, assen ihren Lunch und hörten zu. Kein Gerangel, kein Tuscheln, kein Geschwätz. Sie hörten dem Spiel ihrer Mitschülerinnen zu und spendeten dann kräftig Applaus.
Durch das Programm führte die Schulleiterin. Freundlich sprach sie zum Publikum, als seien es Erwachsene, stellte jeden der kleinen Künstler vor und musste nie um Ruhe bitten.
So was geht nur in einer reichen Privatschule, hätte ich früher gedacht, wäre ich nicht zuvor in einem öffentlichen Primarschulhaus von San Francisco gewesen. Mächtiges Gebäude, Schulhof aus Asphalt, an verkehrsreicher Strasse. Dort trat mein Schwiegersohn mit seinem Quartett in der Turnhalle auf. Während zweier Stunden spielte es klassische Musik.
Die Klassen waren leise hereingekommen, hatten sich auf den Turnhallenboden gesetzt, hörten zu und meldeten sich dann beim Gespräch mit den Musikern eifrig zu Wort. Entgangen war mir nicht, wie sich eine Lehrerin neben einen der Schüler gesetzt und ihn fest im Auge behalten hatte. Ein Spezialfall. Weniger pflegeleicht als die hundert andern amerikanischen Schüler und Schülerinnen, ein lustiges Gemisch von heller und dunkler Haut, von krausem und glattem Haar, von schmalen und runden Augen.
Als ich der Schulleiterin in der Privatschule nach dem Konzert gratulierte, freute sie sich.
– Bitte erzählen Sie das in der Schweiz, sagte sie, man hat drüben ein ungutes Bild von uns, und das zu Recht.
Sie hatte im Frühling – wir sind im Jahr 2003 – mit vielen Tausend anderen in den Strassen der Stadt gegen den Kriegsbeginn im Irak demonstriert. Eine riesige Demonstration sei es gewesen, still und friedlich, mit Kindern und Kerzen.
– Aber so was kommt bei uns nie im TV, und bei Ihnen wohl auch nicht.
– Nein, in den Medien wird meist das Böse, das Entsetzliche aus den andern Ländern vermittelt.
Die Mehrzahl der Menschen rings um den Erdball möchte nichts anderes, als friedlich einer Arbeit nachgehen – falls sie Arbeit hat – und denkt nicht an Krieg. Aber hie und da gibt es einen, zwei Spezialfälle, die, wenn man sie nicht im Auge behält, einen Flächenbrand auslösen können. Sie erhalten die Aufmerksamkeit der Medien.
Hier erlebe ich den gewöhnlichen Alltag in der amerikanischen Mittelschicht, wo mich der Nachbar jetzt über den Lattenzaun nach meinem Befinden fragt.
– Gut, ich arbeite gern im Garten.
– Gärten sind wunderbar, sagt er.
Sein Fleckchen Erde ist nicht grösser als unseres, aber sehr gepflegt und bepflanzt bis in die hinterste Ecke. Nicht wie der Wildwuchs bei uns, den ich nun etwas zähmen darf.
Wenn ich vom wuchernden Efeu an der Ladenwand die Hälfte herunterschneide, die dicken Triebe aus der Erde reisse, steigt etwas von der Kraft in mir auf, die ich verloren glaubte.
Wenn ich mit den Händen die verbliebenen Wurzeln aus der Erde bohre, das sandige Gemisch zwischen den Fingern spüre, fühle ich mich wohl in diesem begrenzten Gärtchen hinter dem grenzenlosen Ozean.
Der Schmerz, der mich seit einem halben Jahr zu Boden drückt, scheint sich ein wenig zu lindern, die Last wiegt etwas weniger schwer.
Wenn mich der Duft der orangegelben, noch nicht entfernten Blumen streift, empfinde ich für einen Augenblick gar eine Art Glück.
Am Fenster im ersten Stock erscheint ein rundes Gesicht. Mein Enkelkind ist aus dem Schlaf erwacht, ist aufgestanden im Bettchen, hat mich unten im Garten entdeckt und lacht und lacht.
Zurück in Bern, packe ich das schwarze Heft mit den losen Aufzeichnungen aus, beginne mit dem Buch ‹Und singe dir ein Lied›, zum Andenken an Christoph, an die sechsundvierzig Jahre mit ihm.
Wie war mein Leben vor ihm?
Bei einsamen Spaziergängen, an der Aare unten, tauchen manchmal Erinnerungsfetzen auf, an das Kind im Altenberg.
Bern Altenberg, 1935
Das Haus unten am Altenberg.
Die Aare hier dunkel, zügig, mit ihrem Geruch, Bäume gegenüber am steilen Hang, oben die Stadt, die Rückseite der Stadt, unten der Steg, die Pfeiler der Brückenbogen, darüber die Kornhausbrücke, auf ihr die Menschen ganz klein.
Im Haus wohnt unter dem Dach ein Musikerpaar mit einem zweijährigen Kind.
*
Das Kind ist allein. Ein Einzelkind. Nach ihm werden andere kommen, viele Geschwister. Doch vorläufig gehört die Wohnstube noch ihm allein.
Von nebenan klingt Musik. Jemand übt. Klavier oder Cembalo, Vater oder Mutter, manchmal beide, vierhändig am Flügel. Oft haben sie Probe mit andern Leuten.
Es kennt sie alle, die da singen, streichen und blasen. Sie sind nicht wichtig. Wichtig ist nur die Klangmauer aus den Tasten, die es schützt und ihm sagt, alles ist so wie immer, die Eltern sind da, zumindest eines von beiden. Und solang das Klavier erklingt, bleibt es ungestört. Niemand wird die Tür aufstossen und fragen, was machst du da?
Das Kind setzt sich auf den Boden, öffnet den Baukasten und nimmt die Klötzchen hervor. Die langen, die kurzen, die eckigen und die runden. Auch die Bögen zum Brückenbauen. Doch wer will schon bauen, wenn Menschen hier auf ihr Schicksal warten?
Vor ihrem Auftritt prüft das Kind die Klötzchen auf Eignung zu Haupt- oder Nebenrollen. Dann verwandelt es sie. Schon stehen sie vor ihm: Vater, Mutter, Tante und Onkel, Cousin und Cousine, der Wirt im Restaurant und das Fräulein mit den Stöckelschuhen …
Zufrieden lehnt das Kind sich zurück. Seine Leute sind da, lebendig und einsatzbereit. Sie werden beim Ruhbett in die Eisenbahn steigen, im Schiff über den Parkettboden fahren, Sirup trinken im Restaurant, werden beim Büchergestell auf den Berg klettern, einen Besuch machen zwischen den Büchern, heimfahren in die Stadt unter dem Tisch, schlafen, essen und Klavier üben.
Sie werden alles erleben, was es erlebt hat.
*
Das Kind liegt im Bett, Augen offen, Rücken zur Wand.
Nie hätte es gewagt, sich gegen die Wand zu drehen und einzuschlafen. Es muss wach bleiben, Schrank, Kommode und Tisch im Auge behalten. Wenn nicht, werden sie kommen, herankommen, ans Bett stehen und das Kind erdrücken.
Tagsüber, solang das Haus lebt, sind die Möbel ungefährlich.
Aber nachts, wenn es schlafen sollte, zeigen sie ihre wahre Gestalt. Hat nicht der Schrank eben die Füsse bewegt? Es schaut ihn fest an, hält ihn in Bann, auch die Kommode und den Tisch daneben. Es weiss, sie haben Böses im Sinn.
Um Hilfe rufen? Sinnlos. Käme die Mutter ins Zimmer, würden die Möbel sich verstellen, so tun, als seien sie nur Schrank, Tisch und Kommode.
Am Tag gibt es sich Mühe, sie nicht zu beleidigen, und entschuldigt sich, wenn es unabsichtlich an sie gestossen ist.
Am allermeisten und allerhäufigsten entschuldigt es sich im Klo vor der Toilettenschüssel. Die könnte ihm sehr böse werden.
Es überdenkt den Weg, den sie bis an sein Bett zurücklegen müsste. Der Flur. Die beiden Türen. Die Klotür und die zu seinem Zimmer.
Käme sie überhaupt durch eine Tür?
*
Fliegen möchte das Kind. Hoch in den Himmel und wieder zurück. Schwerelos fliegen. Hinauf und hinab. Sich halten an den Seilen, getragen vom Brett. Andere Kinder sah es fliegen, mit den Zehen voran in die Bäume hinauf, über den Boden fegen und rückwärts hoch bis unter die Wolken.
Seither träumt es vom Fliegen und bedrängt die Eltern mit diesem Wunsch.
An seinem zweiten Geburtstag wird es von der Wohnung die Treppen hinunter hinters Haus geführt. An der Teppichstange – es staunt – hängt die Erfüllung seiner Träume. Die Schaukel. Das Brett glänzt, die Seile riechen aufregend neu. Stolz stehen die Eltern daneben.
Doch sobald es sich setzen will, gleitet das Brett weg. Absichtlich. Das Kind wird vom Brett gefoppt, ja ausgelacht. Jeder Versuch, es mit dem Gesäss zu bezwingen, misslingt. Schliesslich müssen die Eltern zu Hilfe kommen. Sie setzen das Kind aufs Brett.
– Halt dich fest.
Auch die Seile fühlen sich feindlich an. Hart und steif.
Und jetzt?
Wie ein Sack sitzt das Kind auf dem Brett, wartet auf das Fliegen.
War es doch abends im Bett schon oft geflogen, weg von der Erde, durch die Lüfte geschwebt.
Es wartet auf das Wunder.
Nichts geschieht.
Die Eltern stossen es sanft am Rücken.
– Nein, schreit es.
– Du musst mit den Füssen vor- und rückwärts, und mit den Händen …
– Nein, nein, brüllt das Kind.
Warum etwas tun? Warum an Füsse und Hände denken? Es will fliegen, in den Baum, unter die Wolken.
Die Eltern sind ratlos. Und das Kind rutscht vom Brett.
Masslos enttäuscht.
*
Winter. Vor dem Fenster der Wohnstube versammeln sich Vögel. Für die Meisen baumelt ein löchriges Säckchen am Haken, für die andern Vögel liegen die Kerne auf dem Vogelbrett.
Das Kind steht am Fenster auf einem Stuhl und schaut ihnen zu. Es hat sie unterscheiden gelernt, Meisen, Finken, Grünfinken, Bergfinken, Kleiber, hie und da ein Specht, ein Buntspecht, doch manchmal sind sich die Eltern nicht einig, wie der neu dazugekommene Vogel heisst.
Eines Tages plötzlich die Amsel. Sie jagt die kleinern Kostgänger weg.
Es kennt die Amsel, erinnert sich an ihren Frühlingsgesang und ist entsetzt über die Bosheit in diesem schwarz glänzenden Köpfchen.
– Warum ist die Amsel so bös, wenn sie doch so schön singen kann?
Sein Vater, der Musiker, schaut interessiert auf.
Später, beim Besuch von Kollegen und Freunden, wiederholt er die Frage des Kindes. Es kommt sich wichtig vor.
Doch die Erwachsenen beginnen zu sprechen, laut und heftig, es hört Namen, die es schon oft gehört, Namen von Sängerinnen, von Dirigenten … und für das Kind interessiert sich keiner mehr.
*
Von den Wochentagen kennt das Kind nur den Mittwoch. Der Mittwoch ist ein schrecklicher Tag. Schon am Vormittag denkt es an das, was kommen wird. Das Mueti wird am Mittag verreisen, nach Thun, wo es den ganzen Nachmittag Klavierstunden gibt. Das ist nicht zu ändern, und das Kind wird leiden.
Doch es ist nicht allein. Alice ist da. Es mag ihr lustiges Berndeutsch, ihr Kauderwelsch. Alice kommt von dort, wo sie Französisch sprechen. Sie erlaubt dem Kind, den Nachmittagsschlaf in Mutters Bett zu verbringen.
Kaum hat Alice die Tür des Schlafzimmers geschlossen, schlüpft das Kind aus dem Bett, öffnet Mutters Kleiderschrank, zieht ihre Pullover heraus und nimmt den blauen, der am meisten nach ihr riecht.
Es weint nicht. Aber der Schmerz in ihm tut so weh, dass es den Pullover ins Bett nimmt und sein Gesicht darin vergräbt.
*
Abends beim Einschlafen rauscht die Aare. Sie ruft und lockt. Das Kind hat Angst vor ihr.
Bei jedem Spaziergang heisst es, pass auf, geh nicht zu nah an die Böschung, sonst fällst du hinein. Die Aare ist gefährlich.
Die untersten Grasbüschel werden vom Wasser gestreckt und bleiben doch da. Aber das Kind würde mitgerissen, fiele es einmal hinein.
Gellend schreien die Möwen.
Jenseits der Aare lauert der Blutturm, umgeben von düsteren Büschen. Es schaut ungern hinüber und muss es doch immer wieder tun.
Oben thront die Stadt über Büschen und Bäumen. Dort ist alles heller.
Beim Einschlafen ist es froh, wenn vom Platz nebenan die Tennisbälle, klack, klack, die Aare übertönen, wenn die Tramwagen über die Kornhausbrücke donnern und die Brücke mitbrummt.
Tram und Tennisbälle, vertraute Geräusche. Doch in den Schlaf schleicht sich das Kreischen der Möwen und das Rauschen der Aare, die auf ein Kind wartet, das hereinfällt.
*
Heute schläft das Kind lange nicht ein.
Besucher sind da gewesen zum Nachtessen. Es verstand vieles nicht. Kinder haben sich nicht einzumischen ins Gespräch der Erwachsenen. Es spürte die gedrückte Stimmung und vernahm ein neues Wort. Tschechoslowakei.
Jetzt kann es nicht schlafen, beginnt zu weinen, weint so laut, dass die Mutter kommt.
– Was ist los?, fragt sie.
– Ich habe so Angst, schluchzt das Kind.
– Wovor?
– Dass der Vati in den Krieg muss und erschossen wird.
– Nein, nein, die Tschechoslowakei ist weit weg, tröstet sie, hier bei uns gibt es keinen Krieg.*
* 1938 Einmarsch der Deutschen in die Tschechoslowakei
*
Das Kind wünscht sich ein anderes Kind zum Spielen. Zwar liegt jetzt ein Baby im Stubenwagen. Ein Baby, das immer schläft. Spielen mit ihm geht nicht.
Drüben an der Schütti sieht es ein Mädchen von der Stadt den Abhang hinunterspringen. Vielleicht zum Steg und über die Aare zu mir, hofft es, geht hinunter und wartet beim Gartentörchen, wartet lange. Niemand kommt.
Hier gibt es keine Kinder, nur den Jungen des Hausmeisters. Der geht aber schon in die zweite Klasse, ist viel älter als es, viel gescheiter. Er befiehlt, und es wagt nicht zu widersprechen.
Er kann lesen und rechnen, und es kann noch nichts. Spielen hilft er nie, das ist ihm zu blöd.
Er hat ihm mit einer Nadel den roten Ballon kaputtgemacht.
– Gib mal her, hat er gesagt, ich will etwas ausprobieren.
Es hielt den Ballon umschlungen, hatte ihn eben von der Gotte geschenkt bekommen.
– Gib, es passiert ihm nichts, sagte der Junge und stach mit einer Nadel hinein. Der rote Ballon fiel langsam in sich zusammen.
Das Kind war unglücklich, sagte aber nichts.
– Komm, stell dich neben mich!, befahl er.
Das Kind gehorchte.
– Jetzt pass auf, so hoch wie ich kann keiner pinkeln.
Er griff sich in die Hose, nahm sein Ding in die Hand und begann zu spritzen. Tatsächlich, sein Strahl traf die Hausmauer in hohem Bogen.
Widerlich die Vorführung, lästig der Gestank, aber das Kind blieb stumm, fand keine Worte, auch oben im dritten Stock nicht. Sträubte sich nur, noch einmal in den Garten zu gehen.
*
Überglücklich kniet das Kind vor einer leeren Schuhschachtel ohne Deckel. Nein, nicht leer. Sie ist bewohnt von einem winzigen Volk. Ein jedes der kleinen Persönchen trägt eine weisse Zipfelmütze. Sie sitzen auf Stühlchen, essen an Tischchen, schlafen in Bettchen.
Seit Tagen hat ihm Lydia, die im Haushalt hilft, ein Geburtstagsgeschenk gebastelt. Es durfte zusehen, wie das Werk entstand, und hat sich immer heftiger darauf gefreut. Jetzt ist es ausser sich vor Freude, schaut von oben in die Schachtel und lebt mit den Zwergen in ihrer Wohnung.
Wie verloren steht seine Mutter daneben. Es weiss, warum sie traurig ist. Ihr grosses Geschenk, den Puppenwagen mit dem Bäbi drin, hat es kaum beachtet. Auch nicht die Kleidchen, die sie der Puppe gestrickt hat.
Den ganzen Tag bleibt es gefangen von der zipfelmützigen Welt.
Doch die Schachtel verliert ihren Zauber bald. Und die Puppe wird unbeachtet die folgenden Jahre verbringen.
An ihrer Stelle hat sich etwas anderes ins Herz des Kindes gedrängt.
Es steht mit Grossätti am Thunersee, am seichten, sandigen Strand. Auf dem Wasser schwimmt eine Feder heran. Eine Schwanenfeder. Das Kind fischt sie heraus, trocknet sie, berührt mit den Fingern den Schaft und die Äste, scheu, als sei noch Leben darin.
Beim Aufwärts-Streichen zur Spitze sind sie geschmeidig und fett, beim Hinabstreichen teilen sie sich, widerspenstig, mit einem spröden Geräusch.
Das Kind ist fasziniert von der Feder.
Es nimmt sie nach Hause, bettet sie abends in Watte, weckt sie am Morgen, streicht sie glatt, zerzaust und glättet sie wieder und drückt sie zärtlich an sich.
*
Am Sonntagmorgen geht alles sehr schnell, erst über den Steg – nah gurgelt das Wasser – den Rain hinauf, immer im Laufschritt, hinauf zum Waisenhausplatz und weiter zum Bahnhof, durch den man rennt und den Zug knapp erreicht.
Die Fahrt geht meistens nach Uetendorf, dort beginnt der Fussweg nach Thierachern.
Beim Friedhof darf das Kind vorausrennen, ins mächtige Schulhaus, die Treppen hinauf, verfolgt von den Augen der ausgestopften Vögel, dem Geruch von Urin und Kreide aus offenen Türen, bis oben in die Arme der Grossmutter, die es mit lustigem Kichern empfängt.
Schon im Zug freut sich das Kind auf sie, auf die vielen Onkel und Tanten und auf den hohen, strengen Grossvater, den man erst etwas fürchtet und dann bewundert, wenn er am Esstisch obenan sitzt und jetzt der Wichtigste ist. Wichtiger als der Vater, der auf der Seite neben seinen jüngern Brüdern gegenüber den jüngern Schwestern sitzt. Dort ist auch Mutters Platz.
Das Kind sitzt unten am Tisch neben Grossmutter, die ihm nur wenig Kartoffeln und Gemüse, aber eine Wurst auf den Teller legt. Eine ganze Wurst! Unsicher schaut es nach der Mutter. Sie merkt nichts. Nachdem es die Wurst gegessen hat, erhebt sich sein jüngster Onkel, sticht auf der Platte in eine der prall glänzenden Würste und reicht sie ihm ans untere Tischende.
– Halt, halt, viel zu viel für ein Kind, wird gerufen.
– Ein Kind braucht Fleisch, sagt er und lacht.
Das Kind mag ihn am liebsten von allen, diesen lustigen Onkel. Er ist jung und weiss, was Kinder gerne haben. Nicht wie die ältern Leute am Tisch und die Eltern, die ihm das nie erlauben würden.
Gegen Abend wieder das übliche Gehetz, erst durch den Wald hinauf zur Strasse, dann hinunter zur Bahnstation. Oben am Waldrand wird ihm furchtbar übel. Es muss sich erbrechen, betrachtet dann den grausigen Brei mit den kleinen Fleischstückchen darin. Die Wurst.
Der lustige Onkel.
Vielleicht wissen Eltern doch besser, was gut ist für ein Kind.
*
In der Sonntagsschule Thierachern hat das Kind ein Lied gelernt.
Weisst du, wieviel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Abends, nach einer späten Heimfahrt, brennen in der Stadt schon die Strassenlampen. Auch auf dem Waisenhausplatz.
Am Rain ist es dunkel. Dunkler noch unten am Steg. Das Kind riecht die Aare, hört sie, sieht sie kaum mehr. Plötzlich entdeckt es oben den schwarzen Himmel, die Sterne, nie so gesehen zuvor. Verwundert bleibt es stehen, hält sich fest am Geländer und legt den Kopf in den Nacken. Sterne. Alles voll. Viel zu viele. Nichts von ‹Sternlein am blauen Himmelszelt›.
Ein Schreck fährt durch das Kind. Gewaltig ist die Erschütterung über diese unzähligen Sterne, die offenbar immer schon dort gehangen haben, während es schlief.
*
Von jenseits der Aare kommt es, was jetzt, zauberhaft, durch den Nebel klingt. Oben, schräg über dem Blutturm, liegt das Glück.
Das Kind aber ist im Unglück. Die Eltern stehen vor ihm, überrascht vom Problem, beugen sich herab und betrachten den baumelnden Milchzahn.
Die Mutter holt einen Faden. Es sieht die Schlinge um die Türfalle, spürt den Faden im Mund. Eifrig wird erklärt, dann auf sein Einverständnis gewartet.
Es will nicht, will keinen noch so kurzen Schmerz. Lieber das Baumeln.
Das sei gefährlich wegen des Verschluckens.
Eifriger reden die Eltern, versichern, zu spüren sei nichts, das gehe schnell und schwups, sei der Zahn raus.
Es will nicht.
Vater sagt, wenn das Kind jetzt tapfer sei, dürfe es morgen aufs Rösslispiel.
Das Rösslispiel. Es steht auf der Schützenmatt und ist das Glück. Von dort schweben die Klänge über die Aare. Es hat sie bereits von nahem gehört, ist zur Post mitgegangen ins Bollwerk, dann zum Metzger am Waisenhausplatz, hat sein Wursträdchen trotz Kauen nicht schlucken können und auf dem Steg unten in die Aare gespuckt. Begleitet von dieser himmlischen Musik aus dem Leierkasten, so zittrig fein, ganz anders als die irdische Musik seiner Eltern, die täglich aus den Tasten klingt.
Die Vorstellung, morgen auf einem Rösslein in den Himmel zu reiten, wäre es heute ein bisschen tapfer, ist zu schön.
Doch es lässt keinen an den Zahn heran.
Anderntags sitzt das Kind auf einem der Rösslein, erstaunt über seinen Vater, der ihm das heute, trotz immer noch baumelndem Zahn, erlaubt hat. Und wie es durch die Lüfte reitet, beschwingt von Musik, spürt es: Das Glück muss man nicht erarbeiten, es wird einem geschenkt.
Bern Holligen, 1939
Ich war fünfeinhalb, als wir umzogen in ein altes Landhaus mit verwildertem Garten im Westen der Stadt. Es sollte abgerissen werden. Die Besitzerin wurde von der Stadt zum Verkauf gedrängt. Der drohende Krieg sorgte für Aufschub, doch repariert wurde nichts mehr. Für die neuen Mieter, die wachsende Musikerfamilie, ein Glücksfall.
*
Zögernd trete ich aus der Parterre-Wohnung auf den Platz hinaus, über die Kieselsteinchen zum Brunnen. Ich halte die Hand unter den Strahl, gehe zum Bach und über die kleine Brücke. Vorsichtig trete ich auf die Matte hinaus mit den vielen Bäumen – vorläufig sind es für mich nur Büsche und Bäume –, bald werde ich sie kennen, den weissen und violetten Flieder, die Haselbüsche, Apfelbäume, Birnbäume, den Hanslibirnbaum mit den Worggibirnen, die zu Beginn gut schmecken und dann den Rachen zusammenziehen, die Kastanienbäume jenseits des obern Bachlaufs.
Langsam gehe ich zum Hügel, zum Veielihubel – sein Name gefällt mir –, an der mächtigen Tanne vorüber. Nirgends ein Verbot, keiner ruft mich zurück, ungestört steige ich hoch bis zum Zaun, von wo ich hinunterschaue auf das Gelände, auf Wiese, Bach, Garten und Haus und auf die städtischen Häuserblöcke, die das Ganze umklammern.
Ich platze beinah vor Wohlgefühl, renne den Abhang hinunter, über die Brücke zum Kiesplatz, ums Haus herum auf die Rückseite. Genau genommen ist es die Vorderseite.
Hier kommt man über eine Abzweigung von der höher gelegenen Strasse zum Eingang, zum Windfang mit den farbigen Scheiben und der Haustür mit den Klingelknöpfen. Und gleich daneben liegt ein Schattenreich hinter dem Gartenzaun, wo es düster ist, ja dunkel, voller Verstecke zwischen Baumstämmen und Büschen. Auch sie werden mir bald vertraut sein: die Haselstauden, Schneebeerensträucher, die Fichten, Föhren, Birken und mitten drin die Eibe, deren Äste am Boden beginnen und ein geheimes Stübchen einschliessen. Vor ihren roten, schleimigen Früchten wurde ich gewarnt.
Neben der Eibe blühen seltene Blumen. Blätter wie lange Schwerter. Blüten wie grosse Schmetterlinge. Ich kauere neben sie, schaue in ihre Kelche, staune lange in ihr Blau.