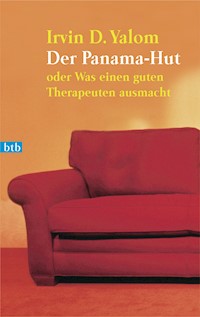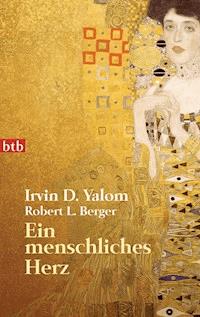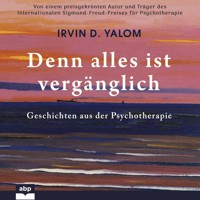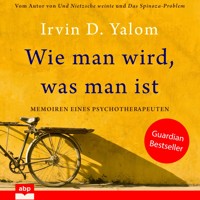10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Ménage à trois zwischen Lou Andreas Salomé, Nietzsche und der Psychoanalyse
Das Wien des Fin de siècle: Die selbstbewusste junge Russin Lou Andreas Salomé drängt den angesehenen Arzt Josef Breuer, dem suizidgefährdeten Friedrich Nietzsche zu helfen und ihn von seiner zerstörerischen Obsession für sie zu kurieren. Breuer willigt ein und unterzieht Nietzsche einer neuartigen Heilungsmethode, deren Ausgang jedoch für beide unerwartet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Das Wien des Fin de siècle. Die junge Russin Lou Salomé sucht Josef Breuer auf, den angesehenen Arzt und Mentor Sigmund Freuds. Sie macht sich Sorgen um ihren Freund Friedrich Nietzsche. Breuer soll den unter betäubenden Kopfschmerzen leidenden, einsamen großen Denker kurieren und von seiner Obsession für sie heilen. Doch Nietzsche darf nicht erfahren, dass Salomé Breuer gebeten hat, ihn zu behandeln. Breuer will ihn der neuartigen »Redekur« unterziehen, die er gerade mit seiner Patientin Anna O. entwickelt hat. Um Nietzsche zum Reden zu bewegen, beginnt er von seiner Obsession für die junge Patientin Bertha zu erzählen. So entspinnen sich zwischen dem ruhigen, einfühlsamen Breuer und dem verschlossenen, verletzlichen Nietzsche heftige Rededuelle. Und je näher sich die beiden kommen, umso deutlicher muss Breuer erkennen, dass er Nietzsche nur heilen kann, wenn er diesem erlaubt, auch ihm zu helfen.
Yalom verwebt Fiktion und Wirklichkeit zu einem dichten Netz, und bald beginnen die großen Köpfe aus den Pioniertagen der Psychotherapie lebendig zu werden und zu uns zu sprechen.
Autor
Irvin D. Yalom wurde 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den USA und ist vielfach ausgezeichnet. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine bislang drei Romane wurden international zu Bestsellern.
Inhaltsverzeichnis
Dem Kreise von Freunden die über viele Jahre zu mir hielten und mir Halt boten:
Mort, Jay, Herb, David, Helen, John, Mary, Saul, Cathy, Larry, Carol, Rollo, Harvey, Ruthellen, Stina, Herant, Bea, Marianne, Bob, Pat.
Meiner Schwester Jeanund meiner besten Freundin Marilyn.
Mancher kann seine eigenen Ketten nicht lösen, und doch ist er dem Freunde ein Erlöser.
Verbrennen mußt du dich wollen in deiner eigenen Flamme: wie wolltest du neu werden, wenn du nicht erst Asche geworden bist.
Also sprach Zarathustra
1
Das Glockenspiel von San Salvatore riß Josef Breuer aus seinen Träumen. Er zog seine schwere goldene Uhr aus der Westentasche. Neun. Zum wiederholten Male studierte er das Billett mit Silberrand, das er am Vortage erhalten hatte.
21. Oktober 1882
Doktor Breuer,
ich muß Sie in einer dringlichen Angelegenheit sprechen. Die Zukunft der deutschen Philosophie steht auf dem Spiele. Ich erwarte Sie morgen früh um neun im Café Sorrento.
Lou Salomé
Eine Impertinenz! Eine Unverfrorenheit, dergleichen er seit Jahren nicht erlebt hatte. Er kannte keine Lou Salomé. Keine Adresse auf dem Kuvert. Keine Möglichkeit, dieser Person mitzuteilen, daß neun Uhr eine unpassende Zeit sei, daß es Frau Breuer ganz und gar nicht gefiele, alleine frühstücken zu müssen, daß Dr. Breuer Ferien mache und daß ihn ›dringliche Angelegenheiten‹ nicht interessierten, ja, daß Dr. Breuer gerade deshalb nach Venedig gereist sei, um sich ›dringlicher Angelegenheiten‹ zu entziehen.
Und doch saß er nun Punkt neun hier im Café Sorrento, musterte die Gesichter der Gäste und fragte sich, wer von den Damen wohl die impertinente Lou Salomé sein mochte.
»Nehmen Sie noch Kaffee, Signore?«
Breuer nickte auf die Frage des Kellners, eines Knaben von dreizehn oder vierzehn Jahren mit naß zurückgekämmtem schwarzem Haar. Wie lange saß er wohl schon versunken da und träumte vor sich hin? Er blickte abermals auf seine Taschenuhr. Wieder zehn Minuten Lebenszeit vergeudet. Und womit? Wie gewöhnlich war er in Gedanken bei Bertha gewesen, der lieblichen Bertha, zwei lange Jahre seine Patientin. Er hatte an ihre spöttischen Worte denken müssen: ›Doktor Breuer, was fürchten Sie von mir?‹ Und daran, was sie gesagt hatte, als er ihr hatte eröffnen müssen, er könne sie nicht länger betreuen: ›Ich werde warten. Sie werden immer der einzige Mann in meinem Leben sein.‹
Er wies sich zurecht: ›Genug! Hör auf! Höre auf zu denken! Wozu hast du Augen! Sieh dich um! Gewähre der Welt Einlaß!‹
Breuer hob seine Tasse und sog zusammen mit tiefen Zügen kalter, venezianischer Oktoberluft den Duft des aromatischen Kaffees ein. Er wandte den Kopf und schaute. Sämtliche Tische des Café Sorrento waren mit Frühstücksgästen besetzt – größtenteils Touristen, größtenteils ältere Herrschaften. Einige Gäste hielten Zeitungen in der einen Hand, Kaffeetassen in der anderen. Hinter den Tischen stoben Wolken stahlblauer Tauben auf. Auf dem stillen Canal Grande ließ nur das Kielwasser einer einsam dahingleitenden Gondel die schimmernden Spiegelungen der Palazzi an beiden Ufern erzittern. Andere Gondeln schliefen noch, vertäut an schiefstehenden Pfählen, die da und dort aus dem Kanal ragten wie wahllos von Riesenhand hingeschleuderte Speere.
›So ist’s recht, alter Narr, mach die Augen auf!‹ sagte sich Breuer. ›Von überallher kommen die Menschen, um Venedig zu bewundern, Menschen, die sich weigern zu sterben, ehe sie nicht der Gnade seiner einzigartigen Schönheit teilhaftig geworden sind. Wieviel vom Leben mag wohl schon an mir vorbeigezogen sein, allein, weil ich nicht hingesehen habe? Oder hingesehen habe, ohne zu sehen?‹ Gestern hatte er einen einsamen Spaziergang unternommen, hatte die Insel Murano umrundet und hatte gleichwohl nach einer Stunde nichts gesehen, nichts wahrgenommen; es waren keine Bilder von der Netzhaut ins Gehirn gelangt. Seine Aufmerksamkeit hatte einzig Bertha gegolten: ihrem betörenden Lächeln, ihrem hingebungsvollen Blick, der Wärme ihres vertrauensvollen Körpers und ihrem beschleunigten Atem, wann immer er sie untersuchte oder massierte. Diese Bilder besaßen Macht, sie führten ein Eigenleben. Sobald seine Wachsamkeit nachließ, stahlen sie sich in sein Bewußtsein und usurpierten seine Vorstellungen. ›Soll das mein Los sein?‹ fragte er sich. ›Bin ich dazu verdammt, die Bühne zu sein, auf der sich bis in alle Ewigkeit meine Erinnerungen an Bertha in Szene setzen?‹
Am Nebentisch erhob sich jemand. Das metallische Scharren der Stuhlbeine auf dem Pflaster brachte ihn zur Besinnung, und erneut hielt er Ausschau nach Lou Salomé.
Ah, da kam sie! Die Dame, welche nun die Riva del Carbon herunterschritt und die Café-Terrasse betrat, die mußte es sein. Nur sie konnte jenes Billett verfaßt haben, diese stolze, schlanke Frau im Pelz, welche sich nun gebieterisch einen Weg zwischen vollbesetzten Tischen hindurch zu ihm bahnte. Aus größerer Nähe erkannte Breuer, daß sie jung war, jünger womöglich noch als Bertha, ein Schulmädchen gar. Aber was für ein sicheres Auftreten! Bei einem solchen Charisma würde sie es noch weit bringen!
Lou Salomé hielt zielstrebig, ohne das geringste Zögern, auf ihn zu. Wie konnte sie sich dessen nur so sicher sein, daß er der Gesuchte war? Mit der linken Hand strich sich Breuer hastig über den krausen, rötlichen Bart, damit auch ja keine Krümel vom Frühstücksgebäck darin hingen, die Rechte zupfte den schwarzen Rock zurecht und sorgte dafür, daß der Kragen sich nicht unvorteilhaft im Nacken hochschob. Kaum einen Meter vor ihm blieb sie unverhofft stehen und blickte ihm einen Moment lang geradewegs in die Augen.
Mit einemmal verstummte das Geschwätz in Breuers Kopf. Plötzlich bedurfte das Hinsehen keinerlei Anstrengung. Nun spielten sich Netzhaut und Hirnrinde das Bild Lou Salomés ohne weiteres zu und schleusten es bereitwillig in sein Bewußtsein. Eine ungewöhnliche Frau von nicht landläufiger Schönheit: ausgeprägte Stirn, kräftiges, gut geschnittenes Kinn, strahlend blaue Augen, volle, sinnliche Lippen, achtlos frisiertes, am Oberkopf zum Knoten geschlungenes silberblondes Haar, die Ohren und der lange, schlanke Hals gut sichtbar. Insbesondere gefiel ihm, wie einzelne, widerspenstige Haarsträhnen sich der Bändigung widersetzten und verwegen in alle Richtungen standen.
Drei Schritte noch, und dann stand sie an seinem Tische. »Doktor Breuer, ich bin Lou Salomé. Darf ich?« Sie deutete auf einen Stuhl. Und dann saß sie auch bereits, ohne daß Breuer Zeit geblieben wäre, sie angemessen zu begrüßen – also sich zu erheben, sich zu verbeugen, einen Handkuß anzudeuten, den Stuhl zurechtzurücken.
»Cameriere!« Breuer schnippte forsch mit den Fingern. »Einen Kaffee für die Dame. Cafèlatte?« Er blickte fragend zu Fräulein Salomé hinüber. Sie nickte. Trotz der morgendlichen Frische legte sie ihren pelzgefütterten Umhang ab.
»Ja, cafèlatte.«
Breuer und sein Gegenüber schwiegen einen Augenblick lang. Dann sah ihm Lou Salomé forschend in die Augen und hob zu sprechen an: »Ich habe einen zutiefst verzweifelten Freund. Es steht zu befürchten, er könnte sich in naher Zukunft das Leben nehmen. Das wäre für mich ein schmerzlicher Verlust, und überdies insofern tragisch, als ich selber daran einen gewissen Anteil hätte. Nun, das könnte ich ertragen und überwinden, doch ...« – sie beugte sich zu ihm vor und senkte die Stimme – » ... der Verlust ginge weit über meine Person hinaus; der Tod dieses Mannes hätte gewaltige Folgen – für Sie, für die europäische Kultur, für uns alle. Glauben Sie mir.«
Breuer wollte protestieren. ›Sie übertreiben gewiß, mein Fräulein‹, wollte er sagen, brachte die Worte jedoch nicht heraus. Was bei ihren Altersgenossinnen den Eindruck jugendlicher Emphase gemacht haben würde, wirkte an ihr nicht überzogen, klang vielmehr durchaus glaubwürdig. Ihr Ernst und ihre Eindringlichkeit waren nicht so leicht abzutun.
»Wer ist der Herr, der Freund, von dem Sie sprechen? Ist mir der Name geläufig?«
»Noch nicht! Aber sein Name wird bald in aller Munde sein. Er heißt Friedrich Nietzsche. Vielleicht mag Ihnen dieser Brief von Richard Wagner an Professor Nietzsche als Empfehlung dienen.« Sie zog einen Brief aus ihrer Handtasche, strich den Bogen glatt und hielt ihn Breuer hin. »Eines sollten Sie jedoch zuvor wissen: Weder ahnt Nietzsche, daß ich hier bin, noch, daß dieser Brief in meinen Händen ist.«
Fräulein Salomés Bekenntnis ließ Breuer zögern. ›Ja, darf ich die Zeilen denn lesen? Einen Brief, von welchem dieser Professor Nietzsche nicht weiß, daß sie ihn mir aushändigt – nicht einmal weiß, daß sie ihn hat! Wie ist der Brief in ihren Besitz gelangt? Geborgt? Gestohlen?‹
Einer Reihe seiner eigenen Wesenszüge maß Breuer großen Wert bei. Er war loyal, er war großzügig, er war für seinen diagnostischen Spürsinn berühmt. In Wien war er Hausarzt bedeutender Wissenschaftler, Künstler und Denker wie Brahms, Brücke und Brentano. Mit vierzig Jahren genoß er in ganz Europa eine hohe Reputation, distinguierte Persönlichkeiten aus aller Welt nahmen lange Reisen auf sich, um ihn zu konsultieren. Doch weit mehr Wert als auf all dies legte er auf seine Gradsinnigkeit: In seinem ganzen Leben hatte er sich nichts Unehrenhaftes zuschulden kommen lassen. Es sei denn, man legte ihm die Wollust zur Last, welche in seinen Phantasien Bertha galt, und nicht, wie es hätte sein sollen, seiner Frau Mathilde.
Er zögerte daher, den Brief entgegenzunehmen, den ihm Lou Salomé reichen wollte. Aber nur kurz. Ein Blick in ihre ungewöhnlichen kristallblauen Augen, und er griff nach dem Schreiben, das als Datum den 10. Januar 1872 führte und mit der Anrede ›Mein lieber Freund!‹ begann. Mehrere Absätze waren angestrichen.
Nun veröffentlichen Sie eine Arbeit, welche ihresgleichen nicht hat. Was Ihr Buch vor allen anderen auszeichnet ist die vollendete Sicherheit, mit welcher sich eine tiefsinnige Eigentümlichkeit darin kundgibt. Wie anders hätte sonst mir und meiner Frau der sehnlichste Wunsch erfüllt werden können, einmal von außen Etwas auf uns zutreten zu sehen, das uns vollständig einnehmen möchte? Wir haben Ihr Buch – früh jedes für sich – abends gemeinsam – doppelt durchgelesen; wir bedauern, nicht bereits die uns verheißenen doppelten Exemplare zur Verfügung zu haben. Um das eine Exemplar streiten wir uns.
Aber Sie sind krank. Sind Sie auch mißmutig, o! so wünschte ich Ihren Mißmut zerstreuen zu können. Wie soll ich das anfangen? Genügt Ihnen mein grenzenloses Lob?
Nehmen Sie es wenigstens freundlich auf, selbst wenn es Ihnen nicht genügt! –
Herzliche Grüße von
Ihrem
Richard Wagner
Richard Wagner! Bei aller Wiener Weltläufigkeit, bei allem vertrauten Umgange mit den großen Gestalten seiner Zeit war Breuer doch zutiefst beeindruckt. Ein Brief, und gleich ein solcher Brief, von des Meisters eigener Hand! Er fing sich jedoch rasch wieder.
»Überaus interessant, mein liebes Fräulein, aber vielleicht sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann.«
Lou Salomé neigte sich abermals vor und legte eine behandschuhte Hand leicht auf die Breuers. »Nietzsche ist krank, sehr krank. Er braucht Ihre Hilfe.«
»Welcher Art ist denn sein Leiden? Welche Symptome zeigt er?« Breuer, verwirrt durch die Berührung, war froh, sich auf vertrautes Terrain begeben zu können.
»Kopfschmerz. Vor allem quälender Kopfschmerz. Dazu wiederholte Anfälle von Übelkeit. Und drohende Erblindung, seine Sehkraft nimmt seit einiger Zeit stetig ab. Zudem Magenbeschwerden; keine Arznei gewährt ihm den benötigten Schlaf, so daß er bedenkliche Mengen Morphin einnimmt. Schwindelgefühle; mitunter ist er auf festem Boden tagelang wie seekrank.«
Endlose Aufzählungen von Symptomen waren für Breuer, der täglich zwischen fünfundzwanzig und dreißig Patienten behandelte und der nach Venedig gekommen war, um sich eine Erholung von eben diesem beruflichen Einerlei zu gönnen, weder neu noch von sonderlichem Reiz. Und doch sprach Lou Salomé mit einer Eindringlichkeit, daß er nicht umhin konnte, ihr aufmerksam zuzuhören.
»Zu Ihrer Frage, verehrtes Fräulein: Gewiß, ich bin gerne bereit, Ihren Freund zu untersuchen. Das versteht sich von selbst. Schließlich bin ich Arzt. Aber bitte, erlauben Sie mir eine Frage. Weshalb wählen Sie und Ihr Bekannter nicht den direkten Weg? Warum schreiben Sie mir nicht nach Wien und ersuchen um einen Termin?« Und mit diesen Worten sah sich Breuer nach dem Kellner um, damit man ihm die Rechnung bringen möge. Mathilde wäre angenehm überrascht, dachte er, ihn so zeitig schon ins Hotel zurückkehren zu sehen.
Doch die unerschrockene junge Frau ließ sich nicht ohne weiteres abspeisen. »Herr Doktor, ein paar Minuten noch, ich bitte Sie. Die Bedenklichkeit der Verfassung Nietzsches, das Ausmaß seiner Verzweiflung, sie lassen sich gar nicht genug betonen.«
»Ich will es Ihnen gern glauben. Doch ich muß Sie abermals fragen, Fräulein Salomé: Weshalb konsultiert mich Herr Nietzsche nicht in Wien? Oder einen Arzt in Italien? Wo hält sich Ihr Freund auf? Kann ich Ihnen vielleicht mit der Empfehlung eines Kollegen in seiner Heimatstadt dienen? Weshalb kommen Sie zu mir? Woher wußten Sie überhaupt, daß ich in Venedig bin? Und daß ich ein Freund der Oper und Verehrer Wagners bin?«
Lou Salomé zeigte keinerlei Verlegenheit. Sie lächelte, als Breuer sie mit Fragen zu überschütten begann, und ihr Lächeln wurde um so schelmischer, je mehr Fragen es wurden.
»Fräulein, Sie lächeln, als hüteten Sie ein Geheimnis. Sie lieben wohl Rätsel!«
»Fragen über Fragen, Doktor Breuer. Erstaunlich. Da unterhalten wir uns gerade erst wenige Minuten miteinander, und schon gibt es zahlreiche, verwirrende Fragen. Das läßt Gutes hoffen für künftige Gespräche. Lassen Sie mich Ihnen Näheres über unseren Patienten berichten.«
Unseren Patienten! Während Breuer nur erneut über ihre Kühnheit staunen konnte, fuhr Lou Salomé fort: »Nietzsche hat die medizinischen Möglichkeiten in Deutschland, der Schweiz und Italien erschöpft. Kein Arzt war imstande, sein Leiden zu bestimmen oder seine Symptome zu lindern. In den vergangenen vierundzwanzig Monaten hat er, seiner eigenen Darstellung nach, ebenso viele der besten Ärzte Europas konsultiert. Er hat Heimat und Freunde verlassen, er hat seine Dozentur aufgegeben. Er ist zum rastlosen Wanderer geworden, beständig auf der Suche nach einem erträglichen Klima, nach ein, zwei Tagen Erlösung vom Schmerz.«
Die junge Frau schwieg einen Moment lang, hob ihre Tasse an die Lippen und nippte, indes sie Breuers Blick gefangenhielt.
»Verehrtes Fräulein, zwar suchen mich häufig Patienten in ungewöhnlicher oder unerklärlicher Verfassung auf, aber in aller Offenheit: Wunder kann ich nicht vollbringen. In einem Falle wie diesem – Blindheit, Kopfübel, Schwindel, Gastritis, Schwäche, Schlaflosigkeit –, in welchem viele ausgezeichnete Kollegen konsultiert und für machtlos befunden worden sind, besteht kaum Aussicht, daß ich mehr erreichen könnte, als der fünfundzwanzigste hervorragende Arzt in ebenso vielen Monaten zu werden.«
Breuer lehnte sich zurück, zog eine Zigarre hervor und zündete sie an. Er blies dünne blaue Rauchschleier aus, wartete, bis sich der Dunst verzog, und fügte hinzu: »Wie dem auch sei, ich wiederhole mein Angebot, Professor Nietzsche in meiner Ordination zu empfangen. Es ist jedoch durchaus möglich, daß Diagnose und Heilung eines solch hartnäckigen Leidens wie des seinen die Möglichkeiten der Medizin des Jahres achtzehnhundertzweiundachtzig übersteigen. Vielleicht ist Ihr Freund um eine Generation zu früh geboren.«
»Zu früh geboren!« Sie lachte. »Eine hellsichtige Bemerkung, Doktor Breuer! Wie oft habe ich Nietzsche eben diese Ansicht äußern hören! Das überzeugt mich restlos davon, daß Sie der richtige Arzt für ihn sind.«
Trotz seiner Aufbruchsstimmung, und trotzdem er im Geiste Mathilde voller Ungeduld im Hotelzimmer in Straßenkleidung auf und ab schreiten sah, war Breuer plötzlich ganz Ohr. »Das müssen Sie mir erklären!
»Er selbst bezeichnet sich oft als ›posthumen Philosophen‹ einen Philosophen, für den die Welt nicht reif ist. Stellen Sie sich vor, im neuen Werk, an dem er arbeitet, dreht es sich eben darum: Ein Prophet, Zarathustra, vor Weisheit übergehend, will den Menschen die Erleuchtung bringen. Doch es versteht ihn keiner. Die Menschen sind nicht reif für ihn, der Prophet muß erkennen, daß er zu früh gekommen ist, und kehrt in die Einsamkeit zurück.«
»Fräulein, was Sie sagen, ist sehr interessant – ich habe ein Faible fürs Philosophieren. Doch meine Zeit ist heute knapp bemessen, und eine klare Antwort auf die Frage, weshalb Ihr Freund mich nicht in Wien aufsuchen will, haben Sie mir vorenthalten.«
»Doktor Breuer.« Lou Salomé blickte ihm direkt in die Augen. »Verzeihen Sie, wenn ich dunkel spreche oder zu umschweifig. Immer habe ich mich gern in der Gesellschaft großer Geister gewußt – sei’s, weil ich selbst ihrer als Mentoren bedarf, sei’s, weil ich sie einfach gern ›sammle‹. Es ehrt mich, mich mit einem Manne Ihres Tiefsinns und Ihres Horizonts unterhalten zu dürfen.«
Breuer spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg. Er konnte ihrem Blick nicht standhalten und schlug die Augen nieder, als sie fortfuhr:
»Ich will damit andeuten, daß ich mich möglicherweise der Umschweife schuldig mache, um unser Gespräch in die Länge ziehen zu können.«
»Noch einen Kaffee, Fräulein Salomé?« Breuer winkte den Kellner herbei und orderte zudem noch von den köstlichen Frühstückshörnchen. »Haben Sie jemals über den Unterschied zwischen deutscher und italienischer Backkunst nachgedacht? Erlauben Sie mir, Ihnen meine Anschauung über die Übereinstimmung zwischen Brot und Nationalcharakter darzulegen.«
Breuer eilte also nicht an Mathildes Seite zurück. Während er in Gesellschaft Lou Salomés gemächlich frühstückte, wurde er der Ironie der Situation inne. War es nicht seltsam, wie er, der er nach Venedig geflohen war, um das Unheil wiedergutzumachen, welches eine schöne Frau angerichtet hatte, hier nun im Tête-à-tête mit einer noch reizvolleren Frau beisammensaß? Es fiel ihm außerdem auf, daß er sich zum erstenmal seit Monaten frei fühlte von den um Bertha kreisenden Zwangsvorstellungen.
›Vielleicht‹, sinnierte er, ›besteht ja doch noch Hoffnung. Vielleicht gelingt es mit Hilfe dieser Frau, Bertha von der Bühne meines Bewußtseins abzudrängen. Könnte ich gar eine psychologische Entsprechung zur pharmakologischen Substitutionstherapie entdeckt haben? Mit einer harmlosen Droge wie Baldrian läßt sich eine gefährlichere wie Morphin ersetzen. Entsprechend mit Lou Salomé Bertha – was bedeutete dies für einen erfreulichen Fortschritt! Diese junge Frau ist gereifter, geformter. Gegen sie ist Bertha – wie soll ich sagen – sexuell unterentwickelt, femme manqué, ein in einem Frauenkörper gefangenes, ungelenkes Kind.‹
Und doch wußte Breuer sehr wohl, daß es gerade die vorsexuelle Unschuld Berthas war, die ihn anzog. Beide Frauen erregten ihn, der bloße Gedanke an sie erzeugte Hitze in seiner Lendengegend. Und beide Frauen jagten ihm Angst ein, beide waren gefährlich, jede auf ihre Weise. An Lou Salomé erschreckte ihn ihre Macht, das, was sie ihm anzutun vermöchte, bei Bertha hingegen war es die Duldsamkeit, das, was er ihr anzutun vermöchte. Er schauderte, als er daran dachte, wie nahe er mit Bertha dem Abgrund gekommen war, wie nahe er daran gewesen war, die Grundregeln der ärztlichen Ethik zu verletzen, sich und seine Familie ins Verderben zu stürzen, sein Leben zu ruinieren.
Indessen aber war er so ins Gespräch vertieft und so in den Bann seiner jungen Frühstücksgefährtin geschlagen, daß zuletzt sie diejenige war, die wieder auf die Krankheit ihres Freundes zu sprechen kam – genauer, auf Breuers Bemerkung über medizinische Wunder.
»Ich bin einundzwanzig Jahre alt, Herr Doktor, und ich glaube nicht mehr an Wunder. Der Mißerfolg Ihrer vierundzwanzig achtbaren Kollegen kann nur bedeuten, daß wir die Grenzen des heutigen medizinischen Wissens erreicht haben, darüber bin ich mir im klaren. Verstehen Sie mich nicht falsch! Ich bilde mir nicht ein, Sie vermöchten Nietzsches körperliche Gebrechen zu heilen. Nicht aus diesem Grunde habe ich mich an Sie gewandt.«
Breuer betupfte sich Schnurrbart und Bart mit der Serviette. »Verzeihen Sie, wertes Fräulein, nun bin ich vollends perplex. Soviel ich aus Ihren Worten ersehe, haben Sie um meine Hilfe gebeten, weil Ihr Freund krank sei.«
»Nein, Doktor Breuer, ich sprach von einem Freunde, der verzweifelt ist und der Gefahr läuft, seinem Leben ein Ende zu machen. Es ist Nietzsches Verzweiflung, die ich Sie zu heilen bitte, nicht seinen Körper.«
»Aber Fräulein, wenn doch Ihr Freund über seine gesundheitliche Verfassung verzweifelt ist und ich keine medizinische Abhilfe bieten kann, dann ist nichts zu machen. Ich kann nichts ersinnen für ein krank Gemüt.«
Breuer deutete Lou Salomés Kopfnicken als Wiedererkennen der Forderung Macbeths an seinen Arzt und sprach weiter: »Fräulein Salomé, es gibt keine Arznei gegen die Verzweiflung, keinen Arzt für die Seele. Ich kann wenig mehr tun, als eine Reihe ausgezeichneter Heilbäder in Österreich oder Italien zu empfehlen. Oder eine Unterredung mit einem Priester oder anderen gläubigen Ratgeber, vielleicht einem Angehörigen oder einem Freunde und Vertrauten.«
»Doktor Breuer, ich weiß, daß Sie mehr tun können. Ich habe einen Spion. Mein Bruder Jenia ist Medizinstudent und hat Anfang des Jahres in Wien bei Ihnen gehört.«
Jenia Salomé! Breuer überlegte angestrengt, ob er den Namen je vernommen hatte. Es gab so viele Studenten.
»Von ihm erfuhr ich, daß Sie Wagner lieben, daß Sie eine Woche im Hotel Amalfi in Venedig zu verbringen gedächten und auch, woran ich Sie erkennen könnte. Allem voran aber war er derjenige, von dem ich hörte, Ihre Heilkunst erstrecke sich sehr wohl auf die Verzweiflung. Im Sommer des Vorjahres besuchte er ein Kolleg, bei welchem Sie über Ihre Behandlung einer jungen Frau sprachen, einer gewissen Anna O., einer Patientin, die tiefer Verzweiflung anheimgefallen war und welche Sie mit einer neuen Methode behandelten, einer ›Redekur‹, einer auf der Vernunft beruhenden, mit dem Entwirren vermengter gedanklicher ›Assoziationen‹ befaßten Kur. Jenia meinte, Sie seien der einzige Arzt in Europa, der sich tatsächlich auf eine Behandlung der Psyche verstünde.«
Anna O.! Breuer schrak bei der Erwähnung des Namens zusammen, und er verschüttete Kaffee, als er zitternd seine Tasse an die Lippen hob. Er trocknete sich die Hand möglichst unauffällig mit der Serviette ab und hoffte, Fräulein Salomé habe sein Ungeschick nicht bemerkt. Anna O.! Unfaßlich! Wohin er sich auch wandte, überall stieß er auf Anna O. – sein Deckname für Bertha Pappenheim. Aufs peinlichste diskret, benutzte Breuer niemals die wirklichen Namen von Patienten, wenn er seinen Studenten Fälle vorstellte. Statt dessen bildete er ein Pseudonym, indem er die Initialen der Patienten um einen Buchstaben weiter zum Anfang des Alphabets hin verschob, also B. P., Bertha Pappenheim, zu A. O. oder Anna O.
»Jenia war tief von Ihnen beeindruckt, Doktor Breuer. Er schilderte mir Ihr Kolleg und Ihre Behandlung der Anna O. nicht ohne zu beteuern, wie er es als Gnade empfinde, vom Lichte eines solchen Genies gestreift worden zu sein. Und Jenia ist wohlgemerkt kein leicht zu beeindruckender Jüngling. Nie zuvor hatte ich ihn so reden gehört. Ich beschloß, eines Tages Ihre Bekanntschaft zu machen, vielleicht bei Ihnen zu studieren. Dieses unbestimmte ›eines Tages‹ nahm eine neue Dringlichkeit an, als nun Nietzsches Verfassung im Laufe der letzten zwei Monate immer bedenklicher wurde.«
Breuer blickte sich um. Viele Gäste waren aufgebrochen, indes er noch immer hier saß, auf der Flucht vor Bertha, und sich mit einer außergewöhnlichen Frau unterhielt, welche erstere ihm zugeführt hatte. Ein Frösteln befiel ihn. Wäre er denn niemals vor Bertha sicher?
»Fräulein«, hob Breuer an und mußte sich räuspern, ehe er fortfahren konnte: »Der Fall, den Ihr Bruder Ihnen schilderte, war eben dies und nicht mehr: ein Einzelfall, bei dem ich eine äußerst ungesicherte, experimentelle Methode erprobte. Es besteht keinerlei Grund zu der Annahme, daß die nämliche Methode Ihrem Freund helfen könnte. Im Gegenteil, es besteht aller Grund zu der Annahme, daß sie es nicht täte.«
»Weshalb, Doktor Breuer?«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen aus Zeitnot nicht ausführlich antworten. Nur soviel: Die Leiden von Anna O. und Ihrem Freund unterscheiden sich stark voneinander. Anna O. war Hysterika und litt an gewissen Gebrechen, die Ihr Bruder Ihnen beschrieben haben wird. Meine Methode bestand darin, Schritt für Schritt alle Symptome aufzulösen, indem ich der Patientin unter Hypnose dazu verhalf, sich an das vergessene psychische Trauma zu erinnern, aus welchem das Symptom entsprungen war. Sobald der eigentliche Anlaß ausgemacht war, verschwand das Symptom.«
»Gesetzt, Doktor Breuer, wir betrachteten die Verzweiflung als Symptom. Könnten Sie nicht ebenso verfahren?«
»Die Verzweiflung ist kein klinisches Symptom, Fräulein, sie ist zu vage, zu wenig faßbar. Jedes der Symptome von Anna O. zeigte sich an einem ganz bestimmten Körperteil, jede Störung wurde durch das Abströmen intrazerebraler Erregung über bestimmte Nervenbahnen verursacht. Ihrer Beschreibung zufolge ist hingegen die Verzweiflung Ihres Freundes rein ideogener Natur. Für diese Gemütsverfassung ist keine Behandlungsmethode bekannt.«
Zum erstenmal wirkte Lou Salomé unsicher. »Aber, lieber Herr Doktor ...« Erneut bedeckte sie seine Hand mit der ihren. »Vor Ihrem Versuche mit Anna O. gab es auch für die Hysterie keine psychologische Behandlung. Meines Wissens gab es nur Bäder und diese abscheuliche elektrische Therapie. Ich bin überzeugt, daß Sie – Sie vielleicht als einziger! – eine neue Therapie für Nietzsche entwickeln können.«
Unvermittelt wurde sich Breuer wieder der verstrichenen Zeit bewußt. Er mußte zu Mathilde zurück. »Fräulein, ich will gern alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihrem Freunde zu helfen. Bitte sehr, meine Karte. Ich erwarte einen Besuch Ihres Freundes in Wien.«
Sie ließ den Blick nur flüchtig auf der Visitenkarte ruhen, ehe sie sie einsteckte. »Doktor Breuer, ich fürchte, die Sache ist so einfach nicht. Nietzsche kann man nicht unbedingt – wie soll ich sagen – als willigen Patienten bezeichnen. Genaugenommen weiß er nichts davon, daß ich mit Ihnen spreche. Er ist ein sehr verschlossener Mensch und ein furchtbar stolzer Mann. Niemals würde er sich dazu verstehen können, seine Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen.«
»Dennoch sagen Sie mir, er rede unverhüllt von Selbstmord.«
»In jedem Gespräch, in jedem Brief. Aber er bittet nicht um Hilfe. Wüßte er von unserer Begegnung, er würde mir niemals verzeihen, und ganz gewiß würde er sich weigern, Sie zu konsultieren. Selbst wenn ich ihn irgend bereden könnte, Sie aufzusuchen, würde er die Konsultation auf seine körperlichen Beschwerden beschränken. Nie, um nichts in der Welt, würde er sich in die Lage desjenigen begeben, der Sie darum bäte, ihm die Verzweiflung zu nehmen. Er hat sehr entschiedene Ansichten über Schwäche und Macht.«
Breuer verspürte Verärgerung und Ungeduld. »Soso, Fräulein, das Drama gerät vollends zum Verwirrspiel. Sie verlangen von mir, ich möchte mich mit einem gewissen Professor Nietzsche treffen, welchen Sie für einen der bedeutendsten Philosophen unseres Jahrhunderts halten, und möchte ihn davon überzeugen, wie das Leben – oder zum mindesten sein Leben – lebenswert sei. Aber nicht genug damit, Sie verlangen, ich möchte dies bewerkstelligen, ohne daß unser Philosoph davon das geringste weiß.«
Lou Salomé nickte und sank in ihren Stuhl zurück.
»Aber wie das möglich!« rief er. »Allein das erste – jemandem die Verzweiflung zu nehmen – übersteigt an sich schon die Möglichkeiten der Medizin. Und gar Ihr zweites Anliegen – daß der Patient unter der Hand behandelt werde – verweist das gesamte Unternehmen ins Reich des Phantastischen. Womöglich bestehen weitere Hemmnisse, die Sie verbergen? Womöglich spricht Professor Nietzsche nur Sanskrit, oder er weigert sich, überhaupt seine Einsiedelei in Tibet zu verlassen?«
Breuer schwamm der Kopf. Als er aber Lou Salomés belustigten Gesichtsausdruck bemerkte, riß er sich zusammen. »Im Ernst gesprochen, Fräulein Salomé, wie sollte ich das Unmögliche vollbringen?«
»Sehen Sie, Doktor Breuer! Sehen Sie nun, weshalb ich Sie aufgesucht habe und keinen Geringeren?«
Die Glockenschläge von San Salvatore meldeten die volle Stunde. Zehn Uhr! Mathilde würde sich mittlerweile beunruhigen. Ja, wenn Mathilde nicht wäre ... Breuer winkte erneut dem Kellner. Während sie auf die Rechnung warteten, machte Lou Salomé einen – ungewöhnlichen Vorschlag.
»Doktor Breuer, darf ich Sie morgen zum Frühstück einladen? Wie ich eingangs schon sagte, ich trage ein Teil Verantwortung für Professor Nietzsches Verzweiflung. Es gibt noch vieles, was ich Ihnen darlegen müßte.«
»Bedaure. Zwar geschieht es nicht alle Tage, daß ich von einer so reizenden Dame zum Frühstück gebeten werde, Fräulein, aber es ist mir nicht möglich, Ihre Einladung anzunehmen. Die Beweggründe für meine Reise nach Venedig lassen es unratsam erscheinen, meine Frau ein zweites Mal im Stich zu lassen.«
»Dann mache ich Ihnen einen anderen Vorschlag. Ich versprach meinem Bruder, ihn in diesem Monat noch zu besuchen. Tatsächlich hatte ich bis vor kurzem die Absicht, die Reise in Gesellschaft Professor Nietzsches anzutreten. Erlauben Sie mir, Sie bei meinem Aufenthalt in Wien noch genauer zu unterrichten. Und in der Zwischenzeit will ich mein Bestes tun, Professor Nietzsche zu bewegen, Sie offiziell wegen seines gesundheitlichen Verfalles zu konsultieren.«
Sie verließen das Café gemeinsam. Es waren nur wenige Gäste, Bummler, geblieben, die Kellner stellten bereits Tische und Stühle zusammen. Als Breuer sich verabschieden wollte, nahm Lou Salomé seinen Arm und zog ihn mit.
»Doktor Breuer, diese Stunde war viel zu kurz. Ich bin gierig, ich möchte Ihnen gern noch mehr Zeit stehlen. Darf ich Sie zum Hotel zurückbegleiten?«
Ihre Äußerung erschien Breuer unerhört gewagt, männlich. Und doch klang die Aufforderung aus ihrem Munde passend, ungekünstelt – so, wie es im Verkehr mit den Menschen Usus sein sollte. Wenn eine Frau die Gesellschaft eines Mannes genoß, weshalb sollte sie nicht seinen Arm nehmen und bitten, ihn begleiten zu dürfen? Und doch würde keine einzige Frau seiner Bekanntschaft die Worte ausgesprochen haben. Er hatte eine vollkommen neue Art Frau vor sich. Diese Frau war frei!
»Selten habe ich so bedauert, eine Bitte ausschlagen zu müssen!« versicherte Breuer und drückte ihren Arm. »Doch ich muß zurück, und zwar allein. Meine liebe wie besorgte Frau wird am Fenster stehen und warten, und ich muß ein wenig Rücksicht auf ihre Gefühle nehmen.«
»Gewiß, aber ...« – sie entzog ihm ihren Arm und wandte sich ihm zu, unumschränkt und bestimmt wie ein Mann – » ... mich mutet Ihr ›muß‹ bleischwer und drückend an. Ich selber habe meine Pflichten auf eine einzige zusammengestrichen: die, meine Freiheit zu wahren. Die Ehe mit ihrem ganzen Gefolge von Besitzdenken und Eifersucht versklavt den Geist. Hiervon will ich nie die Beute werden. Ich hoffe, Doktor Breuer, es wird eine Zeit kommen, da weder Männer noch Frauen sich mehr zu freiwilligen Opfertieren ihrer gegenseitigen Schwächen herabwürdigen.« Sie wandte sich mit dem gleichen Aplomb, welcher ihr Erscheinen gekennzeichnet hatte, zum Gehen. »Adieu, Doktor Breuer. Bis zum Wiedersehen in Wien.«
2
Vier Wochen danach saß Breuer am Schreibtisch seines Ordinationszimmers in der Bäckerstraße Nummer sieben. Es war vier Uhr nachmittags, und er erwartete mit Ungeduld die Ankunft Lou Salomés.
Bei seinem arbeitsreichen Tag kannte er Augenblicke der Muße kaum, da er der Zusammenkunft jedoch entgegenfieberte, hatte Breuer die letzten drei Patienten schneller als gewöhnlich abgefertigt. Alle drei waren mit unzweideutigen Krankheitsbildern gekommen, die wenig Aufwand erfordert hatten.
Die ersten zwei, beides Männer um die Sechzig, litten an nahezu identischen Beschwerden: Atemnot und einem trockenen, rasselnden Bronchialhusten. Seit Jahren behandelte Breuer beide wegen eines Lungenemphysems; bei nassem, kaltem Wetter verschlechterte sich ihr Befinden durch akute Bronchitis und die mit ihr einhergehende Beeinträchtigung der Lungentätigkeit. Beiden Patienten verschrieb er Morphin gegen den Husten (Doversches Pulver, fünf Gramm dreimal täglich), geringe Dosen eines schleimlösenden Mittels (Brechwurz), Inhalationen und Senfwickel für die Brust. Nicht wenige Kollegen rümpften über Senfwickel die Nase, doch er hielt große Stücke auf dieses bewährte Mittel und verschrieb es häufig – namentlich in diesem Jahr, da halb Wien es an der Lunge hatte. Seit drei Wochen kein Sonnenstrahl, dafür anhaltender kalter Sprühregen.
Der dritte Patient, Hausbursche bei Kronprinz Rudolf, ein fiebriger, pockennarbiger junger Mann mit Halsschmerzen, war so genierlich, daß Breuer ihn schließlich recht barsch hatte auffordern müssen, sich zur Untersuchung zu entkleiden. Diagnose: follikuläre Angina. Wiewohl in der Handhabung der Instrumente zur Tonsillektomie geschickt, hielt Breuer den Eingriff in diesem Falle für verfrüht. Er verschrieb statt dessen kühlende Halskompressen, zum Gurgeln Kaliumchlorat und zum Inhalieren fein zerstäubtes, mit Kohlensäure gesättigtes Wasser. Da es die dritte Halsentzündung des Patienten in diesem Winter war, empfahl ihm Breuer zur Abhärtung der Haut und Erhöhung der Widerstandskraft täglich kalte Körpergüsse.
Während er nun also wartete, nahm er noch einmal den Brief zur Hand, welchen er vor drei Tagen von Fräulein Salomé erhalten hatte. Nicht minder herrisch als in ihrem ersten Billett kündigte sie an, sie werde heute um vier Uhr in seiner Praxis zur Besprechung erscheinen. Breuers Nasenflügel bebten vor Empörung. »Sie dekretiert, zu welcher Stunde ich sie zu erwarten hätte! Sie verfügt! Sie erweist mir die Ehre ...«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!