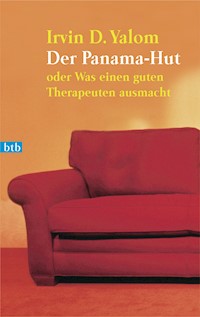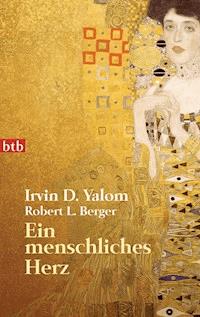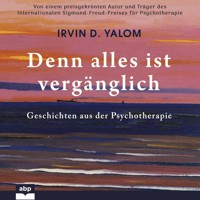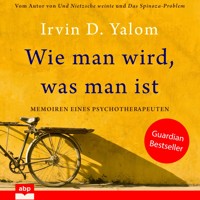11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irvin D. Yalom ist einer der angesehensten Psychotherapeuten Amerikas. Er gilt als Klassiker der existentiellen Psychotherapie, seine Lehrbücher und Romane erscheinen weltweit und erreichen Millionen. Seine Frau Marilyn, eine renommierte Kulturwissenschaftlerin und Autorin, starb im Herbst 2019 nach 65jähriger Ehe. Als klar war, dass ihre Krankheit zum Tode führen würde, begannen beide ein Buch zu schreiben - das am Ende Irvin D. Yalom alleine fertigstellen musste. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe und herausragenden intellektuellen Bezieung. Ein großes Alterswerk, das alle existentiellen Themen berührt, die uns angehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Irvin D. Yalom, einer der angesehensten Psychotherapeuten Amerikas, feiert am 13. Juni 2021 seinen neunzigsten Geburtstag. Er gilt als Klassiker der existentiellen Psychotherapie, seine Lehrbücher und Romane erscheinen weltweit und erreichen Millionen. Seine Frau Marilyn Yalom, eine renommierte Literaturwissenschaftlerin und Historikerin, starb im letzten Herbst nach fünfundsechzigjähriger Ehe. Als klar war, dass ihre schwere Krankheit zum Tode führen würde, begannen beide ein Buch zu schreiben – das am Ende Irvin D. Yalom alleine fertigstellen musste. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe und herausragenden intellektuellen Beziehung. Ein großes Alterswerk, das alle existentiellen Themen berührt, die uns angehen.
Autor und Autorin
IRVIN D. YALOM wurde 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington, D. C. geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den USA und als einer der bedeutendsten lebenden Vertreter der existentiellen Psychotherapie. Er ist vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Sigmund-Freud-Preis für Psychotherapie und dem Oskar Pfister Award. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine Romane sind seit Jahren internationale Bestseller.
MARILYN YALOM (1932 – 2019), renommierte und vielfach ausgezeichnete amerikanische Literaturwissenschaftlerin, zählt zu den Pionierinnen im Bereich der Gender Studies und war Mitbegründerin des ehemaligen Center for Research on Women (CROW) an der Stanford University. Für ihre Beiträge zur französischen Kultur wurde sie 1992 mit dem Ordre des Palmes Académiques ausgezeichnet. Yalom hat neben ihrer akademischen Tätigkeit eine Vielzahl erfolgreicher Sachbücher veröffentlicht.
Irvin D. Yalom und Marilyn Yalom waren fünfundsechzig Jahre miteinander verheiratet.
Irvin D. Yalom und Marilyn Yalom
UNZERTRENNLICH
Über den Tod und das Leben
Mit Fotos von Reid YalomÜbersetzt und mit einem Nachwortvon Regina Kammerer
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »A Matter of Death and Life« in der Stanford University Press, Stanford, CaliforniaDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Irvin D. Yalom und Marilyn Yalom
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
2021 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Lektorat: Frauke Brodd/write and read, Luxemburg
Covergestaltung: semper smile, München
nach einem Entwurf von Rob Ehle/Stanford University unter Verwendung eines Motivs von © Philip Delaquis
Covermotiv: © Matthias Günter: Das Kollektiv GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27407-8V005www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Fotos der Bildteile: © Reid YalomFotos im Innenteil: © privatDas Motto stammt von Rabbi Sanford Ragins, erstmals veröffentlicht in L’chol Z’man v’Ei: For sacred Moments – New Rabbi’s Manual, CCAR Press, © 2015 by Sanford Ragins. Reprintend with Permission.Der Auszug von Let Evening Come stammt von Jane Kenyon, Collected Poems, © 2005 by the estate of Jane Kenyon. Reprinted with the permission of The Permissions Company LLC on behalf of Graywolf Press, graywolfpress.org. Das Zitat von Jean-Paul Sartre stammt aus Jean-Paul Sartre, Die Wörter, Autobiographische Schriften, © 1965 by Rowohlt GmbH Verlag, in der Übersetzung von Hans Mayer.Die Bibelzitate stammen aus Die Bibel oder die ganze HeiligeSchrift des Altenund neuen Testamentes nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers. Textfassung 1912. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1982
INHALT
Vorwort
1 Die lebenswichtige Box
2 Krank werden
3 Bewusstsein der Vergänglichkeit
4 Warum ziehen wir nicht ins Betreute Wohnen
5 Ruhestand: Der exakte Moment der Entscheidung
6 Rückschläge und erneute Hoffnungen
7 In die Sonne schauen, wieder einmal
8 Um wessen Tod geht es?
9 Das Ende vor Augen
10 Ich ziehe ärztliche Beihilfe zum Suizid in Betracht
11 Ein angespannter Countdown bis Donnerstag
12 Eine komplette Überraschung
13 Jetzt weisst du es also
14 Todesurteil
15 Abschied von der Chemotherapie – und der Hoffnung
16 Von der Palliativbetreuung zur Sterbebegleitung
17 Hospizbetreuung
18 Eine tröstliche Illusion
19 Französische Bücher
20 Das Ende kommt in Sicht
21 Der Tod tritt ein
22 Die Nach-Tod-Erfahrung
Wir werden uns erinnernTrauerreden für Marilyn Yalom22. November
23 Leben als eigenständiger, alleinstehender Erwachsener
24 Allein zu Hause
25 Sex und Trauer
26 Unwirklichkeit
27 Taubheit
28 Hilfe von Schopenhauer
29 Eindeutige Verleugnung
30 Ausgehen
31 Unentschlossenheit
32 Wie ich mein eigenes Werk wiederentdecke
33 Sieben Lektionen zur Bewältigung von Leid für Fortgeschrittene
34 Meine Ausbildung geht weiter
35 Liebe Marilyn
Nachwort
Bildteil
Trauern ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir den Mut haben, andere zu lieben.
VORWORT
Unsere Beziehung begann und endete mit Büchern. Bei unserer ersten Begegnung waren wir fünfzehn Jahre alt, und Marilyn erzählte mir, sie habe die Schule geschwänzt, weil sie die ganze Nacht aufgeblieben war, um Margaret Mitchells tausendseitiges Vom Winde verweht zu Ende zu lesen. Ich war sofort entzückt von ihr. Auch ich war fasziniert von Romanen, und Marilyn war die erste Person, die ich kannte, die meine Leidenschaft fürs Lesen teilte. Schon bald verliebten wir uns, und seitdem sind wir unzertrennlich.
Beide schlugen wir akademische Karrieren ein nach unserem Abschluss an der Johns Hopkins University, wo ich eine psychiatrische Facharztausbildung absolvierte und Marilyn ihren Doktor der Vergleichenden Literaturwissenschaften erwarb (in Französisch und Deutsch). Ich war immer ihr erster Leser und Kritiker – und sie war immer meine erste Leserin und Kritikerin. Nachdem ich mein erstes Buch geschrieben hatte, ein Lehrbuch zur Gruppentherapie, bekam ich ein Stipendium der Rockefeller Foundation, um am Bellagio Center in Italien an meinem nächsten Buch zu arbeiten, an Die Liebeund ihr Henker. Kurz nach unserer Ankunft erzählte mir Marilyn von ihrem wachsenden Interesse an einem Thema, über das sie ausgezeichnetes Material vorliegen hatte, wie ich fand. Es ging um Frauenerinnerungen in der Französischen Revolution. Alle Rockefeller-Stipendiaten hatten ein Apartment und ein separates Studio zum Arbeiten, und ich drängte sie dazu, den Direktor zu fragen, ob er nicht eventuell auch ein Studio für sie habe. Der Direktor erwiderte, dies sei eine ungewöhnliche Bitte, ein Arbeitszimmer für die Ehefrau eines Gelehrten, außerdem seien die Studios im Hauptgebäude bereits alle vergeben. Aber nachdem er einige Minuten nachgedacht hatte, bot er Marilyn ein nicht genutztes Studio mitten im Wald an, das nur fünf Minuten Fußmarsch entfernt lag. Erfreut begann Marilyn mit Hochdruck an ihrem ersten Buch Compelled to Witness: Women’s Memoirs of the French Revolution (Zur Zeugenschaft verpflichtet: Wie Frauen die FranzösischeRevolution erinnern) zu schreiben. Sie war überglücklich. Von diesem Zeitpunkt an waren wir Schreibkollegen, und für den Rest ihres Lebens hielt sie – trotz den vier Kindern, einem Vollzeit-Lehrauftrag und verschiedenen Verwaltungsposten – Buch für Buch Schritt mit mir.
2019 wurde bei Marilyn ein Multiples Myelom diagnostiziert, ein Krebs der Plasmazellen (Antikörper produzierende weiße Blutkörperchen, die im Knochenmark zu finden sind). Sie musste sich einer Chemotherapie mit Revlimid unterziehen, was zu einem Schlaganfall führte, einem Besuch auf der Notaufnahme und vier Tagen im Krankenhaus. Zwei Wochen später, als sie wieder zu Hause war, unternahmen wir einen kleinen Spaziergang im nahegelegenen Park, und Marilyn verkündete: »Ich habe ein Buch im Kopf, das wir gemeinsam schreiben sollten. Ich möchte die schwierigen Tage und Monate, die vor uns liegen, dokumentieren. Vielleicht werden unsere Erfahrungen anderen Paaren, bei denen ein Partner an einer tödlichen Erkrankung leidet, helfen.«
Marilyn schlug oft Themen für Bücher vor, die sie oder ich angehen sollten, und ich erwiderte: »Das ist eine gute Idee, Liebes, aber du solltest dich darauf stürzen. Die Idee für ein gemeinsames Projekt ist verlockend, aber ich habe gerade mit einem Buch von Erzählungen begonnen, wie du weißt.«
»Oh, nein, nein – dieses Buchwirst du nicht schreiben. Du wirst dieses eine mit mir schreiben! Du wirst deine Kapitel schreiben und ich meine, und sie werden sich abwechseln. Es wird unser Buch werden, ein einzigartiges Buch, denn es wird zwei Denkweisen beinhalten, nicht nur eine, es werden die Überlegungen eines Paares sein, das seit fünfundsechzig Jahren verheiratet ist! Eines Paares, das glücklich genug ist, einander beistehen zu können auf diesem Weg, der schlussendlich zum Tode führt. Du gehst mit deinem Rollator, und ich gehe auf Beinen, die dazu höchstens noch fünfzehn oder zwanzig Minuten lang in der Lage sind.«
Irv und ich sind zum Schreiben gekommen, weil es das ist, was wir können und was uns aufrechterhält. Obwohl wir unsere Arbeiten immer gegenseitig korrigiert und kritisiert haben, ist dies das erste Mal in einem halben Jahrhundert, dass wir etwas gemeinsam schreiben. Wir stellen uns die Fragen, die alte Menschen beantwortet haben wollen, ehe sie sterben: Was müssen wir tun, um körperlich und geistig so gut wie möglich in Schuss zu bleiben? Wie können wir unsere Besitztümer gerecht an unsere Nachkommen verteilen? Welche Pläne müssen wir machen für unsere Beerdigung? Was ist mit dem, der alleine zurückbleibt? Wie können wir uns gegenseitig stützen und unsere verbleibenden Tage, Monate, Jahre genießen?
In seinem 1980 erschienenen Buch Existentielle Psychotherapie schrieb Irv, dass es leichter sei, dem Tod entgegenzutreten, wenn es nur wenig zu bereuen gibt in dem Leben, das man geführt hat. Wenn ich auf unser langes gemeinsames Leben zurückblicke, gibt es wenig, was wir bedauern. Aber das macht es nicht im Geringsten einfacher, die körperlichen Beschwernisse zu ertragen, die wir nun Tag für Tag erfahren, noch lindert es den Gedanken daran, dass wir uns gegenseitig verlassen müssen. Wie kämpfen wir gegen die Verzweiflung? Wie schaffen wir es, bis zum Ende ein bedeutsames Leben zu führen?
Wir schreiben dieses Buch in einem Alter, in dem die meisten unserer Zeitgenossen bereits tot sind. Wir leben nun jeden Tag mit dem Wissen, dass unsere gemeinsame Zeit begrenzt ist und äußerst kostbar. Wir schreiben, um unserer Existenz einen Sinn zu verleihen, auch wenn es uns in die dunkelsten Zonen des körperlichen Verfalls und des Todes befördert. Dieses Buch soll uns zuallererst und vor allem dabei helfen, mit dem Ende des Lebens zurechtzukommen.
Obwohl dieses Buch ganz offensichtlich ein Ergebnis unserer persönlichen Erfahrung ist, betrachten wir es auch als Teil eines allgemeinen, nationalen Dialogs zu Themen, die das Ende des Lebens mit sich bringt. Alle möchten die beste medizinische Versorgung erhalten, emotionalen Rückhalt bei Familie und Freunden finden und so schmerzlos wie möglich sterben. Selbst wir mit unseren medizinischen und gesellschaftlichen Vorteilen sind nicht immun gegen den Schmerz und die Furcht vor dem nahenden Tod. Wie alle möchten wir die Qualität unseres restlichen Lebens bewahren, selbst wenn das heißt, dafür medizinische Prozeduren tolerieren zu müssen, die uns auf dem Weg dorthin manchmal krank machen. Wie viel sind wir bereit zu ertragen, um am Leben zu bleiben? Wie können wir unsere Tage so schmerzlos wie möglich beenden? Wie können wir diese Welt der nächsten Generation würdig hinterlassen?
Wir beide wissen, dass Marilyn ziemlich sicher an ihrer Krankheit sterben wird. Dieses Tagebuch über das, was vor uns liegt, werden wir gemeinsam schreiben, in der Hoffnung, dass unsere Erfahrungen und Beobachtungen nicht nur uns Sinn und Beistand zu geben vermögen, sondern auch unseren Lesern und Leserinnen.
Irvin D. Yalom
Marilyn Yalom
KAPITEL 1 DIE LEBENSWICHTIGE BOX
Irv im April
Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich mit meinen Fingern über meine obere linke Brust streiche. Seit dem letzten Monat habe ich hier einen neuen Gegenstand sitzen, eine 5 x 5 Zentimeter große Metallbox, die mir von einem Chirurgen eingesetzt wurde, an dessen Namen und Gesicht ich mich nicht mehr erinnere. Alles begann mit einer Sitzung bei einer Physiotherapeutin, bei der ich war, weil ich Probleme mit meinem Gleichgewicht hatte. Als sie mir zu Anfang der Stunde den Puls fühlte, drehte sie sich mit einem schockierten Ausdruck auf dem Gesicht zu mir herum und meinte: »Sie und ich, wir gehen jetzt sofort in die Notaufnahme! Ihr Puls liegt bei dreißig.«
Ich bemühe mich, sie zu beruhigen. »Das ist schon seit Monaten so, aber mir geht es gut.«
Meine Worte beeindruckten sie wenig. Sie weigerte sich, unsere Therapiesitzung fortzusetzen, und nahm mir das Versprechen ab, sofort meinen Internisten, Dr. W., aufzusuchen, um die Sache mit ihm zu besprechen.
Drei Monate zuvor hatte Dr. W. bei der alljährlichen Routineuntersuchung meinen niedrigen und gelegentlich unregelmäßigen Puls bemerkt und mich zur Stanford Arrhythmia Clinic geschickt. Dort verpassten sie mir ein Zwei-Wochen-EKG, bei dem herauskam, dass ich unter einem andauernd erniedrigten Puls litt, mit periodischen, kurzen Anfällen von aurikulärem Herzflimmern. Um zu verhindern, dass sich ein Blutpfropfen Richtung Hirn löste, setzte mich Dr. W. auf Eliquis, ein Antikoagulans. Obwohl mich Eliquis vor einem Schlaganfall schützte, brachte es gleichzeitig neues Ungemach: Ich hatte schon seit Jahren Gleichgewichtsprobleme, und ein ernsthafter Sturz könnte nun tödlich enden, denn es gibt keine Möglichkeit, dem Antikoagulans in diesem Fall etwas entgegenzusetzen und die Blutung zu stoppen.
Als mich Dr. W. zwei Stunden nach der Empfehlung der Physiotherapeutin untersuchte, stimmte er zu, dass mein Puls noch niedriger geworden war, und verordnete mir erneut ein Zwei-Wochen-EKG.
Zwei Wochen später, als mir das Langzeit-EKG von einer medizinischen Fachkraft wieder abgenommen und zur Auswertung ans Labor geschickt worden war, kam es zu einem weiteren alarmierenden Zwischenfall, dieses Mal bei Marilyn: Sie und ich unterhielten uns gerade, als sie plötzlich nicht mehr sprechen konnte, sie brachte kein einziges Wort mehr heraus. Dieser Zustand dauerte fünf Minuten. Danach kam, über die nächsten Minuten, nach und nach ihre Fähigkeit zu sprechen zurück. Ich vermutete, dass sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Bei Marilyn war zwei Monate zuvor ein Multiples Myelom diagnostiziert worden, und sie hatte eine Chemotherapie begonnen. Es war möglich, dass durch diese starke Chemotherapie, der sie sich seit zwei Wochen unterzog, ein Schlaganfall ausgelöst worden war. Ich rief sofort Marilyns Internistin an, die zufällig in der Nähe war und zu uns nach Hause eilte. Nach einer schnellen Untersuchung rief sie einen Krankenwagen, um Marilyn in die Notaufnahme zu bringen.
Die nächsten Stunden im Wartebereich der Notaufnahme waren die schlimmsten, die Marilyn und ich je mitgemacht haben. Das von den Ärzten angeordnete CT belegte, dass sie in der Tat einen Schlaganfall infolge eines Blutgerinnsels erlitten hatte. Sie verabreichten ihr ein Medikament, tPA (Gewebespezifischer Plasminogenaktivator), um das Gerinnsel aufzulösen. Ein sehr kleiner Prozentsatz von Patienten reagiert allergisch auf dieses Medikament – und Marilyn war eine von ihnen. Sie starb beinahe in der Notaufnahme. Schrittweise erholte sie sich, ohne dass etwas vom Schlaganfall zurückgeblieben war, und nach vier Tagen konnte sie das Krankenhaus verlassen.
Aber das Schicksal war noch nicht fertig mit uns. Nur Stunden, nachdem ich Marilyn vom Krankenhaus nach Hause gebracht hatte, rief mich mein Arzt an, um mir mitzuteilen, es sei aufgrund der Ergebnisse des Langzeit-EKGs unumgänglich, dass ich mir einen Herzschrittmacher in die Brust einsetzen ließe. Ich entgegnete, Marilyn sei gerade erst aus dem Krankenhause nach Hause gekommen und ich müsse mich unbedingt um sie kümmern. Ich versicherte ihm, dass ich mich Anfang der nächsten Woche sofort um einen OP-Termin bemühen würde.
»Nein, nein, Irv«, entgegnete mein Arzt, »hören Sie mir zu: Das hier ist nicht verhandelbar. Sie müsseninnerhalb der nächsten Stunde in die Notaufnahme, um diesen Eingriff vornehmen zu lassen. Ihr Langzeit-EKG hat ergeben, dass Sie 3.291 AV-Blocks über die Dauer von einem Tag und sechs Stunden hatten.«
»Was genau bedeutet das?«, fragte ich. Meine letzte Lehrstunde in kardialer Physiologie war beinahe sechzig Jahre her, und ich gebe zu, nicht auf der Höhe des medizinischen Fortschritts geblieben zu sein.
»Das bedeutet«, erklärte er, »dass es in den letzten zwei Wochen über dreitausendmal dazu gekommen ist, dass der elektrische Impuls von Ihrem natürlichen Schrittmacher im linken Vorhof nicht zur Herzkammer darunter durchgedrungen ist. Dies führte zu einer Unterbrechung, woraufhin die Herzkammer sprunghaft reagierte, um das Herz aus eigener Kraft wieder zum Schlagen zu bringen. So etwas ist lebensbedrohlich und muss sofort behandelt werden.«
Ich fuhr also sofort in die Notaufnahme, wo mich ein Herzchirurg untersuchte. Drei Stunden später wurde ich in den Operationssaal gerollt und bekam einen Herzschrittmacher eingesetzt. Vierundzwanzig Stunden später wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen.
Die Verbände waren inzwischen entfernt worden, und die Metallbox saß in meiner Brust genau links unter dem Schlüsselbein. Siebzigmal in der Minute befiehlt dieses metallische Gerät meinem Herzen nun zu schlagen, und dies wird es in den nächsten zwölf Jahren weiterhin zuverlässig tun, ohne aufgeladen werden zu müssen. Es ist das erstaunlichste mechanische Hilfsmittel, dem ich je begegnet bin. Anders als eine Taschenlampe, die nicht leuchtet, eine TV-Fernbedienung, mit der sich die Programme nicht regeln lassen, ein Navigationsgerät, das die Richtung nicht anzeigt, arbeitet dieses kleine Gerät auf höchstmöglichen Touren. Sollte es versagen, wäre mein Leben innerhalb von Minuten zu Ende. Ich bin wie betäubt von der Zerbrechlichkeit meines Daseins.
So, dies ist also meine gegenwärtige Situation: Marilyn, meine geliebte Frau, der wichtigste Mensch in meinem Leben seit meinem fünfzehnten Lebensjahr, leidet an einer schweren Krankheit, und mein eigenes Leben fühlt sich gefährlich fragil an.
Und trotzdem bin ich seltsamerweise ruhig, fast gelassen. Warum bin ich nicht verschreckt? Diese sonderbare Frage stelle ich mir immer wieder. Ich war meist körperlich gesund in meinem Leben, und doch hatte ich immer in gewissem Maße mit der Furcht vor dem Tod zu kämpfen. Ich glaube, dass mein Forschen und Schreiben zu diesem Thema und meine fortwährenden Versuche, Patienten beizustehen, die dem Tod gegenüberstanden, ihren Ursprung in meiner eigenen großen Angst haben. Aber was ist nun mit dieser schrecklichen Angst geschehen? Woher kommt meine Ruhe, wenn der Tod doch so viel näher rückt?
Während die Tage vergehen, rücken unsere qualvollen Erlebnisse in den Hintergrund. Marilyn und ich verbringen die Morgen in unserem Hinterhof. Wir sitzen nebeneinander und halten Händchen, während wir die Bäume um uns herum bewundern und in Erinnerungen an unser gemeinsames Leben schwelgen. Wir reden über unsere vielen Reisen: unsere zwei Jahre auf Hawaii, als ich in der Army war und wir am herrlichen Kailua Beach lebten, unser Sabbatical-Jahr in London, weitere sechs Monate in der Nähe von Oxford, mehrere Monate in Paris, andere lange Aufenthalte auf den Seychellen, in Bali, Frankreich, Österreich und Italien.
Nachdem wir uns in diesen exquisiten Erinnerungen verloren haben, drückt Marilyn meine Hand und sagt: »Irv, da gibt es nichts, was ich würde ändern wollen.«
Und ich stimme ihr aus vollem Herzen zu.
Beide haben wir das Gefühl, unser Leben ganz gelebt zu haben. Kein Gedanke, den ich bei Patienten mit Todesangst eingesetzt habe, um Trost zu spenden, war machtvoller als dieser: ein Leben ohne Reue zu führen.
Marilyn und ich fühlen uns beide frei von Bedauern – wir haben mutig und in Gänze gelebt. Wir ließen uns die Möglichkeiten, die uns geschenkt wurden, um zu wachsen, nicht entgehen, und nun hatten wir wenig ungelebtes Leben zu beklagen.
Marilyn geht zurück ins Haus, um sich ein wenig hinzulegen. Die Chemotherapie zehrt an ihren Kräften, und oft verschläft sie einen Großteil des Tages. Ich lehne mich in meiner Chaiselongue zurück und denke an die vielen Patienten, die überwältigt waren von der Furcht vor dem Tod – und auch an die vielen Philosophen, die sich dem Tod unverblümt annahmen.
Vor zweitausend Jahren sagte Seneca: »Wie bei einem Theaterstück kommt es beim Leben nicht darauf an, wie lange es dauert, sondern wie gut es gespielt wird.« Nietzsche, der Meister der Sinnsprüche, sagte: »Man muss gefährlich leben.« Ein anderer Spruch von Nietzsche kommt mir ebenfalls in den Sinn: »Viele sterben zu spät, und einige sterben zu früh … ›stirb zur rechten Zeit‹!«
Hm, zur rechten Zeit … Volltreffer. Ich bin fast achtundachtzig und Marilyn siebenundachtzig. Unsere Kinder und Enkelkinder sind im Leben angekommen. Ich fürchte, ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Ich bin dabei, meine therapeutische Praxis aufzugeben, und meine Frau ist nun ernsthaft erkrankt.
»Stirb zur rechten Zeit!« Es ist schwer, diesen Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Und dann geht mir ein anderer Spruch von Nietzsche durch den Sinn: »Was vollkommen ward, alles Reife – will sterben … Aber alles Unreife will leben … Alles, was leidet, will leben, dass es reif werde und lustig und sehnsüchtig, sehnsüchtig nach Fernerem, Höherem, Hellerem.«
Ja, auch diese Zeilen treffen ziemlich genau ins Schwarze. Reife – das passt. Reife ist genau das, was wir beide, Marilyn und ich, gerade erfahren.
Meine Gedanken über den Tod gehen auf die frühe Kindheit zurück. Ich erinnere mich daran, dass ich als Jugendlicher berauscht von E. E. Cummings Gedicht »Buffalo Bill’s Defunct« war und es mir viele, viele Male vorsprach, während ich auf meinem Fahrrad dahinfuhr.
Buffalo Bill’s
defunct
who used to
ride a watersmooth-silver
stallion
and break onetwothreefourfive pigeonsjustlikethat
Jesus
he was a handsome man
and what i want to know is
how do you like your blue-eyed boy
Mister Death
Ich war dabei oder fast dabei, als meine Eltern starben. Mein Vater saß nur ein paar Schritte von mir entfernt, als ich sah, wie sein Kopf plötzlich kippte und seine Augen nach links gingen, zu mir. Ich hatte meine medizinische Ausbildung gerade einen Monat zuvor beendet und griff zu einer Spritze aus dem Arztkoffer meines Schwagers, um ihm Adrenalin direkt ins Herz zu injizieren. Aber es war zu spät: Er war an einem massiven Schlaganfall gestorben.
Zehn Jahre später besuchten meine Schwester und ich meine Mutter im Krankenhaus: Sie hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Wir saßen stundenlang bei ihr und redeten, bis sie schließlich in den OP geschoben wurde. Anschließend gingen wir für einen kurzen Spaziergang nach draußen, und als wir zurückkamen, war ihr Bett bereits abgezogen. Nur die Matratze war noch da. Keine Mutter mehr.
Es ist 8:30 Uhr an einem Samstagmorgen. Mein Tag bis dahin: Gegen 7 Uhr bin ich aufgewacht und habe wie immer ein wenig gefrühstückt, um anschließend die knapp fünfzig Meter zu meinem Studio zurückzulegen, wo ich meinen Computer hochgefahren habe, um meine E-Mails zu checken. Die erste E-Mail lautet folgendermaßen:
Mein Name ist M, ich bin ein Student aus dem Iran. Ich war wegen Panikattacken in Behandlung, bis mir mein Arzt Ihre Bücher ans Herz legte und vorschlug, ich solle Existentielle Psychotherapie lesen. Als ich dieses Buch las, hatte ich das Gefühl, die Antwort auf viele der Fragen, die ich mir seit meiner Kindheit stelle, gefunden zu haben, und ich hatte das Gefühl, Sie beim Lesen auf jeder Seite neben mir zu haben. Es sind Ängste und Zweifel, auf die niemand außer Ihnen eine Antwort hat. Ich lese jeden Tag in Ihren Büchern, und die letzte Panikattacke liegt nun einige Monate zurück. Ich bin so glücklich, auf Sie gestoßen zu sein, als ich an einem Punkt in meinem Leben angelangt war, an dem ich keine Hoffnung mehr hatte. Ihre Bücher zu lesen hat mir Hoffnung gegeben. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken.
Mir steigen Tränen in die Augen. Briefe wie diese erreichen mich jeden Tag – normalerweise sind es zwischen zwanzig und dreißig täglich –, und ich fühle mich wirklich gesegnet, dass ich die Möglichkeit habe, so vielen zu helfen. Und weil diese E-Mail aus dem Iran kommt, einem unserer »Feinde«, bedeutet sie mir noch mehr. Es gibt mir das Gefühl, dass ich zu einer Liga von Menschenfreunden gehöre, die versucht, der Menschheit zu helfen.
Ich antworte dem iranischen Studenten:
Ich bin sehr froh, dass meine Bücher wichtig für Sie sind und dass sie Ihnen helfen konnten. Hoffen wir, dass unsere beiden Länder eines Tages wieder zu Verstand kommen und Mitgefühl füreinander entwickeln.
Mit vielen herzlichen Grüßen – Irv Yalom
Ich bin immer sehr berührt von meiner Fan-Post, auch wenn mich manchmal die schiere Anzahl überwältigt. Ich versuche, jeden Brief zu beantworten, und achte darauf, jeden, der mir schreibt, auch namentlich anzusprechen, damit jeder und jede weiß, dass ich ihre Briefe gelesen habe. Ich sammele sie in einem E-Mail-Ordner unter dem Begriff »Fans«, damit habe ich vor einigen Jahren angefangen, und inzwischen sind es mehrere tausend Einträge. Ich markiere diesen Brief mit einem Stern – ich habe vor, mir diese mit Sternchen versehenen Briefe wieder ins Gedächtnis zu rufen, sollte ich einmal niedergeschlagen sein und etwas Aufmunterung brauchen.
Inzwischen ist es 10 Uhr, und ich verlasse mein Büro. Sobald ich draußen bin, kann ich das Fenster unseres Schlafzimmers sehen und schaue hinüber zum Haus. Ich sehe, dass Marilyn wach ist und die Vorhänge zurückgezogen hat. Sie ist immer noch sehr schwach von der Chemotherapie, die sie vor drei Tagen erhalten hat, und ich beeile mich, ins Haus zu kommen, um ihr ein kleines Frühstück zuzubereiten. Aber sie hat bereits etwas Apfelsaft getrunken und keinen Appetit auf etwas anderes. Sie liegt auf der Couch im Wohnzimmer und genießt den Blick auf die alte Eiche in unserem Garten.
Wie immer frage ich sie, wie sie sich fühlt.
Wie immer antwortet sie ehrlich: »Ich fühle mich furchtbar. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin getrennt von allem … in meinem Körper geschehen schreckliche Dinge. Wenn du nicht wärst, wäre ich nicht mehr hier … Ich möchte nicht mehr leben … Es tut mir leid, dass ich dir das immer wieder sage. Ich weiß, dass ich es andauernd sage.«
Ich habe sie diese Worte seit mehreren Wochen jeden Tag sagen hören. Ich fühle mich mutlos, hilflos. Nichts schmerzt mich mehr als ihr Schmerz: Sie muss sich jeder Woche einer Chemotherapie unterziehen, die mit Übelkeit, Kopfschmerzen und extremer Müdigkeit einhergeht. Sie fühlt sich ihrem Körper und allem und jedem um sie herum unsäglich entfremdet. Viele Chemotherapie-Patienten bezeichnen dies als »Chemo-Brain«. Ich ermutige sie, wenigstens die dreißig Meter zum Briefkasten zu gehen, jedoch wie immer vergeblich. Ich halte ihre Hand und versuche, ihr auf jede erdenkliche Weise Kraft zu spenden.
Heute reagiere ich anders, als sie erneut ihren Wunsch äußert, nicht länger so leben zu wollen. »Marilyn, wir haben schon öfters über die kalifornische Gesetzgebung gesprochen, die es Ärzten erlaubt, Sterbehilfe zu leisten, wenn ihre Patienten an einer unheilbaren Erkrankung leiden und unerträgliche Schmerzen haben. Erinnerst du dich an unsere Freundin Alexandra, die genau das in Anspruch genommen hat? In den letzten Monaten hast du immer wieder gesagt, dass du nur noch wegen mir am Leben bist und dir Sorgen machst, wie ich das ohne dich überstehe. Ich habe lange darüber nachgedacht. Gestern Nacht lag ich deswegen stundenlang wach im Bett. Ich möchte, dass du eines weißt: Ich werde deinen Todüberstehen. Ich kann weiterleben – wahrscheinlich nicht allzu lange, wenn man an die kleine Metallkiste in meiner Brust denkt. Ich werde dich ohne jeden Zweifel jeden einzelnen Tag meines Lebens vermissen … aber ich werde in der Lage sein weiterzumachen. Der Tod jagt mir nicht mehr diese schreckliche Angst ein … nicht mehr so wie früher.
Erinnerst du dich daran, wie ich mich nach meiner Knieoperation und dem Schlaganfall gefühlt habe, der mich das Gleichgewicht gekostet und dazu gezwungen hat, einen Rollator oder Stock zu benutzen? Erinnerst du dich, wie elend es mir ging und wie depressiv ich war? Es reichte, um wieder in Therapie zu gehen. Nun, wie du weißt, ging auch das vorbei. Ich bin inzwischen ruhiger – leide keine Qualen mehr –, ich schlafe sogar einigermaßen.
Ich will, dass du Folgendes weißt: Ich kann deinen Tod überleben. Was ich nicht ertragen kann, ist der Gedanke, dass du nur wegen mir mit solch unerträglichen Schmerzen am Leben bleibst.«
Marilyn schaut mir tief in die Augen. Dieses Mal haben meine Worte sie berührt. Wir sitzen lange zusammen und halten uns an den Händen. Einer von Nietzsches Sätzen geht mir durch den Kopf: »Der Gedanke an den Selbstmord ist ein sehr starkes Trostmittel. Man kommt damit gut über die ›böse Nacht‹ hinweg.« Aber ich behalte ihn für mich.
Marilyn schließt für eine Weile ihre Augen, dann nickt sie. »Danke, dass du das gesagt hast. Das hast du noch nie. Es ist eine Erleichterung … Ich weiß, dass diese Monate ein Alptraum für dich waren. Du musstest alles übernehmen – einkaufen, kochen, mich zum Arzt und in die Klinik fahren, dort stundenlang auf mich warten, mich anziehen, meine Freunde anrufen. Ich weiß, wie erschöpft du bist. Aber trotzdem scheint es dir einigermaßen gut zu gehen. Du wirkst so ausgeglichen, so stabil. Du hast mir immer wieder gesagt, dass du mir meine Krankheit abnehmen würdest, wenn du könntest. Und ich weiß, das würdest du. Du hast dich immer um mich gekümmert, mich immer geliebt, aber in letzter Zeit bist du anders.«
»Wie meinst du das?«
»Schwer zu beschreiben. Manchmal scheinst du so im Frieden mit dir. Du wirkst beinahe gelassen. Wie kommt das? Wie hast du das geschafft?«
»Das ist die große Frage. Ich weiß es selber nicht. Aber ich habe eine Ahnung, und es hat nichts mit meiner Liebe zu dir zu tun. Du weißt, dass ich dich liebe, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Es geht um etwas anderes.«
»Erzähl es mir.« Marilyn setzt sich auf und schaut mich aufmerksam an.
»Ich denke, es hat damit zu tun.« Ich tätschele die Metallkiste in meiner Brust.
»Du meinst mit deinem Herzen? Aber warum die Ruhe?«
»Diese Kiste, die ich ständig berühre und reibe, erinnert mich dauernd daran, dass ich an meinen Herzproblemen sterben werde, wahrscheinlich plötzlich und schnell. Ich werde nicht wie John sterben oder all die anderen, die wir in dieser Demenzabteilung gesehen haben.«
Marilyn nickt; sie versteht es genau. John war ein enger Freund mit schwerer Demenz, der vor Kurzem in einem Seniorenheim in der Nähe gestorben ist. Als ich ihn das letzte Mal besucht habe, erkannte er weder mich noch andere: Er stand nur noch da und schrie Stunde um Stunde. Ich bekomme dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf: Es ist mein Alptraum von einem Tod.
»Nun, dank dem, was in meiner Brust vor sich geht«, sage ich und berühre meine Metallkiste, »werde ich wohl schnell sterben – wie mein Vater.«
KAPITEL 2 KRANK WERDEN
Marilyn im Mai
Jeden Tag liege ich auf dem Sofa in unserem Wohnzimmer und schaue durch die hohen Fenster nach draußen auf die Eichen und immergrünen Pflanzen, die in unserem Garten zu Hause sind. Der Frühling ist gekommen, und ich habe beobachtet, wie die grünen Blätter an unserer wunderbaren Kalifornischen Eiche zurückgekehrt sind. Heute früh habe ich eine Eule auf der Fichte zwischen unserem Haus und Irvs Studio sitzen sehen. Ich kann ein Stück von dem Gemüsegarten sehen, den unser Sohn Reid angelegt hat, mit Tomaten, grünen Bohnen, Gurken und Kürbis. Er möchte, dass ich an das Gemüse denke, wie es im Sommer heranreifen wird, wenn es mir vermutlich wieder »besser« geht.
In den letzten Monaten ist es mir meist schlecht gegangen. Man hat ein Multiples Myelom bei mir festgestellt, mich auf starke Medikamente gesetzt, ich habe einen Schlaganfall erlitten. Auf meine wöchentlichen Chemotherapie-Infusionen folgen unweigerlich Tage von Übelkeit und andere Formen körperlicher Beschwerden, deren Beschreibung ich Ihnen erspare. Ich bin die meiste Zeit erschöpft – es ist, als ob mein Hirn in Watte gepackt ist oder ein Nebelschleier zwischen mir und dem Rest der Welt hängt.
Mehrere Freundinnen von mir hatten Brustkrebs, und erst jetzt begreife ich so richtig, was sie durchmachen mussten, um ihre Krankheit zu bekämpfen. Chemotherapie, Bestrahlung, Operation, Selbsthilfegruppen – all das war Teil ihres Alltags als Brustkrebspatientinnen. Als ich vor fünfundzwanzig Jahren Eine Geschichteder Brust schrieb, wurde Brustkrebs noch als »tödliche« Erkrankung betrachtet. Heute sehen sie Ärzte als eine »chronische« an, die behandelt und zu einem Stillstand gebracht werden kann. Fast beneide ich Brustkrebspatientinnen, denn sie können mit der Chemotherapie aufhören, sobald eine Remission vorliegt. Patienten mit einem Multiplen Myelom müssen im Allgemeinen kontinuierlich behandelt werden, wenn auch nicht unbedingt im Ein-Wochen-Rhythmus, den ich gerade ertrage. Wieder und wieder stelle ich mir die Frage: Ist es das wirklich wert?
Ich bin siebenundachtzig Jahre alt. Mit siebenundachtzig ist man reif genug, um zu sterben. Wenn ich in die Traueranzeigen des San Francisco Chronicle und der New York Times schaue, sehe ich, dass die meisten Menschen in ihren Achtzigern oder jünger sind. Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA beträgt neunundsiebzig Jahre. Selbst in Japan, das weltweit die höchste Lebenserwartung hat, liegt das Durchschnittsalter für Frauen bei 87,32 Jahren. Nach dem langen und sehr glücklichen Leben, das ich mit Irv geführt habe, und zwar bei meist guter Gesundheit, warum sollte ich jetzt mit täglicher Qual und Verzweiflung leben wollen?
Die simple Antwort ist die, dass es keinen einfachen Weg zu sterben gibt. Wenn ich die Behandlung ablehne, werde ich eher früher als später qualvoll an meinem Multiplen Myelom sterben. In Kalifornien ist ärztliche Sterbehilfe erlaubt. Ich könnte, wenn ich mich dem Ende nähere, Beistand bei einem Arzt suchen und assistierten Selbstmord begehen.
Aber es gibt eine andere, kompliziertere Antwort auf die Frage, ob ich am Leben bleiben sollte. In dieser fürchterlichen Zeit ist mir immer bewusster geworden, wie sehr mein Leben mit dem Leben anderer verbunden ist – nicht nur mit meinem Mann und meinen Kindern, sondern auch mit den vielen Freunden und Freundinnen, die mich in meiner Zeit der Not kontinuierlich unterstützen. Diese Freunde haben viele ermutigende Botschaften geschrieben, sie haben Essen vorbeigebracht und Blumen und Pflanzen geschickt. Eine alte Freundin vom College schenkte mir einen weichen, kuscheligen Bademantel. Und eine andere strickte mir einen wollenen Schal. Ich bin mir immer wieder bewusst, wie gesegnet ich bin, zusätzlich zu meiner Familie solche Freunde zu haben. Schließlich ist mir klar geworden, dass man nicht nur für sich alleine, sondern auch für andere am Leben bleibt. Obwohl diese Einsicht auf der Hand liegen mag, verstehe ich sie erst jetzt so ganz.
Wegen meiner Verbindung zum Center for Research on Women (dem ich offiziell zwischen 1976 und 1987 vorstand), entwickelte ich ein Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Unterstützerinnen, von denen viele zu engen Freundinnen wurden. Fünfzehn Jahre lang, von 2004 bis 2019, führte ich einen literarischen Salon bei mir zu Hause in Palo Alto und in meinem Apartment in San Francisco. Eingeladen waren Schriftstellerinnen, die vor Ort in der Bay Area lebten, was ebenfalls beträchtlich zur Erweiterung meines Freundeskreises beitrug. Als frühere Professorin für Französisch fuhr ich zudem, wann immer ich konnte, nach Frankreich und verbrachte Zeit in anderen europäischen Ländern. Ja, ich hatte eine beneidenswerte Position, die es mir ermöglichte, solche Freundschaften zu schließen. Der Gedanke tröstet mich, dass mein Leben oder Tod für viele Freunde und Freundinnen weltweit von Bedeutung ist – in Frankreich, Cambridge, New York, Dallas, Hawaii, Griechenland, der Schweiz und in Kalifornien.
Glücklicherweise leben unsere vier Kinder – Eve, Reid, Victor und Ben – alle in Kalifornien, drei von ihnen in der Bay Area und der Vierte in San Diego. In diesen vergangenen Monaten sind sie sehr präsent in unserem Leben gewesen, sie waren tage- und nächtelang in unserem Haus, kochten für uns und sprachen uns Mut zu. Eve, die Ärztin ist, versorgte mich mit Cannabis-Kaugummis – vor jedem Essen nahm ich ein halbes, um etwas gegen meine Übelkeit zu tun und mehr Appetit zu bekommen. Sie scheinen besser zu wirken als alle anderen Medikamente und haben keine nennenswerten Nebenwirkungen.
Lenore, unsere Enkelin aus Japan, lebt in diesem Jahr bei uns, während sie bei einem Silicon Valley Biotech Start-up arbeitet. Zunächst konnte ich ihr dabei helfen, sich an das amerikanische Leben zu gewöhnen – jetzt ist sie es, die sich um mich kümmert. Sie hilft uns bei Problemen mit unseren Computern und Fernsehern und erweitert unseren Speiseplan mit japanischem Essen. Wir werden sie sehr vermissen, wenn sie uns in ein paar Monaten verlässt, um an die Northwestern University zu gehen.
Aber vor allem ist es Irv, der mir Kraft gibt. Er kümmert sich so rührend und liebevoll um mich – ist geduldig, verständnisvoll, hingebungsvoll bemüht, mein Elend zu lindern. Ich fahre seit fünf Monaten kein Auto mehr, und abgesehen von der Zeit, in der unsere Kinder zu Besuch sind, ist es Irv, der einkauft und kocht. Er fährt mich zu meinen Arztterminen und bleibt während den mehrstündigen Infusionen an meiner Seite. Er durchforstet abends das Fernsehprogramm und lässt auch Sendungen über sich ergehen, die kaum seine erste Wahl wären. Ich schreibe dies nicht, um ihm zu schmeicheln oder ihn wie einen Heiligen vor meinen Lesern dastehen zu lassen. Es ist einfach die ungeschminkte Wahrheit, wie ich sie erlebe.
Oft vergleiche ich meine Situation mit jener von Patienten, die keinen liebevollen Partner oder Freund an ihrer Seite haben und die gezwungen sind, die Behandlungen ganz alleine durchzustehen. Als ich vor Kurzem im Stanford Infusion Center saß und auf meine Chemotherapie wartete, sagte die Frau neben mir, dass sie ganz alleine sei im Leben, aber Trost in ihrem christlichen Glauben finde. Sie muss ihre ärztlichen Termine ohne jemanden, der ihr beisteht, organisieren, spürt jedoch immer die Gegenwart Gottes. Obwohl ich selbst nicht gläubig bin, freute ich mich für sie. Und es spendet mir auch Trost, wenn Freunde sagen, dass sie für mich beten. Meine Bahai-Freundin Vida betet jeden Tag für mich, und falls es einen Gott gibt, kann er gar nicht anders, als ihre inbrünstigen Gebete erhören. Andere Freunde und Freundinnen – Katholiken, Protestanten, Juden und Muslime – haben ebenfalls geschrieben, dass ich in ihren Gebeten bin. Die Schriftstellerin Gail Sheehy rührte mich zu Tränen, als sie schrieb: »Ich werde für dich beten, und ich werde mir vorstellen, dass du in Gottes Hand bist. Du bist schmal genug, um genau hineinzupassen.«
Von unserer Kultur her jüdisch, glauben Irv und ich nicht an ein Weiterleben nach dem Tod. Und trotzdem tragen mich die Worte der hebräischen Bibel: »Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück.« (Psalm 23) Diese Worte kreisen in meinem Kopf, sie haben sich ebenso festgesetzt wie viele andere aus religiösen und nicht religiösen Quellen.
»Tod, wo ist dein Stachel?« (I. Korinther)
»Das Schlimmste ist der Tod, und der Tod wird schließlich siegen.« (Shakespeare, Richard II.)
Und da ist »The Bustle in the House,« ein wunderbares Gedicht von Emily Dickenson:
The sweeping up the Heart And putting love away
We shall not want to use again Until Eternity –
All diese vertrauten poetischen Sätze gewinnen eine neue Bedeutung in meiner gegenwärtigen Situation, während ich auf dem Sofa liege und nachdenke. Mit Sicherheit kann ich nicht dem Rat von Dylan Thomas folgen: »Glüh, rase Alter, weil dein Tag vergeht.« Es steckt nicht mehr genügend Lebenskraft in mir. Ich fühle mich einigen der prosaischen Inschriften näher, auf die mein Sohn Reid und ich stießen, als wir 2008 für unser Buch The American Resting Place (Die amerikanische Ruhestätte) Grabsteine fotografierten. Eine davon ist mir noch in guter Erinnerung: »In euren Herzen lebe ich weiter.« In den Herzen jener weiterleben, die wir zurücklassen, oder wie Irv es so oft sagt: im Leben jener »Wellen schlagen«, die uns persönlich oder durch unser Werk kennengelernt haben, oder aber dem Rat des Heiligen Paulus folgen, der schrieb: »Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.« (I. Korinther 13)
Paulus’ Plädoyer für die alles überragende Kraft der Nächstenliebe ist es immer wieder wert, gelesen zu werden. Er erinnert uns daran, dass die Liebe im Sinne von Güte gegenüber anderen und Mitgefühl für ihr Leid über allen anderen Tugenden steht. (Die Feministin in mir ist immer wieder schockiert, wenn ich lese, was im Korintherbrief folgt: dass Frauen »in der Gemeinde schweigen sollen« und dass sie »daheim ihre Männer fragen« sollen, wenn sie etwas lernen wollen; dass es eine Schande sei, wenn Frauen in der Kirche sprechen. Wenn ich das lese, kichere ich jedes Mal leise in mich hinein, weil ich mich an Reverend Jane Shaws zahlreiche großartigen Predigten in der Stanford Chapel erinnere.)
Henry James hat die Worte von Paulus über die Nächstenliebe in eine kluge Formel gepackt:
Drei Dinge sind im Leben eines Menschen wichtig.
Erstens: Menschlichkeit. Zweitens: Menschlichkeit. Drittens: Menschlichkeit.
Ich hoffe, mich an dieses Diktum zu halten, auch wenn mir meine persönliche Situation Schmerzen bereitet.
Ich kenne viele Frauen, die ihrem Tod oder dem ihrer Ehemänner tapfer ins Auge sahen. Als ich im Februar 1954 zum Begräbnis meines Vaters vom Wellesley College nach Washington, D. C. zurückkehrte, waren die ersten Worte meiner trauernden Mutter an mich, ich müsse »sehr tapfer« sein. Sie war immer eine sehr großherzige Frau, und ihre Sorge um ihre Töchter überwog alles, als sie ihren Mann nach siebenundzwanzigjähriger Ehe begrub. Mein Vater war damals erst vierundfünfzig und starb ganz plötzlich, beim Tiefseefischen in Florida, an einem schweren Herzinfarkt.
Einige Jahre später heiratete meine Mutter erneut. Sie brachte es schließlich auf vier Ehen und begrub vier Ehemänner! Sie lebte lange genug, um ihre Enkelkinder noch kennenzulernen und sogar einige ihrer Urenkel. Nachdem sie nach Kalifornien gezogen war, um in unserer Nähe zu sein, starb sie friedlich im Alter von zweiundneunzigeinhalb Jahren. Ich war immer davon ausgegangen, dass ich in ihrem Alter sterben würde – aber nun weiß ich, dass ich es nicht in meine Neunziger schaffen werde.
Eine enge Freundin, Susan Bell, erreichte fast die Neunzig. Susan war dem Tod mehr als einmal im Leben von der Schippe gesprungen: Sie war 1939 mit ihrer Mutter vor dem Einmarsch der Nazis in die Tschechoslowakei nach London entkommen, ihr Vater, der zurückblieb, war im Konzentrationslager Theresienstadt gestorben. Sie und ihre Eltern waren Protestanten, aber für die Nazis waren Susans vier jüdische Großeltern Grund genug, ihr Leben zu bedrohen und ihrem Vater das Leben zu nehmen.
Ein paar Wochen bevor sie starb, schenkte Susan mir etwas Kostbares – ihre silberne Teekanne aus dem England des neunzehnten Jahrhunderts. Es war Tee aus dieser Kanne gewesen, der uns 1990 wach gehalten hatte, als wir an unserem Buch Revealing Lives (Aufschlussreiche Leben