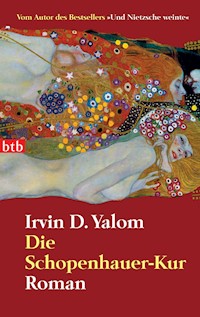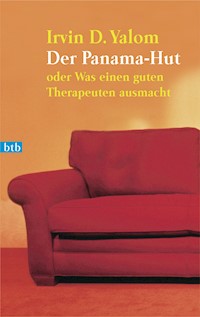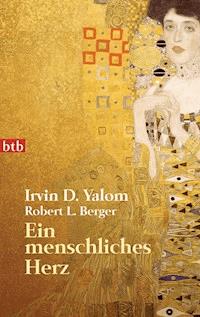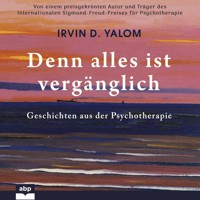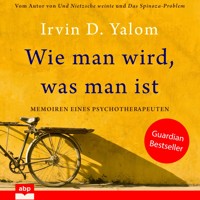9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Opus Magnum des großen amerikanischen Psychoanalytikers und Bestsellerautors Irvin D. Yalom
Der jüdische Philosoph Spinoza und der nationalsozialistische Politiker Alfred Rosenberg – nicht nur Jahrhunderte liegen zwischen ihnen, auch ihre Weltanschauungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine ein unbeugsamer Freigeist, der wegen seiner religionskritischen Ansichten aus der jüdischen Gemeinde verbannt wurde und heute als Begründer der modernen Bibelkritik gilt. Der andere ein verbohrter, von Hass zerfressener Antisemit, dessen Schriften ihn zum führenden Ideologen des nationalsozialistischen Regimes machten und der dafür bei den Nürnberger Prozessen zur Rechenschaft gezogen wurde. Und trotzdem gibt es eine Verbindung zwischen ihnen, von der kaum jemand weiß, denn bis zu seinem Tod war Rosenberg wie besessen vom Werk des jüdischen Rationalisten, als dessen »entschiedenster Verehrer« sich kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe bezeichnet. Fesselnd erzählt der große Psychoanalytiker Irvin D. Yalom die Geschichte dieser beiden unterschiedlichen Männer und entführt seine Leser dabei in die Welt der Philosophie und gleichzeitig auch in die Tiefen der menschlichen Psyche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Irvin D. Yalom
Das Spinoza-Problem
Roman
Aus dem Amerikanischen von Liselotte Prugger
Für Marilyn
Prolog
Spinoza fasziniert mich schon lange, seit Jahren wollte ich über diesen kühnen Denker des siebzehnten Jahrhunderts schreiben, der so ganz allein auf sich gestellt – ohne eine Familie, ohne eine Gemeinschaft im Hintergrund – Bücher schrieb, die wahrlich die Welt veränderten. Er ahnte die Säkularisation voraus, den liberalen, demokratischen politischen Staat, die zunehmende Bedeutung der Naturwissenschaften, und er ebnete den Weg für die Aufklärung. Die Tatsache, dass er im Alter von vierundzwanzig Jahren von den Juden exkommuniziert und für den Rest seines Lebens von den Christen zensiert wurde, faszinierte mich schon immer, vielleicht auch aufgrund meiner eigenen ikonoklastischen Neigungen. Und dieses seltsame Gefühl einer Seelenverwandtschaft mit Spinoza wurde noch von dem Wissen bestärkt, dass Einstein, einer meiner ersten Helden, ein Spinoza-Anhänger war. Wenn Einstein von Gott sprach, sprach er von Spinozas Gott – einem Gott, der eins ist mit der Natur, einem Gott, der alle Substanz in sich vereinigt, und einem Gott, »der nicht mit dem Universum Würfel spielt« – womit er ausdrücken wollte, dass alles, was geschieht, ausnahmslos den planmäßigen Gesetzen der Natur folgt.
Ich glaube auch, dass Spinoza ebenso wie Nietzsche und Schopenhauer, auf deren Leben und Philosophie zwei meiner früheren Romane basieren, vieles geschrieben hat, was für mein Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie hochrelevant ist – beispielsweise, dass Ideen, Gedanken und Gefühle von vorangegangenen Erfahrungen hervorgerufen werden, dass Leidenschaften leidenschaftslos untersucht werden können, dass Verstehen zu Transzendenz führt –, und ich wünschte mir, seine Beiträge mit einem philosophischen Roman zu feiern.
Aber wie über einen Mann schreiben, der ein so kontemplatives Leben führte, welches von so wenigen äußeren Ereignissen gekennzeichnet war? Er war außerordentlich introvertiert, und er ließ seine eigene Person in seinen Werken außen vor. Ich hatte nichts von dem Material zur Verfügung, das normalerweise Erzählungen färbt – keine Familientragödien, keine Liebesgeschichten, keine Eifersüchteleien, interessante Anekdoten, Fehden, Streitereien oder Versöhnungen. Er führte eine umfangreiche Korrespondenz, doch nach seinem Tod befolgten seine Kollegen seine Anweisungen und entfernten fast alle persönlichen Anmerkungen aus seinen Briefen. Nein, in seinem Leben gab es nicht viele öffentliche Dramen: Die meisten Gelehrten betrachten Spinoza als gelassene und sanfte Seele – manche vergleichen sein Leben mit dem Leben christlicher Heiliger, manche sogar mit Jesus.
Und so beschloss ich, einen Roman über sein Innenleben zu schreiben. Dabei konnte mir mein persönliches Fachwissen möglicherweise weiterhelfen. Schließlich war er ein menschliches Wesen gewesen und musste einfach mit den gleichen grundlegenden menschlichen Konflikten gekämpft haben, die mir und den vielen Patienten, mit denen ich über Jahrzehnte hinweg arbeiten durfte, zusetzten. Auf die Exkommunikation, die im Alter von vierundzwanzig Jahren von der jüdischen Gemeinde in Amsterdam gegen ihn ausgesprochen worden war, muss er stark emotional reagiert haben – ein unwiderrufliches Verdikt, das alle Juden, seine eigene Familie eingeschlossen, zwang, ihn für alle Zeiten zu meiden. Kein Jude würde jemals wieder mit ihm sprechen, mit ihm Handel treiben, seine Worte lesen oder sich ihm auf weniger als fünf Meter Abstand nähern. Und natürlich existiert niemand ohne ein Innenleben aus Phantasien, Träumen, Leidenschaften und der Sehnsucht nach Liebe. Etwa ein Viertel des Hauptwerks Spinozas, die Ethik, ist dem Thema »Über die menschliche Unfreiheit oder die Macht der Affekte« gewidmet. Als Psychiater war ich fest davon überzeugt, dass er diesen Abschnitt nicht hätte schreiben können, hätte er nicht einen bewussten Kampf mit seinen eigenen Leidenschaften ausgetragen.
Dennoch fehlte mir jahrelang die zündende Idee, und ich suchte vergeblich nach dem Drehbuch, das ein Roman braucht – bis eine Reise nach Holland vor fünf Jahren alles veränderte. Ich war zu einer Vortragsreihe eingeladen und erbat mir als Teil meines Honorars einen »Spinoza-Tag«, der mir auch gewährt wurde. Der Vorsitzende der Holländischen Spinoza-Gesellschaft und ein führender Spinoza-Philosoph erklärten sich bereit, mir einen Tag zu opfern und alle wichtigen Spinoza-Schauplätze mit mir zu besuchen – seine Wohnstätten, sein Grab und, die Hauptattraktion, das Spinoza-Museum in Rijnsburg. Und dort kam mir die Erleuchtung.
Mit gespannter Vorfreude betrat ich das Spinoza-Museum in Rijnsburg, das etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von Amsterdam entfernt liegt, und suchte – ja, was eigentlich? Vielleicht eine Begegnung mit Spinozas Geist. Vielleicht eine Geschichte. Aber nachdem ich das Museum betreten hatte, war ich sofort enttäuscht. Ich bezweifelte, dass dieses kleine, karge Museum mich Spinoza näherbringen konnte. Die einzigen entfernt persönlichen Gegenstände waren die einhunderteinundfünfzig Bände der Bibliothek, die Spinoza gehört hatten, und diesen wandte ich mich sofort zu. Meine Gastgeber gewährten mir freien Zugang, und ich nahm ein Buch aus dem siebzehnten Jahrhundert nach dem anderen aus dem Schrank, roch daran, wog es in der Hand und war begeistert, dieselben Dinge zu berühren, die Spinozas Hände einst berührt hatten.
Aber mein Gastgeber riss mich schon bald aus meinen Träumereien: »Natürlich wurden seine Habseligkeiten – das Bett, die Kleidung, die Schuhe, Schreibfedern und Bücher – nach seinem Tod versteigert, um die Kosten für das Begräbnis aufzubringen, Dr. Yalom. Die Bücher wurden verkauft und in alle Winde zerstreut, aber glücklicherweise hatte der Notar vor der Versteigerung eine vollständige Bücherliste angefertigt, und über zweihundert Jahre später suchte ein jüdischer Philanthrop die meisten dieser Titel wieder zusammen, nach Ausgabe, Jahreszahl und Ort der Veröffentlichung. Deshalb nennen wir sie die Spinoza-Bibliothek, obwohl es sich in Wirklichkeit nicht um die Originale handelt. Seine Finger haben diese Bücher nie berührt.«
Ich drehte der Bibliothek den Rücken zu und betrachtete das Portrait Spinozas, das an der Wand hing. Bald spürte ich, wie ich in diese riesigen, traurigen, mandelförmigen, müden Augen eintauchte, ein fast mystisches Erlebnis – etwas, das mir nicht oft passiert. Aber dann sagte mein Gastgeber: »Vielleicht wissen Sie es nicht, aber Spinoza sah nicht wirklich so aus. Der Künstler malte das Bild nach einer nur wenige Zeilen umfassenden Beschreibung. Sollte es von Spinoza zu seinen Lebzeiten Zeichnungen gegeben haben, so ist jedenfalls keine von ihnen erhalten.«
Vielleicht eine Geschichte über schlichte Unzugänglichkeit?, fragte ich mich.
Während ich mir die Gerätschaften für das Schleifen der Linsen im zweiten Raum ansah – wiederum nicht sein Originalwerkzeug, wie auf einem Schild im Museum stand, sondern nur eine ähnliche Ausrüstung –, hörte ich, wie einer meiner Gastgeber in der Bibliothek nebenan von den Nazis sprach.
Ich ging zurück. »Wie bitte? Die Nazis waren hier? In diesem Museum?«
»Ja – mehrere Monate nach dem Blitzkrieg in Holland fuhren die Soldaten vom ERR mit ihren großen Limousinen vor und stahlen alles – die Bücher, eine Büste und ein Portrait von Spinoza –, einfach alles. Sie karrten alles weg und versiegelten und enteigneten das Museum.«
»ERR? Was bedeutet das?«
»Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Die Taskforce von Reichsleiter Rosenberg. Alfred Rosenberg war der wichtigste antisemitische Ideologe der Nazis. Er hatte den Auftrag, Kriegsbeute für das Dritte Reich einzusammeln, auf Befehl Rosenbergs plünderte der ERR ganz Europa – zunächst nur jüdisches Eigentum und später dann alles, was irgendeinen Wert hatte.«
»Demnach sind diese Bücher Spinozas zweimal abhanden gekommen?«, fragte ich. »Meinen Sie damit, dass diese Bücher noch einmal neu angeschafft werden mussten und die Bibliothek ein zweites Mal zusammengestellt wurde?«
»Nein – die Bücher haben wie durch ein Wunder überlebt und wurden nach dem Krieg bis auf wenige verlorengegangene Exemplare wieder hierher zurückgebracht.«
»Unglaublich!« Das riecht nach einer Geschichte, dachte ich. »Aber warum kümmerte Rosenberg sich überhaupt um diese Bücher? Mir ist schon klar, dass sie einen gewissen Wert besitzen – immerhin stammen sie aus dem siebzehnten Jahrhundert oder sind noch älter –, aber warum sind die Leute nicht einfach ins Rijksmuseum von Amsterdam marschiert und haben sich einen Rembrandt unter den Nagel gerissen? Der wäre das Fünfzigfache der ganzen Sammlung wert gewesen.«
»Nein, darum ging es nicht. Geld hatte nichts damit zu tun. Der ERR hatte ein seltsames Interesse an Spinoza. Der Mitarbeiter Rosenbergs, der Nazi, der die Bibliothek auf seinen Befehl hin plünderte, hinterließ in seinem offiziellen Bericht einen vielsagenden Satz: ›Auch diese Bibliotheken … enthalten ausserordentlich wertvolle frühe Werke, die zur Erforschung des Spinozaproblems (sic!) von besonderer Bedeutung sind.‹ Sie können sich den Bericht im Web ansehen, wenn Sie wollen – er befindet sich in den offiziellen Dokumenten des Nürnberger Prozesses.«
Ich war wie vom Donner gerührt. »›Erforschung des Spinoza-Problems‹? Das verstehe ich nicht. Was meinte er damit? Was war das Spinoza-Problem der Nazis?«
Wie auf Kommando hoben meine Gastgeber gleichzeitig die Schultern und drehten ihre Handflächen nach oben.
Ich bohrte weiter: »Sie sagen also, dass sie wegen dieses Spinoza-Problems die Bücher in Sicherheit brachten und nicht wie so vieles in Europa einfach verbrannt haben?«
Sie nickten.
»Und wo wurde die Bibliothek während des Krieges gelagert?«
»Das weiß niemand. Die Bücher waren einfach fünf Jahre lang verschwunden und tauchten 1946 in einem deutschen Salzbergwerk wieder auf.«
»In einem Salzbergwerk? Nicht zu fassen!« Ich nahm eines der Bücher in die Hand – eine Ausgabe der Ilias aus dem sechzehnten Jahrhundert –, drückte es an mich und sagte: »Dann hat dieses alte Geschichtenbuch seine eigene Geschichte zu erzählen.«
Meine Gastgeber führten mich durch das übrige Haus. Ich war zu einer günstigen Zeit gekommen – nur wenige Besucher hatten jemals die andere Hälfte des Gebäudes zu sehen bekommen, in dem über Jahrhunderte Abkömmlinge einer Arbeiterfamilie gewohnt hatten. Das letzte Familienmitglied war aber vor kurzem gestorben, und die Spinoza-Gesellschaft hatte die Immobilie sofort gekauft und gerade mit der Restaurierung begonnen, um sie später dem Museum anzugliedern. Ich schlenderte inmitten von Bauschutt durch die bescheidene Küche und das Wohnzimmer und stieg dann die schmale, steile Treppe zum kleinen, unspektakulären Schlafzimmer hinauf. Flüchtig sah ich mich in der einfachen Kammer um und wollte gerade wieder hinuntersteigen, als mein Blick auf einem dünnen, quadratischen Riss in einer Ecke der Zimmerdecke hängen blieb, der etwa sechzig mal sechzig Zentimeter groß war.
»Was ist das?«
Der alte Hausmeister stieg ein paar Stufen hinauf, um nachzusehen, und sagte mir, es sei eine Falltür, die in einen winzigen Dachbodenraum führte, wo zwei Juden – eine ältere Mutter mit ihrer Tochter – während des Krieges vor den Nazis versteckt gehalten wurden. »Wir gaben ihnen zu essen und haben uns um sie gekümmert.«
Draußen ein Feuersturm! Vier von fünf holländischen Juden von den Nazis ermordet! Und währenddessen wurde oben im Spinoza-Haus rührend für zwei jüdische Frauen gesorgt, die sich den ganzen Krieg über auf dem Dachboden versteckt hielten. Und unten wurde das winzige Spinoza-Museum geplündert, versiegelt und von einem Beamten der Rosenberg-Einsatztruppe enteignet, der glaubte, dass seine Bibliothek den Nazis helfen könnte, ihr »Spinoza-Problem« zu lösen. Und was war ihr Spinoza-Problem? Ich fragte mich, ob dieser Nazi, Alfred Rosenberg, vielleicht seine eigenen Beweggründe hatte, um nach Spinoza Ausschau zu halten. Ich hatte das Museum mit einem Geheimnis betreten und verließ es nun mit deren zwei.
Kurz danach begann ich zu schreiben.
1
AMSTERDAM, APRIL 1656
Wenn sich die letzten Sonnenstrahlen im Wasser des Zwanenburgwal spiegeln, macht Amsterdam Feierabend. Die Färber sammeln ihre magenta- und purpurfarbenen Stoffe ein, die auf den Steinufern des Kanals trocknen. Händler rollen die Markisen ein und schließen die Läden ihrer Verkaufsstände. Ein paar Arbeiter, die nach Hause schlurfen, bleiben kurz an den Heringsständen am Kanal stehen, genehmigen sich einen schnellen Imbiss mit holländischem Gin und setzen dann ihren Weg fort. Amsterdam bewegt sich träge: Die Stadt ist in Trauer, sie erholt sich noch immer von der Seuche, die erst wenige Monate zuvor einen von neun Menschen dahingerafft hat.
Ein paar Meter von der Gracht entfernt, setzt in der Breestraat Nummer 4 der bankrotte und leicht angetrunkene Rembrandt van Rijn den letzten Pinselstrich auf sein Gemälde Jakob segnet die Söhne des Joseph, signiert es in der rechten unteren Ecke mit seinem Namen, wirft seine Palette auf den Fußboden, dreht sich um und steigt die schmale Wendeltreppe hinunter. Das Rembrandt-Haus, drei Jahrhunderte später dazu bestimmt, sein Museum und sein Denkmal zu werden, ist an diesem Tag Zeuge seiner Schmach: Es wimmelt von Bietern, die auf die Versteigerung sämtlicher Habseligkeiten des Künstlers warten. Er schiebt die Gaffer auf der Treppe unsanft zur Seite, tritt aus der Haustür, atmet die salzige Luft ein und stolpert auf das Wirtshaus an der Ecke zu.
In Delft, sieben Kilometer weiter südlich, geht der Stern eines anderen Künstlers auf. Der fünfundzwanzig Jahre alte Johannes Vermeer wirft einen letzten Blick auf sein neues Werk Bei der Kupplerin. Er begutachtet es von rechts nach links. Als erstes die Prostituierte mit der prächtigen, gelben Joppe. Gut. Gut. Das Gelb glänzt wie poliertes Sonnenlicht. Und die Gruppe von Männern, die sich um sie schart: Ausgezeichnet – jeder von ihnen könnte ohne weiteres aus der Leinwand heraustreten und ein Gespräch beginnen. Er beugt sich näher heran, um den angedeuteten und doch durchdringenden Blick des anzüglich grinsenden jungen Mannes mit dem geckenhaften Hut einzufangen. Vermeer nickt seiner eigenen Miniatur zu. Ausgesprochen zufrieden signiert er das Gemälde in der rechten, unteren Ecke mit seinem Namen und einem Schnörkel.
Zurück in Amsterdam, in der Breestraat Nummer 57, nur zwei Straßen von der bevorstehenden Versteigerung in Rembrandts Haus entfernt, macht sich ein fünfundzwanzig Jahre alter Kaufmann (nur wenige Tage älter als Vermeer, den er sehr verehren, aber nie persönlich treffen wird) daran, seinen Import-Export-Laden zuzusperren. Für einen Krämer ist er eigentlich zu schmal und zu hübsch. Seine Gesichtszüge sind perfekt, seine olivfarbene Haut makellos, die Augen groß, dunkel und schwermütig.
Er sieht sich ein letztes Mal um: Viele Regale sind so leer wie seine Taschen. Seeräuber haben seine letzte Lieferung aus Bahia abgefangen, und nun gibt es keinen Kaffee, keinen Zucker und auch keinen Kakao. Über eine Generation lang betrieb die Spinoza-Familie ein blühendes Handelsgeschäft, doch nun ist für die Spinoza-Brüder Gabriel und Bento nur noch ein kleines Einzelhandelsgeschäft übrig geblieben. In der staubigen Luft, die Bento Spinoza einatmet, macht er resigniert den übelriechenden Rattenkot aus, der den Duft der getrockneten Feigen, der Rosinen, des kandierten Ingwers, der Mandeln und der Kichererbsen begleitet und sich in die scharfen Dämpfe des spanischen Weines mischt. Er geht hinaus und stellt sich seinem täglichen Duell mit dem verrosteten Vorhängeschloss an der Ladentür. Eine unbekannte Stimme, die ihn gestelzt auf Portugiesisch anspricht, schreckt ihn auf.
»Sind Sie Bento Spinoza?«
Spinoza dreht sich um und sieht sich zwei Fremden gegenüber, jungen, erschöpften Männern, die anscheinend von weither angereist sind. Der eine, der ihn angesprochen hat, ist groß, und sein massiger, vierschrötiger Kopf ist vornübergebeugt, als sei er zu schwer, um ihn aufrecht zu halten. Seine Kleidung ist von guter Qualität, aber verschmutzt und verknittert. Der andere, in einer zerlumpten Bauerntracht, steht hinter seinem Gefährten. Er hat langes, verfilztes Haar, dunkle Augen, ein kräftiges Kinn und eine ebensolche Nase. Seine Körperhaltung ist steif. Nur die Augen bewegen sich, schießen wie verängstigte Kaulquappen hin und her.
Spinoza nickt vorsichtig.
»Ich bin Jacob Mendoza«, sagt der größere der beiden. »Wir müssen Sie sehen. Wir müssen mit Ihnen sprechen. Dies hier ist mein Vetter Franco Benitez, den ich gerade aus Portugal hergebracht habe. Mein Vetter …«, Jacob packt Franco an der Schulter, »… ist in einer Krise.«
»Ja«, antwortet Spinoza. »Und?«
»In einer ernsten Krise.«
»Ja. Und warum suchen Sie mich auf?«
»Uns wurde gesagt, dass Sie derjenige sind, bei dem wir Hilfe finden können. Vielleicht der Einzige.«
»Hilfe?«
»Franco hat allen Glauben verloren. Er zieht alles in Zweifel. Alle religiösen Rituale. Gebete. Sogar die Existenz Gottes. Er lebt in ständiger Furcht. Er schläft nicht. Er spricht davon, sich selbst zu töten.«
»Und wer leitete Sie so in die Irre, dass er Sie hierher schickte? Ich bin nur ein Kaufmann, der ein kleines Geschäft betreibt. Und kein sehr profitables, wie Sie sehen.« Spinoza deutet auf das staubige Fenster, hinter dem die halbleeren Regale zu erkennen sind. »Rabbi Mortera ist unser spiritueller Führer. Sie müssen zu ihm gehen.«
»Wir kamen gestern an, und heute Morgen wollten wir genau das tun. Aber unser Hausherr, ein entfernter Vetter, riet uns davon ab. ›Franco braucht einen Helfer, keinen Richter‹, sagte er. Er erzählte uns, dass Rabbi Mortera mit Zweiflern sehr streng umgeht. Er glaube, sagte mein Vetter, dass auf alle Juden in Portugal, die zum Christentum konvertierten, ewige Verdammnis warte, auch wenn sie gezwungen worden seien, sich zwischen Konversion und Tod zu entscheiden. ›Rabbi Mortera‹, sagte er mir, ›wird Francos Zustand nur noch verschlimmern. Geh zu Bento Spinoza. Er ist ein weiser Mann in solchen Angelegenheiten.‹«
»Was ist das für ein Gerede? Ich bin nichts weiter als ein Kaufmann …«
»Er behauptete, dass Sie der nächste große Rabbiner von Amsterdam geworden wären, wenn der Tod Ihres älteren Bruders und Ihres Vaters Sie nicht dazu gezwungen hätte, das Geschäft zu übernehmen.«
»Ich muss gehen. Ich muss zu einem Treffen, das ich nicht versäumen darf.«
»Gehen Sie zum Sabbatgottesdienst in die Synagoge? Ja? Wir auch. Ich nehme Franco mit, denn er muss wieder zu seinem Glauben zurückfinden. Dürfen wir Sie begleiten?«
»Nein, ich gehe zu einem anderen Treffen.«
»Zu welchem anderen Treffen?«, bohrt Jacob nach, nimmt sich dann aber sofort zurück. »Verzeihen Sie. Es geht mich nichts an. Dürfen wir Sie morgen aufsuchen? Wären Sie bereit, uns am Sabbat zu helfen? Das ist erlaubt, denn es ist eine Mitzwa. Wir brauchen Sie. Mein Vetter ist in Gefahr.«
»Sonderbar.« Spinoza schüttelt den Kopf. »Niemals wurde ein solches Ansinnen an mich herangetragen. Es tut mir leid, aber Sie irren. Ich habe Ihnen nichts zu bieten.«
Franco, der auf den Boden gestarrt hatte, während Jacob sprach, hebt nun die Augen und spricht seine ersten Worte: »Ich bitte nur um wenig, nur um ein paar Worte mit Ihnen. Wollen Sie sich einem jüdischen Mitbruder verweigern? Es ist Ihre Pflicht gegenüber einem Reisenden. Ich musste aus Portugal fliehen, genau wie Ihr Vater und Ihre Familie fliehen mussten, um der Inquisition zu entgehen.«
»Aber was kann ich …«
»Es ist gerade ein Jahr her, seitdem mein Vater auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Sein Verbrechen? Sie fanden Blätter der Thora, die in der Erde hinter unserem Haus vergraben waren. Der Bruder meines Vaters, Jacobs Vater, wurde kurz danach ermordet. Ich habe eine Frage: Sehen Sie sich diese Welt an, in der ein Sohn den Gestank des brennenden Fleisches seines Vaters riecht: Wo ist der Gott, der eine solche Welt erschaffen hat? Warum lässt Er so etwas zu? Werfen Sie mir vor, dass ich diese Frage stelle?« Franco sieht Spinoza einige Augenblicke lang tief in die Augen und fährt dann fort. »Gewiss wird ein Mann, den man den ›Gesegneten‹ nennt – Bento auf Portugiesisch und Baruch auf Hebräisch –, sich einem Gespräch mit mir nicht verweigern.«
Spinoza nickt ernst. »Ich werde mit Ihnen sprechen, Franco. Morgen Mittag?«
»In der Synagoge?«, fragt Franco.
»Nein, hier. Kommen Sie zu mir in den Laden. Er wird geöffnet sein.«
»Der Laden? Geöffnet?«, unterbricht Jacob. »Aber der Sabbat?«
»Mein jüngerer Bruder Gabriel vertritt die Familie Spinoza in der Synagoge.«
»Aber die Heilige Thora«, beharrt Jacob, der ignoriert, dass Franco ihn am Ärmel zieht, »belegt Gottes Willen, dass wir am Sabbat nicht arbeiten, dass wir diesen heiligen Tag mit Gebeten an ihn verbringen und Mitzwot leisten.«
Spinoza dreht sich um und fragt so nachsichtig, als spräche ein Lehrer mit einem jungen Schüler: »Sagen Sie, Jacob, glauben Sie, dass Gott allmächtig ist?«
Jacob nickt.
»Dass Gott perfekt ist? Niemand kommt ihm gleich?«
Wieder stimmt Jacob zu.
»Dann würden Sie mir sicherlich Recht geben, dass per Definition eine perfekte und vollkommene Substanz keine Mängel, keine Unzulänglichkeiten, keine Bedürfnisse und keine Wünsche hat. Ist es nicht so?«
Jacob denkt nach, zögert und nickt dann vorsichtig. Spinoza stellt fest, dass sich Francos Lippen zu einem Lächeln kräuseln.
»Dann«, fährt Spinoza fort, »konstatiere ich, dass Gott keine Wünsche hat, wie, ja selbst ob wir ihn preisen. Und daher gestatten Sie mir, Jacob, dass ich Gott auf meine Art liebe.«
Francos Augen weiten sich. Er dreht sich zu Jacob um, als wollte er sagen: »Siehst du? Siehst du? Das ist der Mann, den ich suche.«
2
REVAL, ESTLAND, 3. MAI 1910
Zeit: 16:00 Uhr. Ort: Eine Bank im Hauptkorridor der Petri-Realschule vor dem Büro des Direktors Epstein.
Der siebzehnjährige Alfred Rosenberg wetzt unruhig auf der Bank hin und her; er weiß nicht so recht, weshalb er ins Büro des Direktors gerufen wurde. Alfreds Körper ist drahtig, seine Augen graublau, sein Gesicht wohlproportioniert, eine Locke seines kastanienfarbenen Haares hängt ihm im genau richtigen Winkel in die Stirn. Seine Augen sind nicht von dunklen Ringen umschattet – diese werden später kommen. Er hält sein Kinn hoch. Vielleicht ist er trotzig, doch seine Fäuste, die er immer wieder ballt und löst, signalisieren Besorgnis.
Er sieht wie alle und wie keiner aus. Er ist jetzt fast ein Mann und hat ein ganzes Leben vor sich. In acht Jahren wird er von Reval nach München reisen und ein äußerst reger antibolschewistischer und antisemitischer Journalist werden. In neun Jahren wird er bei einer Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei die aufwühlende Rede eines neuen Hoffnungsträgers hören, eines Veteranen des Ersten Weltkriegs namens Adolf Hitler, und Alfred wird bald nach Hitler der Partei beitreten. In zwanzig Jahren wird er seinen Stift zur Seite legen und triumphierend lächeln, nachdem er die letzte Seite seines Buches Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts beendet hat. Als Bestseller mit Millionenauflage wird es viel vom ideologischen Fundament der NSDAP enthalten und eine Rechtfertigung für die Vernichtung der europäischen Juden liefern. In dreißig Jahren werden seine Truppen ein kleines, holländisches Museum in Rijnsburg stürmen und Spinozas persönliche Bibliothek mit einhunderteinundfünfzig Bänden konfiszieren. Und in sechsunddreißig Jahren wird er verwirrt aus seinen schwarz umschatteten Augen schauen und den Kopf schütteln, während der amerikanische Henker in Nürnberg ihn fragt: »Wollen Sie noch etwas sagen?«
Der junge Alfred hört das Echo sich nähernder Schritte im Korridor, und als er Herrn Schäfer, seinen Vertrauenslehrer und Deutschlehrer, erblickt, springt er auf die Füße, um ihn zu grüßen. Herr Schäfer runzelt nur die Stirn und schüttelt langsam den Kopf, geht an ihm vorbei und öffnet die Tür zum Büro des Direktors. Doch kurz bevor er eintritt, hält er inne, dreht sich zu Alfred um und flüstert ihm nicht unfreundlich zu: »Rosenberg, du hast mich und uns alle mit deiner Rede gestern Abend enttäuscht. Deine erbärmliche Bewertung ist nicht damit vergessen, dass du zum Klassensprecher gewählt wurdest. Selbst jetzt noch glaube ich daran, dass du kein ganz und gar hoffnungsloser Fall bist. Schon in ein paar Wochen wirst du deinen Abschluss machen. Sei jetzt nicht töricht.«
Die Wahlrede gestern Abend! Ach, das ist es also. Alfred schlägt sich mit der Hand an den Kopf. Natürlich – deshalb haben sie mich hierher zitiert! Obwohl fast alle vierzig Mitschüler seiner Abschlussklasse versammelt waren – hauptsächlich baltische Deutsche, aber hier und da auch ein paar Russen, Esten, Polen und Juden –, hatte Alfred seine Wahlrede absichtlich ausschließlich an die deutsche Mehrheit gerichtet und sie aufgestachelt, indem er von ihrer Mission als Bewahrer der edlen deutschen Kultur sprach. »Haltet unsere Rasse rein«, hatte er ihnen zugerufen. »Schwächt sie nicht dadurch, dass ihr unsere edlen Traditionen vergesst, minderwertiges Gedankengut annehmt, euch mit minderwertigen Rassen mischt.« Vielleicht hätte er es dabei bewenden lassen sollen. Aber dann waren die Pferde mit ihm durchgegangen. Vielleicht war er zu weit gegangen.
Er wird aus seinen Gedanken gerissen, als sich die gut drei Meter hohe, massive Tür öffnet und Direktor Epsteins dröhnende Stimme erschallt: »Herr Rosenberg, bitte, herein.«
Alfred tritt ein und sieht seinen Direktor und seinen Deutschlehrer an einem Ende eines langen, schweren, dunklen Holztisches sitzen. Alfred kommt sich in Gegenwart des über einen Meter achtzig großen Direktors Epstein immer klein vor. Dessen würdevolle Haltung, die stechenden Augen und sein dichter, akkurat gestutzter Bart unterstreichen seine Autorität noch.
Direktor Epstein bedeutet Alfred, sich auf einen Stuhl am anderen Ende des Tisches zu setzen. Er ist merklich niedriger als die beiden großen Stühle mit den hohen Lehnen am gegenüberliegenden Ende. Der Direktor kommt ohne Umschweife direkt zum Punkt: »Nun, Rosenberg, ich habe jüdische Vorfahren, nicht wahr? Und meine Frau ist auch Jüdin, nicht wahr? Und Juden sind eine minderwertige Rasse und sollten Deutsche nicht unterrichten? Und wie ich vermute, ganz bestimmt nicht zum Direktor erhoben werden?«
Keine Antwort. Alfred atmet aus, versucht, sich in seinem Stuhl noch kleiner zu machen, und lässt den Kopf hängen.
»Rosenberg, stelle ich Ihre Auffassung richtig dar?«
»Herr Direktor … äh, ich sprach zu unüberlegt. Meine Anmerkungen waren nur ganz allgemein gemeint. Es war eine Wahlrede, und ich habe so gesprochen, weil es das ist, was die Leute hören wollten.« Aus den Augenwinkeln sieht Alfred, wie Herr Schäfer in seinem Stuhl zusammensinkt, die Brille abnimmt und sich die Augen reibt.
»Ach so, ich verstehe. Du hast nur allgemein gesprochen? Aber jetzt sitze ich hier vor dir, nicht allgemein, sondern tatsächlich.«
»Herr Direktor, ich sage nur, was alle Deutschen denken. Dass wir unsere Rasse und unsere Kultur bewahren müssen.«
»Und was mich und die Juden betrifft?«
Alfred lässt abermals stumm den Kopf hängen. Er möchte aus dem Fenster schauen, das sich etwa auf halber Länge des Tisches befindet, schaut stattdessen aber besorgt zum Direktor.
»Ja, natürlich kannst du nicht antworten. Vielleicht wird es deine Zunge lösen, wenn ich dir sage, dass mein Stammbaum und auch der meiner Frau rein deutsch ist und dass unsere Vorfahren im vierzehnten Jahrhundert ins Baltikum kamen. Und darüber hinaus sind wir auch noch strenggläubige Lutheraner.«
Alfred nickt langsam.
»Und dennoch nanntest du mich und meine Frau Juden«, fährt der Direktor fort.
»Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur, dass es Gerüchte gibt …«
»Gerüchte, die du zu deinem eigenen persönlichen Vorteil nur allzu gern ausgestreut hast. Und, sag mir, Rosenberg: Die Gerüchte beruhen auf welchen Tatsachen? Oder sind sie vielleicht gar aus der Luft gegriffen?«
»Tatsachen?« Alfred schüttelt den Kopf. »Äh, vielleicht Ihr Name?«
»Epstein ist also ein jüdischer Name? Alle Epsteins sind Juden, ist es das? Oder fünfzig Prozent von ihnen? Oder nur ein paar? Oder vielleicht nur einer von tausend? Was haben deine wissenschaftlichen Untersuchungen denn ergeben?«
Keine Antwort. Alfred schüttelt den Kopf.
»Du meinst, dass du dir trotz deiner wissenschaftlichen und philosophischen Ausbildung an deiner Schule nie überlegst, woher du weißt, was du weißt? Ist das nicht eine der wichtigsten Lehren der Aufklärung? Haben wir an dir versagt? Oder du an uns?«
Alfred ist sprachlos. Herr Epstein trommelt mit den Fingern auf den langen Tisch und fährt dann fort.
»Und dein Name Rosenberg? Ist dein Name auch ein jüdischer Name?«
»Nein. Ganz bestimmt nicht.«
»Da bin ich mir nicht so sicher. Ich will dir etwas über Namen erzählen. Während der Aufklärung in Deutschland …« Direktor Epstein hält kurz inne und bellt dann los: »Rosenberg, weißt du, wann und was die Aufklärung war?«
Mit Blick auf Herrn Schäfer und einem Stoßgebet in der Stimme antwortet Alfred zaghaft: »Achtzehntes Jahrhundert und … und es war die Ära … die Ära von Vernunft und Wissenschaft?«
»Ja, richtig. Gut. Nun, dann ist Herrn Schäfers Unterricht doch nicht gänzlich spurlos an dir vorübergegangen. Im Laufe jenes Jahrhunderts wurden in Deutschland Maßnahmen ergriffen, Juden zu deutschen Staatsbürgern zu machen. Sie wurden verpflichtet, deutsche Namen zu wählen und dafür zu zahlen. Hätten sie das nicht getan, hätten sie vielleicht so lächerliche Namen wie Schmutzfinger oder Drecklecker bekommen. Die meisten Juden erklärten sich also bereit, für einen hübscheren oder eleganteren Namen zu bezahlen, nach einer Blume vielleicht – wie Rosenblum – oder für Namen, die in irgendeiner Weise mit der Natur zu tun hatten, wie Grünbaum. Noch beliebter waren Namen von Adelsschlössern. So assoziierte man beispielsweise das Schloss Epstein mit einem Adelsgeschlecht. Es gehörte einer bedeutenden Familie des Heiligen Römischen Reiches, und sein Name wurde oft von Juden gewählt, die im achtzehnten Jahrhundert in dessen Nachbarschaft lebten. Einige Juden bezahlten geringere Summen für traditionelle jüdische Namen wie Levy oder Cohen.
Nun ist dein Name, Rosenberg, auch ein sehr alter Name. Aber seit mehr als hundert Jahren erlebt er einen Aufschwung. Er ist inzwischen ein häufiger jüdischer Name im Vaterland, und ich versichere dir, falls oder wenn du in das Vaterland reisen solltest, wirst du Blicke und Schmunzeln ernten, und du wirst Gerüchte über jüdische Vorfahren in deinem Stammbaum hören. Sag mir, Rosenberg, wenn das geschieht, was wirst du den Leuten antworten?«
»Ich werde Ihrem Beispiel folgen, Herr Direktor, und von meinen Vorfahren sprechen.«
»Ich persönlich habe die Ahnenreihe meiner Familie mehrere Jahrhunderte zurück verfolgt. Du auch?«
Alfred schüttelt den Kopf.
»Weißt du, wie man eine solche Forschung betreibt?«
Erneutes Kopfschütteln.
»Dann wird eines der Forschungsprojekte, die du vor deinem Abschluss vorlegen musst, darin bestehen, das Wesen der Ahnenforschung zu studieren und anschließend eine Suche nach deiner eigenen Herkunft durchzuführen.«
»Eines meiner Projekte, Herr Direktor?«
»Ja, es wird zwei Pflichtarbeiten geben, die meine sämtlichen Zweifel an deiner Befähigung zum Schulabschluss und deiner Befähigung zum Besuch des Polytechnikums ausräumen sollen. Nach unserer heutigen Unterhaltung werden Herr Schäfer und ich uns über ein weiteres erbauliches Projekt für dich unterhalten.«
»Ja, Herr Direktor.« Allmählich geht Alfred die prekäre Lage auf, in der er sich befindet.
»Sag mir, Rosenberg«, fährt Direktor Epstein fort, »wusstest du, dass gestern Abend auch jüdische Studenten auf der Versammlung waren?«
Ein kaum merkliches Nicken von Alfred.
Direktor Epstein fragt: »Und hast du deren Gefühle und deren Reaktion auf deine Worte, die Juden seien dieser Schule unwürdig, in Betracht gezogen?«
»Ich glaube, dass ich in erster Linie dem Vaterland verpflichtet bin und dazu, die Reinheit der großen arischen Rasse zu bewahren, der kreativen Kraft in allen Zivilisationen.«
»Rosenberg, die Wahl ist vorbei. Erspare mir deine Vorträge. Beantworte meine Frage. Ich fragte dich nach den Gefühlen der Juden unter deinen Zuhörern.«
»Ich glaube, dass die jüdische Rasse uns vernichten wird, wenn wir nicht auf der Hut sind. Sie sind schwach. Sie sind parasitär. Der ewige Feind. Die Antirasse zu arischen Werten und arischer Kultur.«
Überrascht von Alfreds heftiger Reaktion tauschen Direktor Epstein und Herr Schäfer besorgte Blicke aus. Direktor Epstein bohrt weiter.
»Mir scheint, als wolltest du der Frage, die ich stellte, ausweichen. Ich will versuchen, unser Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Die Juden sind eine schwache, parasitäre, minderwertige, kleine Rasse?«
Alfred nickt.
»Dann sag mir, Rosenberg: Wie kann eine so schwache Rasse unsere allmächtige arische Rasse bedrohen?«
Während Alfred eine Antwort zu formulieren versucht, fährt Herr Epstein fort: »Sag mir, Rosenberg, hast du bei Herrn Schäfer etwas über Darwin gelernt?«
»Ja«, gab Alfred zur Antwort. »Im Geschichtsunterricht von Herrn Schäfer und auch im Biologieunterricht von Herrn Werner.«
»Und was weißt du über Darwin?«
»Ich weiß von der Evolution der Arten und vom Überleben der Tüchtigsten.«
»Ach ja, die Tüchtigsten überleben. Nun hast du in deinem Religionsunterricht bestimmt das Alte Testament gründlich gelesen, nicht wahr?«
»Ja, im Unterricht von Herrn Müller.«
»Nun, Rosenberg: Dann wollen wir einmal die Tatsache betrachten, dass fast alle Völker und Kulturen, die in der Bibel beschrieben werden – und davon gibt es Dutzende –, inzwischen ausgestorben sind. Richtig?«
Alfred nickt.
»Kannst du mir einige dieser ausgestorbenen Völker nennen?«
Alfred schluckt: »Phönizier, Moabiter … und Edomiter.« Alfred wirft einen Blick auf Herrn Schäfers nickenden Kopf.
»Ausgezeichnet. Aber sie sind alle tot und verschwunden. Bis auf die Juden. Die Juden überlebten. Würde Darwin nicht behaupten, dass die Juden die Tüchtigsten von allen sind? Kannst du mir folgen?«
Alfred antwortet blitzschnell: »Aber nicht durch eigene Kraft. Sie sind Parasiten und haben die arische Rasse sogar an noch größerer Tüchtigkeit gehindert. Sie überleben nur, weil sie die Kraft, das Gold und den Reichtum aus uns heraussaugen.«
»Ach so, sie verhalten sich also nicht fair«, sagt Direktor Epstein. »Du willst damit sagen, dass es im großen Konzept der Natur Platz für Fairness gibt. Mit anderen Worten: Das edle Tier sollte sich in seinem Kampf ums Überleben weder tarnen noch aus dem Hinterhalt heraus jagen? Seltsam: Ich kann mich nicht erinnern, dass Darwin in irgendeiner Arbeit etwas über Fairness geschrieben hätte.«
Alfred, verwirrt, sitzt stumm da.
»Nun, lassen wir das«, sagt der Direktor. »Wenden wir uns einem weiteren Punkt zu: Sicherlich würdest du zustimmen, Rosenberg, dass die jüdische Rasse bedeutende Männer hervorgebracht hat. Denk nur an unseren Herrn Jesus, der als Jude geboren wurde.«
Wieder antwortet Alfred schnell: »Ich habe gelesen, dass Jesus in Galiläa auf die Welt kam und nicht in Judäa, wo die Juden waren. Auch wenn einige Galiläer irgendwann begonnen haben, den jüdischen Glauben zu praktizieren, floss kein einziger Tropfen israelitisches Blut in ihnen.«
»Wie bitte?« Direktor Epstein ringt die Hände, dreht sich zu Herrn Schäfer um und fragt: »Woher kommen nur solche Ideen, Herr Schäfer? Wäre er ein Erwachsener, würde ich fragen, ob er etwas getrunken hat. Unterrichten Sie solche Sachen in Geschichte?«
Herr Schäfer schüttelt den Kopf und wendet sich an Alfred. »Woher kommen solche Ideen? Du sagst, du liest darüber, aber bestimmt nicht in meinem Unterricht. Was liest du, Rosenberg?«
»Ein wunderbares Buch, Herr Professor: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts.«
Herr Schäfer schlägt die Hand vor die Stirn und sinkt im Stuhl zusammen.
»Was ist das?«, fragt Direktor Epstein.
»Das Buch von Houston Stewart Chamberlain«, sagt Herr Schäfer. »Er ist Engländer und mittlerweile Wagners Schwiegersohn. Er strickt fantasievoll an der Geschichte. Das heißt, er schreibt über geschichtliche Ereignisse, die er sich eines ums andere ausdenkt.« Er wendet sich wieder an Alfred. »Wie bist du an Chamberlains Buch gekommen?«
»Ich habe bei meinem Onkel zu Hause darin geschmökert und es mir dann im Buchladen auf der Straße gegenüber gekauft. Sie hatten es nicht vorrätig, aber sie haben es mir bestellt. Ich habe es letzten Monat gelesen.«
»Was für eine Begeisterung! Ich wünschte nur, du hättest für deine Unterrichtstexte ebenso viel Begeisterung erkennen lassen«, sagt Herr Schäfer und weist mit dem Arm auf die Regale mit den ledergebundenen Büchern an den Wänden im Büro des Direktors. »Wenigstens für einen einzigen Text!«
»Herr Schäfer«, fragt der Direktor, »Sie sind mit diesem Werk, diesem Chamberlain, vertraut?«
»So sehr, wie ich mit irgendeinem Pseudohistoriker vertraut sein möchte. Er macht den französischen Rassisten Arthur de Gobineau populär, dessen Schriften zur grundsätzlichen Überlegenheit der arischen Rasse Wagner beeinflussten. Sowohl Gobineau als auch Chamberlain stellen aberwitzige Behauptungen über die arische Führerschaft in den großen griechischen und römischen Zivilisationen auf.«
»Sie waren aber wirklich groß!«, mischt Alfred sich plötzlich ein. »Bis sie sich mit minderwertigen Rassen vermischten – mit den bösartigen Juden, den Negern, den Asiaten. Daraufhin musste jede Zivilisation verfallen.«
Direktor Epstein wie auch Herr Schäfer sind verstört, dass ein Schüler es wagt, ihr Gespräch zu unterbrechen. Der Direktor wirft einen Blick zu Herrn Schäfer, als hätte dieser es zu verantworten. Herr Schäfer reicht den Rüffel an seinen Schüler weiter: »Ach, würde er diesen Eifer nur auch in der Klasse zeigen!« Er wendet sich an Alfred. »Wie oft habe ich dir das schon gesagt, Rosenberg? Du warst an deiner Weiterbildung immer so offensichtlich desinteressiert. Wie oft habe ich versucht, dich zur Mitarbeit an unserem Lesestoff zu bewegen? Und jetzt plötzlich stelle ich fest, dass dich tatsächlich ein Buch in Begeisterung versetzt. Wie dürfen wir das verstehen?«
»Vielleicht liegt es daran, dass ich ein solches Buch bisher noch nie gelesen habe – ein Buch, das die Wahrheit über die Vornehmheit unserer Rasse ausspricht, das sagt, dass die Gelehrten fälschlicherweise die Geschichte für den Fortschritt der Menschheit verantwortlich machten, während es in Wahrheit doch unsere Rasse war, die in den ganzen großen Imperien die Zivilisation geschaffen hat! Nicht nur in Griechenland und Rom, sondern auch in Ägypten, Persien und sogar in Indien. Alle diese Imperien verfielen erst, als unsere Rasse von den minderwertigen Rassen ringsherum verunreinigt wurde.«
Alfred schaut zu Direktor Epstein und sagt so respektvoll wie möglich: »Wenn ich mir erlauben darf, Herr Direktor, das ist die Antwort auf Ihre Frage von vorhin. Deshalb mache ich mir keine Sorgen um die verletzten Gefühle von ein paar wenigen jüdischen Studenten oder um die Slawen, die zwar auch minderwertig, aber nicht so organisiert sind wie die Juden.«
Direktor Epstein und Herr Schäfer tauschen abermals Blicke aus. Endlich erkennen sie den Ernst der Lage. Dieser junge Mann ist mehr als nur einfach ein alberner oder impulsiver Jugendlicher.
Direktor Epstein sagt: »Rosenberg, warte bitte draußen. Herr Schäfer und ich werden unter vier Augen konferieren.«
3
AMSTERDAM, 1656
In der Jodenbreestraat wimmelte es am Sabbat bei Einbruch der Dämmerung vor Juden. Alle hatten ein Gebetsbuch und einen kleinen Samtbeutel mit dem Gebetsschal bei sich. Alle sephardischen Juden in Amsterdam waren auf dem Weg zur Synagoge, nur einer nicht. Nachdem er die Tür seines Ladens verschlossen hatte, blieb Bento an der Türschwelle stehen, warf einen langen Blick auf den Strom seiner jüdischen Mitbrüder, atmete tief ein, tauchte in die Menge ein und strebte in die entgegengesetzte Richtung. Er vermied den Blick der Entgegenkommenden und flüsterte sich beschwichtigende Worte zu, um seine Unsicherheit zu beruhigen: Niemand kennt mich, niemand beachtet mich. Es ist ein gutes Gewissen, worauf es ankommt, nicht ein schlechter Ruf. Ich habe das schon so oft getan. Aber die schwachen Waffen der Vernunft prallten an seinem hämmernden Herzen ab. Dann versuchte er, die Außenwelt auszuschalten, sich in sich selbst zu vertiefen und damit abzulenken, dass er über dieses sonderbare Duell zwischen Vernunft und Gefühl staunte, ein Duell, in dem die Vernunft immer unterlag.
Als die Menschenmenge sich lichtete, schlenderte er entspannter weiter, bog an der Straße, die an der Koningsgracht West entlangführte, links ab und steuerte auf das Haus und die Schule Franciscus van den Endens zu, des genialen Lehrers für Latein und klassische Geschichte.
Obwohl das Zusammentreffen mit Jacob und Franco schon bemerkenswert gewesen war, so war es einige Monate zuvor zu einer noch denkwürdigeren Begegnung im Laden von Spinoza gekommen, als Franciscus van den Enden zum ersten Mal das Geschäft betreten hatte. Während Spinoza seinen Weg fortsetzte, schwelgte er in der Erinnerung dieses Zusammentreffens. Die Einzelheiten hafteten vollkommen klar in seinem Gedächtnis.
Am Vorabend des Sabbat setzt bereits die Dämmerung ein, als ein würdevoller, formell gekleideter Mann mittleren Alters in vornehmer Haltung sein Handelsgeschäft betritt, um die Waren zu begutachten. Bento ist zu sehr mit seinen Eintragungen in seinem Kassenbuch beschäftigt, um die Ankunft seines Kunden zu bemerken. Schließlich hüstelt van den Enden höflich, um auf sich aufmerksam zu machen, und bemerkt dann energisch, aber nicht unfreundlich: »Junger Mann, wir sind doch nicht zu beschäftigt, um einen Kunden zu bedienen, wie?«
Bento lässt seinen Stift mitten im Wort fallen und springt auf. »Zu beschäftigt? Wohl kaum, mein Herr. Sie sind heute mein allererster Kunde. Bitte entschuldigen Sie meine Unaufmerksamkeit. Womit kann ich Ihnen dienen?«
»Ich hätte gern einen Liter Wein und – abhängig vom Preis – vielleicht ein Kilogramm dieser verhutzelten Rosinen da in der unteren Kiste.«
Während Bento ein Bleigewicht auf die eine Schale der Waage legt und die Rosinen mit einer abgenutzten, hölzernen Kelle auf die andere schaufelt, bis beide Schalen im Gleichgewicht schweben, fügt van den Enden hinzu: »Aber ich habe Sie beim Schreiben gestört. Was für ein erfrischendes und ungewöhnliches – nein, mehr als ungewöhnliches, ja geradezu einzigartiges – Erlebnis, in ein Geschäft zu treten und auf einen jungen Angestellten zu stoßen, der so mit Schreiben beschäftigt ist, dass er nicht einmal einen Kunden bemerkt. Als Lehrer erlebe ich normalerweise genau das Gegenteil. Ich stoße auf Schüler, die nicht schreiben und nicht denken, obwohl sie es tun sollten.«
»Die Geschäfte laufen schlecht«, antwortet Bento. »Und so sitze ich Stunde um Stunde hier und habe nichts zu tun außer zu denken und zu schreiben.«
Der Kunde deutet auf Spinozas Kassenbuch, das immer noch auf der Seite aufgeschlagen ist, die er gerade beschrieben hat. »Lassen Sie mich eine Vermutung darüber wagen, was Sie da aufschreiben. Die Geschäfte laufen schlecht, und so machen Sie sich zweifellos Sorgen über das Schicksal Ihres Inventars. Sie vermerken in Ihrem Kassenbuch die Ausgaben und Einnahmen, stellen ein Budget auf und listen mögliche Lösungen. Richtig?«
Mit rotem Kopf dreht Bento sein Journal um und legt es mit dem Rücken nach oben auf den Tisch.
»Sie brauchen nichts vor mir zu verbergen, junger Mann. Ich bin ein Meisterspion und kann Geheimnisse für mich behalten. Und auch ich denke verbotene Gedanken. Darüber hinaus bin ich Lehrer für Rhetorik von Beruf und könnte Ihre Niederschriften mit ziemlicher Sicherheit verbessern.«
Spinoza hält ihm sein Journal zum Lesen hin und fragt verschmitzt lächelnd: »Wie gut ist Ihr Portugiesisch, mein Herr?«
»Portugiesisch! Jetzt haben Sie mich aber erwischt, junger Mann. Holländisch ja, Französisch, Englisch, Deutsch ebenfalls ja und auch Latein und Griechisch. Ein eingeschränktes Ja sogar bei Spanisch und ansatzweise auch bei Hebräisch und Aramäisch. Aber Portugiesisch leider nein. Sie sprechen übrigens ausgezeichnet Holländisch. Warum schreiben Sie nicht auf Holländisch? Sie sind doch bestimmt hier geboren?«
»Ja. Mein Vater emigrierte als Kind aus Portugal. Obwohl ich bei meinen geschäftlichen Verhandlungen Holländisch spreche, bin ich im Schriftlichen nicht perfekt. Manchmal schreibe ich auch auf Spanisch. Und ich vertiefe mich gerade ins Studium der hebräischen Sprache.«
»Seit jeher sehne ich mich danach, die Heilige Schrift einmal in ihrer Originalsprache zu lesen. Leider war mein Hebräischunterricht bei den Jesuiten nur sehr unzulänglich. Aber Sie schulden mir noch immer eine Antwort darauf, was Sie da schreiben.«
»Ihre Folgerung, dass ich über Budgets und eine Verbesserung der Verkaufszahlen schreibe, basiert, wie ich annehme, auf meiner Bemerkung, dass die Geschäfte schlecht gehen. Eine verständliche Deduktion, aber in diesem speziellen Fall vollkommen unrichtig. Meine Gedanken beschäftigen sich nur selten mit geschäftlichen Dingen, und ich schreibe niemals darüber.«
»Ich nehme alles zurück. Aber bevor ich den Fokus Ihres Schreibens weiter verfolge, erlauben Sie mir bitte, kurz abzuschweifen – eine pädagogische Anmerkung, eine Angewohnheit, die ich nur schwer ablegen kann: Ihr Gebrauch des Wortes ›Deduktion‹ ist korrekt. Der Vorgang, auf bestimmten Beobachtungen aufzubauen, um eine rationale Schlussfolgerung zu ziehen, mit anderen Worten, aus bestimmten Beobachtungen von unten her eine Theorie aufzubauen, heißt Induktion, wohingegen eine Deduktion mit einer a-priori-Theorie beginnt und dann abwärts zu verschiedenen Schlussfolgerungen führt.«
Als van den Enden Spinozas nachdenkliches, vielleicht auch dankbares Nicken registriert, fährt er fort: »Wenn es nicht die Geschäfte sind, worüber schreiben Sie dann?«
»Ach, nur darüber, was ich vor dem Fenster meines Ladens sehe.«
Van den Enden dreht sich um und folgt Bentos Blick zur Straße hinaus.
»Sehen Sie. Alle sind in Bewegung. Sie hasten hin und her. Den ganzen Tag, ihr ganzes Leben lang. Mit welchem Ziel? Reichtum? Ehre? Sinnenlust? Solche Ziele weisen ganz sicher in die falsche Richtung.«
»Warum?«
Bento hat alles gesagt, was er sagen wollte, doch ermutigt von den Fragen seines Kunden fährt er fort: »Solche Ziele vervielfältigen sich. Jedes Mal, wenn ein Ziel erreicht ist, brüten sie nur weitere Bedürfnisse aus. Folglich noch mehr Hasten, noch mehr Suchen, ad infinitum. Der wahre Weg zu unvergänglichem Glück muss anderswo liegen. Darüber denke ich nach, und darüber schreibe ich.« Bento läuft puterrot an. Nie zuvor hat er solche Gedanken laut ausgesprochen.
Das Gesicht des Kunden verrät großes Interesse. Er stellt seine Einkaufstasche ab, tritt näher und starrt Bento ins Gesicht.
Das war der Moment – der Moment der Momente. Bento liebte jenen Moment, jenen überraschten Blick, jenes neue, wachsende Interesse und jene Wertschätzung im Gesicht des Fremden. Und was für ein Fremder er war! Ein Sendbote aus der großen Welt da draußen, aus der nichtjüdischen Welt. Ein offensichtlich einflussreicher Mann. Es war ihm unmöglich, sich jenen Moment nur ein einziges Mal in Erinnerung zu rufen. Vielmehr spielte er diese Begebenheit ein weiteres Mal und manchmal auch ein drittes und viertes Mal durch. Und jedes Mal, wenn er sie sich vor Augen führte, füllten sich seine Augen mit Tränen. Ein Lehrer, ein eleganter Mann von Welt, interessierte sich für ihn, nahm ihn ernst, dachte vielleicht: »Das ist ja ein außergewöhnlicher junger Mann.«
Nur mit Mühe riss Bento sich von diesem Moment der Momente los und fuhr mit seiner Erinnerung an dieses erste Zusammentreffen fort.
Der Kunde lässt nicht locker: »Sie sagen, dass unvergängliches Glück woanders liege. Erzählen Sie mir von diesem ›woanders‹.«
»Ich weiß nur, dass es nicht in vergänglichen Zielen liegt. Es ist die Seele, die bestimmt, was angstvoll, wertlos, wünschenswert oder unschätzbar ist, und deshalb ist es die Seele und nur die Seele, die einer Veränderung bedarf.«
»Wie heißen Sie, junger Mann?«
»Bento Spinoza. Auf Hebräisch werde ich Baruch genannt.«
»Und auf Lateinisch ist Ihr Name Benedictus. Ein schöner, gesegneter Name. Ich bin Franciscus van den Enden. Ich leite eine Lateinschule. Spinoza, sagen Sie … hmm, vom lateinischen spina und spinosus, was so viel wie ›Dorn‹ und ›voller Dornen‹ bedeutet.«
»D’Espinosa auf Portugiesisch«, sagt Bento und nickt. »›Von einem dornigen Ort.‹«
»Nun, die Art Ihrer Fragen dürfte sich für die orthodoxen, doktrinären Lehrmeister durchaus als dornig erweisen.« Van den Enden kräuselt die Lippen zu einem verschmitzten Lächeln. »Sagen Sie mir, junger Mann, sind Sie ein Stachel im Fleische Ihrer Lehrer?«
Bento lächelt ebenfalls: »Ja, früher einmal war das so. Doch nun habe ich mich von meinen Lehrern befreit. Ich beschränke meine Stacheligkeit auf mein Kassenbuch. Meine Art von Fragen ist in einer abergläubischen Gemeinde nicht willkommen.«
»Aberglaube und Vernunft waren noch nie gute Gefährten. Aber vielleicht kann ich Sie mit ähnlich gesinnten Weggefährten bekannt machen. Hier zum Beispiel ist ein Mann, den Sie kennen lernen sollten.«
Van den Enden greift in seine Tasche und zieht ein altes Buch heraus, das er Bento reicht. »Der Mann heißt Aristoteles, und dieses Buch enthält seine Erkundung Ihrer Art von Fragen. Auch er betrachtete die Seele und das Streben nach einer Vervollkommnung unserer Kräfte der Vernunft als oberstes und einzigartiges menschliches Vorhaben. Mit der Nikomachischen Ethik von Aristoteles sollten Sie sich als Nächstes befassen.«
Bento hält das Buch an seine Nase und atmet den Duft ein. Dann schlägt er es auf. »Ich weiß von diesem Mann und würde ihn gern kennen lernen. Aber wir könnten uns leider nicht unterhalten. Ich kann kein Griechisch.«
»Dann sollte Ihre Ausbildung auch Griechisch umfassen. Natürlich erst, nachdem Sie Latein beherrschen. Wie schade, dass Ihre gelehrten Rabbiner so wenig über die Klassiker wissen. So eng begrenzt ist ihr Horizont, dass sie oft vergessen, dass Nichtjuden sich ebenfalls mit der Suche nach Weisheit beschäftigen.«
Bento antwortet augenblicklich. Wie immer erinnert er sich seiner jüdischen Herkunft, wenn Juden angegriffen werden. »Das stimmt nicht. Rabbi Menassch und auch Rabbi Mortera haben Aristoteles in der lateinischen Übersetzung gelesen. Und Maimonides hielt Aristoteles für den bedeutendsten aller Philosophen.«
Van den Enden streckt sich. »Gut gesagt, junger Mann, gut gesagt. Mit dieser Antwort haben Sie die Aufnahmeprüfung bestanden. Eine solche Loyalität gegenüber alten Lehrern veranlasst mich, Sie formell zum Studium an meiner Schule einzuladen. Es ist nun an der Zeit, dass Sie nicht nur von Aristoteles wissen, sondern ihn auch selbst kennen lernen. Ich kann ihn Ihrem Verständnis zuführen und auch die Welt seiner Gefährten, wie Sokrates, Platon und viele andere.«
»Bleibt nur die Frage der Studiengebühren. Wie ich sagte, laufen die Geschäfte schlecht.«
»Wir werden uns bestimmt einigen. Zum einen werden wir sehen, was für eine Art Hebräischlehrer Sie sind. Meine Tochter und ich möchten unser Hebräisch verbessern. Und vielleicht entdecken wir ja auch andere Möglichkeiten von Tauschgeschäften. Für den Augenblick schlage ich vor, dass Sie zu meinem Wein und den Rosinen – aber nicht diesen verhutzelten da – noch ein Kilogramm Mandeln dazugeben. Lassen Sie mich die prallen Rosinen auf dem oberen Regal probieren.«
So überwältigend war diese Erinnerung an den Beginn seines neuen Lebens, dass Bento, in Tagträumen schwelgend, mehrere Straßen über sein Ziel hinauslief. Er schreckte hoch, orientierte sich schnell und ging den selben Weg zurück zu van den Endens Haus, einem schmalen, dreistöckigen Gebäude an der Singel. Als er zur obersten Etage hinaufstieg, wo der Unterricht stattfand, blieb Bento wie immer auf jedem Treppenabsatz stehen und spähte in die Wohnräume. Der aufwendig geflieste Fußboden des ersten Treppenabsatzes mit seiner Umrandung aus blauen und weißen Delfter Windmühlenfliesen interessierte ihn wenig.
Im ersten Stockwerk erinnerte ihn der Geruch von Sauerkraut und das beißende Aroma von Curry daran, dass er wieder einmal vergessen hatte, an das Mittag- oder Abendessen zu denken.
Im zweiten Stockwerk hielt er sich nicht damit auf, die glänzende Harfe und die Tapeten an den Wänden zu bewundern, sondern erfreute sich stattdessen an den vielen Ölgemälden, die dicht an dicht an den Wänden hingen. Mehrere Minuten lang studierte Bento ein kleines Gemälde mit einem gestrandeten Schiff. Aufmerksam registrierte er die Perspektive, die von den großen Gestalten am Strand und den beiden kleineren im Boot gebildet wurde – die eine stand im Vorschiff und die andere, noch kleiner, saß am Bug. Er prägte sich die Szene ein und nahm sich vor, noch am selben Abend eine Kohlezeichnung davon anzufertigen.
Im dritten Stockwerk wurde er von van den Enden und sechs weiteren Schülern der Akademie begrüßt; einer der jungen Leute lernte Latein, und fünf hatten sich schon zur griechischen Sprache vorgearbeitet. Van den Enden begann den Abend wie immer mit einem Lateindiktat, das die Schüler entweder ins Holländische oder Griechische übersetzen mussten. In der Hoffnung, seinen Schülern die Leidenschaft für die Beherrschung neuer Sprachen einzuimpfen, unterrichtete van den Enden anhand von Texten, die er nicht nur für interessant, sondern auch für unterhaltsam hielt. Ovid war der Text der letzten drei Wochen gewesen, und an diesem Abend las van den Enden einen Abschnitt aus der Geschichte des Narcissus.
Im Gegensatz zu den anderen Schülern zeigte Spinoza nur geringes Interesse an geheimnisvollen Geschichten über wunderliche Metamorphosen. Bald war es offensichtlich, dass er keine unterhaltsamen Texte brauchte. Stattdessen hatte er eine Leidenschaft fürs Lernen und eine atemberaubende Sprachbegabung. Obwohl van den Enden sofort gewusst hatte, dass Bento ein außergewöhnlicher Schüler wäre, erstaunte es ihn immer wieder, wie er jedes Konzept, jede Allgemeingültigkeit und jede grammatikalische Eigentümlichkeit schon begriff und sich merkte, bevor die Erklärungen die Lippen seines Lehrers verlassen hatten.
Die täglichen Lateinübungen wurden von van den Endens Tochter Clara Maria betreut, einer schlaksigen Dreizehnjährigen mit Schwanenhals, verführerischem Lächeln und gekrümmter Wirbelsäule. Clara war, was Sprachen anging, selbst ein Wunderkind und demonstrierte vor den anderen Schülern schamlos ihre Gewandtheit, indem sie stets zwischen mehreren Sprachen wechselte, wenn sie mit ihrem Vater den täglichen Unterricht für jeden Schüler besprach. Anfangs war Bento schockiert: Einer der jüdischen Grundsätze, die er nie in Frage stellte, war die Unterlegenheit von Frauen – weniger Rechte und weniger Verstand. Obwohl Clara Maria ihn in Erstaunen versetzte, betrachtete er sie gleichwohl als Kuriosität, als Laune der Natur, und er sollte seine Ansicht niemals ändern, dass Frauen im Allgemeinen den Männern intellektuell weit unterlegen waren.
Sobald van den Enden mit den fünf Schülern, die Griechisch lernten, den Raum verlassen hatte, begann Clara Maria mit einer bei einer Dreizehnjährigen fast schon komisch anmutenden Ernsthaftigkeit, mit Bento und einem deutschen Schüler, Dirk Kerckrinck, die Vokabeln und Deklinationen zu üben, die man ihnen als Hausaufgabe aufgegeben hatte. Dirk lernte Latein, eine Voraussetzung für seine Zulassung zum Medizinstudium in Hamburg. Nach den Vokabeln wies Clara Maria Bento und Dirk an, ein bekanntes holländisches Gedicht von Jacob Cats, in dem es um das anständige Benehmen junger, unverheirateter Frauen ging, ins Lateinische zu übersetzen. Clara Maria las das Gedicht ihren Schülern unvergleichlich charmant vor, und als Dirk ihre Darbietung beklatschte und Bento es ihm eilig nachtat, strahlte sie übers ganze Gesicht, stand auf und verbeugte sich.
Die letzte Stunde war für Bento immer der Höhepunkt des ganzen Abends. Alle acht Schüler kamen im größeren Klassenzimmer zusammen – dem einzigen mit Fenstern – und lauschten van den Enden, der einen Diskurs über die antike Welt hielt. Sein Thema an diesem Abend war die griechische Vorstellung von Demokratie, seiner Ansicht nach die perfekteste Regierungsform, selbst wenn er zugeben musste – und hier warf er einen kurzen Blick zu seiner Tochter, die an allen seinen Veranstaltungen teilnahm –, dass »die griechische Demokratie über fünfzig Prozent der Bevölkerung ausschloss, nämlich Frauen und Sklaven«. Er fuhr fort: »Bedenken Sie die paradoxe Stellung der Frau im griechischen Drama: Auf der einen Seite war es den Frauen überhaupt verboten, Aufführungen zu besuchen, und erst in späteren, aufgeklärteren Jahrhunderten wurden sie zwar in die Amphitheater vorgelassen, durften aber nur auf den Plätzen mit der schlechtesten Sicht sitzen. Und betrachten Sie auf der anderen Seite die Heldinnen im Drama – stahlharte Frauen, die Protagonistinnen der bedeutendsten Tragödien von Sophokles und Euripides. Ich will Ihnen drei der eindrucksvollsten Gestalten in der ganzen Literatur nennen: Antigone, Phaedra und Medea.«
Nach seiner Präsentation, während der er Clara Maria anwies, einige der stärksten Passagen Antigones auf Griechisch und Holländisch vorzulesen, bat er, nachdem die anderen gegangen waren, Bento darum, noch ein paar Minuten zu bleiben.
»Ich möchte ein paar Dinge mit Ihnen besprechen, Bento. Zum einen: Erinnern Sie sich doch noch an mein Angebot bei unserem ersten Treffen in Ihrem Geschäft? Mein Angebot, Sie mit gleichgesinnten Denkern bekanntzumachen?« Bento nickte, und van den Enden fuhr fort: »Ich habe es nicht vergessen, und ich werde mein Versprechen nun nach und nach einlösen. Ihre Fortschritte in Latein sind ausgezeichnet, und wir werden uns nun der Sprache des Sophokles und des Homer zuwenden. Nächste Woche wird Clara Maria mit dem griechischen Alphabet beginnen. Außerdem habe ich Texte ausgewählt, die Sie besonders interessieren dürften. Wir werden mit Abschnitten von Aristoteles und Epikur arbeiten, die sich auf genau die Themen beziehen, für die Sie bei unserer ersten Begegnung Interesse bekundet haben.«
»Sie meinen meine Einträge im Kassenbuch über vergängliche und unvergängliche Ziele?«
»Ganz genau. Als einen ersten Schritt, Ihr Latein zu perfektionieren, schlage ich vor, dass Sie Ihre Einträge ab sofort in dieser Sprache vornehmen.«
Bento nickte.
»Und noch eins«, fuhr van den Enden fort. »Clara Maria und ich sind nun so weit, unter Ihrer Anleitung Hebräisch zu lernen. Wäre es Ihnen angenehm, nächste Woche damit zu beginnen?«
»Sehr gerne«, gab Bento zur Antwort. »Es wäre mir eine große Freude und böte mir außerdem die Möglichkeit, meine große Schuld an Sie zurückzuzahlen.«
»Nun, dann sollten wir vielleicht über pädagogische Methoden nachdenken. Haben Sie Erfahrung im Unterrichten?«
»Vor drei Jahren bat mich Rabbi Mortera, ihm bei seinem Hebräischunterricht für die jüngeren Schüler zu assistieren. Ich habe mir viele Gedanken zu den Fallstricken der hebräischen Sprache aufgeschrieben und hoffe, eines Tages eine hebräische Grammatik zu verfassen.«
»Ausgezeichnet. Seien Sie versichert, dass Sie eifrige und aufmerksame Schüler haben werden.«
»Wie der Zufall es will«, fügte Bento hinzu, »wurde heute Nachmittag eine seltsame Anfrage nach pädagogischer Hilfe an mich herangetragen. Vor ein paar Stunden suchten mich zwei verzweifelte Männer auf und versuchten, mich als eine Art Berater zu gewinnen.« Bento erzählte von seinem Zusammentreffen mit Jacob und Franco.
Van den Enden lauschte gespannt, und als Bento geendet hatte, sagte er: »Ich werde ein weiteres Wort zu den Lateinvokabeln hinzufügen, die ich Ihnen heute als Hausaufgabe gegeben habe. Notieren Sie bitte: caute. Die Bedeutung können Sie von dem spanischen Wort cautela ableiten.«
»Ja, das heißt ›Vorsicht‹ – cautela auf Portugiesisch. Aber warum caute?«
»Auf Lateinisch bitte.«
»Sed cur caute?«
»Ich habe einen Spion, der mir erzählt, dass Ihre jüdischen Freunde nicht erbaut davon sind, dass Sie bei mir studieren. Ganz und gar nicht. Und sie sind nicht erbaut davon, dass Sie sich zunehmend von Ihrer Gemeinde distanzieren. Caute, mein Junge. Passen Sie auf, dass Sie ihnen nicht weiteren Kummer bereiten. Vertrauen Sie Ihre tieferen Gedanken und Zweifel keinem Fremden an. Nächste Woche werden wir sehen, ob Epikur Ihnen nützliche Ratschläge geben kann.«
4
ESTLAND, 10. MAI 1910
Nachdem Alfred hinausgegangen war, standen die beiden alten Freunde auf und streckten sich, während Direktor Epsteins Sekretärin einen Teller mit Apfel- und Walnussstrudel auf den Tisch stellte. Sie nahmen wieder Platz und bissen hin und wieder schweigend davon ab, während sie den Tee aufbrühte.
»Nun, Hermann, ist dies das Gesicht der Zukunft?«, fragte Direktor Epstein.
»Keiner Zukunft, die ich erleben möchte. Ich freue mich über den heißen Tee – es fröstelt mich in seiner Gegenwart.«
»Wie viele Sorgen sollten wir uns über diesen Jungen und über seinen Einfluss auf seine Klassenkameraden machen?«
Ein Schatten huschte vorüber. Ein Schüler ging draußen im Korridor vorbei, und Herr Schäfer stand auf und schloss die Tür, die halb offen geblieben war. »Ich bin schon sein Vertrauenslehrer, seitdem er hier angefangen hat, und ich hatte ihn in mehreren Fächern. Eigenartig, ich kenne ihn überhaupt nicht. Wie du siehst, wirkt er so mechanisch, so distanziert. Ich treffe die jungen Leute oft bei hitzigen Diskussionen an, aber Alfred gesellt sich nie zu ihnen. Er hält sich bedeckt.«
»In den letzten Minuten wohl kaum, Hermann.«
»Das war vollkommen neu. Das hat mich erschüttert. Ich habe einen anderen Alfred Rosenberg erlebt. Die Lektüre von Chamberlain hat ihm Mut gemacht.«
»Vielleicht hat das auch sein Gutes. Vielleicht stolpert er ja noch über andere Bücher, die ihn auf andere Art begeistern. Du sagst, dass er sonst nicht gerade ein Bücherwurm ist?«
»Seltsamerweise ist das schwierig zu beantworten. Manchmal glaube ich, dass er Bücher an und für sich gut findet oder jedenfalls deren Nimbus, vielleicht aber auch nur die Bucheinbände. In der Schule stolziert er oft mit einem Stapel Bücher unter dem Arm herum – Hauptmann, Heine, Nietzsche, Hegel, Goethe. Von Zeit zu Zeit nimmt dieses Gehabe schon fast komische Züge an. Anscheinend will er damit seine überlegene Intelligenz zur Schau stellen und damit prahlen, dass ihm Bücher wichtiger sind, als beliebt zu sein. Oft habe ich meine Zweifel, dass er die Bücher wirklich liest. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich denken soll.«
»Eine solche Leidenschaft für Chamberlain«, sinnierte der Direktor. »Lässt er eine ähnliche Leidenschaft auch für andere Dinge erkennen?«
»Das ist die Frage. Er hält seine Gefühle immer sehr im Zaum, allerdings erinnere ich mich an ein Aufblitzen von Begeisterung für die Vorgeschichte in unserer Region. Hier und da nehme ich eine kleine Gruppe von Schülern zu archäologischen Ausgrabungen gleich nördlich der Kirche St. Olai mit, wo sie auch ein bisschen mitgraben dürfen. Alfred hat sich zu solchen Exkursionen immer freiwillig gemeldet. Bei einem dieser Ausflüge half er dabei, ein paar Steinzeitwerkzeuge und eine prähistorische Feuerstelle freizulegen, und er war begeistert!«
»Seltsam«, sagte der Direktor, der gerade Alfreds Akte durchblätterte. »Er hat sich für unsere Schule entschieden und nicht fürs Gymnasium, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, die Klassiker zu studieren und anschließend auf die Universität zu gehen, um Literatur oder Philosophie zu studieren. Denn dort liegen anscheinend seine Interessen. Warum geht er aufs Polytechnikum?«
»Ich glaube, es sind finanzielle Gründe. Seine Mutter starb, als er noch ein Baby war, und sein Vater leidet unter Schwindsucht und arbeitet nur sporadisch als Bankangestellter. Der neue Kunstlehrer, Herr Purvit hält ihn für einen recht guten technischen Zeichner und ermutigt ihn, eine Karriere als Architekt anzustreben.«
»Er hält sich also abseits von den anderen«, sagte der Direktor und schloss Alfreds Akte. »Und trotzdem hat er die Wahl für sich entschieden. Und war er vor ein paar Jahren nicht auch schon einmal Klassensprecher?«
»Das hat wenig mit Popularität zu tun, denke ich. Die Schüler haben keine Achtung vor diesem Amt, und die beliebten Jungen scheuen sich normalerweise, Klassensprecher zu werden, weil es mit Arbeit und allerlei Mühen verbunden ist. Ich glaube nicht, dass die Jungen Rosenberg ernst nehmen. Ich habe nie gesehen, dass er mit einer Gruppe zusammengestanden oder mit anderen herumgealbert hätte. Vielmehr ist er oft Zielscheibe von Hänseleien. Er ist ein Einzelgänger; er läuft ständig allein und nur mit seinem Skizzenblock in Reval herum. Also würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen, dass er hier seine extremistischen Ideen verbreiten könnte.«
Direktor Epstein stand auf und ging ans Fenster. Davor standen breitblättrige Bäume mit frischem Frühlingsgrün und weiter hinten stattliche, weiße Gebäude mit roten Ziegeldächern.
»Erzähl mir mehr von diesem Chamberlain. Meine literarischen Interessen liegen woanders. Welches Ausmaß hat sein Einfluss in Deutschland?«
»Er nimmt schnell zu. Alarmierend schnell. Sein Buch wurde vor etwa zehn Jahren publiziert, und seine Popularität steigt noch immer beträchtlich. Ich hörte, dass es sich über hunderttausend Mal verkauft hat.«
»Hast du es gelesen?«