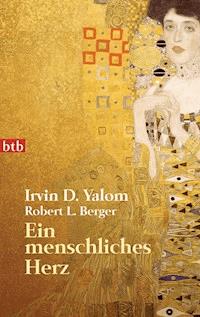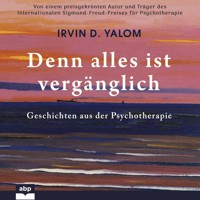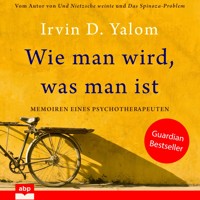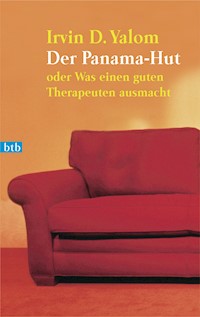
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Schlüsselmomente der Psychoanalyse – humorvoll und lehrreich in Szene gesetzt
Wie sieht es aus, das richtige Verhältnis zwischen Therapeut und Klient? Welche Abgründe gilt es zu verbergen, welche offen zu legen? Was ist von Patiententräumen zu halten, in denen der Therapeut eine entscheidende Rolle spielt? Irvin D. Yalom, Amerikas angesehenster und wortgewaltigster Psychotherapeut, zieht die Bilanz seines über fünfzigjährigen Berufslebens und beschert seinen Lesern ungewohnte Einblicke in das Leben eines Therapeuten – ein lehrreiches und mit zahlreichen Anekdoten gewürztes Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Irvin D. Yalom
Der Panama-Hut
oder Was einen guten Therapeuten ausmacht
Deutsch von Almuth Carstens
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »The Gift of Therapy« bei HarperCollins, New York.
Erweiterte und aktualisierte Ausgabe 2010 Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2002
Copyright © 2002 by Irvin Yalom
First published by HarperCollins Publishers Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency All rights reserved. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Satz: Uhl + Massopust, Aalen
RK · Herstellung: SK
Buch
»Es ist dunkel. Ich betrete Ihre Praxis, kann Sie dort jedoch nirgends finden. Die Praxis ist leer. Ich sehe mich um. Das Einzige, was ich dort entdecke, ist Ihr Panama-Hut. Und der ist voller Spinnweben.«
So schildert Dr. Irvin D. Yalom am Anfang seines neuen Buches den Traum eines Patienten – und sieht darin die Angst dieses Patienten verkörpert, seinen Therapeuten zu verlieren. Für Yalom ein willkommener Anlass, »Der Panama-Hut oder Was einen guten Therapeuten ausmacht« zu schreiben. In Anlehnung an Rainer Maria Rilkes »Briefe an einen jungen Dichter« möchte Yalom mit diesem Werk der nächsten Generation von Psychotherapeuten zu einem erfüllten, inspirierten Berufsleben verhelfen und auch alle interessierten Laien an seinem Wissen teilhaben lassen. Aus dem reichen Erfahrungsschatz von 45 Berufsjahren formuliert er sein Verständnis von Schlüsselmomenten der Psychotherapie: das gesamte Spektrum der Beziehung zwischen Therapeut und Klient; die Auseinandersetzung mit den großen, existenziellen Fragen der Menschheit; die alltäglichen Fragen im Verlauf einer Therapie; die Deutung und Einbeziehung von Träumen; und die generellen Probleme und die Glücksmomente des Therapeutendaseins.
Autor
Irvin D. Yalom war Professor für Psychiatrie an der Stanford University und ist einer der angesehensten Psychotherapeuten Amerikas. Seine Bücher »The Theory and Practice of Group Psychiatry« und »Inpatient Group Therapy« gelten als Klassiker. Seine literarischen Werke wurden zu Bestsellern und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sie sind alle bei btb veröffentlicht.
Einleitung
Es ist dunkel. Ich betrete Ihre Praxis, kann Sie dort jedoch nirgends finden. Die Praxis ist leer. Ich sehe mich um. Das Einzige, was ich entdecke, ist Ihr Panama-Hut. Und der ist voller Spinnweben.
Die Träume meiner Patienten haben sich verändert. Mein Hut ist voller Spinnweben. Meine Praxis ist dunkel und verlassen. Ich bin nirgendwo zu finden.
Meine Patienten sorgen sich um meine Gesundheit: Werde ich den langen Zeitraum, den ihre Therapie in Anspruch nimmt, überleben? Wenn ich in Urlaub fahre, fürchten sie, dass ich nicht zurückkehre. Sie malen sich aus, wie sie an meiner Beerdigung teilnehmen oder mein Grab besuchen.
Meine Patienten lassen mich nie vergessen, dass ich alt werde. Aber damit erfüllen sie nur ihre Aufgabe: Habe ich sie nicht aufgefordert, all ihre Gefühle, Gedanken und Träume zu offenbaren? Sogar potenzielle neue Patienten stimmen in den Chor ein und begrüßen mich unweigerlich mit der Frage: »Nehmen Sie immer noch Patienten an?«
Eine unserer Hauptmethoden der Todesleugnung ist der Glaube an eine persönliche Besonderheit, die Überzeugung, dass wir von biologischen Notwendigkeiten ausgenommen sind und das Leben uns nicht ebenso hart mitspielen wird wie allen anderen. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren einen Augenarzt aufsuchte, weil ich nicht mehr so gut sah. Er erkundigte sich nach meinem Alter und meinte dann: »Achtundvierzig, aha. Ja, Sie sind pünktlich dran, ganz nach Plan!«
Natürlich wusste ich vom Verstand her, dass er völlig Recht hatte, doch aus meinem tiefsten Innern stieg ein Schrei empor: »Welcher Plan? Wessen Plan? Mag ja sein, dass Sie und andere pünktlich nach Plan funktionieren, aber ich doch nicht!«
Und so wird mir mit Schrecken klar, dass ich in eine Spätphase meines Lebens eintrete. Meine Ziele, Interessen und Ambitionen haben sich auf vorhersagbare Weise verändert. In seiner Studie über den Lebenszyklus beschrieb Erik Erickson diesen späten Lebensabschnitt als Stadium der Generativität, eine postnarzisstische Phase, in der sich die Aufmerksamkeit für die eigene Entwicklung zur Fürsorge für und zum Interesse an nachfolgenden Generationen wandelt. Jetzt, da ich mich den siebzig nähere, weiß ich die Klarheit von Ericksons Sichtweise zu schätzen. Sein Konzept der Generativität scheint mir richtig. Ich möchte weitergeben, was ich gelernt habe. Und zwar so bald wie möglich.
Der nächsten Generation von Psychotherapeuten Anleitung und Inspiration zu bieten, wird heute jedoch immer problematischer, weil unser Fachgebiet in einer tiefen Krise steckt. Ein von wirtschaftlichen Überlegungen gesteuertes Gesundheitssystem schreibt eine radikale Veränderung der psychologischen Behandlung vor, sodass die Psychotherapie jetzt zur Rationalisierung verpflichtet ist – das heißt vor allem kostengünstig und damit notgedrungen kurz, oberflächlich und wenig fundiert sein muss.
Ich mache mir Sorgen darüber, wie die nächste Generation leistungsfähiger Psychotherapeuten ausgebildet werden wird. Sicherlich nicht als Assistenten von Psychiatern. Die Psychiatrie steht kurz davor, das Feld der Psychotherapie zu verlassen. Junge Psychiater sind gezwungen, sich auf Psychopharmakologie zu spezialisieren, weil Kosten für eine Psychotherapie mittlerweile nur noch dann erstattet werden, wenn sie von niedrig honorierten (anders gesagt: schlecht ausgebildeten) Ärzten durchgeführt wird. Es scheint gewiss, dass die heutige Generation klinischer Psychiater, die sich sowohl in der Psychotherapie als auch in pharmakologischer Behandlung auskennt, eine aussterbende Spezies ist.
Wie steht es mit einer Ausbildung in klinischer Psychologie - die diese Lücke offensichtlich füllen könnte? Leider sind klinische Psychologen demselben Druck des Marktes ausgesetzt wie die Psychotherapeuten, und psychologische Institute, die Doktoranden aufnehmen, reagieren damit, dass sie eine Therapie lehren, die symptomorientiert, kurz und damit kostengünstig ist.
Also sorge ich mich um die Psychotherapie – um ihre Deformation durch ökonomische Zwänge und um ihre Verarmung durch radikal gekürzte Ausbildungsprogramme. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass auch künftig Therapeuten aus verschiedenen pädagogischen Disziplinen (Psychologie, Beratung, Sozialarbeit, Seelsorge, klinische Philosophie) weiterhin eine gründliche Ausbildung anstreben und selbst unter dem Druck der Realitäten des Gesundheitssystems Patienten finden werden, die ein umfassendes Wachstum und Veränderung zum Ziel haben und willens sind, sich auf eine zeitlich offene Therapie einzulassen. Für diese Therapeuten und diese Patienten habe ich Der Panama-Hut geschrieben.
Studenten rate ich auf den folgenden Seiten von Sektierertum ab und schlage ihnen einen therapeutischen Pluralismus vor, bei dem effektive Interventionen sich aus unterschiedlichen Therapie-Ansätzen speisen. Ich selbst arbeite allerdings überwiegend in einem interpersonalen oder einem existenziellen Bezugsrahmen. Daher ist der Großteil meiner Ratschläge aus der einen oder anderen dieser beiden Perspektiven abgeleitet.
Seit meinem Einstieg in die Psychiatrie habe ich zwei dauerhafte Interessen: die Gruppentherapie und die existenzielle Therapie. Es sind parallele Interessen, die jedoch beide separat funktionieren: Das heißt, ich praktiziere keine »existenzielle Gruppentherapie« – ich wüsste auch gar nicht, was das sein sollte. Diese zwei Methoden unterscheiden sich nicht nur in ihrer äußeren Form (das heißt, eine Gruppe mit ungefähr sechs bis neun Mitgliedern gegenüber einer Eins-zu-Eins-Sitzung bei der existenziellen Therapie), sondern sie sind auch in ihrem Bezugssystem fundamental unterschiedlich. Wenn ich gruppentherapeutisch mit Patienten arbeite, habe ich einen interpersonalen Ansatz und setze voraus, dass diese Patienten wegen ihrer Unfähigkeit, befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, am Leben verzweifeln.
Operiere ich dagegen in einem existenziellen Bezugsrahmen, so gehe ich von einer ganz anderen Annahme aus: dass die Patienten als Ergebnis einer Konfrontation mit den harten Tatsachen des Menschseins – den »Gegebenheiten« der Existenz - am Leben verzweifeln. Da zahlreiche Hinweise in diesem Buch sich aus diesem existenziellen Rahmen herleiten, der vielen Lesern unbekannt ist, hier eine kurze Einführung.
Die existenzielle Psychotherapie ist ein dynamisches therapeutisches Verfahren, das sich auf Belange konzentriert, die in der Existenz wurzeln.
Lassen Sie mich diese knappe Definition erweitern, indem ich den Ausdruck »dynamisches Verfahren« näher erkläre. Dynamisch hat sowohl eine umgangssprachliche als auch eine technische Bedeutung. Die umgangssprachliche Bedeutung von dynamisch (abgeleitet vom griechischen dynasthai —vermögen, können), die Kraft oder Vitalität impliziert (das heißt eines Dynamos, eines Football-Spielers oder politischen Redners), ist hier offensichtlich nicht relevant. Denn wenn das die Bedeutung von »dynamisch« wäre, wo ist dann der Therapeut, der behaupten würde, nicht-dynamisch, nämlich schwerfällig und träge zu sein?
Nein, ich benutze »dynamisch« im technischen Sinne des Wortes, das zwar noch die Vorstellung von Kraft beinhaltet, aber in Freuds Modell der psychischen Funktionen wurzelt, welches postuliert, dass widersprüchliche Kräfte innerhalb des Individuums dessen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen bestimmen. Überdies – und das ist ein entscheidender Punkt – existieren diese widersprüchlichen Kräfte auf wechselnden Ebenen des Bewusstsein; manche sind sogar völlig unbewusst.
Die existenzielle Psychotherapie ist also eine dynamische Therapie, die wie die verschiedenen psychoanalytischen Therapien das Vorhandensein unbewusster Kräfte voraussetzt; Kräfte, die das Funktionieren des Bewusstseins beeinflussen. Von psychoanalytischen Theorien unterscheidet sie sich jedoch in Bezug auf die nächste Frage: Welches ist die Natur dieser widersprüchlichen inneren Kräfte?
Der existenzielle psychotherapeutische Ansatz geht davon aus, dass der innere Konflikt, der uns peinigt, nicht nur auf unseren Kampf mit unterdrückten triebhaften Bestrebungen oder internalisierten signifikanten Vorbildern oder mit Bruchstücken von vergessenen traumatischen Erinnerungen zurückzuführen ist, sondern auch auf unsere Konfrontation mit den »Gegebenheiten« der Existenz.
Und was sind diese »Gegebenheiten« der Existenz? Wenn wir uns gestatten, die alltäglichen Dinge des Lebens auszublenden oder auszuklammern, und gründlich über unsere Situation in der Welt nachsinnen, gelangen wir unweigerlich zu den tiefer liegenden Schichten der Existenz (den so genannten »letzten Belangen«). Vier letzte Belange sind meiner Meinung nach höchst aufschlussreich für die Psychotherapie: Tod, Einsamkeit, Sinn des Lebens und Freiheit. (Alle vier werden jeweils in einem gesonderten Teil definiert und erörtert.)
Studenten haben mich oft gefragt, warum ich mich nicht für Ausbildungsprogramme in existenzieller Psychotherapie einsetze. Der Grund ist der, dass ich die existenzielle Psychotherapie niemals als separate, eigenständige Schule betrachtet habe. Statt zu versuchen, Lehrpläne für existenzielle Psychotherapie zu entwickeln, sollten wir meiner Meinung nach die Ausbildung aller gut geschulten dynamischen Therapeuten dahingehend ergänzen, dass ihre Sensibilität für existenzielle Fragen gesteigert wird.
Prozess und Inhalt. Wie sieht die existenzielle Psychotherapie in der Praxis aus? Um diese Frage zu beantworten, muss man sein Augenmerk sowohl auf den »Inhalt« als auch den »Prozess« richten – die beiden Hauptaspekte des therapeutischen Diskurses. »Inhalt« ist genau das, was es besagt – der präzise Wortlaut, die im Wesentlichen angesprochenen Themen. »Prozess« gehört einer ganz anderen und ungemein wichtigen Dimension an: der zwischenmenschlichen Beziehung von Patient und Therapeut. Wenn wir nach dem »Prozess« einer Interaktion fragen, meinen wir damit: Was verraten uns die Worte (und auch das nonverbale Verhalten) über das Wesen der Beziehung zwischen den an der Interaktion beteiligten Personen?
Würde man meine Therapiesitzungen beobachten, dann suchte man wohl oft vergeblich nach ausführlichen expliziten Diskussionen über Tod, Freiheit, Sinn des Lebens oder existenzielle Einsamkeit. Derartige Inhalte sind vielleicht nur für einige (aber nicht alle) Patienten in manchen (aber nicht allen) Stadien ihrer Therapie ausschlaggebend. Der effiziente Therapeut darf sowieso nie versuchen, die Erörterung bestimmter Inhalte zu erzwingen: Die Therapie sollte sich nie an der Theorie, sondern an der Beziehung ausrichten.
Untersucht man jedoch dieselben Sitzungen auf einen charakteristischen Prozess hin, der sich aus einer existenziellen Orientierung herleitet, so stößt man auf ein ganz anderes Phänomen. Eine erhöhte Sensibilität für existenzielle Fragen beeinflusst das Wesen der Beziehung zwischen Therapeut und Patient enorm und wirkt sich auf jede einzelne therapeutische Sitzung aus.
Ich bin selbst überrascht über die besondere Form, die dieses Buch angenommen hat. Ich habe nie damit gerechnet, ein Buch zu verfassen, das eine Reihe von Ratschlägen für Therapeuten enthält. Im Rückblick ist mir der Ausgangspunkt allerdings ganz klar. Vor zwei Jahren schaute ich mir die Huntington Japanese Gardens in Pasadena an, bemerkte anschließend, dass es in der Huntington Library eine Ausstellung mit Bestsellern der Renaissance in Großbritannien gab, und spazierte hinein. Drei der zehn gezeigten Bände waren Bücher mit Aufzählungen von »Tipps« – über Tierzucht, Nähen, Gärtnerei. Ich staunte, dass schon damals, vor hunderten von Jahren, kurz nach Einführung der Druckerpresse, Listen mit Ratschlägen die Aufmerksamkeit der Massen weckten.
Vor Jahren behandelte ich eine Schriftstellerin, die das Schreiben zweier aufeinander folgender Romane gelangweilt hatte, und die jetzt beschloss, kein Buch mehr in Angriff zu nehmen, bis eins daherkäme und sie in den Hintern bisse. Ich lachte über ihre Bemerkung, begriff aber bis zu dem Moment in der Huntington Library, als mich die Idee für ein Buch mit »Tipps« in den Hintern biss, gar nicht richtig, was sie meinte. Ich erinnere mich, dass ich an Ort und Stelle beschloss, andere schriftstellerische Projekte ruhen zu lassen, meine klinischen Notizen und Tagebücher zu plündern und ein Buch mit Ratschlägen für angehende Therapeuten zu verfassen.
Über der Entstehung dieses Textes schwebte der Geist von Rainer Maria Rilke. Kurz vor meinem Erlebnis in der Huntington Library hatte ich noch einmal seine Briefe an einen jungen Dichter gelesen, und ich nahm ihn mir bewusst zum Vorbild, was Ehrlichkeit, Ausführlichkeit und großzügige Gesinnung betrifft.
Die Ratschläge in diesem Buch gehen auf Notizen aus fünfundvierzig Jahren klinischer Praxis zurück. Sie sind eine für mich typische Mischung aus Ideen und Techniken, die sich in meiner Arbeit als nützlich erwiesen haben. Diese Ideen sind so persönlich, eigenwillig und gelegentlich originell, dass der Leser sie höchstwahrscheinlich nirgendwo sonst antrifft. Daher soll dieser Text keinesfalls ein systematischer Leitfaden sein; ich denke ihn mir eher als Ergänzung zu einem umfassenden Ausbildungsprogramm. Die fünfundachtzig Kategorien in diesem Buch habe ich willkürlich gewählt, geleitet eher von meiner Passion für die Aufgabe als von einer bestimmten Ordnung oder einem System. Ich begann mit einer Liste von über zweihundert Ratschlägen und straffte schließlich an den Stellen, für die ich zu wenig Begeisterung empfand.
Ein weiterer Faktor beeinflusste meine Auswahl dieser fünfundachtzig Punkte. Meine jüngsten Romane und Geschichten enthalten zahlreiche Schilderungen therapeutischer Methoden, die sich für mich in der klinischen Arbeit als nützlich erwiesen haben, aber da meine belletristischen Werke einen komischen, oft burlesken Tonfall haben, wissen viele Leser nicht genau, ob es mir mit den therapeutischen Methoden, die ich beschreibe, ernst ist. Der Panama-Hut bietet mir Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen.
Als praxisorientierte Sammlung meiner bevorzugten Interventionen und Kommentare wartet dieses Buch mehr mit Technik als mit Theorie auf. Lesern, die mehr über theoretische Hintergründe wissen möchten, seien meine Werke Existentielle Psychotherapie und Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie empfohlen, die Ursprungsbücher für diesen Text.
Da ich in Medizin und Psychiatrie ausgebildet bin, habe ich mich an den Begriff Patient gewöhnt (vom lateinischen patiens —ein Leidender oder Duldender), doch ich benutze ihn synonym mit Klient, der traditionell üblichen Bezeichnung in der Psychologie und Beratung. Manche denken bei »Patient«, der Therapeut nähme eine reservierte, desinteressierte, autoritäre Haltung ein. Aber lesen Sie weiter – ich beabsichtige durchweg, zu einer therapeutischen Beziehung zu ermutigen, die auf Engagement, Offenheit und Gleichberechtigung basiert.
Viele Bücher, auch meine eigenen, bestehen aus einer begrenzten Anzahl wesentlicher Punkte und zusätzlich reichlich Füllmaterial, um die einzelnen Punkte elegant miteinander zu verbinden. Da ich eine sehr große Zahl von Vorschlägen ausgewählt habe, viele davon für sich stehend, und Füllsel und Übergänge weitgehend ausgelassen habe, hat mein Text eine episodische, sprunghafte Qualität.
Obgleich ich diese Ratschläge willkürlich ausgewählt habe und davon ausgehe, dass viele Leser sie nicht systematisch von Anfang bis Ende lesen, habe ich im Nachhinein versucht, sie leserfreundlich zu gruppieren.
Der erste Teil des Buches (Kapitel 1-40) befasst sich mit dem Wesen der Beziehung Therapeut-Patient, mit besonderer Betonung des Hier und Jetzt, des Umgangs des Therapeuten mit dem Selbst und der Selbstoffenbarung des Therapeuten.
Der nächste Teil (Kapitel 41—51) wendet sich vom Prozess dem Inhalt zu und schlägt Methoden zur Erforschung der letzten Belange, Tod, Sinn des Lebens und Freiheit, vor (auf die verantwortliches Handeln und Entscheidung folgen).
Der dritte Teil (Kapitel 52-76) greift verschiedene Fragen auf, die sich in der alltäglichen Praxis der Therapie stellen.
Im vierten Teil (Kapitel 77-83) spreche ich über die Verwendung von Träumen in der Therapie.
Im letzten Teil (Punkt 84—85) erörtere ich die Gefahren und Privilegien im Dasein eines Therapeuten.
Der Text ist mit vielen meiner spezifischen Lieblingssätze und -interventionen gespickt. Gleichzeitig ermutige ich zu Spontaneität und Kreativität. Betrachten Sie daher meine ganz eigenen Interventionen nicht als therapeutische Rezepte; sie repräsentieren meine persönliche Perspektive und meine Versuche, in meinem Innern meinen eigenen Stil und meine eigene Stimme zu finden. Viele Studenten werden feststellen, dass sich andere Ansätze und Techniken besser für sie eignen. Die Ratschläge in diesem Buch leiten sich aus meiner klinischen Praxis mit einigermaßen gut bis sehr gut funktionierenden Patienten (statt Psychotikern oder deutlich Behinderten) her, die mich einmal, oder, was seltener vorkommt, zweimal wöchentlich über einige Monate hinweg bis zu zwei und drei Jahre lang aufsuchten. Meine therapeutischen Ziele bei diesen Patienten sind ehrgeizig: Außer Symptombeseitigung und Schmerzerleichterung strebe ich es an, ein Wachstum der Persönlichkeit und eine grundlegende charakterliche Veränderung zu ermöglichen. Ich weiß, dass viele meiner Leser sich in einer anderen klinischen Lage befinden mögen: ein unterschiedliches Setting mit unterschiedlicher Patienten-Population und kürzerer Therapiedauer. Dennoch hoffe ich, dass meine Leser einen Weg finden, das, was ich gelernt habe, an ihre eigene, spezielle Arbeitssituation anzupassen und darauf anzuwenden.
1. Räumen Sie Wachstumshindernisse aus dem Weg
Als ich als junger Psychotherapie-Student noch meinen Weg suchte, war das Buch, aus dessen Lektüre ich den größten Gewinn zog, Karen Horneys Neurose und menschliches Wachstum. Das für mich nützlichste Konzept in diesem Buch war die Vorstellung, dass der Mensch einen angeborenen Hang zur Selbstverwirklichung hat. Wenn Hindernisse beiseite geräumt werden, so glaubte Horney wächst das Individuum zu einem reifen, voll entwickelten Erwachsenen heran, wie eine Eichel zu einer Eiche heranwächst.
»Wie eine Eichel zu einer Eiche heranwächst« —was für ein wunderbar befreiendes und erhellendes Bild! Es veränderte meinen psychotherapeutischen Ansatz für alle Zeiten. Ich hatte eine neue Vision von meiner Arbeit: Es war meine Aufgabe, Hindernisse zu beseitigen, die den Weg meines Patienten blockieren. Mir oblag nicht alles; ich musste den Patienten nicht zu dem Wunsch inspirieren zu wachsen, und auch nicht zur Neugier, zum Wollen, zu Lebensfreude, Fürsorglichkeit, Loyalität oder irgendeiner anderen der tausend Eigenschaften, die uns erst wahrhaft menschlich machen. Nein, ich musste die Hindernisse identifizieren und aus dem Weg räumen. Der Rest würde, angetrieben von den Selbstverwirklichungskräften des Patienten, automatisch folgen.
Ich entsinne mich an eine junge Witwe mit einem, wie sie es nannte, »versiegten Herzen« – der Unfähigkeit, je wieder zu lieben. Es machte mir Angst, diese Unfähigkeit zu lieben ansprechen zu müssen. Ich wusste nicht, wie ich das anfangen sollte. Was ich allerdings sehr wohl konnte, war, mich der Identifizierung und der Beseitigung der vielen Blockaden zu widmen, die sie daran hinderten zu lieben.
Ich bekam schnell heraus, dass Liebe ihr wie Verrat vorkam. Einen anderen zu lieben war ein Betrug an ihrem toten Ehemann; ihr schien es, als klopfte sie damit die letzten Nägel in seinen Sarg. Einen anderen so innig zu lieben wie ihren Mann (und mit weniger wollte sie sich nicht zufrieden geben) bedeutete, dass ihre Liebe zu ihrem Mann irgendwie unzulänglich oder brüchig gewesen wäre. Einen anderen zu lieben wäre selbstzerstörerisch, denn ein Verlust und der brennende Schmerz darüber wären unvermeidlich. Wieder zu lieben, kam ihr verantwortungslos vor: Sie war böse, brachte Unglück, und ihr Kuss war der Kuss des Todes.
Monatelang arbeiteten wir hart daran, all diese Hindernisse für eine neue Liebe zu identifizieren. Monatelang rangen wir der Reihe nach mit jeder irrationalen Blockade. Doch als das geschafft war, gewannen die internen Prozesse der Patientin die Oberhand: Sie lernte einen Mann kennen, sie verliebte sich, sie heiratete noch einmal. Ich musste ihr nicht beibringen, wie man sucht, gibt, Gefühle hegt, liebt – das hätte ich auch gar nicht gekonnt.
Ein paar Worte über Karen Horney. Ihr Name ist den meisten jungen Therapeuten unbekannt. Da die Bücher hervorragender Theoretiker auf unserem Gebiet nur so kurze Zeit verfügbar sind, werde ich ab und zu in Erinnerungen verfallen – nicht nur, um ihnen Reverenz zu erweisen, sondern auch, um hervorzuheben, dass unser Fach eine lange Geschichte mit bemerkenswert kompetenten Persönlichkeiten besitzt, die ein solides Fundament für unsere heutige therapeutische Arbeit gelegt haben.
Die »Neo-Freudianer«, zu denen sie gehörte, waren eine Gruppe von Klinikern und Theoretikern, die sich gegen Freuds ursprüngliche Konzentration auf die Triebtheorie wandten, das heißt, gegen die Vorstellung, dass das sich entwickelnde Individuum weitgehend davon bestimmt wird, wie sich seine inhärenten Triebe entfalten und ausdrücken. Diese Bewegung leistete einen ausschließlich amerikanischen Beitrag zur Theorie der Psychodynamik.
Sie legte Wert darauf, den gewaltigen Einfluss der zwischenmenschlichen Strukturen zu berücksichtigen, in die das Individuum eingebettet ist und die sein Leben lang seinen Charakter formen. Die bekanntesten Interpersonal-Theoretiker Harry Stack Sullivan, Erich Fromm und Karen Horney sind mittlerweile so gründlich in unsere therapeutische Sprache und Praxis integriert und assimiliert, dass wir alle, ohne es zu wissen, Neo-Freudianer sind. Es erinnert einen an Monsieur Jourdain in Molières Der Bürger als Edelmann, der, nachdem er die Definition des Wortes Prosa kennen gelernt hat, mit Erstaunen ausruft: »Wenn man bedenkt, dass ich mein Leben lang Prosa gesprochen habe, ohne es zu wissen!«
2. Vermeiden Sie eine Diagnose (außer für die Krankenversicherung)
Heutigen Psychotherapie-Studenten wird zu stark vermittelt, wie wichtig eine Diagnose ist. Die Standard-Krankenversicherungen fordern, dass Therapeuten rasch eine präzise Diagnose stellen, um dann mit einer kurzen, konzentrierten Therapie zu beginnen, die der jeweiligen Diagnose entspricht. Klingt gut. Klingt logisch und effizient. Mit der Realität hat es allerdings wenig zu tun. Es stellt nämlich den illusorischen Versuch dar, wissenschaftliche Genauigkeit zu erzwingen, wo sie weder möglich noch wünschenswert ist.
Obgleich eine Diagnose fraglos entscheidend ist beim Erwägen der Behandlung von ernsthaften Störungen mit biologischem Substrat (zum Beispiel Schizophrenie, bipolare Störungen, Affektpsychosen, Schläfenlappen-Epilepsie, Vergiftungen, Erkrankungen der Organe oder des Gehirns in Folge von Toxinen, Degeneration oder Infektionen), ist sie in der alltäglichen Psychotherapie mit nicht so stark beeinträchtigten Patienten oft kontraproduktiv.
Warum? Erstens ist eine Psychotherapie ein sich langsam entfaltender Prozess, währenddessen der Therapeut versucht, den Patienten so gut wie möglich kennen zu lernen. Eine Diagnose verengt das Blickfeld; sie mindert die Fähigkeit, den anderen als eine Person wahrzunehmen. Wenn wir eine Diagnose gestellt haben, neigen wir dazu, diejenigen Seiten des Patienten, die nicht zu der jeweiligen Diagnose passen, selektiv auszugrenzen und entsprechend übermäßig aufmerksam zu sein für subtile Eigenarten, die unsere Anfangsdiagnose zu bestätigen scheinen. Mehr noch, aus einer Diagnose kann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden. Jemanden als »Borderline«-Patienten oder »hysterisch« einzustufen, kann dazu beitragen, dass genau diese Züge stimuliert und verfestigt werden. Tatsächlich gibt es eine lange Tradition ärztlich bewirkter Einflüsse auf die Form von klinischen Fällen, in die auch die aktuelle Kontroverse über multiple Persönlichkeiten und über verdrängte Erinnerungen an sexuellen Missbrauch gehört. Und bedenken Sie außerdem die geringe Verlässlichkeit einer Kategorisierung von Persönlichkeitsstörungen mittels DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, also ein diagnostischer und statistischer Kriterienkatalog für psychische Störungen), nach der die Patienten dann doch oft längerfristige Psychotherapien eingehen müssen.
Und welchem Therapeuten ist noch nicht aufgefallen, wie viel leichter es ist, eine DSM-Diagnose nach dem ersten Gespräch zu stellen als wesentlich später, sagen wir, nach der zehnten Sitzung, wenn wir erheblich mehr über das Individuum wissen? Ist das nicht eine seltsame Wissenschaft? Ein Kollege von mir brachte die grundsätzliche Schwierigkeit dieser Vorgehensweise auf den Punkt, als er seinen Psychiatrie-Assistenten fragte: »Wenn Sie selbst therapiert würden oder es in Erwägung zögen, mit welcher DSM-Diagnose könnte Ihr Therapeut eine so komplexe Persönlichkeit wie Sie dann treffend beschreiben?« (C. P. Rosenbaum, persönliches Gespräch, Nov. 2000)
Das therapeutische Unterfangen muss eine Gratwanderung zwischen zu wenig und zu viel Objektivität sein; wenn wir das DSM-Diagnosesystem zu ernst nehmen, dann setzen wir vielleicht das Menschliche, das Spontane, das Kreative und Ungewisse an einer Therapie aufs Spiel. Denken Sie daran, dass frühere Experten, die inzwischen verworfene Diagnosekategorien formulierten, ebenso kompetent, stolz und selbstbewusst waren wie die heutigen Mitglieder eines DSM-Komitees. Zweifellos wird auch das DSM-Speisekartenformat Fachleuten für Psychohygiene irgendwann absurd erscheinen.
3. Therapeut und Patient als »gemeinsam Reisende«
Andre Malraux, der französische Romancier, beschrieb einen Landpfarrer, der über Jahrzehnte hinweg die Beichte abgenommen hatte, und dann das, was er dabei über die menschliche Natur gelernt hatte, wie folgt zusammenfasste: »Zunächst einmal sind die Leute viel unglücklicher, als man denkt ... und so etwas wie einen erwachsenen Menschen gibt es nicht.« Jedem – und das schließt Therapeuten wie Patienten ein – ist es beschieden, nicht nur die Heiterkeit des Lebens zu erfahren, sondern auch seine unvermeidlichen dunklen Seiten: Desillusionierung, Alter, Krankheit, Einsamkeit, Verlust, Sinnlosigkeit, schmerzhafte Entscheidungen und Tod. Niemand hat dies so prägnant und düster formuliert wie Schopenhauer:
In früher Jugend, wenn wir über unser kommendes Leben nachsinnen, sind wir wie Kinder in einem Theater, bevor sich der Vorhang hebt; hoch gestimmt sitzen wir da und warten begierig darauf, dass das Stück beginnt. Es ist ein Segen, dass wir nicht wissen, was tatsächlich geschehen wird. Könnten wir es voraussehen, kämen uns Kinder vielleicht wie Gefangene vor, verurteilt nicht zum Tode, sondern zum Leben, und alle noch nicht ahnend, was ihr Urteil bedeutet.
Oder an anderer Stelle:
Wir sind wie Lämmer auf der Wiese, die sich unter den Augen des Schlachters vergnügen, der sich erst das eine und dann das andere als Opfer aussucht. Deshalb ahnen wir in unseren guten Tagen alle nichts von dem Bösen, welches das Schicksal uns womöglich bald schon zugedacht hat – Krankheit, Armut, Verstümmelung, Verlust der Sehkraft oder des Verstandes.
Mag Schopenhauers Sicht der Dinge auch stark von seinem persönlichen Unglück gefärbt sein, so ist es doch schwierig zu leugnen, dass dem Leben jedes bewussten Individuums eine gewisse Verzweiflung innewohnt. Meine Frau und ich unterhalten uns manchmal damit, dass wir imaginäre Dinnerpartys für Gruppen von Menschen planen, die ähnliche Neigungen haben – zum Beispiel eine Party für alle Monopolisten oder alle glühenden Narzissten oder raffinierten Passiv-Aggressiven, die wir kennen, oder umgekehrt eine Party, zu der wir nur die wahrhaft glücklichen Menschen einladen, denen wir begegnet sind. Obgleich wir keine Probleme haben, alle möglichen Marotten-Tische voll zu kriegen, haben wir es noch nie geschafft, einen Tisch nur mit glücklichen Menschen zu bevölkern. Jedes Mal, wenn wir ein paar Leute mit fröhlichem Wesen identifiziert und auf eine Warteliste gesetzt haben, und dann weitersuchen, um den Tisch zu komplettieren, stellen wir fest, dass der eine oder andere unserer glücklichen Gäste irgendwann von einer größeren Widrigkeit betroffen wird – oft von der eigenen schweren Krankheit oder der eines Kindes oder Ehepartners.
Diese traurige, aber realistische Sicht auf das Leben beeinflusst seit langem mein Verhältnis zu denen, die meine Hilfe suchen. Es gibt zwar viele Bezeichnungen für die therapeutische Beziehung (Patient/Therapeut, Klient/Berater, Analysand /Analytiker, Klient/Förderer und als neueste – und bei weitem abstoßendste – User/Provider), doch für mein Gefühl ist keine davon ganz zutreffend. Ich betrachte meine Patienten und mich am liebsten als gemeinsam Reisende, ein Begriff, der die Unterscheidung zwischen »ihnen« (den Leidenden) und »uns« (den Heilern) aufhebt. Während meiner Ausbildung wurde ich oft mit der Vorstellung vom erschöpfend analysierten Therapeuten konfrontiert, aber im Laufe meines Lebens, in dem ich enge Freundschaften mit vielen meiner Kliniker-Kollegen schloss, die Autoritäten meines Fachgebiets kennen lernte, gebeten wurde, meinen ehemaligen Therapeuten und Lehrern zu helfen, und selbst eine Autorität geworden bin, habe ich erkannt, dass diese Vorstellung ein Mythos ist. Wir sind alle gleichermaßen betroffen, und kein Therapeut und auch sonst niemand ist gefeit gegen die inhärenten Tragödien des Daseins.
Eine meiner Lieblingsgeschichten über das Heilen, zu finden in Hermann Hesses Das Glasperlenspiel, handelt von Joseph und Dion, zwei berühmten Heilern, die in biblischen Zeiten lebten. Obgleich beide sehr erfolgreich waren, arbeiteten sie auf unterschiedliche Weise. Joseph, der Jüngere, heilte durch stilles, inspiriertes Zuhören. Die Pilger vertrauten ihm. Der Strom der Leiden und Ängste, der sich in seine Ohren ergoss, verflüchtigte sich wie Wasser auf Wüstensand, und die Bußfertigen verließen ihn erleichtert und besänftigt. Dion dagegen, der ältere Heiler, begegnete denen, die seine Hilfe suchten, aktiv und erahnte ihre noch ungebeichteten Sünden. Er war ein großartiger Richter und scheltender Zuchtmeister und heilte durch tätige Intervention. Er behandelte die Büßer wie Kinder, indem er Ratschläge gab, Strafen verhängte, Pilgerfahrten und Hochzeiten anordnete und Feinde nötigte, sich zu versöhnen.
Die beiden Heiler begegneten sich nie und waren lange Jahre Rivalen, bis Joseph, der Jüngere, seelisch krank wurde, in tiefe Verzweiflung verfiel und von Gedanken an Selbstmord verfolgt wurde. Da er nicht im Stande war, sich mit seinen eigenen therapeutischen Methoden zu heilen, brach er zu einer Reise in den Süden auf, um bei Dion Hilfe zu suchen.
Unterwegs machte Joseph eines Abends in einer Oase Station, wo er mit einem älteren Reisenden ins Gespräch kam. Als Joseph ihm Zweck und Ziel seiner Pilgerfahrt schilderte, bot sich der andere als Führer zu Dion an. Auf ihrer langen gemeinsamen Reise offenbarte der Ältere Joseph seine Identität. Mirabile dictu: Er selbst war Dion — genau der Mann, den Joseph suchte.
Ohne zu zögern, lud Dion seinen jüngeren, verzweifelten Rivalen in sein Haus ein, wo sie viele Jahre lang zusammen lebten und arbeiteten. Dion bat Joseph zunächst, sein Diener zu werden. Später erhob er ihn zum Schüler und schließlich zum vollwertigen Kollegen. Jahre danach wurde Dion krank und rief auf dem Totenbett seinen jungen Mitarbeiter zu sich, um ihm etwas zu gestehen. Er sprach von Josephs früherer schrecklicher Krankheit und seiner Reise zum alten Dion, um Hilfe von ihm zu erbitten. Er sprach davon, dass es Joseph wie ein Wunder erschienen war, dass sein Mitreisender und Führer sich als Dion selbst erwiesen hatte.
Nun, da er im Sterben lag, sei die Stunde gekommen, sagte Dion zu Joseph, sein Schweigen bezüglich dieses Wunders zu brechen. Er gestand, dass es auch ihm damals wie ein Wunder vorgekommen war, denn auch er sei verzweifelt gewesen. Er habe sich leer und seelisch tot gefühlt und, da er sich selbst nicht helfen konnte, eine Reise angetreten, um Hilfe zu suchen. Genau an dem Abend, an dem sie sich in der Oase getroffen hatten, war er zu einem berühmten Heiler namens Joseph unterwegs gewesen.
Hesses Geschichte hat mich immer außerordentlich bewegt. In ihr liegt für mich eine höchst erhellende Erkenntnis über das Zuteilwerdenlassen und Empfangen von Hilfe, über Ehrlichkeit und Falschheit und über die Beziehung zwischen Heiler und Patient. Die beiden Männer halfen einander sehr, doch auf ganz unterschiedliche Weise. Der jüngere Heiler wurde beschützt; er fand einen Erzieher, Lehrer, Mentor und Vater. Dem älteren Heiler hingegen wurde dadurch geholfen, dass er jemandem nützen konnte, dass er einen Schüler gewann, von dem er die Liebe eines Sohnes, Respekt und Trost in seiner Einsamkeit empfing.
Wenn ich die Geschichte allerdings noch einmal überdenke, frage ich mich, ob sich die beiden verwundeten Seelen nicht noch besser hätten helfen können. Vielleicht verschenkten sie die Gelegenheit für etwas noch Tieferes, Authentischeres, nachdrücklicher Veränderndes. Vielleicht fand die wahre Therapie am Totenbett statt, als sie sich ehrlich offenbarten, dass sie beide nur menschlich, allzu menschlich waren. Die zwanzig Jahre der Geheimhaltung, so hilfreich sie auch waren, verhinderten womöglich eine grundlegendere Form gegenseitiger Unterstützung. Was wäre wohl geschehen, wenn Dions Beichte auf dem Totenbett zwanzig Jahre früher stattgefunden hätte, wenn Heiler und Suchender sich gemeinsam den Fragen gestellt hätten, auf die es keine Antwort gibt?
All dies spiegelt sich in Rilkes Briefen an einen jungen Dichter wider, in denen er ihm rät, »Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben«. Ich würde hinzufügen: »Versuchen Sie, auch die Fragenden lieb zu haben.«
4. Beziehen Sie den Patienten mit ein
Sehr viele unserer Patienten haben Probleme mit Intimität und erhalten schon dadurch therapeutische Hilfe, dass sie eine vertraute Beziehung mit ihrem Therapeuten erleben. Manche fürchten Nähe, weil sie glauben, sie hätten etwas grundsätzlich Unannehmbares an sich, etwas Widerwärtiges und Unverzeihliches. In diesem Fall kann der Schritt, sich einem anderen Menschen vollständig zu enthüllen und trotzdem akzeptiert zu werden, das Hauptvehikel therapeutischer Hilfe sein. Andere meiden Nähe vielleicht, weil sie Angst haben, ausgenützt, vereinnahmt oder verlassen zu werden; auch für sie wird die vertraute und enge Beziehung zum Therapeuten zum emotionalen Korrektiv.
Deshalb ist nichts wichtiger als die ständige Pflege meiner Beziehung zu dem Patienten, und ich achte sorgfältig auf jede Nuance bei unseren Begegnungen. Wirkt der Patient heute distanziert? Konkurriert er? Ist er meinen Kommentaren gegenüber unaufmerksam? Nutzt er das, was ich sage, insgeheim, weigert sich jedoch, meine Hilfe offen anzuerkennen? Ist er übermäßig respektvoll? Unterwürfig? Bringt er zu selten Einwände oder Widerspruch vor? Ist er gleichgültig oder argwöhnisch? Komme ich in seinen Träumen oder Tagträumen vor? In welchen Worten führt er imaginäre Gespräche mit mir? All das und mehr möchte ich wissen. Ich lasse nie eine Sitzung verstreichen, ohne einen prüfenden Blick auf unsere Beziehung zu werfen, manchmal mit einer simplen Frage wie »Wie geht es uns heute miteinander?« oder »Wie erleben Sie den Abstand zwischen uns heute?« Gelegentlich bitte ich den Patienten, sich gedanklich in die Zukunft zu versetzen: »Stellen Sie sich vor, wie Sie in einer halben Stunde auf der Heimfahrt sind und auf unsere heutige Sitzung zurückblicken. Was für Gefühle hegen Sie dann für sich und mich? Welche Aussagen über unsere Beziehung wurden heute nicht getroffen, welche Fragen dazu nicht gestellt?«
5. Unterstützen Sie den Patienten
Eine der wertvollsten Erfahrungen in einer intensiven Therapie ist die, unterstützt zu werden. Frage: Woran erinnern Patienten sich Jahre später, wenn sie auf ihre Therapie zurückblicken? Antwort: nicht an bestimmte Einsichten, nicht an die Interpretationen ihres Therapeuten. Meistens erinnern sie sich vielmehr an dessen positive, unterstützende Bemerkungen.
Ich lege Wert darauf, meine positiven Gedanken und Gefühle hinsichtlich meiner Patienten in vielen Bereichen auszudrücken - was zum Beispiel ihre sozialen Fähigkeiten angeht, ihre Wissbegier, Warmherzigkeit, Loyalität ihren Freunden gegenüber, ihre sprachliche Genauigkeit, ihren Mut, inneren Dämonen gegenüberzutreten, ihren Willen zur Veränderung, ihre Bemühungen, den Teufelskreis von Missbrauch zu unterbrechen, und ihre Entschlossenheit, die »heiße Kartoffel« nicht an die nächste Generation weiterzureichen. Knausern Sie nicht – dazu besteht kein Anlass; alles spricht dafür, dass Sie diese Beobachtungen und Ihre positiven Empfindungen äußern sollten. Und hüten Sie sich vor leeren Komplimenten - formulieren Sie Ihre Unterstützung so treffend wie Ihr Feedback oder Ihre Interpretationen. Bedenken Sie die große Macht des Therapeuten – eine Macht, die zum Teil davon herrührt, dass wir in die intimsten Lebensmomente, Gedanken und Fantasien unserer Patienten eingeweiht sind. Akzeptanz und Unterstützung von jemandem, der einen so gut kennt, ist eine enorme Bestätigung.
Wenn Patienten einen wichtigen und mutigen therapeutischen Schritt machen, gratulieren Sie ihnen dazu. Wenn ich während der Sitzung sehr engagiert war und bedaure, dass sie zu Ende geht, sage ich, dass ich die Stunde nur sehr ungern abschließe. Und (ein Geständnis – jeder Therapeut hat seine kleinen, heimlichen Übertretungen!) ich zögere nicht, dies auch nonverbal auszudrücken, indem ich um einige Minuten überziehe.
Oft ist der Therapeut das einzige Publikum bei großen Dramen und mutigen Handlungen. Ein solches Privileg verlangt nach einer Rückmeldung für den Schauspieler. Auch wenn Patienten andere Vertraute haben mögen, wissen diese bestimmte bedeutsame Schritte höchstwahrscheinlich nicht so umfassend zu würdigen wie der Therapeut. Vor Jahren teilte mir zum Beispiel mein Patient Michael mit, er habe gerade sein geheimes Postfach abgemeldet. Jahrelang war dieses Postfach sein Mittel zur Kommunikation mit einer langen Reihe heimlicher außerehelicher Geliebter gewesen. Daher war die Abmeldung des Postfachs ein einschneidender Akt, und ich sah es als meine Pflicht an, den Mut, den dieser Schritt erfordert hatte, zu würdigen, und bemühte mich, meine Bewunderung dafür auszudrücken.
Ein paar Monate später quälten ihn immer noch wiederkehrende Bilder und Sehnsüchte nach seiner letzten Geliebten. Ich bot ihm Unterstützung an.
»Wissen Sie, Michael, die Art Leidenschaft, die Sie erlebt haben, verfliegt nicht so schnell. Natürlich werden Sie auch weiterhin von Sehnsüchten heimgesucht. Das ist unvermeidlich - es gehört zu unserem Menschsein.«
»Es gehört zu meiner Schwäche, meinen Sie wohl. Ich wünschte, ich wäre ein Mann aus Stahl und könnte sie endgültig vergessen.«
»Für solche Männer aus Stahl gibt es einen Namen: Roboter. Und ein Roboter sind Sie Gott sei Dank nicht. Wir haben oft über Ihre Sensibilität und Kreativität gesprochen — die sind Ihr größtes Plus –, deshalb schreiben Sie auch so eindringlich, und deshalb fühlen sich andere zu Ihnen hingezogen. Aber genau diese positiven Eigenschaften haben auch ihre dunkle Seite – Angst –, die es Ihnen unmöglich macht, gewisse Umstände mit Gleichmut hinzunehmen.«
Ein gutes Beispiel für einen umdeutenden Kommentar, der mich sehr tröstete, erlebte ich vor einiger Zeit, als ich William Blatty, einem Freund, Autor von Der Exorzist, meine Enttäuschung über eine negative Rezension eines meiner Bücher schilderte. Er reagierte auf wunderbar unterstützende Weise, die meine Wunde sofort heilte. »Irv, natürlich regst du dich über die Rezension auf. Gott sei Dank! Wenn du nicht so sensibel wärst, wärst du nicht so ein guter Schriftsteller.«
Jeder Therapeut wird seine eigene Form der Unterstützung von Patienten finden. Ich habe ein unauslöschliches Bild von Ram Dass im Kopf, der seinen Abschied von einem Guru beschreibt, bei dem er in einem indischen Aschram jahrelang studiert hatte. Als Ram Dass klagte, er sei wegen seiner vielen Mängel und Unvollkommenheiten noch nicht aufbruchsbereit, erhob sich sein Guru, umkreiste ihn langsam und sehr feierlich und schloss seine Inspektion dann mit einer offiziellen Verlautbarung ab: »Ich sehe keine Unvollkommenheiten.« Ich habe einen Patienten noch nie buchstäblich umkreist, um ihn unter die Lupe zu nehmen, und ich bin der Überzeugung, dass der Prozess des Wachsens niemals endet, aber trotzdem hat dieses Bild meine Kommentare oft geleitet.
Unterstützung kann auch Bemerkungen über Äußerlichkeiten einschließen – ein Kleidungsstück, ausgeruhtes Aussehen, eine neue Frisur. Wenn ein Patient besessen ist von seiner /ihrer angeblichen körperlichen Reizlosigkeit, finde ich es nur menschlich, dass man ihm/ihr sagt (falls einem danach zu Mute ist), dass man ihn/sie für attraktiv hält und sich wundert, woher der Mythos der Reizlosigkeit stammt.
In einer Geschichte über Psychotherapie in Die Reise mit Paula wird mein Protagonist Dr. Ernest Lash von einer außergewöhnlich attraktiven Patientin in die Enge getrieben, die ihn mit bestimmten Fragen bedrängt: »Wirke ich reizvoll auf Männer? Auf Sie? Wenn Sie nicht mein Therapeut wären, würden Sie dann sexuell auf mich reagieren?« Das sind die Albtraumfragen schlechthin, und Therapeuten fürchten sie vor allen anderen. Die Angst vor solchen Fragen veranlasst viele Therapeuten, zu wenig von sich selbst zu geben. Ich glaube jedoch, diese Angst ist ungerechtfertigt. Wenn Sie denken, es könne der Patientin nützen, warum dann nicht einfach sagen, wie es mein fiktiver Therapeut tut: »Wenn alles anders wäre, wir uns in einer anderen Welt begegnet wären, wenn ich ledig und nicht Ihr Therapeut wäre, ja, dann fände ich Sie sehr attraktiv und würde mich bemühen, Sie näher kennen zu lernen.« Was riskieren Sie schon? Meiner Ansicht nach stärkt solche Offenheit das Vertrauen der Patientin in Sie und in den Prozess der Therapie. Das schließt natürlich sonstige Fragen nicht aus – zum Beispiel über die Motivation oder das Timing der Patientin (die Standardfrage »Warum gerade jetzt?«) oder über ihr übermäßiges Interesse an Körperlichkeit oder Verführung, hinter dem sich möglicherweise bedeutsamere Fragen verstecken.
6. Einfühlungsvermögen: mit den Augen des Patienten sehen
Es ist merkwürdig, wie gewisse Sätze oder Ereignisse im Gedächtnis haften bleiben und einen dauerhaft leiten oder trösten. Vor Jahrzehnten behandelte ich eine Patientin mit Brustkrebs, die ihre ganze Jugend hindurch in einen langen, erbitterten Zwist mit ihrem sich verweigernden Vater verstrickt war. Da sie sich nach irgendeiner Form von Aussöhnung, einem Neuanfang ihrer Beziehung sehnte, freute sie sich darauf, sich von ihm ins College fahren zu lassen – eine Gelegenheit, bei der sie mehrere Stunden mit ihm allein sein würde. Doch der lang ersehnte Ausflug erwies sich als Katastrophe: Ihr Vater verhielt sich typisch, indem er ausgiebig über den hässlichen, mit Müll übersäten Bach am Straßenrand nörgelte. Sie dagegen sah keinerlei Abfälle in dem schönen, ländlichen kleinen Fluss. So konnte sie ihm nichts erwidern, und schließlich verfielen beide in Schweigen und verbrachten den Rest der Fahrt damit, jeden Blickkontakt zu meiden.
Später unternahm sie dieselbe Fahrt allein und bemerkte mit Erstaunen, dass es zwei Bäche gab – auf jeder Straßenseite einen. »Diesmal saß ich am Steuer«, sagte sie traurig, »und das Flüsschen, das ich durch das Fenster auf der Fahrerseite sah, war genauso hässlich und voller Müll, wie mein Vater es beschrieben hatte.« Als sie aber gelernt hatte, mit den Augen ihres Vaters zu sehen, war es zu spät – ihr Vater war tot und begraben.
Diese Geschichte habe ich nie vergessen, und ich ermahne mich selbst und meine Studenten oft: »Sieh mit den Augen des anderen. Versuche, die Welt so zu sehen, wie dein Patient sie sieht.« Die Frau, die mir die Geschichte erzählte, starb kurze Zeit später an Brustkrebs, und ich bedaure, dass ich ihr nicht sagen kann, wie sehr sie mir, meinen Studenten und vielen Patienten im Laufe der Jahre geholfen hat.
Carl Rogers bezeichnete vor fünfzig Jahren »genaues Einfühlen« als eines der drei wesentlichen Merkmale des effizienten Therapeuten (neben »bedingungsloser positiver Anteilnahme« und »Aufrichtigkeit«) und setzte die psychotherapeutische Forschung in Gang, die schließlich erhebliche Beweise für die Wirksamkeit des Einfühlungsvermögens erbrachte.
Der therapeutische Effekt wird gesteigert, wenn der Therapeut sich vollständig in den Patienten hineinversetzt. Patienten profitieren enorm von der bloßen Erfahrung, dass sie richtig gesehen und richtig verstanden werden. Es ist daher wichtig für uns zu begreifen, wie unser Patient Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erlebt. Ich lege Wert darauf, meine Annahmen regelmäßig zu überprüfen. Zum Beispiel:
»Bob, wenn ich an Ihre Beziehung zu Mary denke, habe ich folgendes Bild: Sie sagen, Sie seien überzeugt, dass Sie nicht zusammenpassen, dass Sie sich sehr gern von ihr trennen würden, dass Sie sich in ihrer Gesellschaft langweilen und es vermeiden, ganze Abende mit ihr zu verbringen. Doch jetzt, wo sie den Schritt getan hat, den Sie sich wünschten, und sich zurückgezogen hat, sehnen Sie sich wieder nach ihr. Ich glaube, ich höre Sie sagen, dass Sie nicht mit ihr zusammen sein wollen, aber trotzdem die Vorstellung nicht ertragen, dass sie nicht verfügbar ist, wenn Sie sie womöglich brauchen. Habe ich so weit Recht?«
Genaues Einfühlen ist am wichtigsten in der unmittelbaren Gegenwart – das heißt im Hier und Jetzt der Therapiestunde. Vergessen Sie nie, dass Patienten die Sitzungen ganz anders erleben als der Therapeut. Immer wieder sind Therapeuten, auch sehr erfahrene, höchst überrascht, wenn sie wieder einmal auf dieses Phänomen stoßen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass einer meiner Patienten eine Stunde damit einleitet, dass er eine intensive emotionale Reaktion auf die letzte Sitzung beschreibt, und ich verblüfft bin und mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, was in dieser Sitzung eine solch heftige Reaktion hervorgerufen hat.
Auf derartig divergierende Sichtweisen von Patient und Therapeut wurde ich zum ersten Mal vor Jahren aufmerksam, als ich die Erfahrungen von Gruppenmitgliedern sowohl in Therapiegruppen als auch in Encounter-Gruppen untersuchte. Ich bat zahlreiche Teilnehmer, einen Fragebogen auszufüllen, auf dem sie entscheidende Vorfälle bei jedem Treffen nennen sollten. Die mannigfaltigen Ereignisse, die beschrieben wurden, unterschieden sich stark von den Einschätzungen der jeweiligen Gruppenleiter, welches denn die entscheidenden Vorfälle gewesen seien, und ein ähnlicher Unterschied zwischen Teilnehmern und Leitern existierte auch bei der Auswahl des für alle Gruppentreffen entscheidendsten Vorfalls.
Meine nächste Erfahrung mit unterschiedlichen Perspektiven von Patient und Therapeut machte ich während eines informellen Experiments, bei dem eine Patientin und ich jeweils eine Zusammenfassung jeder Therapiesitzung schrieben. Das Experiment hat eine besondere Geschichte. Ginny, die Patientin, war eine begabte, kreative Schriftstellerin, die nicht nur an einer Schreibblockade, sondern an einer Blockade aller Formen ihrer Ausdruckskraft litt. Eine einjährige Teilnahme an meiner Therapiegruppe war relativ erfolglos: Sie offenbarte wenig von sich, gab den anderen Mitgliedern kaum etwas, und idealisierte mich so sehr, dass eine echte Begegnung nicht möglich war. Als Ginny wegen finanzieller Schwierigkeiten die Gruppe verlassen musste, schlug ich ein ungewöhnliches Experiment vor. Ich bot ihr unter der Bedingung eine Einzeltherapie an, dass sie, statt mich zu bezahlen, eine freifließende, unzensierte Zusammenfassung jeder Therapiestunde schrieb, in der sie all die Gefühle und Gedanken äußerte, die sie während unserer Sitzung nicht verbalisiert hatte. Ich wollte genau dasselbe tun und schlug vor, dass wir beide unsere wöchentlichen Berichte versiegelt meiner Sekretärin übergeben und alle paar Monate die Notizen des anderen lesen sollten.
Meine Idee war zu ehrgeizig gewesen. Ich hatte gehofft, dass mein Vorschlag der Patientin nicht nur das Schreiben wieder ermöglichen, sondern sie auch ermutigen würde, sich in der Therapie offener zu äußern. Vielleicht würde das Lesen meiner Notizen unsere Beziehung verbessern. Ich hatte vor, meine eigenen Erfahrungen während der Sitzung – Freude, Frustration, Ablenkungen – unzensiert aufzuschreiben. Möglicherweise konnte Ginny, wenn sie mich realistischer sah, beginnen, mich zu de-idealisieren und mir eher auf einer Ebene von Mensch zu Mensch begegnen.
(Als Nebenbemerkung, die nicht zu dieser Erörterung des Einfühlungsvermögens gehört, möchte ich hinzufügen, dass sich diese Episode zu einer Zeit abspielte, als ich versuchte, meine Stimme als Schriftsteller zu finden, und mein Angebot, parallel zu meiner Patientin zu schreiben, hatte auch ein egoistisches Motiv: Es ermöglichte mir eine ungewöhnliche Schreibübung, bot mir die Gelegenheit, meine beruflichen Fesseln abzuwerfen, meiner Stimme freien Lauf zu lassen, wenn ich alles aufschrieb, was mir nach jeder Stunde einfiel.)
Der Austausch unserer Notizen alle paar Monate wurde zu einem Rashomon-Erlebnis: Obgleich wir beide an derselben Sitzung teilgenommen hatten, empfanden und erinnerten wir sie auf jeweils ganz eigene Weise. Zum einen werteten wir Teile der Sitzung unterschiedlich. Meine eleganten und brillanten Interpretationen? Sie hatte sie nicht einmal gehört. Stattdessen würdigte sie die kleinen, persönlichen Äußerungen, die ich kaum bemerkt hatte: meine Komplimente über ihre Kleidung oder ihr Aussehen oder ihr Schreiben, meine unbeholfenen Entschuldigungen, wenn ich mich ein paar Minuten verspätet hatte, mein Lachen über ihren Witz, meine Neckereien, wenn wir ein Rollenspiel machten.a
All diese Erfahrungen haben mich gelehrt, nicht davon auszugehen, dass der Patient und ich in einer Sitzung dasselbe erleben. Wenn Patienten über Gefühle sprechen, lege ich besonderen Wert darauf, mich nach ihren Empfindungen über die betreffende Sitzung zu erkundigen. Ich lerne fast immer etwas Neues und Unerwartetes. Einfühlsam zu sein ist ein so großer Teil des Alltagsdiskurses – Popsänger schmettern ununterbrochen Plattitüden darüber, in der Haut des anderen zu stecken, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen –, dass wir dazu neigen, die Komplexität des Prozesses zu vergessen. Es ist außerordentlich schwierig, wirklich zu wissen, was der andere fühlt; viel zu oft projizieren wir unsere eigenen Gefühle in ihn hinein.
In seinen Vorlesungen über Einfühlungsvermögen zitierte Erich Fromm häufig Terenz’ Äußerung von vor zweitausend Jahren – »Ich bin ein Mensch, und nichts Menschliches sei mir fremd« – und drängte uns, die Studenten, offen zu sein für jenen Teil von uns, der von einer Handlung oder Fantasie angesprochen wird, die der Patient uns vorträgt, ganz gleich, wie abscheulich, gewalttätig, lüstern, masochistisch oder sadistisch sie sein mag. Sonst, so legte er uns nahe, sollten wir untersuchen, warum wir uns entschieden hätten, diesen Teil unter Verschluss zu halten.
Natürlich steigern Kenntnisse über die Vergangenheit des Patienten unsere Fähigkeit, mit seinen Augen zu sehen, enorm. Wenn Patienten zum Beispiel eine lange Reihe von Verlusten erlitten haben, werden sie die Welt durch die Brille des Verlusts betrachten. Vielleicht wollen sie Ihnen dann aus Angst vor einem weiteren Verlust nicht zu nahe kommen. Daher kann die Erforschung der Vergangenheit wichtig sein, nicht, um Kausalitäten zu konstruieren, sondern weil sie uns ein besseres Einfühlungsvermögen erlaubt.
7. Lehren Sie Einfühlungsvermögen
Genaues Einfühlen ist nicht nur eine wichtige Eigenschaft des Therapeuten, sondern wir müssen auch dem Patienten helfen, selbst Einfühlungsvermögen für andere zu entwickeln.