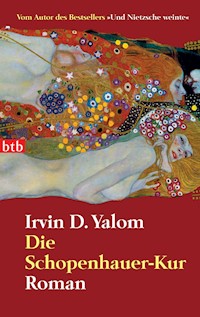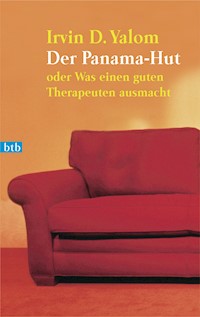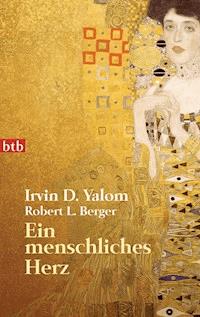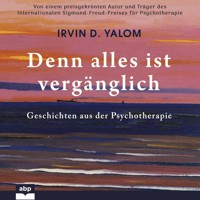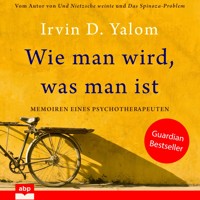9,99 €
Mehr erfahren.
Ernest Lash, ein junger Psychoanalytiker aus San Francisco, glaubt an die Wirksamkeit seines Tuns, ist aber andererseits davon überzeugt, daß die klassischen Therapien dringend einer Erneuerung bedürfen. Eines Tages beauftragt ihn die Ethikkommission seines Fachbereichs mit der Untersuchung eines prekären Falls: Er soll die Arbeitsweise eines älteren, sehr berühmten Kollegen namens Seymour Trotter überprüfen, der angeklagt ist, ein Verhältnis mit einer vierzig Jahre jüngeren Patientin gehabt zu haben. Trotter beharrt darauf, daß Sex das einzige Mittel gewesen sei, um die junge Frau vor ihrem selbstzerstörerischen Verhalten zu retten. Zunächst ist Ernest entrüstet. Doch je mehr er sich mit der Sache beschäftigt, desto mehr fasziniert ihn die Idee, jedem Patienten bzw. jeder Patientin eine fallspezifische Behandlung zuteil werden zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 801
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Irvin D. Yalom
Die rote Couch
Roman
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
Buch
Ernest Lash, ein junger Psychoanalytiker aus San Francisco, glaubt an die Wirksamkeit seines Tuns, ist aber andererseits davon überzeugt, daß die klassischen Therapien dringend einer Erneuerung bedürfen. Eines Tages beauftragt ihn die Ethikkommission seines Fachbereichs mit der Untersuchung eines prekären Falls: Er soll die Arbeitsweise eines älteren, sehr berühmten Kollegen namens Seymour Trotter überprüfen, der angeklagt ist, ein Verhältnis mit einer vierzig Jahre jüngeren Patientin gehabt zu haben. Trotter beharrt darauf, daß Sex das einzige Mittel gewesen sei, um die junge Frau vor ihrem selbstzerstörerischen Verhalten zu retten. Zunächst ist Ernest entrüstet. Doch je mehr er sich mit der Sache beschäftigt, desto mehr fasziniert ihn die Idee, jedem Patienten bzw. jeder Patientin eine fallspezifische Behandlung zuteil werden zu lassen. So beschließt er eines Tages, sich in Zukunft mit absoluter Ehrlichkeit auf die Therapeuten-Klienten-Beziehung einzulassen. Doch er hat die Rechnung ohne Carol, die betrogene Ehefrau eines seiner Patienten, gemacht. Carol, eine erfolgreiche Anwältin, ist wild entschlossen, sich an ihrem Mann zu rächen, indem sie seinen Therapeuten verführt …
Autor
Irvin D. Yalom ist Professor für Psychiatrie an der Stanford University. Seine Bücher »The Theory and Practice of Group Psychotherapy« und »In patient Group Therapy« sind in den USA zu Klassikern geworden.
Auf die Zukunft – Lily, Alana, Leonore, Jason.
Möge euer Leben erfüllt seinvon Staunen.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Ernest war gern Analytiker. Tag für Tag ließen ihn seine Patienten in den verborgensten Winkeln ihres Lebens stöbern. Tag für Tag tröstete er sie, teilte ihre Sorgen und linderte ihre Verzweiflung. Wofür er seinerseits bewundert und gehätschelt wurde. Und auch bezahlt, obwohl er auch ohne Honorar als Therapeut gearbeitet hätte, wenn er auf das Geld nicht angewiesen gewesen wäre.
Glücklich der, der seine Arbeit liebt. Und Ernest schätzte sich tatsächlich glücklich. Mehr als glücklich. Gesegnet. Er war ein Mann, der seine Berufung gefunden hatte – ein Mann, der sagen konnte, ich bin genau da, wo ich hingehöre, im Auge des Sturms, wo meine Talente, meine Interessen, meine Passionen gebündelt sind.
Ernest war kein religiöser Mensch. Aber wenn er morgens seinen Terminkalender aufschlug und die Namen der acht oder neun Lieben sah, mit denen er den Tag verbringen würde, wurde er von einem Gefühl überwältigt, das er nur als religiös bezeichnen konnte. In diesen Momenten verspürte er ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit allem gegenüber, das ihn zu seiner Berufung geführt hatte.
Manchmal, wenn er morgens durch das Oberlicht seines viktorianischen Hauses in der Sacramento Street in den Frühnebel schaute, stellte er sich vor, wie seine Analytikerkollegen aus der Vorzeit in der Morgendämmerung schwebten.
»Ich danke euch, ich danke euch«, sang er dann vor sich hin. Er dankte ihnen allen – all den Heilern, die der Verzweiflung entgegengewirkt hatten. Zuerst den Urahnen, deren empyreische Umrisse kaum sichtbar waren: Jesus, Buddha, Sokrates. Unter ihnen, ein wenig deutlicher, die großen Erzväter: Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Jung. Und noch näher die Großeltern unter den Therapeuten: Adler, Horney, Sullivan, Fromm und das gütig lächelnde Gesicht Sandor Ferenczis.
Vor einigen Jahren hatten sie ihm Antwort auf seinen Aufschrei der Verzweiflung gegeben, als er sich nach seinem Jahr als Assistenzarzt genau wie alle anderen ehrgeizigen jungen Neuropsychiater der neurochemischen Forschung gewidmet hatte – dem Bereich der Zukunft, der goldenen Arena persönlicher Chancen. Seine Vorfahren wußten, daß er sich verirrt hatte. Er gehörte nicht in ein wissenschaftliches Labor. Und auch nicht in die Medikamentenausgabe einer psychopharmakologischen Praxis.
Sie schickten ihm einen Boten, um ihn seinem Schicksal zuzuführen. Bis auf den heutigen Tag wußte Ernest nicht, wie er zu der Entscheidung gefunden hatte, Therapeut zu werden. Aber er erinnerte sich genau daran, wann es geschehen war. Er entsann sich dieses Tages mit erstaunlicher Klarheit. Und er erinnerte sich auch an den Menschen, Seymour Trotter mit Namen, dem er nur ein einziges Mal begegnet war, der aber sein Leben für alle Zeit verändern sollte.
Vor sechs Jahren hatte der Leiter seiner Abteilung ihn, Ernest, auf ein Semester in das Komitee für medizinische Ethik des Stanford Hospitals abkommandiert, und sein erster Disziplinarfall dort betraf Dr. Trotter. Seymour Trotter war der einundsiebzigjährige Patriarch der psychiatrischen Gemeinde und ehemaliger Präsident der »American Psychiatric Association«. Man warf ihm vor, eine sexuelle Beziehung zu einer zweiunddreißigjährigen Patientin eingegangen zu sein.
Ernest war damals Assistenzprofessor im Fach Psychiatrie, und seine Zeit als Assistenzarzt lag erst vier Jahre zurück. Da er sich beruflich ausschließlich mit neurochemischer Forschung beschäftigte, war er, was die Welt der Psychotherapie betraf, vollkommen naiv – viel zu naiv, um zu begreifen, daß man ihm diesen Fall übertragen hatte, weil niemand sonst sich daran die Finger verbrennen wollte: Alle dienstälteren Psychiater in Nordkalifornien verehrten und fürchteten Seymour Trotter zutiefst.
Ernest wählte ein nüchternes Verwaltungsbüro im Krankenhaus für das Gespräch und versuchte, sich einen offiziellen Anstrich zu geben. Während er auf Dr. Trotter wartete, behielt er die Uhr im Auge und die Beschwerdeakte lag ungeöffnet auf dem Schreibtisch vor ihm. Um unparteiisch zu bleiben, hatte Ernest beschlossen, den Angeklagten zu befragen, ohne sich vorher allzusehr mit der Geschichte vertraut zu machen. Die Akte würde er später lesen und dann gegebenenfalls ein zweites Treffen anberaumen.
Zunächst hörte er ein klopfendes Geräusch, das durch den Korridor hallte. War Trotter etwa blind? Darauf hatte ihn niemand vorbereitet. Das Klopfen, dem ein Schlurfen folgte, kam näher. Ernest erhob sich und trat in den Flur.
Nein, nicht blind. Lahm. Dr. Trotter taumelte unsicher zwischen zwei Stöcken den Flur entlang. Er ging gebückt und hielt die Stöcke weit, beinahe um Armeslänge, auseinander. Seine kräftigen Wangenknochen und sein ausgeprägtes Kinn behaupteten sich nach wie vor, aber das weichere Fleisch war von Runzeln und Altersflecken bedeckt. Tiefe Hautfalten hingen von seinem Hals herab, und weiße Haarbüschel ragten hinter seinen Ohren hervor. Trotzdem hatte das Alter diesen Mann nicht bezwungen – etwas Junges, ja Jungenhaftes ging von ihm aus. Was war es? Vielleicht sein Haar, das er grau und dicht in einem Bürstenschnitt trug, oder seine Kleidung, eine blaue Jeansjacke über einem weißen Rollkragenpullover.
Sie begrüßten sich in der Tür. Dr. Trotter stolperte einige Schritte in den Raum hinein, hob plötzlich seine Stöcke, fuhr energisch herum und landete scheinbar zufällig mit einer Pirouette auf seinem Platz.
»Volltreffer! Überrascht, wie?«
Ernest ließ sich nicht ablenken. »Sie kennen den Zweck dieses Gesprächs, Dr. Trotter – und Sie wissen auch, warum ich das Band mitlaufen lasse?«
»Ich habe gehört, daß mich die Krankenhausverwaltung für die Ernennung zum Arbeiter des Monats in Betracht zieht.«
Ernest blinzelte unbeeindruckt durch seine große Brille und schwieg.
»Entschuldigung, ich weiß, daß Sie nur Ihren Job machen, aber wenn Sie erst einmal die Siebzig überschritten haben, werden Sie über solche Witze auch lächeln. Ja, einundsiebzig letzte Woche. Und Sie sind wie alt, Dr. …? Ich habe Ihren Namen vergessen. Jede Minute«, sagte er und tippte sich an die Schläfe, »geben ein Dutzend kortikale Neuronen ihren Geist auf, sterben wie die Fliegen. Die Ironie dabei ist, daß ich vier Abhandlungen über Alzheimer veröffentlicht habe – natürlich habe ich vergessen wo, aber es waren gute Zeitschriften. Wußten Sie das?«
Ernest schüttelte den Kopf.
»Sie haben’s also nie gewußt, und ich hab’s vergessen. Damit wären wir in etwa quitt. Wissen Sie, welches die beiden Vorteile bei Alzheimer sind? Ihre alten Freunde werden zu neuen Freunden, und Sie können Ihre eigenen Ostereier verstecken.«
Wider seinen Willen mußte Ernest lächeln.
»Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Methode?«
»Ich bin Dr. Ernest Lash, und der Rest gehört im Augenblick vielleicht nicht ganz zur Sache, Dr. Trotter. Wir haben noch viel vor uns heute.«
»Mein Sohn ist vierzig. Sie können nicht älter sein als er. Ich weiß, daß Sie in Stanford Assistenzarzt waren. Ich habe Sie letztes Jahr bei einem Vortrag gehört. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Sehr klare Präsentation. Heute schwört man ganz auf Psychopharmaka, stimmt’s? Was für eine therapeutische Ausbildung kriegt ihr heute eigentlich noch mit? Bringt man euch überhaupt noch was bei?«
Ernest nahm seine Armbanduhr ab und legte sie auf den Schreibtisch. »Ein andermal werde ich Ihnen gern eine Kopie des Lehrplans von Stanford überreichen, aber lassen Sie uns im Augenblick bitte beim Thema bleiben, Dr. Trotter. Vielleicht wäre es das Beste, wenn Sie mir mit Ihren eigenen Worten von Mrs. Felini erzählen würden.«
»Okay, okay, okay. Sie wollen, daß ich ernst bleibe. Sie wollen, daß ich Ihnen meine Geschichte erzähle. Lehnen Sie sich zurück, mein Junge, und ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Wir fangen am Anfang an. Es war vor ungefähr vier Jahren – mindestens vier Jahren … ich habe all meine Unterlagen über diese Patientin verlegt … welches Datum steht auf ihrer Anklageschrift? Was? Sie haben sie nicht gelesen. Faul? Oder versuchen Sie, unwissenschaftlichen Vorurteilen aus dem Weg zu gehen?«
»Bitte, Dr. Trotter, fahren Sie fort.«
»Das oberste Gebot der Gesprächsführung lautet, eine warme, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Nachdem Ihnen das so gekonnt gelungen ist, fühle ich mich viel freier, über schmerzhafte und peinliche Dinge zu sprechen. Oh – damit habe ich Sie erwischt! Sie müssen vor mir auf der Hut sein, Dr. Lash, ich habe vierzig Jahre lang in Gesichtern gelesen. Ich kann das sehr gut. Aber wenn Sie mit Ihren Unterbrechungen fertig sind, werde ich jetzt anfangen. Sind Sie soweit?
Vor Jahren – sagen wir vor ungefähr vier Jahren – kommt also eine Frau, Belle, in meine Sprechstunde, oder sollte ich vielleicht sagen, sie schleppt sich herein? Ungefähr Mitte Dreißig, aus wohlhabenden Verhältnissen – Italoschweizerin – depressiv, trägt eine langärmelige Bluse im Sommer. Eine, die sich selbst verletzt offensichtlich – Handgelenke vernarbt. Wenn Sie im Sommer lange Ärmel sehen, denken Sie immer an aufgeschnittene Handgelenke und Drogeninjektionen, Dr. Lash. Gutaussehend, tolle Haut, verführerische Augen, elegant gekleidet. Echte Klasse, aber nahe am Abgrund.
Lange Geschichte der Selbstzerstörung. Alles, was man sich nur denken kann: Drogen und Gott weiß was sonst noch, hat nichts ausgelassen. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie wieder auf Alkohol und spielte auch ein bißchen mit Heroin rum. Trotzdem nicht richtig abhängig. Irgendwie schien sie kein Talent dafür zu haben – manche Leute sind so –, aber sie arbeitete daran. Außerdem Eßstörungen. Vorwiegend Anorexie, gelegentlich aber auch bulimisches Erbrechen. Die Schnitte habe ich bereits erwähnt, jede Menge davon, überall auf beiden Armen und den Handgelenken – sie mochte den Schmerz und das Blut; das waren die einzigen Augenblicke, in denen sie sich lebendig fühlte. Das hört man oft von Patienten. Ein halbes Dutzend Krankenhausaufenthalte – immer kurz. Hat sich nach ein oder zwei Tagen immer selbst entlassen. Das Personal war heilfroh, wenn sie ging. Sie war richtig gut darin, einen Aufstand zu provozieren.
Verheiratet, keine Kinder. Sie wollte keine – meinte, die Welt sei zu gräßlich, um sie Kindern zuzumuten. Netter Ehemann, kaputte Beziehung. Er wollte unbedingt Kinder, und es gab jede Menge Streit um das Thema. Er war Investmentbanker wie ihr Vater, immer auf Reisen. Nach ein paar Jahren Ehe machte seine Libido dicht, oder er kanalisierte sie in das Anhäufen von Geld – er machte gutes Geld, landete aber nie den Volltreffer, wie ihr Vater es getan hatte. Arbeit, Arbeit, Arbeit, hat mit dem Computer geschlafen. Vielleicht hat er ihn auch gefickt, wer weiß? Belle hat er jedenfalls nicht gefickt. Ihren Berichten zufolge ist er ihr jahrelang aus dem Weg gegangen; der Grund war wahrscheinlich sein Zorn darüber, daß sie keine Kinder wollte. Schwer zu sagen, was die Ehe aufrecht erhielt. Seine Eltern waren Anhänger der Christian Science, und er lehnte eine Paartherapie beharrlich ab, genauso wie jede andere Form der Psychotherapie. Aber sie räumte auch ein, daß sie ihn nie sehr dazu gedrängt habe. Mal sehen. Was noch? Geben Sie mir ein Stichwort, Dr. Lash.
Ihre früheren Therapien? Gut. Wichtige Frage. Die stelle ich immer gleich in den ersten dreißig Minuten. Therapie ohne Unterlaß – oder Therapieversuche – seit ihren Jugendjahren. Hat sämtliche Therapeuten in Genf abgeklappert und ist eine Weile zur Analyse nach Zürich gefahren. Ist in den USA aufs College gegangen und hat einen Therapeuten nach dem anderen aufgesucht, häufig nur für eine einzige Sitzung. Bei einigen hat sie es ganze drei oder vier Monate ausgehalten, sich aber nie wirklich auf irgend jemanden eingelassen. Belle war – und ist – sehr schnell mit Kritik bei der Hand. Kaum jemand ist gut genug oder der richtige für sie. An jedem Therapeuten gibt es etwas auszusetzen: förmlich, zu überheblich, zu voreingenommen, zu herablassend, zu geschäftsorientiert, zu kalt, zu sehr auf Diagnosen fixiert. Psychopharmaka? Psychologische Tests? Verhaltensprotokolle? Vergessen Sie’s – wer das vorschlug, wurde sofort gestrichen. Was noch?
Warum sie mich ausgesucht hat? Hervorragende Frage, Dr. Lash – bringt uns zum Kern der Sache und beschleunigt das Ganze. Wir werden schon noch einen Psychotherapeuten aus Ihnen machen. Ich hatte gleich so ein Gefühl, was Sie betrifft, als ich Ihren Vortrag hörte. Guter, scharfer Verstand. Das sah man schon daran, wie Sie Ihre Fakten präsentierten. Was mir besonders gefiel, war ihre Fallpräsentation, vor allem die Art, wie Sie Patienten auf sich wirken lassen. Ich hab damals gesehen, daß Sie genau die richtigen Instinkte haben. Carl Rogers pflegte zu sagen: ›Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht damit, Therapeuten auszubilden – die Zeit ist besser genutzt, wenn Sie sie auswählen.‹ Ich fand immer, daß da eine Menge dran ist.
Mal sehen, wo war ich? Ah, wie sie auf mich kam: Ihr Gynäkologe, den sie anhimmelte, war ein ehemaliger Patient von mir. Er hat ihr gesagt, ich sei ganz in Ordnung und bereit, mir mit einem Patienten Mühe zu geben. Sie hat meinen Namen in der Bibliothek nachgeschlagen und einen Artikel gelesen, den ich fünfzehn Jahre zuvor geschrieben hatte; es ging um Jungs Idee, für jeden Patienten eine neue Therapiesprache zu erfinden. Kennen Sie diesen Aufsatz? Nein? Journal of Orthopsychiatry. Ich schicke Ihnen einen Nachdruck. Ich bin noch einen Schritt weitergegangen als Jung. Ich habe vorgeschlagen, daß wir für jeden Patienten eine neue Therapie erfinden, daß wir den Gedanken der Einzigartigkeit eines jeden Patienten ernst nehmen und für jeden von ihnen eine einzigartige Psychotherapie entwickeln.
Kaffee? Ja, gern. Schwarz. Vielen Dank. So ist sie also an mich geraten. Und die nächste Frage, die Sie stellen sollten, Dr. Lash? Warum zu diesem Zeitpunkt? Genau. Das ist die richtige Frage. Immer eine sehr ergiebige Frage bei einem neuen Patienten. Die Antwort: gefährliche sexuelle Spiele. Das war sogar ihr klar. Sie hatte immer mit solchen Sachen experimentiert, aber langsam wurde es massiv. Man stelle sich vor, daß sie mit ihrem Wagen auf der Autobahn neben Lastwagen oder Trucks her fuhr, sich den Rock hochzog und masturbierte, bis der Fahrer neben ihr auf sie aufmerksam wurde –, bei achtzig Meilen die Stunde. Wahnsinn. Dann nahm sie die nächste Ausfahrt, und falls der Fahrer ihr folgte, hielt sie an, kletterte in seine Führerkabine und blies ihm einen. Solche lebensgefährliche Sachen. Und zwar ständig. Sie war so außer Kontrolle, daß sie, wenn sie sich langweilte, in irgendeine herruntergekommene Bar von San Jose fuhr und sich einfach jemanden aufgriff. Ihr kam es, wenn sie in gefährlichen Situationen steckte und unbekannte, potentiell gewalttätige Männer in sich spürte. Und dabei drohte ihr nicht nur von den Männern Gefahr, sondern auch von den Prostituierten, denen es nicht paßte, daß sie ihnen das Geschäft verdarb. Sie drohten ihr, sie umzubringen, und sie mußte sich ständig neue Lokale suchen. Und Aids, Herpes, Safer Sex, Kondome? Als hätte sie nie was davon gehört.
Das war also mehr oder weniger Belle, als wir anfingen. Sie kriegen langsam eine Vorstellung? Haben Sie irgendwelche Fragen, oder soll ich einfach fortfahren? Okay. Also, offensichtlich hatte ich bei unserer ersten Sitzung all ihre Tests bestanden. Sie kam ein zweites Mal und ein drittes, und wir begannen mit der Behandlung, zweimal, manchmal dreimal die Woche. Ich verwandte eine ganze Stunde darauf, einen detaillierten Bericht über ihre Arbeit mit all ihren früheren Therapeuten aufzunehmen. Das ist immer eine gute Strategie, wenn man es mit einem schwierigen Patienten zu tun hat, Dr. Lash. Finden Sie heraus, wie die anderen sie behandelt haben, und versuchen Sie dann, deren Irrtümer zu vermeiden. Vergessen Sie den ganzen Mist von wegen ein Patient sei nicht bereit für die Therapie! Es ist die Therapie, die nicht bereit für den Patienten ist. Aber Sie müssen mutig und kreativ genug sein, um für jeden Patienten eine neue Therapie zu erarbeiten.
Belle Felini war keine Patientin, der man sich mit traditionellen Techniken nähern konnte. Wenn ich in meiner professionellen Rolle – Fallgeschichte aufnehmen, reflektieren, Sympathie zeigen, Deutungen anbieten – bleibe, puff, ist sie weg. Glauben Sie mir. Sayonara. Auf Wiedersehen. Das hat sie bei all ihren Therapeuten gemacht, die sie je aufgesucht hat – und viele von ihnen haben einen guten Ruf. Sie kennen die alte Geschichte: Operation gelungen, Patient tot.
Welche Techniken ich angewandt habe? Ich fürchte, Sie haben mich nicht ganz verstanden. Meine Technik besteht darin, alle Technik fahrenzulassen! Und das ist keine Klugscheißerei, Dr. Lash – das ist die erste Regel einer guten Therapie. Und das sollte auch Ihre Regel sein, falls Sie Therapeut werden sollten. Ich habe versucht, humaner und weniger mechanisch zu sein. Ich erstelle keinen systematischen Therapieplan – das werden Sie nach vierzig Jahren Praxis auch nicht mehr tun. Ich baue einfach auf meine Intuition. Aber Ihnen als Anfänger gegenüber ist das nicht fair. Rückblickend würde ich sagen, der auffälligste Aspekt an Belles Pathologie war ihre Impulsivität. Sie will etwas haben – bingo, sie muß es sich sofort verschaffen. Ich erinnere mich, daß ich ihre Frustrationstoleranz erhöhen wollte. Das war mein Anfangspunkt, mein erstes, vielleicht auch wichtigstes Therapieziel. Mal sehen, wie haben wir angefangen? Es fällt mir schwer, mich ohne meine Notizen an den Anfang zu erinnern; die Sache liegt so viele Jahre zurück.
Ich habe Ihnen erzählt, ich hätte meine Unterlagen verloren. Ich sehe den Zweifel in Ihrem Gesicht. Die Notizen sind weg. Verschwunden, als ich vor zwei Jahren andere Praxisräume bezog. Sie haben keine andere Wahl, als mir zu glauben.
Ich erinnere mich hauptsächlich daran, daß die Sache am Anfang viel besser lief, als ich erwartet hatte. Keine Ahnung, warum, aber Belle fühlte sich gleich zu mir hingezogen. An meinem guten Aussehen kann es nicht gelegen haben. Ich hatte damals gerade eine Katarakt-Operation hinter mir, und mein Auge sah gräßlich aus. Und meine Ataxie trug auch nichts zu meinem Sex-Appeal bei … Es handelt sich übrigens um eine erblich bedingte zerebelläre Ataxie, falls es Sie interessiert. Eindeutig progressiv … ein Gehgestell in ein oder zwei Jahren und ein Rollstuhl in drei oder vier. C’est la vie.
Ich glaube, Belle mochte mich, weil ich sie wie ein Individuum behandelt habe. Ich habe genau das getan, was Sie jetzt tun – und ich möchte Ihnen sagen, Dr. Lash, ich weiß es zu schätzen, daß Sie es tun. Ich habe keinen ihrer Berichte gelesen. Ich bin völlig blind an die Sache herangegangen, wollte ganz offen sein. Belle war für mich nie eine Diagnose, kein Grenzfall, keine Eßstörung, keine zwanghafte oder asoziale Störung. So gehe ich übrigens an all meine Patienten heran. Und ich hoffe, ich werde auch für Sie nie eine Diagnose werden.
Was? Wo die Diagnose denn meiner Meinung nach hingehöre? Nun, ich weiß, daß ihr Jungen, die ihr heute euren Abschluß macht, und die ganze Psychopharmaindustrie von Diagnosen lebt. Die psychiatrischen Fachzeitschriften sind voller bedeutungsloser Diskussionen über abgestufte Diagnosen. Strandgut der Zukunft. Ich weiß, daß die Diagnose bei manchen Psychosen wichtig ist, aber bei der alltäglichen Psychotherapie spielt sie kaum eine Rolle – und wenn, dann eine negative. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, daß es einfacher ist, eine Diagnose zu erstellen, wenn man den Patienten zum erstenmal sieht, und daß es immer schwieriger wird, je besser man einen Patienten kennenlernt? Fragen Sie jeden erfahrenen Therapeuten nach seiner privaten Meinung – alle werden Ihnen dasselbe sagen! Mit anderen Worten, Gewißheit ist umgekehrt proportional zum Wissen. Schöne Wissenschaft, wie?
Was ich Ihnen sagen will, Dr. Lash, ist, daß ich, was Belle betrifft, nicht nur keine Diagnose erstellt habe; ich habe nicht einmal diagnostisch gedacht. Das tue ich immer noch nicht. Trotz allem, was passiert ist, trotz dem, was sie mir angetan hat, tue ich es immer noch nicht. Und ich glaube, das wußte sie. Wir waren einfach zwei Menschen, die miteinander in Kontakt traten. Und ich mochte Belle. Habe ich immer getan. Ich mochte sie sehr! Und auch das wußte sie. Vielleicht ist das das Problem.
Nun sprach Belle nicht gut auf Gesprächstherapie an – ganz gleich, welchen Maßstab man anlegte. Impulsiv, handlungsorientiert, keinerlei Neugier, was sie selbst betraf, nichtintrospektiv, unfähig, frei zu assoziieren. Was die traditionellen Arbeitsschritte in der Therapie angeht, – Selbstuntersuchung, Einsicht – hat sie immer versagt, was dazu führte, daß ihr Selbstbild in der Folge noch negativer wurde. Das war der Grund, warum ihre Therapien immer geplatzt sind. Und das war der Grund, warum ich wußte, daß ich ihre Aufmerksamkeit auf anderem Wege erringen mußte. Das war der Grund, warum ich für Belle eine neue Therapie erfand.
Wie die aussah? Nun, ich möchte Ihnen ein Beispiel aus der Anfangszeit der Therapie nennen, vielleicht aus dem dritten oder vierten Monat. Ich hatte mich auf ihr selbstzerstörerisches sexuelles Verhalten konzentriert und sie danach gefragt, was sie wirklich von den Männern wollte, einschließlich des ersten Mannes in ihrem Leben, ihres Vaters. Aber ich kam einfach nicht weiter. Sie sträubte sich mit Händen und Füßen dagegen, über die Vergangenheit zu sprechen – das hätte sie zu oft mit anderen Psychofritzen durchexerziert. Außerdem hatte sie sich in den Kopf gesetzt, daß das Stochern in der Vergangenheit nur eine Ausrede war, um keine persönliche Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Sie hatte mein Buch über Psychotherapie gelesen und zitierte mich mit genau dieser Feststellung. So etwas hasse ich. Wenn die Patienten Widerstand leisten, indem sie deine Bücher zitieren, haben sie dich.
In einer Sitzung habe ich sie nach frühen Tagträumen oder sexuellen Phantasien gefragt, und schließlich hat sie, um mir meinen Willen zu lassen, eine immer wiederkehrende Phantasie beschrieben, die aus der Zeit stammte, als sie acht oder neun Jahre alt war: Draußen herrscht Sturm, sie kommt kalt und tropfnaß in ein Zimmer, und ein älterer Mann wartet dort auf sie. Er umarmt sie, zieht ihr die nassen Kleider aus, trocknet sie mit einem großen, warmen Handtuch ab, gibt ihr heiße Schokolade zu trinken. Also habe ich ein Rollenspiel vorgeschlagen: Ich sagte, sie solle aus dem Sprechzimmer gehen und dann wieder hereinkommen und so tun, als wäre sie naß und durchgefroren. Das Ausziehen habe ich natürlich ausgelassen, aber ich habe ein relativ großes Handtuch aus dem Waschraum geholt und sie tüchtig abgetrocknet – wobei ich alles Sexuelle gemieden habe, wie ich es immer tat. Ich habe ihr den Rücken und das Haar ›abgetrocknet‹, sie dann in das Handtuch gewickelt, in ihren Sessel gesetzt und ihr eine Tasse Instant-Kakao gemacht.
Fragen Sie mich nicht, warum oder wieso ich das zu genau dem Zeitpunkt getan habe. Wenn Sie so lange praktiziert haben wie ich, lernen Sie, auf Ihre Intuition zu bauen. Aber dieses Zwischenspiel änderte alles. Belle war für eine Weile sprachlos, ihr kamen die Tränen, und dann greinte sie wie ein Baby. Belle hatte noch nie, noch nie in der Therapie geweint. Ihr Widerstand schmolz einfach dahin.
Was ich damit meine, ihr Widerstand schmolz einfach dahin? Ich meine, daß sie mir vertraute, daß sie glaubte, daß wir auf derselben Seite stünden. Der technische Ausdruck dafür, Dr. Lash, ist ›therapeutische Allianz‹. Danach wurde sie eine echte Patientin. Das wichtige Material sprudelte nur so aus ihr heraus. Sie begann für die nächste Sitzung zu leben. Die Therapie wurde zum Mittelpunkt ihres Lebens. Wieder und wieder sagte sie mir, wie wichtig ich für sie sei. Und das nach erst drei Monaten.
Ob ich zu wichtig war? Nein, Dr. Lash, der Therapeut kann im frühen Stadium der Therapie gar nicht wichtig genug sein, selbst Freud benutzte diese Strategie: den Versuch, eine Psychoneurose durch eine Übertragungsneurose zu ersetzen – das ist eine effektive Möglichkeit, Kontrolle über zerstörerische Symptome zu gewinnen.
Das scheint Sie zu verwirren. Nun, worum es geht, ist folgendes. Der Patient entwickelt eine zwanghafte Beziehung zum Therapeuten – er denkt intensiv über jede Sitzung nach, führt zwischen den Sitzungen lange Phantasiegespräche mit dem Therapeuten. Zu guter Letzt werden die Symptome durch die Therapie gesteuert. Mit anderen Worten, statt von inneren neurotischen Faktoren getrieben zu werden, beginnen die Symptome gemäß den Anforderungen der therapeutischen Beziehung zu fluktuieren.
Nein, danke, keinen Kaffee mehr, Ernest. Aber trinken Sie ruhig welchen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Sie Ernest nenne? Gut. Dann lassen Sie uns fortfahren. Ich legte meinen Schwerpunkt also auf diese Entwicklung. Ich tat alles, was ich konnte, um noch wichtiger für Belle zu werden. Ich beantwortete jede Frage, die sie mir bezüglich meines eigenen Lebens stellte, ich nutzte ihre positiven Charaktereigenschaften aus. Ich sagte ihr, was für eine intelligente, gutaussehende Frau sie sei. Es war mir schrecklich, was sie sich selbst antat, und das habe ich ihr auch ganz offen gesagt. Nichts von alledem war schwierig: Ich brauchte lediglich die Wahrheit zu sagen.
Sie haben mich vor ein paar Minuten nach meiner Technik gefragt. Vielleicht ist meine beste Antwort auf diese Frage sehr einfach: Ich habe die Wahrheit gesagt. Ganz allmählich begann ich, eine größere Rolle in ihren Phantasien zu spielen. Sie schwelgte in langen Tagträumereien über uns beide – einfach nur, daß wir zusammen waren, einander in den Armen hielten, daß ich Kinderspiele mit ihr spielte, sie fütterte. Einmal brachte sie einen Becher Joghurt und einen Löffel mit in die Sprechstunde und bat mich, sie zu füttern – was ich zu ihrem großen Entzücken tat.
Klingt doch unschuldig, oder? Aber ich wußte gleich, daß da ein Schatten über uns lag. Ich wußte es schon damals, ich wußte es, als sie davon sprach, wie sehr es sie erregte, wenn ich sie fütterte. Ich wußte es, als sie mir erzählte, daß sie lange Kanutouren unternahm, zwei oder drei Tage die Woche, nur um allein zu sein, auf dem Wasser zu treiben und ihre Tagträume, was mich betraf, zu genießen. Ich wußte, daß meine Herangehensweise an das Problem riskant war, aber es war ein kalkuliertes Risiko. Ich wollte zulassen, daß sich die positive Übertragung soweit aufbaute, daß ich sie dazu benutzen konnte, um gegen ihre selbstzerstörerischen Triebe anzugehen.
Nach einigen Monaten war ich so wichtig für sie geworden, daß ich mich langsam ihren Krankheitssymptomen widmen konnte. Zuerst konzentrierte ich mich auf die Dinge, bei denen es um Leben oder Tod ging: HIV, die Clubszene und ihre Autobahnnummer als Engel der Barmherzigkeit. Sie ließ einen HIV-Test machen – negativ, Gott sei Dank. Ich erinnere mich daran, daß wir zwei Wochen auf die Ergebnisse des HIV-Tests warteten. Lassen Sie sich eines gesagt sein, ich habe genauso geschwitzt wie sie.
Haben Sie schon mal mit Patienten gearbeitet, die gerade auf die Ergebnisse eines HIV-Tests warten? Nein? Nun, Ernest, diese Wartezeit ist ein Fenster der Möglichkeiten. Man kann es benutzen, um ein gutes Stück voranzukommen. Einige Tage lang sehen sich die Patienten mit ihrem eigenen Tod konfrontiert, möglicherweise zum ersten Mal. In dieser Zeit kann man ihnen helfen, ihre Prioritäten unter die Lupe zu nehmen und neu zu ordnen, ihr Leben und ihr Verhalten auf die Dinge zu gründen, die wirklich zählen. Existenzschocktherapie nenne ich das manchmal. Aber nicht bei Belle. Es ließ sie kalt. Sie hatte einfach zuviel verleugnet. Wie so viele andere selbstzerstörerische Patienten glaubte Belle, keine andere Hand als ihre eigene könne ihr Schaden zufügen.
Ich klärte sie über HIV auf und über Herpes, den sie, was an ein Wunder grenzte, auch nicht hatte, und über Safer Sex. Das lenkte ihr Interesse auf sicherere Gelegenheiten, um Männerbekanntschaften zu schließen, wenn es denn unbedingt sein mußte: Tennisclubs, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Lesungen in Buchhandlungen. Belle hatte wirklich was drauf – was für eine Raffinesse! Sie konnte in fünf oder sechs Minuten eine Verabredung mit einem ihr völlig fremden, gutaussehenden Mann treffen, während die ahnungslose Ehefrau nur ein paar Meter abseits stand. Ich muß zugeben, ich habe sie beneidet. Die meisten Frauen wissen gar nicht zu schätzen, wieviel Glück sie in dieser Beziehung haben. Können Sie sich vorstellen, daß ein Mann – erst recht so ein gebeuteltes Wrack wie ich – so etwas schafft?
Eines, was mich an Belle überraschte – wenn man bedenkt, was ich Ihnen bisher erzählt habe –, war ihre absolute Ehrlichkeit. In unseren ersten beiden Sitzungen, als wir beschlossen, zusammenzuarbeiten, legte ich ihr meine grundlegende Bedingung für jede Therapie dar: totale Ehrlichkeit. Sie mußte sich verpflichten, mir über alle wichtigen Ereignisse ihres Lebens vorbehaltlos Auskunft zu geben: Drogenmißbrauch, unüberlegte sexuelle Handlungen, das Schneiden, das Verbrennen, die Phantasien – alles. Ansonsten verschwendeten wir ihre Zeit, erklärte ich ihr. Aber wenn sie mich über alles ins Bild setze, könne sie sich absolut auf mich verlassen. Sie versprach es, und wir besiegelten die Abmachung mit einem feierlichen Händedruck.
Und soweit ich weiß, hat sie ihr Versprechen gehalten. Das war übrigens ein Teil meines Einflusses auf sie. Wenn es während der Woche bedeutsame Ausrutscher gab – wenn sie sich zum Beispiel die Handgelenke zerkratzte oder in eine Bar ging –, analysierte ich die Sache zu Tode. Ich bestand auf einer tiefgehenden und ausführlichen Erforschung dessen, was direkt vor dem Ausrutscher passiert war. ›Bitte, Belle‹, sagte ich dann, ›ich muß alles wissen, was dem Ereignis vorangegangen ist, alles, was uns helfen könnte, es zu verstehen: die vorhergehenden Ereignisse des Tages, Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, Ihre Phantasien.‹ Das trieb Belle die Wände hoch – es gebe andere Dinge, über die sie reden wolle, und es sei ihr verhaßt, große Teile der Therapiezeit auf dieses Thema zu verschwenden. Das allein half ihr schon, ihre Impulsivität unter Kontrolle zu halten.
Einsicht? Kein besonders wichtiger Faktor in Belles Therapie. Oh, sie begriff langsam, daß in der Mehrheit der Fälle ihrem impulsiven Verhalten ein Gefühlszustand großer Hohlheit oder innerer Leere voranging und daß die Risiken, die sie einging, das Schneiden, der Sex, die Freßgelage, allesamt Versuche waren, buchstäblich Erfüllung zu finden oder sich ins Leben zurückzuholen.
Aber was Belle nicht verstand, war die Tatsache, daß diese Versuche nutzlos waren. Jeder einzelne von ihnen scheiterte, da sie grundsätzlich zu tiefer Scham führten und dann zu weiteren verzweifelten – und noch zerstörerischeren – Versuchen, sich lebendig zu fühlen. Belle war seltsam begriffstutzig, wenn es darum ging, sich vorzustellen, daß ihr Verhalten Konsequenzen hatte.
Einsicht half uns also nicht weiter. Ich mußte etwas anderes tun, um ihr zu helfen, ihre Impulsivität zu beherrschen. Ich war am Ende meiner Schulweisheit. Wir stellten eine Liste mit all ihren destruktiven, impulsiven Verhaltensmustern auf, und sie erklärte sich bereit, sich auf keines mehr einzulassen, ohne mich vorher anzurufen und mir die Gelegenheit zu geben, es ihr auszureden. Aber sie rief selten an – sie wollte mich nicht belästigen. Tief im Innersten war sie davon überzeugt, daß meine Zuneigung zu ihr an einem seidenen Faden hing und ich ihrer bald müde werden und sie fallen lassen würde. Es gelang mir nicht, ihr das auszureden. Sie bat mich darum, ihr etwas von mir zu überlassen, irgend etwas Konkretes, das sie bei sich tragen konnte. Es würde ihr mehr Selbstbeherrschung verleihen. ›Suchen Sie sich etwas hier aus dem Sprechzimmer aus‹, sagte ich zu ihr. Sie zog mein Taschentuch aus meinem Jackett. Ich schenkte es ihr, aber zuerst schrieb ich einige ihrer wichtigsten Handlungsmotive darauf:
Ich fühle mich wie tot und füge mir Schmerzen zu, um zu merken, daß ich noch lebe.
Ich fühle mich taub und muß gefährliche Risiken eingehen, um mich lebendig zu fühlen.
Ich fühle mich leer und versuche, mich mit Drogen, Essen, Samen zu füllen.
Aber das sind Scheinhilfen. Am Ende schäme ich mich – und fühle mich noch abgestumpfter und leerer.
Ich gab Belle die Anweisung, jedesmal, wenn ihr nach einer impulsiven Tat zumute war, über das Taschentuch und seine Botschaften zu meditieren.
Sie sehen mich so fragend an, Ernest. Mißbilligen Sie das? Warum? Zu konstruiert? Nicht eigentlich. Es wirkt konstruiert, da gebe ich Ihnen recht, aber ungewöhnliche Situationen bedürfen ungewöhnlicher Methoden. Für Patienten, die offensichtlich nie ein definitives Gefühl für Objektkonstanz entwickeln konnten, fand ich ein Erinnerungsstück, irgend etwas Konkretes immer sehr hilfreich. Einer meiner Lehrer, Lewis Hill, der ein Genie war, wenn es um die Behandlung schwerkranker, schizophrener Patienten ging, pflegte in eine kleine Flasche zu atmen und sie seinen Patienten mitzugeben, damit sie sie um den Hals tragen konnten, solange er in Urlaub war.
Sie finden auch das zu konstruiert, Ernest? Lassen Sie mich ein anderes Wort dafür benutzen, das richtige Wort: kreativ. Erinnern Sie sich noch, wie ich vorhin davon sprach, daß man eine neue Therapie für jeden Patienten schaffen müsse? Genau das habe ich damit gemeint. Außerdem haben Sie mir die wichtigste Frage noch nicht gestellt.
Ob es funktioniert hat? Genau, genau. Das ist die richtige Frage. Die einzige Frage. Vergessen Sie die Regeln. Ja, es hat funktioniert! Es hat bei Dr. Hills Patienten funktioniert, und es hat bei Belle funktioniert, die mein Taschentuch bei sich trug und ganz allmählich mehr Kontrolle über ihre Impulse gewann. Ihre ›Ausrutscher‹ wurden seltener, und schon bald konnten wir in unseren Therapiestunden unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten.
Was? Lediglich eine Übertragungsheilung? Irgend etwas an dieser Sache geht Ihnen wirklich gegen den Strich, Ernest. Das ist gut – es ist gut, zu fragen. Sie haben ein Gefühl für die wirklichen Themen. Lassen Sie sich gesagt sein, Sie befinden sich am falschen Ort in Ihrem Leben – es ist Ihnen nicht bestimmt, Neurochemiker zu sein. Nun, Freuds Verunglimpfung der ›Übertragungsheilung‹ ist fast ein Jahrhundert alt. Sie enthält wohl ein Körnchen Wahrheit, aber im Grunde ist sie falsch.
Glauben Sie mir: Wenn Sie einen selbstzerstörerischen Verhaltenszyklus durchbrechen können – ganz gleich, wie Sie das machen –, haben Sie etwas Wichtiges geleistet. Der erste Schritt muß darin bestehen, den Teufelskreis aus Selbsthaß, Selbstzerstörung und noch mehr Selbsthaß aufgrund der Scham über das eigene Verhalten zu durchbrechen. Obwohl sie es nie ausgesprochen hat, können Sie sich vielleicht die Scham und die Selbstverachtung vorstellen, die Belle angesichts ihres entwürdigenden Verhaltens empfunden hat. Die Aufgabe des Therapeuten besteht darin, dem Patienten dabei zu helfen, diesen Prozeß umzukehren. Karen Horney sagte einmal … Kennen Sie Horneys Arbeiten, Ernest?
Schade, aber das scheint das Schicksal der führenden Theoretiker unseres Wissenschaftszweiges zu sein – ihre Lehren halten sich nur ungefähr eine Generation lang. Horney war eine meiner Lieblingstheoretikerinnen. Während meiner Ausbildung habe ich all ihre Arbeiten gelesen. Ihr bestes Buch, Neurose und menschliches Wachstum, ist über fünfzig Jahre alt, aber Sie werden nie ein besseres Buch über die Psychotherapie lesen – und kein bißchen Fachjargon. Ich werde Ihnen meine Ausgabe schicken. An irgendeiner Stelle, vielleicht in diesem Buch, hat sie eine simple, aber durchschlagende Feststellung getroffen: ›Wenn Sie stolz auf sich sein wollen, dann tun Sie Dinge, auf die Sie stolz sein können.‹
Jetzt habe ich mich in meiner Geschichte verirrt. Helfen Sie mir, einen neuen Anfang zu finden, Ernest. Meine Beziehung zu Belle? Natürlich, deshalb sitzen wir ja eigentlich hier, nicht wahr? An dieser Front gab es viele interessante Entwicklungen. Aber ich weiß, daß die Entwicklung, die für Ihr Komitee die größte Bedeutung hat, die körperliche Berührung ist. Belle hat das fast von Anfang an thematisiert. Also, ich pflege all meine Patienten, männliche und weibliche, bei jeder Sitzung ganz bewußt körperlich zu berühren – im allgemeinen ist es ein Händeschütteln beim Abschied oder vielleicht ein Schulterklopfen. Nun, Belle hatte nicht viel dafür übrig: Sie weigerte sich, mir die Hand zu geben und machte schließlich immer wieder spöttische Bemerkungen darüber, wie: ›Ist das ein zulässiges Händeschütteln?‹ oder ›Könnten Sie nicht versuchen, etwas förmlicher zu sein?‹
Manchmal beendete sie die Sitzung, indem sie mich umarmte – immer freundschaftlich, nicht sexuell. Bei der nächsten Sitzung tadelte sie mich für mein Verhalten, für meine Förmlichkeit, für die Art, wie ich mich versteift hätte, als sie mich umarmte. Und ›versteifen‹ bezieht sich auf meinen Körper, nicht auf meinen Schwanz, Ernest – ich habe Ihren Blick gesehen. Sie würden einen lausigen Pokerspieler abgeben. Bei dem lasziven Teil sind wir noch nicht angekommen. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist.
Sie beklagte sich auch über meine Altersfixiertheit. Wenn sie alt und runzelig wäre, sagte sie, würde ich nicht zögern, sie zu umarmen. Da hatte sie wahrscheinlich recht. Körperlicher Kontakt war für Belle außergewöhnlich wichtig: Sie bestand darauf, daß wir uns berührten und hörte nie auf, darauf zu bestehen. Sie drängte und drängte und drängte. Unaufhörlich. Aber ich konnte es verstehen: Belle hatte es in ihrer Kindheit stets an Berührung gemangelt. Ihre Mutter starb, als sie noch ein Säugling war, und sie wurde von einer Reihe distanzierter schweizerischer Gouvernanten großgezogen. Und ihr Vater! Stellen Sie sich vor, bei einem Vater aufzuwachsen, der unter einer Keimphobie leidet. Er berührte sie nie, trug immer Handschuhe, inner- und außerhalb des Hauses gleichermaßen. Die Dienstboten mußten sein gesamtes Papiergeld waschen und bügeln.
Ganz allmählich, nach etwa einem Jahr, hatte ich sie soweit aufgelockert oder war selbst durch Belles unaufhörlichen Druck so weichgeklopft worden, daß ich begann, unsere Sitzungen regelmäßig mit einer onkelhaften Umarmung zu beenden. Onkelhaft? Das bedeutet ›wie ein Onkel‹. Aber was auch immer ich ihr gab, sie verlangte mehr, versuchte ständig, mich auf die Wange zu küssen, wenn sie mich umarmte. Ich bestand immer darauf, daß sie die Grenzen wahrte, und sie bestand immer darauf, gegen diese Grenzen anzukämpfen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele kleine Vorträge ich ihr zu diesem Thema gehalten habe, wie viele Bücher und Artikel ich ihr darüber zu lesen gab.
Aber sie war wie ein Kind in einem Frauenkörper – einem umwerfenden Frauenkörper übrigens –, und ihr Verlangen nach Kontakt flaute nicht ab. Ob sie ihren Sessel nicht näher an meinen rücken dürfe? Ob ich nicht ein paar Minuten lang ihre Hand halten würde? Ob wir nicht nebeneinander auf dem Sofa sitzen könnten? Ob ich nicht einfach meinen Arm um sie legen und schweigend dasitzen könne, ob wir nicht spazierengehen wollten, statt zu reden?
Und sie war so erfinderisch in ihren Überredungsversuchen. ›Seymour‹, sagte sie, ›Sie schwingen schöne Reden, daß Sie für jeden Patienten eine neue Therapie schaffen wollen, aber was Sie in Ihren Artikeln ausgelassen haben, ist, daß das ›nur gilt, solange die Therapie im offiziellen Handbuch steht‹ oder ›solange es nicht der altväterlichen, bürgerlichen Bequemlichkeit des Therapeuten zuwiderläuft.‹ Sie kritisierte mich, weil ich Zuflucht bei den APA-Richtlinien bezüglich der Grenzen der Therapie nahm. Sie wußte, daß ich als Präsident der APA für die Verabschiedung dieser Richtlinien gesorgt hatte, und sie beschuldigte mich, ein Gefangener meiner eigenen Regeln zu sein. Sie warf mir vor, meine eigenen Artikel nicht zu lesen. ›Sie betonen, wie wichtig es ist, der Einzigartigkeit eines jeden Patienten Rechnung zu tragen, und dann tun Sie so, als könnte ein einziger Kanon von Regeln auf alle Patienten in allen Situationen angewandt werden. ›Wir werden alle in einen Topf geworfen‹, sagte sie, ›als wären alle Patienten genau gleich und sollten genau gleich behandelt werden.‹ Und ihr Refrain lautete stets: ›Was ist wichtiger: daß Sie die Regeln befolgen? Daß Sie in der Behaglichkeitszone Ihres Lehnstuhls sitzen bleiben? Oder daß Sie das Beste für Ihre Patienten tun?‹
Bei anderen Gelegenheiten haderte sie mit mir wegen meiner ›Defensivtherapie‹: ›Sie haben furchtbare Angst, man könne Ihnen einen Prozeß anhängen. Ihr humanistischen Therapeuten kuscht doch alle vor den Rechtsanwälten, während ihr gleichzeitig eure psychisch kranken Patienten dazu drängt, sich ihrer Freiheit bewußt zu werden. Glauben Sie wirklich, ich würde Sie vor Gericht bringen? Kennen Sie mich immer noch nicht, Seymour? Sie retten mein Leben. Und ich liebe Sie!‹
Und wissen Sie was, Ernest, sie hatte recht. Sie hatte mich festgenagelt. Ich kuschte tatsächlich. Ich verteidigte meine Richtlinien selbst in einer Situation, in der ich wußte, daß sie der Therapie schadeten. Ich stellte meine Furchtsamkeit, meine Ängste bezüglich meiner kleinen Karriere über ihre Interessen. Wirklich, wenn Sie die Dinge von einer unparteiischen Warte aus betrachten, war es nicht falsch, sie neben mir sitzen und meine Hand halten zu lassen. Im Gegenteil, jedesmal, wenn ich das tat, kam es unweigerlich unserer Therapie zunutze. Sie wurde weniger defensiv, vertraute mir mehr.
Was? Ob es in der Therapie überhaupt einen Platz für feste Grenzen gebe? Natürlich gibt es den. Hören Sie mal zu, Ernest. Mein Problem war, daß Belle gegen alle Grenzen ankämpfte wie ein Stier gegen ein rotes Tuch. Egal wo ich die Grenzen zog, sie stürmte wieder und wieder dagegen an. Sie machte es sich zur Gewohnheit, knappe, enge Kleider zu tragen oder durchsichtige Blusen ohne BH. Als ich etwas dazu sagte, verspottete sie mich wegen meiner viktorianischen Einstellung zum Körper. Ich wolle jede noch so kleine intime Einzelheit ihres Geistes kennenlernen, sagte sie dann, aber ihre Haut sei tabu. Ein paarmal klagte sie über einen Knoten in der Brust und bat mich, sie zu untersuchen – was ich natürlich nicht tat. Sie redete stundenlang über das Thema Sex mit mir und bat mich, wenigstens einmal mit ihr zu schlafen. Eines ihrer Argumente war, daß ein einmaliger Geschlechtsverkehr mit mir sie von ihrer Obsession befreien würde. Sie würde erfahren, daß nichts Besonderes oder Magisches dabei sei und wäre dann frei, über andere Dinge im Leben nachzudenken.
Welche Gefühle ihr Kampf um sexuellen Kontakt in mir geweckt hat? Gute Frage, Ernest, aber ist das auch Gegenstand dieser Untersuchung?
Sie sind sich nicht sicher? Gegenstand der Untersuchung sollte doch sein, was ich getan habe – dafür werde ich verurteilt –, nicht was ich gefühlt oder gedacht habe. Darauf geben die Leute, die einen lynchen, einen Scheißdreck! Aber wenn Sie den Kassettenrekorder für ein paar Minuten ausstellen, werde ich es Ihnen sagen. Betrachten Sie es als Unterweisung. Sie haben doch sicher Rilkes Briefe an einen jungen Dichter gelesen, oder? Nun, betrachten Sie dies als meinen Brief an einen jungen Therapeuten.
Gut. Ihren Stift auch, Ernest. Legen Sie ihn weg und hören Sie eine Weile einfach nur zu. Sie wollen wissen, welche Wirkung das auf mich hatte? Eine schöne Frau ist von mir besessen, masturbiert täglich, während sie an mich denkt, bittet mich, sie zu bumsen, redet pausenlos über ihre Phantasien, über mich, darüber, daß sie sich mein Sperma ins Gesicht reiben oder in Schokoladenkekse geben will – was glauben Sie denn, was ich dabei empfunden habe? Sehen Sie mich an! Zwei Stöcke, Gesundheitszustand eine einzige Talfahrt, häßlich – mein Gesicht wird von seinen eigenen Falten aufgefressen, mein Körper ist schwammig, zerfällt.
Ich gebe es zu. Ich bin nur ein Mensch. Die Sache zeigte langsam Wirkung. An den Tagen, an denen wir eine Sitzung hatten, habe ich an sie gedacht, wenn ich mich anzog. Welches Hemd sollte ich nehmen? Sie haßte breite Streifen – darin sähe ich zu selbstzufrieden aus. Und welches Rasierwasser? Royall Lyme war ihr lieber als Mennen, und ich konnte mich nie entscheiden, welches von beiden ich benutzen sollte. Im allgemeinen nahm ich einfach das Royall Lyme. Eines Tages hat sie in ihrem Tennisclub einen meiner Kollegen kennengelernt – einen Trottel, einen richtigen Narzißten, der immer mit mir rivalisierte –, und sobald sie erfuhr, daß er irgendwie in Verbindung mit mir stand, fragte sie ihn nach mir aus. Seine Verbindung zu mir turnte sie an, und sie ging sofort mit ihm nach Hause. Stellen Sie sich das mal vor, diese umwerfend aussehende Frau bumst den Blödmann, und er weiß nicht, daß er das mir zu verdanken hat. Und ich kann’s ihm nicht sagen. Hat mich ganz schön angekotzt.
Aber es ist eine Sache, wenn ein Patient starke Gefühle in einem weckt. Darauf zu reagieren ist eine andere. Und ich habe dagegen angekämpft – ich habe mich ständig analysiert, ich habe laufend zwei Freunde deswegen konsultiert, und ich habe versucht, die Sache während der Sitzungen unter Kontrolle zu halten. Eins ums andere Mal habe ich ihr gesagt, es sei ein Ding der Unmöglichkeit, daß ich jemals mit ihr schlafe, ich könne mir nie mehr ins Gesicht sehen, wenn ich es täte. Ich habe ihr gesagt, daß sie einen guten, anteilnehmenden Therapeuten viel dringender brauche als einen alternden, verkrüppelten Liebhaber. Aber ich habe auch eingeräumt, daß ich mich zu ihr hingezogen fühlte. Ich habe ihr erklärt, daß ich nicht so nah bei ihr sitzen wollte, weil der körperliche Kontakt mich errege und mich in meiner Effektivität als Therapeut beeinträchtige. Ich habe eine autoritäre Haltung angenommen: Ich habe darauf bestanden, daß ich über größere Weitsicht verfüge als sie, daß ich Dinge über ihre Therapie wisse, von denen sie keine Ahnung habe.
Ja, ja, Sie können den Rekorder wieder einschalten. Ich glaube, ich habe Ihre Frage, was meine Gefühle betrifft, beantwortet. Nun, so ging das über ein Jahr lang; wir haben gegen den Ausbruch der Symptome gekämpft. Es gab viele Fehltritte ihrerseits, aber im großen und ganzen haben wir gute Fortschritte gemacht. Ich wußte, daß das noch keine Heilung war. Ich habe sie lediglich ›gehalten‹, ihr ein Gerüst gegeben, ihr von Sitzung zu Sitzung Sicherheit gegeben. Aber ich konnte die Uhr ticken hören; Belle wurde immer rastloser und ermüdete langsam.
Und dann kam sie eines Tages zu mir, vollkommen fertig. Es war irgendein neuer, sehr sauberer Stoff auf den Markt gekommen, und sie gab zu, daß sie nahe dran sei, etwas Heroin zu kaufen. ›Ich halte auf die Dauer kein Leben aus, das nur aus Frustration besteht‹, sagte sie. ›Ich gebe mir irrsinnige Mühe, aber mir geht langsam die Luft aus. Ich kenne mich, ich weiß, wie ich funktioniere. Sie halten mich am Leben, und ich will mit Ihnen arbeiten. Ich glaube, daß ich es schaffen kann. Aber ich brauche irgendeinen Anreiz! Ja, ja, Seymour, ich weiß, was Sie gleich sagen werden. Ich kenne Ihre Sprüche auswendig. Sie werden sagen, daß ich bereits einen Anreiz habe, daß mein Anreiz ein besseres Leben ist, daß ich mich in meiner Haut wohler fühlen will, daß ich nicht versuche, mir das Leben zu nehmen, Selbstachtung. Aber das alles ist nicht genug. Es ist zu weit weg. Zu abgehoben. Ich muß es anfassen können. Ich muß es anfassen können!‹
Ich wollte gerade etwas Beschwichtigendes sagen, aber sie fiel mir ins Wort. Ihre Verzweiflung war greifbar und brachte nun einen verzweifelten Vorschlag hervor. ›Seymour, arbeiten Sie mit mir. Auf meine Weise. Ich bitte Sie. Wenn ich ein Jahr clean bleibe – wirklich clean, Sie wissen, was ich meine: keine Drogen, keine Abführmittel, keine Kneipenbekanntschaften, kein Schneiden, kein gar nichts – dann belohnen Sie mich! Geben Sie mir einen Anreiz! Versprechen Sie mir, für eine Woche mit mir nach Hawaii zu fahren. Und fahren Sie als Mann und Frau mit mir hin – nicht als Psychofritze und Patientin. Schmunzeln Sie nicht, Seymour, ich meine es ernst – todernst. Ich brauche es. Seymour, stellen Sie ein einziges Mal meine Bedürfnisse über die Regeln. Arbeiten Sie mit mir an dieser Sache.‹
Für eine Woche mit ihr nach Hawaii fahren! Sie schmunzeln, Ernest; das habe ich auch getan. Ungeheuerlich! Ich habe reagiert, wie Sie reagiert hätten: Ich habe gelacht. Ich habe versucht, die Sache abzutun, wie ich all ihre vorhergehenden korrumpierenden Anträge abgetan hatte. Aber diesmal ließ sich das nicht so einfach regeln. Sie hatte etwas Zwanghaftes, etwas Bedrohlicheres an sich. Und sie war beharrlicher. Sie ließ einfach nicht locker. Ich konnte sie nicht davon abbringen. Als ich ihr erklärte, daß es nicht in Frage käme, fing Belle an zu verhandeln: Sie verlängerte die Phase, in der sie sich anständig benehmen wollte, auf anderthalb Jahre, machte aus Hawaii San Francisco und schraubte die Woche erst auf fünf, dann auf vier Tage herunter.
Zwischen den Sitzungen dachte ich dann, ohne es zu wollen, über Belles Vorschlag nach. Ich kam nicht dagegen an. Ich habe in Gedanken damit gespielt. Anderthalb Jahre – achtzehnMonate – anständiges Benehmen? Unmöglich. Absurd. Das würde sie niemals schaffen. Reine Zeitverschwendung, überhaupt davon zu reden!
Aber angenommen –nur mal angenommen – sie wäre wirklich in der Lage, ihr Verhalten für achtzehn Monate zu ändern? Stellen Sie sich das mal vor, Ernest. Überlegen Sie. Wägen Sie die Möglichkeiten ab. Wenn diese impulsive, trieborientierte Frau Kontrollmechanismen entwickeln und sich achtzehn Monate lang ich-gerechter benehmen würde – ohne Drogen, ohne Schneiden, ohne jede Form der Selbstverstümmelung –, wäre sie dann nicht von Grund auf eine andere Frau?
Was? Borderline-Patienten spielen eben ihre Spielchen? Habe ich Sie richtig verstanden? Ernest, Sie werden nie ein richtiger Therapeut, wenn Sie so denken. Genau das meinte ich vorhin, als ich über die Gefahren der Diagnose sprach. Es gibt solche Grenzfälle und solche. Etiketten vergewaltigen die Menschen. Sie können nicht das Etikett behandeln; Sie müssen den Menschen hinter dem Etikett behandeln. Also noch mal, Ernest, ich frage Sie: Würden Sie mir nicht recht geben, daß dieser Mensch, nicht dieses Etikett, aber diese Belle, dieser Mensch aus Fleisch und Blut, von innen heraus radikal verändert sein würde, wenn sie sich achtzehn Monate lang auf fundamental andere Weise verhalten würde?
Sie wollen sich nicht festlegen? Das kann ich Ihnen nicht verübeln – wenn man an Ihre momentane Situation denkt. Und an den Kassettenrekorder. Nun, dann beantworten Sie sich die Frage im stillen selbst. Nein, lassen Sie mich an Ihrer Stelle antworten: Ich glaube nicht, daß es einen Therapeuten auf Erden gäbe, der mir nicht beipflichten würde, daß Belle ein ganz anderer Mensch wäre, wenn sie nicht länger von ihren Impulsen beherrscht würde. Sie würde andere Werte entwickeln, andere Prioritäten, eine andere Sichtweise. Sie würde aufwachen, die Augen öffnen, die Wirklichkeit sehen, vielleicht ihre eigene Schönheit und ihren Wert erkennen. Und sie würde mich anders sehen, würde mich so sehen, wie Sie mich sehen: als einen torkelnden, kraftlosen, alten Mann. Sobald die Wirklichkeit an sie herantritt, würde ihre erotische Übertragung, ihre Nekrophilie, einfach verblassen und mit ihr natürlich alles Interesse an dem hawaiianischen Abenteuer.
Was war das, Ernest? Ob ich die erotische Übertragung vermissen würde? Ob mich das traurig machen würde? Natürlich! Natürlich! Ich finde es herrlich, angehimmelt zu werden. Wer täte das nicht? Sie etwa nicht? Na, kommen Sie schon, Ernest. Sie etwa nicht? Lieben Sie nicht den Applaus nach einem gelungenen Vortrag? Lieben Sie nicht die Menschen, vor allem die Frauen, die sich um Sie scharen?
Gut! Ich weiß Ihre Ehrlichkeit zu schätzen. Kein Grund, sich zu schämen. Wer liebte diese Dinge nicht? So sind wir eben. Also, um fortzufahren, ich würde ihre Bewunderung vermissen, mir würde etwas fehlen. Aber das gehört zu meinem Job: sie der Realität zuzuführen, ihr zu helfen, mir zu entwachsen. Ihr sogar, Gott bewahre uns, zu helfen, mich zu vergessen.
Nun, im Lauf der nächsten Tage und Wochen faszinierte Belles Wetteinsatz mich mehr und mehr. Achtzehn Monate clean bleiben, hatte sie angeboten. Vergessen Sie nicht, daß es sich dabei um ein erstes Angebot handelte. Ich bin ein zäher Verhandlungspartner, und ich war mir sicher, daß ich wahrscheinlich mehr herausschlagen könnte, daß ich Ihren Einsatz hochtreiben könnte. Daß es mir gelingen würde, die Veränderung wirklich auf feste Füße zu stellen. Ich dachte über weitere Bedingungen nach, die ich stellen könnte: Gruppentherapie für sie vielleicht, und mehr Engagement bei dem Versuch, ihren Mann zu einer Paartherapie zu bewegen.
Ich dachte Tag und Nacht über Belles Vorschlag nach. Bekam ihn einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin ein Spieler, und meine Chancen standen ziemlich gut. Wenn Belle die Wette verlor, wenn sie sich einen Ausrutscher erlaubte – Drogen nahm oder Abführmittel oder Streifzüge durch Bars machte oder sich die Handgelenke aufschlitzte –, dann hatte ich nichts verloren. Wir wären lediglich wieder da, wo wir angefangen hatten. Selbst wenn ich nur ein paar Wochen oder Monate der Abstinenz herausschlagen konnte, hätte ich etwas erreicht, auf dessen Grundlage sich weitermachen ließ. Und wenn Belle gewann, würde sie so verändert sein, daß sie die Schuld niemals einfordern würde. Es war eine narrensichere Sache. Null Risiko auf der Sollseite und eine gute Chance auf der Habenseite, daß ich diese Frau retten konnte.
Ich war immer ein Mann der Tat gewesen, habe Rennen geliebt und auf einfach alles gesetzt – Baseball, Basketball. Nach der High-School bin ich zur Marine gegangen; meine College-Zeit habe ich mir mit den Pokergewinnen an Bord finanziert; während meines praktischen Jahrs im Mount Sinai in New York habe ich viele meiner freien Abende beim Spiel mit den diensthabenden Geburtshelfern von der Park Avenue auf der Entbindungsstation zugebracht. Im Ärztezimmer neben dem Kreißsaal wurde ständig gespielt. Sobald ein Platz am Spieltisch frei wurde, meldeten sie sich bei der Vermittlung, die dann ›Dr. Blackwood‹ ausrief. Wann immer ich ›Dr. Blackwood bitte in den Kreißsaal‹ hörte, lief ich so schnell ich konnte rüber. Erstklassige Ärzte, jeder einzelne von ihnen, aber keinen Schimmer von Poker. Sie wissen ja, Ernest, daß man den Assistenzärzten heutzutage so gut wie nichts bezahlt, und am Ende des Jahres hatten alle anderen Assistenzärzte Schulden bis über beide Ohren. Und ich? Ich fuhr dank der Geburtshelfer von der Park Avenue in einem neuen De Soto Cabrio nach Ann Arbor zurück.
Aber zurück zu Belle. Wochenlang schwankte ich, was ihre Wette betraf, und dann, eines Tages, wagte ich den Sprung. Ich erklärte Belle, daß ich ihr Verlangen nach einer Belohnung verstehen könne, und begann ernsthaft zu verhandeln. Ich bestand auf zwei Jahren. Sie war so dankbar, ernst genommen zu werden, daß sie auf all meine Bedingungen einging, und bald darauf hatten wir einen festen, klar umrissenen Vertrag. Ihr Teil des Abkommens sah vor, daß sie zwei Jahre lang absolut clean bleiben mußte: keine Drogen (einschließlich Alkohol), keine Schneidereien, keine Abführmittel, keine Sexabenteuer in Bars oder auf Autobahnen und auch sonst kein gefährliches Sexualverhalten. Normale Affären waren erlaubt. Und nichts Ungesetzliches. Ich dachte, damit sei alles abgedeckt. O ja, sie mußte eine Gruppentherapie anfangen und versprechen, zusammen mit ihrem Mann eine Paartherapie zu machen. Mein Teil des Vertrags war ein Wochenende in San Francisco: Alle Einzelheiten, Hotels, Freizeitgestaltung unterlagen ihrer Entscheidung – carte blanche. Ich würde ganz zu ihrer Verfügung stehen.
Belle nahm die Sache sehr ernst. Am Ende der Verhandlung schlug sie einen formellen Eid vor. Sie brachte eine Bibel zu unserer Sitzung mit, und wir schworen beide, daß wir unseren Teil des Vertrages einhalten würden. Danach besiegelten wir unsere Abmachung mit einem Handschlag.
Die Behandlung ging weiter wie zuvor. Belle und ich trafen uns schätzungsweise zweimal die Woche – dreimal wären vielleicht besser gewesen, aber ihr Mann wurde langsam ungehalten wegen der Therapierechnungen. Da Belle clean blieb und wir keine Zeit mehr auf die Analyse ihrer ›Ausrutscher‹ verwenden mußten, kamen wir bei der Therapie schneller voran und erreichten tiefere Schichten. Träume, Phantasien – alles schien besser zugänglich geworden zu sein. Zum ersten Mal sah ich einen Keim von Neugier, was sie selbst betraf; sie schrieb sich für Aufbaukurse an der Universität ein – zum Thema abnormale Psychologie –, und sie begann eine Autobiographie über ihre frühen Jahre zu schreiben. Allmählich erinnerte sie sich an weitere Einzelheiten aus ihrer Kindheit, ihre traurige Suche, eine neue Mutter zu finden in der Reihe desinteressierter Gouvernanten, von denen die meisten binnen weniger Monate wieder gingen, weil ihr Vater so fanatisch auf Sauberkeit und Ordnung bestand. Seine Keimphobie beherrschte alle Aspekte ihres Lebens. Stellen Sie sich nur vor: Bis sie vierzehn Jahre alt war, durfte sie nicht zur Schule gehen und wurde zu Hause unterrichtet, weil ihr Vater Angst hatte, sie könne Bakterien ins Haus einschleppen. Daher hatte sie nur wenige enge Freunde. Selbst Mahlzeiten mit Freunden waren selten; es war ihr verboten, auswärts zu essen, und sie fürchtete sich vor der Peinlichkeit, ihre Freunde den Mätzchen auszusetzen, die ihr Vater beim Essen machte. Handschuhe, Hände waschen zwischen den einzelnen Gängen, Untersuchung der Dienstboten-Hände auf Sauberkeit. Sie durfte keine Bücher ausleihen – eine geliebte Gouvernante wurde auf der Stelle gefeuert, weil sie Belle und einer Freundin erlaubt hatte, einen Tag lang die Kleider zu tauschen. Ihr Dasein als Kind und Tochter endete abrupt im Alter von vierzehn Jahren, als sie auf ein Internat nach Grenoble geschickt wurde. Von da an hatte sie nur noch oberflächlichen Kontakt mit ihrem Vater, der sich bald darauf wieder verheiratete. Seine neue Frau war sehr schön, aber eine ehemalige Prostituierte – nach Meinung einer unverheirateten Tante, die behauptete, die neue Frau sei nur eine von vielen Huren, die ihr Vater in den vergangenen vierzehn Jahren gekannt hatte. Vielleicht – und das war Belles erste eigene Deutung in dieser Therapie – vielleicht fühlte er sich schmutzig, und das war der Grund, warum er sich ständig wusch und nicht zulassen wollte, daß seine Haut die ihre berührte.
Während dieser Monate kam Belle nur insofern auf unsere Wette zu sprechen, als sie gelegentlich ihrer Dankbarkeit mir gegenüber Ausdruck verlieh. Sie nannte es die ›machtvollste Bestätigung‹, die sie je bekommen habe. Sie wußte, daß die Wette ein Geschenk an sie war: Im Gegensatz zu den ›Geschenken ‹, die sie von den anderen Psychiatern bekommen hatte – Worte, Deutungen, Versprechungen, ›therapeutische Fürsorge‹ –, war dieses Geschenk echt und greifbar. Es war der körperliche Beweis, daß ich mich ganz und gar dafür entschieden hatte, ihr zu helfen. Und es war für sie der Beweis meiner Liebe. Nie zuvor, sagte sie, sei sie so geliebt worden. Nie zuvor habe jemand sie, Belle, über seine Eigeninteressen gestellt, über die Regeln. Ganz gewiß nicht ihr Vater, der ihr bis zu seinem Tod vor zehn Jahren nie die nackte Hand gegeben hatte und der ihr jedes Jahr dasselbe Geburtstagsgeschenk gemacht hatte: ein Bündel Hundertdollarscheine, eines für jedes Lebensjahr, jeder Schein frisch gewaschen und gebügelt.
Und die Wette hatte noch eine andere Bedeutung. Es reizte sie, daß ich bereit war, die Regeln zu brechen. Was sie am meisten an mir liebte, sagte sie, sei meine Bereitschaft, Risiken einzugehen, mein offener Zugang zu meinem eigenen Schatten. ›Sie haben so etwas Unartiges und Düsteres an sich‹, pflegte sie zu sagen. ›Deshalb verstehen Sie mich auch so gut. In gewisser Weise sind wir beide Zwillingsgestirne.‹
Wissen Sie, Ernest, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir so schnell miteinander klar kamen, warum sie sofort wußte, daß ich der richtige Therapeut für sie war – einfach ein respektloses Funkeln in meinen Augen. Belle hatte recht. Sie hatte mich durchschaut. Sie war ein cleveres Mädchen.
Und wissen Sie, ich wußte genau, was sie meinte – genau! Ich kann diese Eigenschaft bei anderen auf dieselbe Weise ausmachen. Ernest, würden Sie bitte nur ein paar Sekunden den Rekorder ausstellen. Gut. Danke. Was ich Ihnen sagen wollte, ist, daß ich dasselbe auch in Ihnen sehe. Sie und ich, wir sitzen auf verschiedenen Seiten dieses Podiums, dieses Richtertisches, aber wir haben etwas gemeinsam. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich verstehe mich darauf, in Gesichtern zu lesen. Ich irre mich nur selten in solchen Dingen.
Nein? Kommen Sie! Sie wissen, was ich meine! Ist das nicht genau der Grund, warum Sie meine Geschichte mit solchem Interesse verfolgen? Mehr als Interesse! Gehe ich zu weit, wenn ich es Faszination nenne? Ihre Augen sind groß wie Untertassen. Ja, Ernest, im Ernst. Sie hätten nicht anders gehandelt an meiner Stelle. Meine faustische Wette hätte genausogut die Ihre sein können.
Sie schütteln den Kopf. Natürlich! Aber ich spreche nicht zu Ihrem Kopf. Ich spreche direkt zu Ihrem Herzen, und vielleicht kommt einmal die Zeit, da Sie offen sein werden für das, was ich Ihnen jetzt sage. Und mehr noch – vielleicht werden Sie sich nicht nur in mir, sondern auch in Belle wiederfinden. Wir drei. Wir sind einander gar nicht so unähnlich! Na gut, das war’s – kommen wir wieder zur Sache.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: