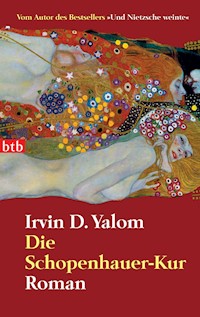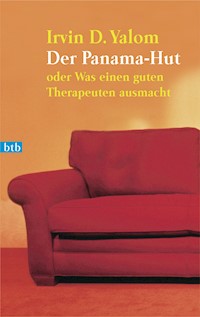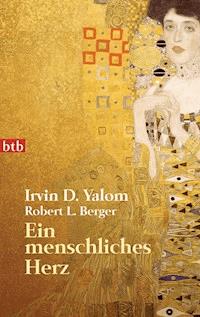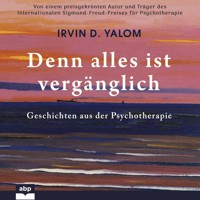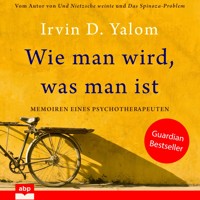9,99 €
Mehr erfahren.
Im vorliegenden Buch, das erstmals auf Deutsch erscheint, beleuchtet Yalom alle wesentlichen Aspekte der Gruppenpsychotherapie: Wie muss sie beschaffen sein, damit sie funktioniert? Welchen Prinzipien sollte sie folgen? Welcher Art sind die Unterschiede zwischen stationärer und ambulanter Betreuung? Wie könnte ein Modell erfolgreicher Arbeit mit Gruppen aussehen? Ein Buch für die Fachwelt wie den interessierten Laien gleichermaßen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Das Besondere an Irvin D. Yalom war schon immer die Verbindung zwischen Lehren und Schreiben, zwischen Literatur und Psychoanalyse. Es gibt nur wenige seiner Zunft, die wie er in der Lage sind, komplizierte therapeutische Ansätze allgemeinverständlich darzustellen und damit auch Laien zugänglich zu machen. So sind auch seine Standardwerke zur Gruppenpsychotherapie, die in den Vereinigten Staaten längst Klassiker sind und zum Kanon der psychotherapeutischen Literatur zählen, mehr als nur Fachliteratur: verständlich und anschaulich geschrieben, bieten sie auch Nicht-Fachleuten die Möglichkeit, sich auf einfache Weise mit den Grundzügen therapeutischer Arbeit vertraut zu machen. Im vorliegenden Buch, das erstmals auf Deutsch erscheint, beleuchtet Yalom alle wesentlichen Aspekte der Gruppenpsychotherapie: Wie muss sie beschaffen sein, damit sie funktioniert? Welchen Prinzipien sollte sie folgen? Welcher Art sind die Unterschiede zwischen stationärer und ambulanter Betreuung? Wie könnte ein Modell erfolgreicher Arbeit mit Gruppen aussehen? Ein Buch für die Fachwelt wie den interessierten Laien gleichermaßen.
Autor
Irvin D. Yalom ist Professor für Psychiatrie an der Stanford University. Seine Bücher »The Theory and Practice of Group Psychiatry« und »Inpatient Group Therapy« sind in den USA zu Klassikern geworden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
In den späten 1960er Jahren vollzog sich ein grundlegender Wandel in der Behandlung stationärer Patienten – die Abkehr von langen Krankenhausaufenthalten in großen, oftmals abgeschiedenen staatlichen Kliniken hin zu kurzen, wiederholten Aufenthalten auf kleinen Akutstationen kommunaler Krankenhäuser.
Diese Reform der stationären Psychiatrie sowie die großen Fortschritte der Psychopharmakologie, das Aufkommen der Krisentheorie, das schwindende Vertrauen in somatische Therapien und die Herausbildung neuer therapeutischer Berufe führten zu einer grundlegenden Veränderung von Charakter und Aufgaben der Akutpsychiatrie. Diese Veränderungen aber wurden meist nicht von entsprechenden Modifikationen der psychotherapeutischen Techniken begleitet. Insbesondere die Gruppentherapie schaffte es nicht, Schritt zu halten und sich den neuen klinischen Bedingungen anzupassen. In der Arbeit mit stationären Patienten benutzen Gruppentherapeuten nach wie vor strategische Ansätze, die zu einer anderen Zeit nach anderen Vorgaben entwickelt wurden.
In diesem Buch vertrete ich die Meinung, dass die Ausgangssituation auf der heutigen psychiatrischen Station eine völlig andere ist als jene der konventionellen Gruppentherapie und daher eine grundlegende Veränderung der herkömmlichen gruppentherapeutischen Techniken erfordert. Mein Ziel ist es, eine modifizierte Theorie der Gruppentherapie und ein strategisches und technisches Instrumentarium bereitzustellen, die den Anforderungen an die akutstationäre Versorgung von Patienten gerecht werden. Zielgruppe sind die Kliniker »an der Front« – jene stark belasteten Therapeuten, die ihre Gruppen inmitten des Tumults, der oft auf psychiatrischen Akutstationen herrscht, zu betreuen haben.
Es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Stationen, doch eine typische moderne Station (von der Art, wie sie in diesem Buch vorausgesetzt wird) weist folgende Merkmale auf: Sie bietet Platz für etwa fünfzehn bis fünfunddreißig Patienten, die ein bis drei Wochen dort bleiben. Das Spektrum der psychischen Störungen ist groß: akute Psychosen, Borderlinestörungen (mit selbstschädigendem Verhalten oder akuter vorübergehender psychotischer Störung), Depressionen, Substanzmissbrauch, Essstörungen, alterspsychiatrische Syndrome, akute Krisen und Dekompensationen (oft mit suizidalem Verhalten) bei Personen mit vergleichsweise leichten Störungen. Die Station kann geschlossen oder offen sein. Zum Personal gehören Vertreter verschiedener Berufsgruppen (und häufig Studierende einiger oder aller dieser Fachrichtungen): Pflege, Psychiatrie, Sozialpädagogik, Beschäftigungstherapie, Klinische Psychologie, Freizeit- und Arbeitstherapie, Bewegungs-, Tanz-, Musik- und Kunsttherapie. Die Mitarbeiter ermöglichen ein breit gefächertes therapeutisches Angebot: medikamentöse Behandlung, Einzelpsychotherapie, Gruppen- und Familienpsychotherapien, Milieutherapie, Beschäftigungstherapie, Elektroschocktherapie. Über allem schwebt als mächtige und unsichtbare dritte Kraft die Geldfrage, die erschreckend großen Einfluss auf die Aufnahme- und Entlassungskriterien besitzt. Auf der Station geht es oft hektisch zu, die Fluktuation (sowohl von Patienten als auch von Mitarbeitern) ist hoch, die Spannung unter den Mitarbeitern groß, die Psychotherapie konzeptionslos.
Dieses Buch soll dem Gruppentherapeuten, der mit stationären Patienten arbeitet, im klinischen Alltag helfen. Für diesen Zweck habe ich aus allen verfügbaren Informationsquellen geschöpft: aus meiner Erfahrung (als Mitarbeiter stationärer Abteilungen und in den letzten drei Jahren als Leiter einer täglichen Therapiegruppe für stationäre Patienten), aus meiner klinischen Forschungsarbeit und aus der Literatur, die Erfahrungen im Krankenhaus beschreibt und wissenschaftlich aufarbeitet. Ich profitiere außerdem von Gesprächen, die ich über viele Jahre hinweg mit dem Krankenhauspersonal geführt habe, sowie von persönlichen Beobachtungen auf fünfundzwanzig Stationen, die ich zur Vorbereitung auf diese Arbeit besucht habe, um mit den Mitarbeitern zu sprechen und therapeutischen Gruppensitzungen beizuwohnen. Es handelte sich um Stationen in privaten, kommunalen und/oder Universitätskrankenhäusern. Sollten meine Beobachtungen von der üblichen Erfahrung abweichen, liegt das nicht zuletzt daran, dass ich an den bekanntesten und renommiertesten Krankenhäusern mit ihren hervorragenden Ausbildungsprogrammen und der großzügigen Personalausstattung war.
Psychiatrische Akutstationen von der Art, wie ich sie in diesem Text beschreibe, sind zwar typisch, keinesfalls aber die Regel. Die Welt der Krankenhauspsychiatrie ist groß, und es gibt vielerlei Einrichtungen, über die ich wenig weiß. Ich hoffe, dass Mitarbeiter solcher Einrichtungen (und dazu gehören auch Stationen für Kinder, Jugendliche oder alte Menschen, für Substanzmissbrauchsfälle, für chronische Patienten, für Patienten mit schweren Psychosen und für psychisch gestörte Straftäter) einige der Grundsätze und Techniken, die ich hier beschreibe, unmittelbar anwenden und andere ihren eigenen Erfordernissen anpassen können.
Psychotherapeuten, die ambulante Therapiegruppen leiten, handeln autonom: Ihre Fähigkeiten und ihre Entscheidungen bestimmen den Verlauf, die Vorgehensweise und die Resultate der Therapie. Für den Leiter der stationären Gruppe sieht das ganz anders aus. Psychiatrische Abteilungen bieten ein breites Spektrum an Therapien an, die sich oft überschneiden und um Patienten, Zeit, Personal, finanzielle Mittel sowie Fortbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten konkurrieren. Folglich trifft für die stationäre Gruppe nicht der Gruppentherapeut, sondern die Verwaltung so wichtige Entscheidungen wie die über Häufigkeit und Dauer von Sitzungen, Größe, Zusammensetzung, Zuweisung von Kotherapeuten, Supervision, Teilnahmepflicht und so weiter.
Da das Schicksal der stationären Gruppe so stark vom äußeren Rahmen bestimmt wird und von administrativen Maßnahmen, die schon vor der eigentlichen Gruppensitzung greifen, ist dieses Buch entsprechend aufgebaut. Die ersten beiden Kapitel befassen sich mit den Schnittstellen zwischen Station und kleiner Gruppe, in den anschließenden vier Kapiteln geht es um spezielle Strategien und Techniken für den therapeutischen Einsatz.
In Kapitel 1 gehe ich auf die derzeit übliche stationäre Praxis ein: die Rolle der Gruppentherapie, die Struktur von Gruppentherapieprogrammen, ihren Stellenwert, den Ablauf und die Häufigkeit von Sitzungen, die Leitung, die strategischen Ziele. Da auf manchen Stationen Unsicherheit darüber herrscht, wie viel Personal und Energie in die Gruppentherapie investiert werden soll, führe ich empirische und rational-humanistische Belege dafür an, wie erfolgreich Gruppentherapie sein kann. Eine ausführliche Dokumentation und Diskussion der Forschungsliteratur würde vom Ziel dieses Buches abweichen, einen Leitfaden für die klinische Praxis anzubieten. Aber akademische Gewohnheiten sind nur schwer auszurotten, daher habe ich mich doch entschlossen, einen Überblick über die wissenschaftliche Literatur anzufügen. Um nicht zu stumpfsinniger Lesearbeit zu ermuntern, blieben in der letzten Fassung nur noch die einschlägigsten Beiträge vom Rotstift verschont, detailliertere Arbeiten wurden in den Anhang verbannt.
In Kapitel 2 stelle ich verschiedene für die Arbeit mit stationären Patienten notwendige strukturelle Modifikationen vor. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Grundregeln traditioneller Gruppentherapie beschreibe ich die Bedingungen der stationären Gruppenarbeit und die technischen und strukturellen Veränderungen, die durch dieses Umfeld notwendig werden – Veränderungen hinsichtlich von Ziel, Zusammensetzung, Häufigkeit und Dauer der Sitzungen, Vertrauensstruktur, Untergruppenbildung und Rolle des Therapeuten.
Die situationsbedingten strukturellen Modifikationen haben weitreichende Auswirkungen auf die Strategien und Techniken des Therapeuten – das ist das Thema von Kapitel 3 und 4. Manche Leser missverstehen den englischen Titel dieses Buches und lesen statt »inpatient«, also stationäre, »impatient group therapy«, also ungeduldige Gruppentherapie. Kapitel 3 zeigt, dass dieser Fehler gar nicht so abwegig ist: Ein langsamer, geduldiger, reflektierender, nondirektiver Therapieansatz ist in der stationären Arbeit nicht angebracht. Therapeuten stationärer Gruppen müssen einen kürzeren Zeitrahmen abstecken, aktiv und zielorientiert arbeiten und der Gruppe immer wieder deutlich und wirksam Struktur geben. Und Unterstützung, immer wieder Unterstützung: Jegliche stationäre Gruppenarbeit erfordert ein stützendes Fundament, und der Leiter muss eine Vielzahl von Techniken kennen, die zum Aufbau eines sicheren, vertrauensvollen Gruppenklimas beitragen.
In Kapitel 4 geht es darum, wie der Therapeut in der Gruppentherapie mit stationären Patienten das Hier und Jetzt einsetzt. Ich stelle das Grundprinzip des Hier und Jetzt vor, erläutere seine Bedeutung für alle experientialistischen Gruppenpsychotherapien und erörtere grundsätzliche Überlegungen, die das stationäre Umfeld erfordert. Viele Gruppentherapeuten vermeiden in stationären Gruppen die Arbeit im Hier und Jetzt, weil sie fälschlicherweise Interaktion mit Konfrontation oder Konflikt gleichsetzen. Kapitel 4 erläutert nachdrücklich, dass die Arbeit im Hier und Jetzt auch zutiefst verstörten Patienten Unterstützung, die Erfahrung von Kohäsion und Selbstbestätigung ermöglichen kann.
Die letzten beiden Kapitel stellen zwei spezielle Modelle für Gruppentherapiesitzungen vor – Kapitel 5 eine Gruppe für Patienten mit leichteren Störungen und Kapitel 6 eine Gruppe für psychotische Patienten mit schweren Störungen. Auch wenn ich diese Modelle sehr detailliert beschreibe, sind sie nicht als festes Grundschema gedacht. Ich will lediglich die allgemeine Strategie einer strukturierten Gruppensitzung veranschaulichen und hoffe zu analogen Vorgehensweisen anzuregen, die dem jeweiligen persönlichen Stil und den klinischen Vorgaben angemessen sind.
In dieser Abhandlung konzentriere ich mich ausschließlich auf das zentrale, unerlässliche Element des Gruppentherapieprogramms für stationäre Patienten: die tägliche Gesprächstherapiegruppe. Meine Absicht war es, ein bündiges Handbuch für die Klinik zu verfassen und nicht ein Werk von enzyklopädischen Ausmaßen. Daher konnte ich auf viele Themen nicht eingehen, darunter das große Spektrum an spezialisierten Gruppen, die unterstützenden Gruppentherapietechniken (wie Videomitschnitt, Psychodrama, Bewegungs-, Tanz- und Musiktherapie), die Methoden für die spezifischen Probleme von Borderline-, suizidgefährdeten, aggressiven, antriebslosen oder paranoiden Patienten, oder die anderen Themen im Umkreis der Gruppentherapie (wie therapeutische Ausbildung und Supervision, T-Gruppen für Mitarbeiter, Gemeinschaftssitzungen). Ich verzichte auf diese wichtigen Themenbereiche nicht nur aus Platzgründen, sondern auch, weil das glatte und unüberschaubare Parkett der stationären Gruppentherapie, wie sie derzeit durchgeführt wird, nicht nach spezialisierten, sondern nach grundsätzlichen Beiträgen zu Theorie und Praxis verlangt.
Es ist ein weiter Weg von hastig notierten Beobachtungen zu einem Buch wie dem vorliegenden, und viele Menschen haben mich dabei begleitet. Allen voran Bea Mitchell und ihr glorreicher Word Processor, denen nicht ein einziges Mal die Farbe aus dem Gesicht wich, wenn ihnen mal wieder eine endgültige Fassung präsentiert wurde, die sich später doch als vorletzte entpuppte. Mein Dank gebührt Dr. David Spiegel und Carol Payne (Krankenschwester) für die kritische Durchsicht des gesamten Manuskripts, Vivian Banish für ihre wertvollen Beiträge zum Modell der »Fokusgruppe«, meiner Familie für die große Unterstützung und die Nachsicht, dass ich so kurz nach Fertigstellung eines anderen zeitintensiven Projekts dieses Werk in Angriff nahm, den Patienten und Mitarbeitern der psychiatrischen Abteilung am Stanford University Medical Center (Station NOB) für ihre unermüdliche Kooperation und Unterstützung, Marjorie Crosby für ihre großzügige finanzielle Unterstützung, Phoebe Hoss für die redaktionelle Betreuung, der Stanford University für die notwendigen Freiräume und Hilfsmittel und all den Mitarbeitern der vielen stationären Abteilungen, die mir großzügig den Zugang zu und die Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit ermöglicht haben.
KAPITEL 1
Gruppenpsychotherapie und die psychiatrische Station heute
Wäre dies eine Abhandlung über Gruppenpsychotherapie mit ambulanten Patienten, könnte man sich gleich in medias res stürzen und die Erörterung der therapeutischen Strategien und Methoden eröffnen. Im Falle der stationären Gruppenpsychotherapie sieht das ganz anders aus! Für den Gruppentherapeuten, der mit stationären Patienten arbeitet, ist es ein entscheidender Behandlungsfaktor, dass die stationäre Gruppe im Gegensatz zur ambulanten Therapiegruppe nicht »eigenständig« existiert, sondern stets Teil eines größeren therapeutischen Systems ist.
Daher werde ich als Erstes die Beziehung zwischen der Gruppentherapie und der therapeutischen Organisation, in die sie eingebunden ist, genauer untersuchen. Die heutige akutpsychiatrische Station bietet neben der Gruppentherapie eine Auswahl weiterer Therapieformen an: psychotrope Medikation, Einzeltherapie, Milieutherapie, Arbeitstherapie, Beschäftigungstherapie, Familientherapie, Elektroschocktherapie. Die Therapieformen beeinflussen sich gegenseitig, und Entscheidungen im Rahmen einer Therapie können sich auf eine andere oder auch auf alle anderen Therapien auswirken. Zudem kann es sein, dass verschiedene Stationsbereiche den verschiedenen Therapien unterschiedliche Bedeutung beimessen – mit tief greifenden Auswirkungen auf die Durchführung der Gruppenpsychotherapie.
Wir betrachten zunächst die Rolle, die der Gruppentherapie im Krankenhaus beigemessen wird, und beschäftigen uns dann mit den wichtigsten Problemen der stationären Gruppentherapieprogramme und den Lösungen, die einzelne Abteilungen dafür anbieten. Schließlich fragen wir nach der Effizienz stationärer Gruppentherapie.
Die gegenwärtige Praxis
Stellenwert der Gruppentherapie
Soweit ich informiert bin, verfügt jede akutpsychiatrische Station über ein gewisses Angebot an Gruppentherapie. Die Argumente, die für die Wirksamkeit der Gruppentherapie sprechen, und ihre weitgehende Befürwortung durch die Vertreter verschiedenster therapeutischer Berufe sind so stark, dass es schwierig zu rechtfertigen wäre, wenn eine Station ganz auf ein kleines Gruppenprogramm verzichten würde.
Allerdings hält sich das Engagement vieler Stationen in Grenzen, und es wird lediglich ein oberflächliches Angebot bereitgestellt. In Einzelfällen werden stationäre Gruppen auch ohne offizielle Genehmigung der Stationsverwaltung eingerichtet. Ich habe in einer Universitätsklinik eine Station besucht, deren medizinischer Leiter, ein Psychopharmakologe, mir erklärte, er habe seinen Dienst vor etwa einem Jahr angetreten und in den ersten drei Monaten Gruppen einzurichten versucht, sei aber dann zu dem Schluss gekommen, Therapiegruppen machten im Akutbereich keinen Sinn, und habe in der Folge das Gruppenprogramm »ausrangiert«. Als ich mich allerdings mit einigen seiner Mitarbeiter unterhielt, erfuhr ich hinter vorgehaltener Hand, dass die Abendschicht des Pflegepersonals unter der Bezeichnung »Diskussionsrunde« eine tägliche Therapiegruppe unterhalte. (Therapiegruppen, die sich unter irgendwelchen Tarnnamen treffen, sind, wie ich später noch ausführen werde, keine Seltenheit.)
Berichte in der einschlägigen Literatur rufen uns gelegentlich in Erinnerung, dass manche Stationen noch bis vor relativ kurzer Zeit keinerlei Therapieprogramm anboten. Zwei Psychiater beispielsweise beschreiben in einem Artikel aus dem Jahr 1974 ihren Versuch, auf einer akutpsychiatrischen Station zweimal pro Woche Gruppentherapiesitzungen abzuhalten. [A]a Die Autoren berichten, dass die Patienten die Gruppen einhellig als hilfreich erachteten, nicht über Langeweile klagten und stets bei den Sitzungen anwesend waren (obwohl die Teilnahme freiwillig war). Die Autoren berichten des Weiteren (mit einem gewissen Erstaunen), dass das Gruppentherapieprogramm gegenüber den herkömmlichen Morgenvisiten der Ärzteschaft viele Vorteile aufwies.
In einem ähnlichen Bericht aus dem Jahr 1975 beschreibt eine Psychiatrieschwester die Einrichtung eines Gruppenprogramms auf einer psychiatrischen Station.[B] Die Schwestern der Akutstation waren der Meinung, dass eine wöchentlich abgehaltene therapeutische Gemeinschaftssitzung keine wirksame Gruppenpsychotherapie ermögliche. Zögerlich und ohne die Unterstützung (oder sogar gegen den offenkundigen Widerstand) des Stationspsychiaters, begannen die Schwestern, selbst ein bescheidenes Gruppenprogramm aufzubauen. Sie berichten etwas überrascht, dass die kleine Therapiegruppe den Patienten wichtige Lernerfahrungen ermöglichte, dass offene Gespräche über Gefühle zum besseren Funktionieren der Station beitrugen, dass die Patienten das förmliche Auftreten der Schwestern (einschließlich ihrer gestärkten weißen Tracht) als sehr negativ empfanden und dass die Therapiegruppe den Patienten half, die anderen verfügbaren Therapieformen besser zu nutzen.
Es stimmt nachdenklich, dass noch Mitte der 1970er Jahre solche Artikel verfasst werden konnten. Wenn aber Stationsmitarbeiter unabhängig voneinander den Nutzen von Gruppenprogrammen entdecken, bestärkt und bestätigt das natürlich meine eigenen Theorien. Es zeigt, wie wenig Aufmerksamkeit gruppentherapeutischen Ansätzen in der Ausbildung von Psychiatern und Pflegepersonal geschenkt wird.
Vielfalt der Programme
Was am meisten auffällt, wenn man das heutige Angebot an stationären Behandlungsprogrammen betrachtet, ist die erstaunliche Bandbreite und Vielfalt. Bei meinen Besuchen ambulanter Einrichtungen der Vereinigten Staaten stelle ich immer wieder fest, dass die therapeutischen Gruppenprogramme weitgehend identisch sind. Ganz im Gegensatz dazu existiert in den stationären Abteilungen ein buntes Nebeneinander von Gruppenarten, Strategien und Führungstechniken. Auch Zusammensetzung, Dauer und Häufigkeit von Sitzungen unterscheiden sich.
Es schwirrt einem der Kopf angesichts einer solchen Fülle: Entweder hat sich gleichzeitig in den Kliniken des ganzen Landes ein gewaltiges kreatives Potential Bahn gebrochen, oder wir haben hier den Beweis für das immense und beklagenswerte Chaos auf diesem Gebiet. Obwohl viele der Programme von beachtlicher Phantasie und Kreativität zeugen – Kreativität, die für die berufliche Weiterentwicklung unerlässlich ist –, scheinen mir hier mit ziemlicher Sicherheit alarmierende Hinweise auf das Fehlen eines festen Bezugssystems vorzuliegen. Es gibt für die Gruppentherapie mit stationären Patienten keinen stimmigen Kanon von Grundregeln und den entsprechenden Strategien und Techniken, der in allen Einrichtungen Gültigkeit besäße. In der Ausbildung junger Psychotherapeuten wirkt sich diese Lücke verheerend aus und fördert bei der Entwicklung eines eigenen Therapieansatzes die gefährlich spekulative Einstellung des »jeder für sich«, die auf lange Sicht dem Berufsstand und dem Wohl der Patienten nur schaden kann.
Man betrachte nur einmal die unterschiedlichen Arten von Therapiegruppen auf den Stationen. Die Abteilungen, die ich besucht habe, verfügten normalerweise über herkömmliche psychotherapeutische Gesprächsrunden, die sich in der Regel ein bis drei Mal pro Woche trafen, sowie eine Reihe weiterer, spezialisierter Gruppen, die oft ein bis zwei Mal wöchentlich stattfanden und von einem Vollzeitmitarbeiter oder einem nur für diesen Zweck teilzeitbeschäftigten Therapeuten geleitet wurden. Die Vielfalt der Gruppen in den von mir besuchten Abteilungen war überraschend groß (selbst wenn man berücksichtigt, dass ähnliche Gruppen auf verschiedenen Stationen unterschiedlich genannt wurden) und umfassten unter anderem interaktionelle Gruppen, psychoanalytisch orientierte Psychotherapiegruppen, Familiengruppen, Orientierungsgruppen, Bewegungstherapiegruppen, Kunsttherapiegruppen, Massagegruppen, Entspannungstrainingsgruppen, Gruppen für geleitete Phantasien, Tanztherapiegruppen, Musiktherapiegruppen, therapeutische Gartengruppen, Medikationstrainingsgruppen, Zukunftsplanungsgruppen, therapeutische Wohngruppen, Kunsthandwerksgruppen, Sexualerziehungsgruppen, Entlassungsvorbereitungsgruppen, Problemlösungstrainingsgruppen, Diskussionsgruppen, Wahrnehmungstrainingsgruppen, verhaltenstherapeutische Gruppen, Fokusgruppen, Ann-Landers-Gruppen, Psychodramagruppen, Männergruppen, Frauengruppen, Gruppen mit strukturierten Trainingsprogrammen, Familienwohngruppen, Entscheidungstrainingsgruppen, Puppenspielgruppen, Gruppen zur Diskussion von Fernsehserien, Projektgruppen und Arbeitsgruppen.
Die Vielfalt der Gruppentherapieprogramme lässt sich durch das stark differierende Angebot dreier Stationen veranschaulichen. Den äußeren Umständen nach waren die drei Stationen vergleichbar: Es handelte sich um psychiatrische Akutstationen mit zwanzig bis dreißig Betten, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Patienten betrug zwei Wochen, die Stationen waren in ein allgemeines Universitätskrankenhaus eingegliedert. Alle drei verfügten über ausreichend Personal und genossen einen ausgezeichneten Ruf auf lokaler wie auf überregionaler Ebene.
Station A wurde grundsätzlich eher herkömmlich geleitet. Die täglichen Visiten verliefen förmlich: Der Oberarzt und die Assistenzärzte sprachen über die Patienten, vom Pflegepersonal oder vom nichtmedizinischen Personal wurde wenig erwartet. Das Gespräch konzentrierte sich vorwiegend auf die Besprechung von Details der Pharmakotherapie oder der Elektroschocktherapie, auf Fragen nach etwaigen organischen Ursachen oder auf die Planung für die Zeit nach der Entlassung. Die Gruppentherapeuten der Station kamen bei den Visiten überhaupt nicht zu Wort, obwohl sie über viele und ausgesprochen relevante Informationen verfügten.
Der Oberarzt gab unumwunden zu, dass ihn Gruppentherapie nicht besonders interessiere. Keiner seiner Assistenzärzte leitete eine Gruppe, weil ihnen angeblich keine angemessene Supervision geboten werden könne. Obwohl eine ganze Reihe gruppentherapeutisch erfahrener Sozialpädagogen und Psychologen als Ansprechpartner bereitstanden, hielt er es für keine gute Idee, Nichtmediziner mit der Supervision von Medizinstudenten oder Assistenzärzten zu betrauen. Ein solches Vorgehen, so glaubte er, würde einen schlechten Eindruck machen und viele junge Ärzte abschrecken, eine berufliche Laufbahn in der Psychiatrie einzuschlagen.
Es gab auf der Station eine offizielle Psychotherapiegruppe, die von einer Sozialpädagogin geleitet wurde. Die Gruppe traf sich drei Mal pro Woche für eine Stunde und wurde von etwa sieben oder acht der Patienten mit leichteren Störungen besucht. Sie wurden von der Leiterin ausgewählt, die vor jeder Sitzung einen Rundgang durch die Station machte und sie einlud oder überredete zu kommen. Die Sozialpädagogin, deren Ausbildungsschwerpunkt auf Einzel- und Familientherapie lag, hatte wenig Lust auf Gruppentherapie und ließ die Sitzungen bereitwillig so oft wie möglich ausfallen. Wenn sie nicht auf der Station war und sogar während längerer Urlaube, gab es keine Gruppensitzungen. Die Schwestern bekamen keine Gruppen, weil der Oberarzt verfügt hatte, dass sie sich nicht psychotherapeutisch betätigen dürften. Die Beschäftigungstherapeutin hatte Gruppen geleitet, war aber entlassen worden, erzählte mir die Stationsschwester, weil »es zu viele Mitarbeiter gab, die zu viele Patienten therapieren wollten, und keiner mehr dazu beitragen mochte, den Tag der Patienten auszufüllen«.
Ein Mal pro Woche kamen eine Kunst- und eine Tanztherapeutin, um mit den Patienten Gruppen abzuhalten, aber keiner der Mitarbeiter konnte mir erklären, was in diesen Sitzungen genau passierte. Ein Mal wöchentlich abends traf sich eine Multifamiliengruppe, die von den Patienten aber nur spärlich besucht wurde. Zwei Mal pro Woche wurde eine halbstündige Gemeinschaftssitzung abgehalten, in welcher Probleme der Station diskutiert werden sollten, doch die Stimmung war gedämpft und die Gespräche oberflächlich. Ein Mal pro Woche hielt die Freizeittherapeutin eine kurze Gemeinschaftssitzung ab, in der sie gemeinsam mit den Patienten die Aktivitäten der kommenden Woche besprach.
Station B bot zwei Mal wöchentlich eine dreiviertelstündige Psychotherapiegruppe an. Geleitet wurde sie von zwei Assistenzärzten und einer Psychiatrieschwester, die für ihre Gruppe die Patienten mit den leichtesten Störungen auswählten (ungefähr acht der insgesamt zweiundzwanzig Patienten der Station). Auf dieser Station gab es noch weitere Gruppenangebote:
zwei Gemeinschaftssitzungen pro Woche: Eine wurde vom leitenden Assistenzarzt gehalten, die andere von der Stationsschwester;
eine Familiengruppe: fünfundvierzig Minuten, ein Mal die Woche, schlecht besucht;
eine Gruppe fürs Training sozialer Kompetenzen: fünfundvierzig Minuten, ein Mal die Woche, für Patienten vor der Entlassung, geleitet von zwei examinierten Krankenschwestern (Inhalt und Vorgehensweise dieser Sitzungen waren nicht abzugrenzen von der zwei Mal wöchentlichen Psychotherapiegruppe);
eine Kunsttherapiegruppe: eine Stunde, drei Mal pro Woche, geleitet von einem speziell für diese Aufgabe hinzugezogenen Therapeuten;
eine »Alltags«-Gruppe: drei Mal pro Woche, geleitet von Beschäftigungstherapeuten und Stationsmitarbeitern, die chronisch kranke Patienten in grundlegenden Dingen wie Kochen oder Körperpflege unterwiesen;
eine »Medikationstrainingsgruppe«: eine Stunde pro Woche, geleitet von Schwestern, die über die Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten aufklärten und mit den Patienten über Ängste sprachen, welche sich mit der Einnahme von Medikamenten verknüpfen.
Station C teilte ihre vierundzwanzig Patienten nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen auf. Sämtliche Patienten einer Gruppe trafen sich zwei Mal die Woche für fünfundvierzig Minuten zu einer Psychotherapiesitzung, die von zwei Assistenzärzten und einer Psychiatrieschwester geleitet wurde. Dem Oberarzt von Station C lag das Gruppenprogramm sehr am Herzen, und in seinem Mitarbeiterstab gab es fünf Vollzeittherapeuten, die an der Arbeit mit Gruppen interessiert waren (ein Musiktherapeut, ein Kunsttherapeut, ein Tanztherapeut, ein Freizeittherapeut und ein Beschäftigungstherapeut). Er hatte dafür gesorgt, dass sämtliche Fachbereiche als gleichrangig galten – alle Mitarbeiter erhielten therapeutische Weiterbildung, und alle Positionen wurden als austauschbar betrachtet, außer die Aufgabe von Ärzten und Schwestern, Medikamente zu verordnen und auszugeben. Zusätzlich zur zwei Mal wöchentlichen Therapiegruppe bot die Station eine Vielzahl weiterer Gruppen an:
eine Familiengruppe: ein Mal pro Woche;
eine Orientierungsgruppe: sechzig Minuten, zwei Mal die Woche; alle Patienten einer Gruppe trafen sich, um für die nächste Woche persönliche Ziele festzulegen;
eine therapeutische Gemeinschaftssitzung: fünfundvierzig Minuten, ein Mal die Woche;
eine Gruppe zum Training sozialer Kompetenzen: ein Mal die Woche mit dem Schwerpunkt Körperpflege und Konversation;
eine Tanztherapiegruppe: zwei Mal wöchentlich;
eine Musiktherapiegruppe: zwei Mal wöchentlich;
eine Gartengruppe: ein Mal wöchentlich, geleitet vom Arbeitstherapeuten mit dem Ziel, fürsorgliches Verhalten zu lehren;
eine Entspannungstherapiegruppe: für ausgewählte, nichtpsychotische Patienten;
eine Kunsttherapiegruppe: zwei Mal wöchentlich;
eine Medikationstrainingsgruppe: ein Mal wöchentlich.
Ich habe diese Stationen ausgewählt, weil sie sich in vielen Punkten sehr stark unterschieden: im Stellenwert, den die Gruppentherapie einnimmt, im Rollenverständnis der einzelnen Berufsgruppen und vor allem in Anzahl und Art der angebotenen Therapiegruppen. Aber keine dieser Stationen kann als typisch gelten: Auf jeder der vielen Stationen, die ich besucht habe, gab es ein individuelles Gruppenprogramm und spezifische, fest verankerte Vorstellungen, wie die Gruppen geführt werden sollten.
Angesichts der großen, oft verblüffenden Vielfalt an stationären Gruppentherapieprogrammen ist es angebracht, sich auf die dominierenden Aspekte der gruppentherapeutischen Praxis zu konzentrieren und sie quer durch viele unterschiedliche Programme hindurch systematisch zu untersuchen. Ich werde auf verschiedene Entscheidungen eingehen, die alle Stationen treffen müssen: über den Stellenwert der Gruppentherapie, die Zusammensetzung der Gruppen, die Häufigkeit der Sitzungen, den Führungsstil und die Schwerpunkte innerhalb der Gruppe.
Stellenwert der stationären Gruppe
Das Ansehen, das die Gruppentherapieprogramme genießen, unterscheidet sich von Station zu Station beträchtlich. An einem Ende des Spektrums stand eine Station, auf welcher der Oberarzt selbst eine Therapiegruppe leitete, bei anderen Gruppen die Supervision übernahm und zum wöchentlichen Erfahrungsaustausch mit den Mitarbeitern zusammenkam, am anderen Ende die bereits erwähnte Station, wo der Oberarzt, ein Psychopharmakologe, das Gruppenprogramm gestrichen hatte und die Schwestern gezwungen waren, ihre Abendgruppen heimlich durchzuführen.
Betrachten die Stationsleiter das Gruppenprogramm als unwichtig oder gar therapieschädlich, kann man nicht davon ausgehen, dass die Gruppe eine effektive Therapieform darstellt. Kein Gruppentherapeut kann eine stationäre Gruppe erfolgreich leiten, wenn die anderen Mitglieder des behandelnden Teams nichts von Gruppentherapie halten. Skepsis von Seiten der Kollegen setzt einen Prozess in Gang (allgemein bekannt als »self-fulfilling prophecy«), in dessen Verlauf die Stationsmitarbeiter so handeln, dass ihre Erwartungen Realität werden. Sie kommunizieren ihre Meinung offen oder unterschwellig an die Patienten, deren Erwartungen an die Gruppentherapie negativ beeinflusst werden. Ein solcher Pessimismus aber untergräbt die Psychotherapie: Zahlreiche Forschungsarbeiten bestätigen, dass die Ergebnisse einer Therapie umso besser sind, je stärker der Patient am Anfang von der Wirksamkeit der Therapie überzeugt ist.[C] Der Ansteckungseffekt in der Gruppentherapie ist größer als in der Einzeltherapie. Vereinzelte Gruppenmitglieder, die der Therapie skeptisch und pessimistisch begegnen, übertragen ihre Gefühle schnell auf andere Teilnehmer. Zudem bilden sie einen »Nährboden«, auf dem die Zuversicht nachfolgender Mitgliedergenerationen erfahrungsgemäß eingehen wird.
Man erkennt eine solche Station sehr leicht: Gruppensitzungen werden selten und nur über kurze Perioden hinweg abgehalten, Einzeltherapeuten unterbrechen die Sitzung und rufen ihre Patienten heraus, die Mitarbeiter suchen nach Gründen, Gruppen ausfallen zu lassen, die Gruppen werden von nicht speziell dafür ausgebildeten Personen geleitet, häufig ohne Supervision, die Gruppen werden als Zeitfüller betrachtet, die Mitarbeiter sind inkompetent und spotten mitunter über die verschiedenen Gruppenangebote, die Gruppen dienen den unterschiedlichsten Zwecken (zum Beispiel der Diskussion, dem Einüben von Fertigkeiten oder der Vorbereitung von Entlassungen), werden aber nicht als »psychotherapeutische« Aktivitäten angesehen. In manchen Fällen ist es den Gruppenleitern sogar ausdrücklich verboten, »Psychotherapie« zu betreiben.
Ein Oberarzt, bei dem ich mich nach dem Gruppentherapieprogramm seiner Station erkundigte, behauptete, es finde täglich eine Therapiegruppe statt. Bald fand ich jedoch heraus, dass er meinte, es gebe zwei kleine Therapiegruppen pro Woche, dann zwei halbstündige Gemeinschaftssitzungen pro Woche und ein Mal pro Woche ein Planungstreffen, bei dem die Patienten ihre Aktivitäten für die kommende Woche festlegten. (Für ihn waren das alles Therapiegruppen.) Er fuhr fort: »Es gibt noch jede Menge ›Mischmaschgruppen‹, die von Schwestern, Beschäftigungstherapeuten und Tänzern geleitet werden, aber da kann man wohl nicht von Therapie sprechen.«
Wenn Patienten aus Gruppentherapiesitzungen geholt werden, ist das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Gruppentherapie gering geachtet wird. Manche Privatstationen befinden sich vorrangig in der Hand von privat praktizierenden Ärzten, die über die stationäre Betreuung ihrer Patienten entscheiden. Sie legen fest, ob ihre Patienten die Therapiegruppen auf der Station besuchen dürfen. Kommt ein solcher Arzt auf die Station, um einen Patienten zu sehen, wird er ohne Rücksicht auf die Folgen der Unterbrechung für die übrigen Teilnehmer fordern, sein Patient möge die Gruppe sofort verlassen. Die Botschaft ist für alle anderen Patienten überdeutlich: Gruppensitzungen sind eine nette Angelegenheit – solange sie die Therapie nicht stören. Das Vertrauen des Patienten in die Gruppentherapie und in die Gruppenleiter – eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Verlauf – ist untergraben, und die Annahme, Gruppentherapie sei ineffizient, wird sich bald bewahrheiten.
Andere Stationen – zum Beispiel die oben erwähnte Station C – schätzen Gruppentherapie und bauen ihr Programm darum herum auf. Für alle Ärzte ist völlig klar, dass ihre Patienten automatisch am Gruppentherapieprogramm der Station teilnehmen und dass die Einzeltherapiestunden danach ausgerichtet werden müssen.
Besonders unbefriedigend ist die Situation in einigen privaten Kliniken, wo viele Patienten von wenigen privat praktizierenden Psychiatern aufgenommen werden. Jeder Psychiater leitet eine Gruppe seiner eigenen Patienten oder, was häufiger der Fall ist, lässt sie von eigens hinzugezogenen Therapeuten (oft Sozialarbeitern mit dem Schwerpunkt Psychiatrie) leiten. Dieses Vorgehen stellt die Interessen einzelner Patienten über das Wohlergehen der Gemeinschaft und wirkt einem konstanten stationsübergreifenden Programm entgegen. Da es oft mehrere Gruppen gibt, die von verschiedenen Personen geleitet werden und dann stattfinden, wenn es dem Gruppenleiter am besten passt, kann das Pflegepersonal kein Programm organisieren, das alle Mitglieder der Station mit einbezieht.
Zusammensetzung der stationären Gruppe
Gruppen auf psychiatrischen Stationen werden alternativ nach zwei Grundprinzipien zusammengesetzt. Die einen (zum Beispiel Station A und B) arbeiten nach dem Level-Modell, bei dem Patienten mit vergleichsweise leichten Störungen einer »Higher-Level«-Gruppe und die stärker regredierten, psychotischen Patienten einer »Lower-Level«-Gruppe zugeordnet werden.
Die anderen (zum Beispiel Station C) arbeiten nach dem Team-Modell. Dabei werden auf der Station zwei oder drei Teams gebildet, denen alle neu aufgenommenen Patienten abwechselnd zugeteilt werden, und jedes Team trifft sich als Therapiegruppe. Die Teamtherapiegruppe ist folglich sehr heterogen und umfasst ständig Patienten mit dem gesamten Spektrum möglicher Störungen, von chronisch regredierten, psychotischen Patienten bis hin zu jenen, die relativ gut integriert sind, sich aber gerade in einer schweren Lebenskrise befinden.
Jedes dieser Modelle für die Zusammensetzung einer Therapiegruppe – das Level-Modell und das Team-Modell – hat seine Vor- und seine Nachteile. Erfolgreiche Programme müssen, wie ich im folgenden Kapitel erläutern werde, eine Möglichkeit finden, die Vorteile beider Modelle zu nutzen.
Häufigkeit von Gruppensitzungen
Die hohe Patientenfluktuation stellt für das Gruppentherapieprogramm jeder Akutstation ein großes Problem dar. Soll der Gruppentherapeut so etwas wie Gruppenstabilität aufbauen, gibt es meiner Ansicht nach nur eine mögliche Strategie: so oft wie nur möglich Gruppensitzungen abzuhalten. Auf einer Station mit zwanzig Betten und einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Patienten von ein bis zwei Wochen unterscheidet sich die Zusammensetzung einer Gruppe, die sich nur zwei Mal pro Woche trifft, von Sitzung zu Sitzung erheblich. Natürlich wechselt auch in einer täglichen Gruppe die Besetzung regelmäßig, doch bleibt ein ausreichender Stamm an Teilnehmern erhalten, um eine gewisse Gruppenstabilität zu gewährleisten (auch dazu mehr im folgenden Kapitel). Nur sehr wenige Stationen jedoch sehen für ihre »offizielle« Psychotherapiegruppe tägliche Sitzungen vor. Üblicherweise hält die Haupttherapiegruppe zwei oder höchstens drei Sitzungen pro Woche ab. Die Spezialgruppen (vorerst benutze ich diese Bezeichnung für die Gesamtheit aller alternativen Gruppen) treffen sich durchschnittlich ein oder zwei Mal pro Woche.
Warum kommt die Gesprächspsychotherapiegruppe im Normalfall so selten zusammen? Stationsleiter bieten dafür verschiedene Erklärungen an, die aber allesamt nicht überzeugen. Einige Stationen behaupten zum Beispiel, sie könnten nicht öfter als zwei Mal pro Woche Gruppen abhalten, weil die Dienstpläne mit ihren wechselnden Schichten den Mitgliedern des Pflegepersonals, die als Kotherapeuten eingesetzt sind, nicht genügend Kontinuität in der Gruppenleitung ermöglichen. (Andere Stationen dagegen sehen keine Schwierigkeit darin, Mitarbeiter über einen begrenzten Zeitraum hinweg – etwa zwei oder drei Monate – eine Gruppe leiten zu lassen und sie während dieser Zeit ausschließlich für Tagesschichten einzuteilen.) Stark unterbesetzte Stationen behaupten manchmal, sie könnten aufgrund von Personalmangel und ohnehin schon eingeschränkter Pflegezeit nicht öfter Gruppensitzungen anbieten.b Auch wenn die Dienstpläne auf einer hektischen »Drehtür«-Station tatsächlich ein Problem darstellen, scheint doch in erster Linie die Einstellung zur Gruppentherapie darüber zu entscheiden, wie häufig Sitzungen stattfinden. Schätzt und unterstützt die Stationsleitung die Gruppentherapie, lösen sich die unüberwindlichen Probleme mit den Dienstplänen auf wundersame Weise in Luft auf, und Einzeltherapien sowie die Tagespläne von Patienten, Schwestern und Assistenzärzten lassen sich ganz leicht um die Gruppentherapiezeiten herum arrangieren. Selbst wenn Kotherapeuten wünschenswert sind, haben verschiedene Stationen die Erfahrung gemacht, dass es notfalls auch ohne sie geht. Ein gut ausgebildeter Leiter kann durchaus »solistisch« arbeiten. Die Station mit dem schlimmsten Personalmangel unter den von mir besuchten Abteilungen bot nur ein Mal pro Woche eine herkömmliche Therapiegruppe an, hatte aber mit bescheidenem Aufwand einen Mitarbeiter von außen hinzugezogen, der an vier Abenden pro Woche eine Gruppe leitete.
Manchmal treffen sich Gruppen nicht hinreichend häufig, weil zu viele Mitarbeiter um den therapeutischen Führungsanspruch konkurrieren. Wie ich im nächsten Abschnitt zeigen werde, treibt die Rivalität zwischen den verschiedenen Fachbereichen die Vertreter der einzelnen Disziplinen dazu, für ihre jeweilige therapeutische Spielwiese zu kämpfen. Im Bemühen, es jedem recht zu machen, erhält jede Richtung ihre Nische im wöchentlichen Gruppenplan, mit dem Ergebnis, dass zum Pensum eines Patienten viele der genannten Spezialgruppen gehören. Auf manchen Stationen gibt es bis zu drei Gruppensitzungen täglich, aber da sich keine dieser Gruppen öfter als ein oder zwei Mal pro Woche trifft, hat der Patient keine Chance auf eine kontinuierliche und zusammenhängende Gruppenerfahrung. Solche Programme orientieren sich nicht an den Bedürfnissen der Patienten, sondern an denen der Mitarbeiter. Trotz ihrer Dichte können sie dem therapeutischen Erfolg entgegenwirken: Sie bewirken Zerstreuung statt Integration und vermögen es nicht, orientierungslosen Patienten die nötige Struktur vorzugeben.
Ein weiterer Grund dafür, dass sich stationäre Gruppen nicht häufig genug treffen, besteht meines Erachtens in der Unsicherheit vieler Gruppenleiter, wie sie die Gruppen leiten sollen. Da es kein stimmiges, allgemein anerkanntes Konzept für die Gruppentherapie mit stationären Patienten gibt, verfügen die Leiter auch nicht über eine angemessene Ausbildung. Die Konsequenz ist, dass sich Gruppenleiter im stationären Bereich an unzureichenden Modellen orientieren oder jeder seinen eigenen Stiefel durchzieht. In beiden Fällen verläuft die Mehrzahl der kleinen stationären Gruppensitzungen planlos und ineffizient. Die Therapeuten leiden nicht weniger unter diesem Mangel an vernünftigen therapeutischen Richtlinien als die Patienten. Die Therapeuten möchten stationäre Therapiegruppen leiten, fühlen sich aber nicht besonders wohl dabei und sind von ihrer Arbeit enttäuscht. Auf diese ambivalente Situation reagieren sie, indem sie nur selten Therapiegruppen durchführen – ein Umstand, der die Leitung der kleinen Gruppe leider noch zusätzlich erschwert.
Leitung der Gruppe
Wer die kleine stationäre Gruppe leiten soll, ist schwer zu beantworten. Oft spiegelt die Leitungsfrage Konflikte der Mitarbeiter wider. Die Leiter von stationären Therapiegruppen repräsentieren ein breites Spektrum an Fachrichtungen – Psychiatrieschwestern, Stationsassistenten, Psychiater, Psychologen, Sozialarbeiter mit Schwerpunkt Psychiatrie, Beschäftigungstherapeuten, Krankenhausseelsorger, Freizeittherapeuten, Arbeitstherapeuten, Bewegungstherapeuten, Tanztherapeuten, Kunsttherapeuten sowie Lernende aller dieser Disziplinen. Am häufigsten werden Gruppen von Psychiatrieschwestern geleitet, am seltensten von Psychiatern (allerdings haben fast fünfzig Prozent der Akutstationen an Universitätskrankenhäusern Gruppen eingerichtet, die von psychiatrischen Assistenzärzten geleitet werden).
Die Meinungen über die angemessene Rolle der einzelnen Berufsgruppen differieren gewaltig. Auf Station C zum Beispiel waren die Grenzen zwischen den Berufsgruppen völlig aufgehoben, und sämtliche Mitarbeiter wurden als Psychotherapeuten bezeichnet. Das andere Extrem fand sich auf Station A, wo ausdrücklich vorgegeben war, dass niemand außer dem Psychiater und bis zu einem gewissen Grad die Sozialarbeiter der Psychiatrie Therapien anbieten durften. (Der Beschäftigungstherapeut von Station A war, wie ich bereits erwähnte, entlassen worden, weil er sich inoffiziell therapeutisch betätigt hatte.)
So geht es in der Leitungsfrage häufig um Macht, Prestige und die Markierung fachlicher Reviere statt um die Kompetenz eines Leiters. Die Lage wird noch dadurch verkompliziert, dass bestenfalls vereinzelte Berufsgruppen während ihrer Ausbildung in gruppentherapeutische Methoden eingeführt werden, und praktisch keine von ihnen bekommt Richtlinien für die Gruppenpsychotherapie mit stationären Patienten an die Hand.
Die Rivalität der Berufsgruppen wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf das gesamte stationäre Gruppentherapieprogramm aus. Grundsätzlich möchte jeder Mitarbeiter Gruppen leiten, den prestigeträchtigen Titel »Therapeut« führen und die Befriedigung erleben, an der Genesung der Patienten unmittelbar mitzuwirken, statt sich bloß dem Ausfüllen von Zeit oder der Aufrechterhaltung des Stationsbetriebs zu widmen. Bei Entscheidungen über Zahl, Art und Häufigkeit von Gruppen wiegt die Sorge, dass die Mitarbeiter nicht zu sehr belastet werden, oft schwerer als Überlegungen, was den Patienten am besten helfen würde. So habe ich zum Beispiel stationäre Gruppen erlebt, die von bis zu vier oder fünf Fachleuten geleitet wurden, aber nicht, weil mehrere Leiter effizienter sind (oft ist das Gegenteil der Fall), sondern um die Vertreter aller Fachbereiche versöhnlich zu stimmen. Wie ich schon an früherer Stelle erwähnte, kommt derselbe Mechanismus zum Tragen, wenn statt einer einzigen Therapiegruppe mit täglichen Sitzungen eine große Anzahl von Spezialgruppen angeboten wird.
Berufliche Rivalitäten dieser Art sind oft therapieschädlich. Werden viele verschiedene Gruppen von vielen verschiedenen Personen geleitet, besteht meist kein Forum, in dem Gruppenleiter die Stationsmitarbeiter über wichtige Vorfälle in der Gruppe informieren können. Gruppen anderer Fachbereiche werden nicht immer Interesse oder Respekt entgegengebracht. Man wundert sich oft, wie wenig die ständigen Mitarbeiter (zum Beispiel das Vollzeitpflegepersonal und der Stationspsychiater) von den therapeutischen Erfahrungen eines Patienten in den vielen verschiedenen Gruppen der Station mitbekommen. Diese Unwissenheit führt zu einem folgenreichen Zusammenbruch der Kommunikation zwischen Pflegepersonal, medizinischem Personal und einweisendem Psychiater.
Oft sagt die offizielle Bezeichnung einer Gruppe wenig darüber aus, was sie tatsächlich macht. So bot zum Beispiel eine Station eine offizielle Psychotherapiegruppe an, die nur ein Mal pro Woche stattfand. Drei Mal wöchentlich dagegen traf sich abends die Tanztherapiegruppe einer ausgebildeten Tanztherapeutin, die nur für diese drei Termine angestellt war. Als ich die Gruppe besuchte und mich mit den Patienten über ihre Gruppenerfahrung unterhielt, erwies sich der Name »Tanztherapiegruppe« als deutliche Fehlbezeichnung: Tatsächlich handelte es sich um eine intensive (und effektive) Psychotherapiegruppe, die nur zwischendurch ein paar Bewegungsübungen einbaute (kurze nonverbale Übungen oder Gestaltübungen). Die große Mehrzahl der Patienten mit leichteren Störungen besuchte die Gruppe und schätzte sie sehr. Betreut wurde sie von einer Laientherapeutin ohne formale psychotherapeutische Ausbildung, aber mit herausragenden Fachkenntnissen. Sie leitete bereits seit über fünfzehn Jahren solche Gruppen. So wertvoll jedoch die Gruppe für die Patienten war, blieb einiges Potential auf der Strecke, denn einen regelmäßigen Kommunikationsfluss zwischen der Tanztherapeutin, dem Vollzeitpersonal und den Einzeltherapeuten der Patienten gab es nicht.
Mangelnde Kenntnisse oder ungenügende Wertschätzung der Gruppen anderer therapeutischer Richtungen bewirken ein beachtliches Maß an Missverständnissen und Misstrauen. Am Ende eines Besuchs auf einer Station, wo ich viele Therapiegruppen beobachtet und ein Seminar abgehalten hatte, unterhielt ich mich mit einer Studierenden der Beschäftigungstherapie, die nicht ohne eine gewisse Bitterkeit bemerkte, dass die Bewegungstherapeutin, ihrer Meinung nach die wichtigste Gruppentherapeutin auf der Station, vom restlichen Personal nicht genügend geschätzt wurde. Auf der Liste der Therapeuten, die ich während meines eintägigen Besuchs befragen oder in mein Seminar einladen sollte, war sie gar nicht erst aufgetaucht. Als ich mich zuvor nach dem Inhalt der zwei Mal wöchentlich abends abgehaltenen Bewegungstherapiegruppe erkundigt hatte, war sie von Mitgliedern des Pflegestabs herablassend als »hypersensible, gefühlsduselige« und »komische« Gruppe charakterisiert worden, die auf gefährliche Weise bestimmte Bedürfnisse befriedige. Interessant war, was die erwähnte Praktikantin über die Gruppe zu berichten wusste. Die Bewegungstherapeutin hatte gelegentlich ein vertrauensvolles »Sich-Fallen-Lassen« oder ein »allgemeines Umarmen« empfohlen, darüber hinaus spielten Berührungen keine besondere Rolle. Dennoch stürzte sich die ganze Station genau auf diese Details, um die Gruppe in Verruf zu bringen. Kritik dieser Art ist natürlich schädlich. Absichtlich oder nicht, überträgt sich die negative Haltung der Stationsmitarbeiter auf die Patienten, wodurch die Gruppe an Effizienz einbüßt.
Es ist sehr bedauerlich, dass in vielen Universitätskliniken die psychiatrischen Assistenzärzte keine Gruppen leiten. Diejenigen, die den Ausbildungsplan für Assistenzärzte verantworten, machen für dieses Versäumnis mehrere Ursachen geltend. In einem der führenden Universitätskrankenhäuser hat jeder Assistenzarzt auf der Station sieben Einzelpatienten zu betreuen und daneben administrative Pflichten zu erfüllen. Die Assistenzärzte arbeiten zwischen zwölf und vierzehn Stunden täglich und haben nach Aussage des Oberarztes schlicht keine Zeit für Gruppen. Ich erwähnte bereits die Erklärung des Oberarztes von Station A, seine Assistenzärzte leiteten keine Gruppen, weil kein medizinisch ausgebildetes Personal zur Supervision bereitstehe. An einer anderen Universitätsklinik berichtete der Oberarzt, psychiatrische Assistenzärzte hätten in der Vergangenheit Gruppen geleitet, doch aufgrund der veränderten Belegungsstruktur und kürzerer Aufenthaltszeiten könne man nicht mehr erfolgreich mit Gruppen arbeiten. Die Supervisoren hielten es für didaktisch notwendig, die Assistenzärzte dauernd darauf hinzuweisen, wie sie mit einer »richtigen Therapiegruppe« vorzugehen hätten. Offensichtlich mangelt es noch immer an Verständnis für die Situation im Krankenhaus. Auch wenn eine Kurzzeitgruppe für die Gruppendynamik nicht ideal ist, stellt sich die Realität auf den Stationen derzeit so dar und wird es auch noch eine Weile lang tun.
Was immer die Gründe sein mögen: Das Fehlen einer gruppentherapeutischen Ausbildung der Assistenzärzte für die Arbeit mit stationären Patienten wirkt sich negativ aus. Der Verwaltungsleiter einer Station ist so gut wie immer ein Psychiater, und solange die Gruppentherapie kein fester Bestandteil der psychiatrischen Ausbildung ist, werden Stationen auch weiterhin von Fachleuten geführt werden, die bedauerlicherweise nicht viel über Gruppentherapieprogramme wissen und sie folglich auch nicht unterstützen.
Psychiatrieschwestern – die für gewöhnlich die meisten Gruppen leiten – betrachten ihre Aufgabe mit gemischten Gefühlen. Sie verfügen oft nicht über eine formale gruppentherapeutische Ausbildung und fühlen sich der Leitungsrolle entweder nicht gewachsen oder empfinden sie als Bedrohung. Obwohl sie sehr gerne Gruppen leiten und es als Anerkennung betrachten, wenn der Arzt ihnen eine solche Aufgabe überträgt, ist ihnen auch bewusst – und das erregt einen gewissen Unmut –, dass sie oft nur deshalb hinzugezogen werden, weil der Psychiater die Gruppe als nicht besonders wichtig einstuft.
Da Schwestern über zwei Jahrzehnte lang die Hauptverantwortung für stationäre Gruppen trugen, haben sie natürlich angefangen, Besitzansprüche auf das Gruppenprogramm zu erheben. Mit der Entwicklung anderer psychiatrischer Therapieberufe (Freizeittherapie, Arbeitstherapie, Bewegungstherapie), deren Vertreter ebenfalls Gruppen leiten möchten, sind in den letzten Jahren gewisse Spannungen entstanden. Eine unglückliche Begleiterscheinung dieses Wettbewerbs ist es, dass sich Gruppenleiter wider ihre eigenen Bedürfnisse nicht um Supervision zu bitten trauen. Sie haben große Angst, dass ein Vertreter einer anderen Disziplin sie verdrängen könnte, und sprechen daher ihre Nöte und Unsicherheiten sehr oft nicht offen an.
Viele Psychiatrieschwestern haben lange Jahre stationäre Therapiegruppen geleitet und haben sich im Laufe der Zeit zu ausgesprochen kompetenten Therapeutinnen entwickelt. Auch darin liegt ein Problem: Manche Schwestern sind frustriert, dass trotz ihrer Fähigkeiten nur wenig vom Prestige und von den finanziellen Vorteilen der eigentlichen psychotherapeutischen Berufe für sie abfällt. Verständlicherweise ärgern sich diese Schwestern auch über die jährlich oder halbjährlich nachrückenden Assistenzärzte, die sich von der Fachkenntnis einer Schwester so bedroht fühlen, dass sie die Möglichkeit, davon zu profitieren, nicht nutzen mögen. Die Konkurrenzsituation zwischen psychiatrischen Assistenzärzten im ersten Berufsjahr und erfahrenen Psychiatrieschwestern ist ein regelrechtes Dauerthema auf den akutpsychiatrischen Stationen von Universitätskrankenhäusern.
In Krankenhäusern mit einer hohen Belegungsrate durch private Ärzte habe ich eine besonders unerfreuliche Situation beobachtet. Dort werden die meisten Patienten von ein paar wenigen solcher Ärzte aufgenommen, die sich auf stationäre Arbeit spezialisiert haben (vorwiegend zur somatischen oder zur Pharmakotherapie). Die einweisenden Ärzte erlauben es den Schwestern nicht, Gruppen zu leiten, sondern ziehen stattdessen Vertreter ganz anderer Berufe zur Gruppentherapie heran (auf zwei Stationen, die ich besucht habe, war es ein Krankenhausseelsorger, auf zwei weiteren ein Ehe- und ein Familientherapeut). Die haben zwar beste Absichten, sind aber in keiner Weise für die Gruppentherapie ausgebildet. Spannungen zwischen Schwestern und Ärzten wurden so noch verstärkt. Das Pflegepersonal war verärgert und entmutigt und fühlte sich unterschätzt. Freimütig wurde erklärt, die privat praktizierenden Ärzte würden alleinige Besitzansprüche auf ihre Patienten geltend machen und sich von der Vorstellung, Patienten mit anderen Psychotherapeuten zu teilen (und sie vielleicht an diese zu verlieren), so bedroht fühlen, dass sie nur unerfahrene Gruppentherapeuten außer Konkurrenz einstellten.
Ich könnte noch lange traurige Geschichten von unzulänglicher medizinischer Versorgung erzählen, aber inzwischen ist wohl deutlich geworden, worauf ich hinauswill: Interdisziplinäre Rivalität schadet zwangsläufig der Versorgung der Patienten, und der »Besitzanspruch« auf die kleine Therapiegruppe ist ein Thema, an dem sich viele Spannungen zwischen den Fachdisziplinen entzünden. Die Zuteilung der Gruppenleiterrolle ist eine heikle Angelegenheit. Wie ich schon zuvor betonte, ist die kleine stationäre Gruppe keine einsame Insel, sondern Teil eines zusammenhängenden, komplexen Archipels.
Schwerpunkte in der stationären Gruppe
Meine Ausführungen dazu, wo heute in der stationären Gruppe die Schwerpunkte gesetzt werden, beginne ich am besten damit, was man unterlässt. Unter den vielen stationären Therapiegruppen, die ich beobachtet habe, gab es nicht eine einzige mit einem interaktionellen Ansatz: Die Gruppen arbeiteten nicht im Hier und Jetzt. Ich halte aber, wie ich in Kapitel 3 ausführlich erläutern werde, einen interaktionellen Ansatz für die Grundvoraussetzung effektiver Gruppentherapie. In allen Gruppen – auch jenen mit psychotischen, verwirrten Patienten – ist es wichtig, den Mitgliedern zu helfen, untereinander zu interagieren, die Interaktion zu verstehen und Verallgemeinerungen daraus abzuleiten.
Gruppentherapeuten, die nicht wissen, wie man Gruppeninteraktion einsetzt (oder die absichtlich darauf verzichten), geraten oft gewaltig ins Schwimmen. Ich habe reihenweise Sitzungen erlebt, in denen der Therapeut vergeblich nach irgendeinem wirkungsvollen Ansatz für die Gruppe gesucht hat. Dem Gruppentherapeuten, der sich aus welchen Gründen auch immer nicht daran orientiert, wie sich die Mitglieder einer Gruppe zueinander verhalten, bleiben nur wenig andere Möglichkeiten: die Orientierung auf das Damals und Dort und die Orientierung auf das gemeinsame Thema. Doch beide Möglichkeiten weisen erhebliche Mängel auf.
Der Therapeut, der sich auf die Probleme im Damals und Dort konzentriert, kann entweder die Umstände untersuchen, deretwegen Patienten in die Klinik gekommen sind, oder die wichtigsten Probleme, die ihnen in ihrem Leben draußen zu schaffen machen, oder aber ihre Klagen oder Besorgnisse über Vorfälle auf der Station. Im besten Fall kommt bei diesem Ansatz heraus, dass ein Patient etwas Wichtiges über sich selbst offenbart und sich von den anderen Patienten akzeptiert fühlt, die wiederum vielleicht ermutigt werden, auch etwas von sich preiszugeben.
Als häufigsten Fehler habe ich beobachtet, dass Gruppentherapeuten die Gruppe damit beauftragen, für die Krise eines Patienten im Damals und Dort eine Lösung zu finden. Das ist so gut wie immer die schlechtestmögliche Vorgehensweise. In den wenigsten Fällen kann eine Gruppe Rat und Lösungsvorschläge für das »externe« Problem eines Patienten anbieten. Erstens sind seine Angaben unweigerlich fehlerhaft. Zweitens hatte der Patient schon jede Menge Zeit, die verschiedenen möglichen Lösungen sowohl allein als auch mit Hilfe seines Einzeltherapeuten abzuwägen. In einem Zeitraum von nicht einmal einer Stunde und mit unzureichenden oder verdrehten Fakten kann die Gruppe einem einzelnen Patienten nur selten von Nutzen sein. Ein solcher Ansatz ist praktisch der Garant dafür, dass die Gruppe ihr Scheitern erlebt. Entmutigung ist die Folge, und das Vertrauen der einzelnen Mitglieder in die Gruppe schwindet.
In der kleinen Therapiegruppe Kritik an der Station zu üben oder administrative Probleme zu diskutieren führt ebenfalls zu nichts. Zum einen sind die Hauptverantwortlichen nicht anwesend – für diese Fragen gibt es fast immer andere Foren, wie etwa Gemeinschaftssitzungen der Station. Zum anderen, und das sollte man besonders bedenken, wird wertvolle Therapiezeit vergeudet. Die kleine Therapiegruppe in eine Nörgelstunde oder Geschäftsbesprechung umzufunktionieren hieße, dem Widerstand der Patienten nachzugeben und eine großartige Chance in der bleiernen Realität stecken bleiben zu lassen.
Die zweite grundsätzliche Möglichkeit, für die sich viele Gruppentherapeuten entscheiden, ist die Diskussion allgemeiner Themen in der Gruppe. Spricht zum Beispiel ein Patient über Suizid, Halluzinationen, Verlust, Misstrauen oder irgendein anderes zwischenmenschliches oder innerpsychisches Thema, kann der Therapeut die Mitglieder zu intensiverer Teilnahme animieren, indem er sie dazu drängt, ihre persönlichen Erfahrungen oder Sichtweisen zu diesem Thema einzubringen. Diese Vorgehensweise hat allerdings verschiedene Nachteile.
Themenbezogene Diskussionen sind oft oberflächlich und abgehoben, da die Mehrheit der Patienten wenig Motivation verspürt, ein Thema zu erörtern, das für sie persönlich nicht vordringlich ist. Die Zusammenkunft erhält den Charakter einer problembezogenen Diskussion statt einer sinnvollen, personenbezogenen Arbeitssitzung. Darüber hinaus verlassen Teilnehmer eine themenbezogene Sitzung oft mit dem Eindruck, dass sie zwar Zeuge einer interessanten Diskussion waren, aber keinen Deut besser mit ihren Problemen umgehen können.
Auf vielen Stationen verhindert schon die Gruppenbezeichnung einen wirkungsvollen interaktionellen Ansatz. Oft handelt es sich um Namen, die mit dem tatsächlichen Ziel der Gruppe nicht das Geringste zu tun haben. Eine Therapiegruppe trug zum Beispiel die Bezeichnung »Lebensentscheidungen«, eine andere »Leben in der Familie«, eine weitere »Entscheidungstraining«. Diese Namen waren schon seit Jahren in Gebrauch, sagten aber nichts mehr darüber aus, was in der Gruppe tatsächlich passierte. Ich habe zum Beispiel eine Sitzung der »Leben in der Familie«-Gruppe besucht, in der sieben der acht anwesenden Teilnehmer ledig waren oder allein lebten.
Immer wieder entpuppten sich gut ausgebildete Klinikmitarbeiter als schlechte Gruppenleiter, weil sie nicht wussten, wie sie die Aufmerksamkeit der Gruppe auf die gruppeninternen Prozesse lenken sollten. Betrachten wir folgendes Beispiel: Eine Gruppensitzung mit neun Patienten, geleitet von einer Schwester und einem bereits erfahrenen psychiatrischen Assistenzarzt, begann mit der Frage zweier neuer Teilnehmer nach der Vorgehensweise in der Gruppe. Die Leiter, die eine ausgesprochen nondirektive Haltung einnahmen, gaben die Frage an die Gruppe weiter. Gleich erklärte Morris, einer der Patienten, er könne für sich keinen Nutzen aus der Gruppe ziehen, denn sein Problem sei, dass er seine Arbeitsstelle verloren habe, völlig mittellos dastehe, in jeder Hinsicht kürzer treten müsse und nun festgestellt habe, dass seine Möglichkeiten erschöpft seien. Mehr als fünfundvierzig Minuten einer Sechzig-Minuten-Sitzung wurden darauf verschwendet, dass Morris vor zwei perplexen Therapeuten und acht anderen Patienten, von denen einige absolut desinteressiert und die anderen teilnahmslos wirkten, die gesamte Geschichte des Scheiterns seiner Firma ausbreitete. Die einzige Intervention der Therapeuten bestand darin, andere Anwesende mit finanziellen Problemen aufzufordern, ebenfalls vor der Gruppe darüber zu sprechen.
Völlig übersehen jedoch wurde der wichtigste Punkt dieser Gruppentherapiestunde, nämlich Morris’ Wirkung auf die anderen. Morris war wie eine Schallplatte mit Sprung – er hatte sich schon in vorhergegangenen Therapiegruppen und Gruppensitzungen der Station stundenlang über nichts anderes ausgelassen als über seine finanziellen Schwierigkeiten. Den anderen Patienten fiel er unheimlich auf die Nerven, sie gingen ihm in der Gruppe und auf der Station aus dem Weg. Die Isolation von Morris war das eigentliche, aber nie ausgesprochene Thema der Sitzung. Die Gruppe konnte wenig gegen seine finanzielle Misere ausrichten, hätte Morris aber viel darüber mitteilen können, wie er Menschen in die Flucht schlug und seine Isolation selbst verursachte. (Seine Frau hatte ihn verlassen, seine Kinder und Freunde mieden ihn, und zwar nicht, wie er glaubte, wegen seiner finanziellen Misserfolge, sondern wegen seiner obsessiven Beschäftigung mit Geld, seiner Ich-Bezogenheit und dem fehlenden Gespür für die Bedürfnisse anderer.)
Die Gruppenleiter waren bestens ausgebildete Einzeltherapeuten und hätten in einer Einzelsitzung unter keinen Umständen so viel wertvolle Therapiezeit für die ausschließliche Betrachtung eines einzigen Symptoms vergeudet. Doch in dieser Gruppensitzung taten sie genau das. Sie versäumten es, irgendeine der offenkundigen interaktionellen Möglichkeiten aufzugreifen: etwa die Gefühle zu erkunden, die Morris durch das fortwährende, alles beherrschende Wiederkäuen seiner Probleme auslöste, oder den Rückzug der anderen Teilnehmer oder die Wut und die Frustration, die sich in der Gruppe gegen die Therapeuten aufbauten, weil sie nicht wirkungsvoll einschritten. Immer und immer wieder habe ich wunderbar reife therapeutische Früchte an Bäumen verfaulen sehen, weil Therapeuten nicht fähig (oder willens) waren, Interaktion in Gang zu setzen.
Um noch ein Beispiel zu nennen: In den vielen Gruppensitzungen, denen ich auf Krankenhausstationen beiwohnte, habe ich selten erlebt, dass ein Therapeut die Gruppe auf ein außerordentlich wichtiges Vorkommnis aufmerksam gemacht hätte – meine Anwesenheit nämlich. Ohne jeden Zweifel hat die Tatsache, dass ein Fremder die Gruppensitzung verfolgte, bei allen Teilnehmern bestimmte Gefühlsregungen ausgelöst. Welche Vorstellungen hatten die Teilnehmer von meiner Funktion, von meiner Beziehung zum Therapeuten oder von der Verwertung meiner Beobachtungen? All diese Fragen wurden nicht angesprochen.
Auch viele andere wichtige Vorfälle innerhalb der Gruppe blieben unerwähnt. Teilnehmer waren gelangweilt oder erregt und verließen ohne Erklärung den Raum, standen mitten in der Sitzung auf und tauschten die Plätze, unterbrachen sich gegenseitig, schliefen ein, machten es dem Therapeuten absichtlich schwer, sprachen sich unangemessen feindselig oder zärtlich an. Solche Dinge zu übergehen lässt in der Gruppe ein Gefühl der Unwirklichkeit, Bedeutungslosigkeit und Sinnlosigkeit entstehen – insbesondere wenn man aus jedem dieser Vorfälle mit bestimmten Techniken, auf die ich später genauer eingehen werde, therapeutischen Nutzen ziehen könnte.
Viele Therapeuten wissen nicht, wie man Interaktion gezielt einsetzt, weil es ihnen an einer Ausbildung in traditionellen Gruppenmethoden mangelt. Die Fähigkeit, Interaktion zwischen den Teilnehmern anzuregen und ihnen zu zeigen, wie sie aus der Beobachtung ihres eigenen Verhaltens lernen können, ist eine therapeutische Fertigkeit, die eine entsprechende Ausbildung und Supervision erfordert. Das aber ist in den einschlägigen Lehrplänen nicht vorgesehen.
Und es gibt noch einen weiteren Grund: Viele Therapeuten haben Angst vor einem interaktionellen Ansatz. Eine Menge Kliniker – und wie es scheint vor allem die Verantwortlichen für das Therapieprogramm, die sich eher mit medizinisch-juristischen Themen befassen und um den Erhalt ihrer sämtlichen Behandlungskompetenzen besorgt sind (und daher auf das Ansehen ihrer Station in der psychiatrischen Gemeinschaft achten müssen) – assoziieren mit dem Hier-und-Jetzt-Ansatz Konfrontation, Konflikt, Encountergruppen, den »heißen Stuhl« oder Ähnliches. Ich halte das für eine Fehleinschätzung, und eines der Hauptanliegen dieses Buches ist es darzulegen, wie die Arbeit im Hier und Jetzt ein unterstützendes, ermutigendes und erleichterndes Gruppenklima bewirkt, das sich bei richtiger Feinabstimmung selbst für Psychiatriepatienten mit sehr schweren akuten Störungen eignet.
Welche Ursachen auch immer verantwortlich sein mögen – Therapeuten, die nicht mit dem interaktionellen Ansatz arbeiten, geraten ins Schwimmen, werden unsicher und haben nicht das Selbstvertrauen desjenigen, der über eine grundlegende, kohärente Theorie und ein Repertoire entsprechender Strategien und Techniken verfügt.
Alle diese Faktoren – die Unterbewertung der Gruppentherapie, das Fehlen regelmäßiger, täglicher Sitzungen, die Unsicherheit über die geeignete Zusammensetzung, die berufliche Konkurrenz um die Gruppenleitung und der mangelnde theoretische und praktische Hintergrund – greifen ineinander und begrenzen die Möglichkeiten der stationären Gruppentherapie erheblich. Es spricht für das ganz eigene Potential der Therapiegruppe, dass sie trotz solcher Schwierigkeiten immer noch Wirkung zeigt.
Die Effizienz der stationären Gruppenpsychotherapie
Fragen zur Effizienz
Obwohl die Gruppentherapie seit vierzig Jahren etabliert ist, stellen viele Oberärzte von Akutstationen die Effizienz einer stationären Gruppentherapie grundlegend in Frage und entscheiden sich dagegen, sie anzubieten. In den Vereinigten Staaten nehmen vermutlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt genauso viele Patienten an Gruppentherapien teil wie an Einzeltherapien. Es wird schwierig sein, eine klinische Institution zu finden – angefangen von der großen Bandbreite an Tageskliniken über Haftanstalten, Stationen für chronische Psychiatriepatienten, Schulen für Straffällige, Kliniken für Übergewichtige, Nichtraucherkurse und so weiter –, in der sich Gruppenmethoden nicht als wirkungsvoll erwiesen haben. Warum aber entflammt dann auf der akutpsychiatrischen Station eine Grundsatzdiskussion über die Effizienz von Gruppentherapie?
In manchen Abteilungen finden Gruppentherapieprogramme aufgrund der spezifischen klinischen Ausrichtung der Stationsleiter keine Unterstützung. Offizielle Lehrpläne der Assistenzarztausbildung oder an Schwesternschulen sehen nur selten die Unterweisung in Gruppenpsychotherapie vor, und eine Unterweisung in stationärer Gruppenpsychotherapie findet so gut wie nie statt. Sofern Oberarzt oder Pflegedienstleiter über keine Zusatzausbildung in Gruppentherapie verfügen, ist es unwahrscheinlich, dass sie Kenntnisse über gruppentherapeutische Methoden besitzen. Und es ist nicht zu erwarten, dass sie eine Therapieform, mit der sie persönlich nicht vertraut sind, besonders fördern.
Auf anderen Stationen geht es bei der Diskussion um die Effizienz von Gruppentherapie in Wirklichkeit um ein ganz anderes Thema – das Abstecken beruflicher Territorien. Traditionell ist die Gruppentherapie eine Domäne des Pflegepersonals. Aber was ist, wenn der Oberarzt oder der einweisende Psychiater der Meinung sind (was oft der Fall ist), dass Schwestern, Beschäftigungstherapeuten oder anderes nichtmedizinisches Personal für die psychotherapeutische Arbeit nicht ausreichend qualifiziert sind? In solchen Fällen wird die Gruppentherapie – per Anweisung von oben – als wirkungslos eingestuft, und dem Gruppentherapieprogramm wird die Unterstützung oder die Anerkennung entzogen.
Auch gewichtigere Faktoren fließen in die Debatte ein. Viele Klinikmitarbeiter fragen sich, ob die Gruppentherapie auf der heutigen akutpsychiatrischen Station eine realistische Behandlungsform darstellt. Sie verweisen in diesem Zusammenhang besonders auf zwei problematische Aspekte der Akutstation: den kurzen Klinikaufenthalt und das breite Spektrum der Psychopathologie (von der gemäßigten neurotischen Störung bis zur hochgradigen psychotischen Dekompensation). Wie, so fragt man sich, können Therapiegruppen unter solchen Bedingungen funktionieren? Schließlich hielt man regelmäßige Teilnahme und Ich-Stärke immer für die Grundvoraussetzungen zur Entstehung von Kohäsion und dem therapeutisch notwendigen Klima für eine effiziente Gruppenarbeit.
Diese Einwände sind nicht ganz unberechtigt. Ich werde kurz auf einige Beispiele eingehen, die zeigen, dass die »traditionelle« Gruppentherapie – das für andere Behandlungssituationen entwickelte Schema – in der stationären Arbeit tatsächlich wirkungslos sein kann. Auf der Station für akut erkrankte Psychiatriepatienten herrschen heutzutage völlig andere Zustände, die eine radikale Modifizierung der herkömmlichen gruppentherapeutischen Techniken erfordern. Die Aufgabe ist gewaltig, aber nicht unlösbar. Ziel dieses Buches ist es, einen therapeutischen Ansatz zu beschreiben, der den neuen Behandlungsbedingungen gerecht wird.
Sollen Stationsverantwortliche Zeit und Energie in ein Gruppentherapieprogramm investieren, müssen sie davon überzeugt werden, dass sich die Frage nach einer sinnvollen stationären Gruppentherapie positiv beantworten lässt. Und auch die Gruppentherapeuten selbst gilt es von der Wirksamkeit ihrer Methode zu überzeugen. An früherer Stelle habe ich bereits gesagt, dass das Ergebnis einer Therapie letztlich um so besser ist, je mehr der Patient von Anfang an auf ihre therapeutische Wirksamkeit vertraut. Dasselbe gilt für die Therapeuten: Glauben die Therapeuten zu Beginn der Therapie ganz fest daran, dass der therapeutische Prozess dem Patienten helfen wird, lässt sich viel eher ein positives Resultat erzielen. Umgekehrt gilt, dass Therapeuten, die große Zweifel an der Effizienz ihres therapeutischen Ansatzes hegen, mit ihrem Verhalten dem Erfolg tatsächlich entgegenwirken [D].
Will man auf einer Station ein effizientes Gruppentherapieprogramm aufbauen, muss man zuerst Überzeugungsarbeit leisten, also werde ich hier Beweise für den Nutzen stationärer Gruppentherapie vorlegen. Da ich ein Handbuch für Praktiker »an vorderster Front« schreiben will und nicht eine kritische Abhandlung über den Forschungsstand, werde ich in diesem Kapitel meine Erkenntnisse zur Wirksamkeit stationärer Gruppentherapie vorstellen, die Erläuterung und die Beurteilung der wissenschaftlichen Methodik dagegen in den Anhang verbannen.
Forschungsergebnisse
Wissenschaftler, die der Wirksamkeit stationärer Gruppentherapie nachgegangen sind, haben zwei unterschiedliche Methoden benutzt: Sie haben das Verhältnis von Ergebnis und Art des stationären Behandlungsprogramms untersucht, und sie haben Patienten die stationäre Gruppentherapie im Nachhinein bewerten lassen. Ich werde die Erkenntnisse beider Ansätze nacheinander erläutern.
Die Ergebnisse bezogen auf die stationäre Gruppenpsychotherapie
Wie würde man unter idealen Forschungsbedingungen ein Projekt anlegen, um die Effizienz von Gruppen verlässlich messen zu können? Man würde eine große Anzahl an Patienten untersuchen, die in eine Akutstation eingewiesen und willkürlich verschiedenen Therapiegruppen zugeteilt wurden, darunter einer Kontrollgruppe ohne jegliche Gruppentherapie. Alle anderen Bestandteile des Behandlungsprogramms eines jeden Patienten müssten identisch sein. Man würde die Ergebnisse systematisch und objektiv bewerten und den Zusammenhang zwischen Ergebnis und Art der Gruppentherapie messen.
Aber ein derartiges Projekt wurde niemals realisiert! Und es wird auch nie realisiert werden. Die Methodik wirft so gewaltige Probleme auf [E], dass es kaum exakte Forschung zur stationären Gruppentherapie auf der modernen Akutstation gibt. Und da die Krankenhauspsychiatrie drastischen Veränderungen unterzogen wurde, besitzt ein Großteil der älteren Forschungsarbeiten zur stationären Therapie aktuell keine Relevanz mehr. Folglich müssen wir uns auf Studien stützen, die alles andere als perfekt sind und entweder Fehler in der Methodik aufweisen oder unter zwar verwandten, aber doch anders gearteten Behandlungsbedingungen durchgeführt wurden.
Ein ganz besonders wichtiger Beitrag kam eher zufällig zustande. Mehrere Wissenschaftler [F] haben gemeinsam eine große Gruppe von Patienten untersucht, die willkürlich auf Stationen für wahlweise Kurzzeit- oder Langzeittherapie eingewiesen wurden. Ziel der Wissenschaftler war es, die Beziehung zwischen Behandlungsergebnis und Dauer des Klinikaufenthalts zu eruieren. Wie sich herausstellte, machten Kurzzeitpatienten im Vergleich zu Langzeitpatienten deutlich größere Fortschritte.
War, so fragten sich die Forscher, nur die Dauer des Krankenhausaufenthalts für die besseren Fortschritte der Patienten verantwortlich, oder spielten noch andere Faktoren eine Rolle? Zu ihrer eigenen Überraschung stellten sie fest, dass die unterschiedlichen Fortschritte bei Langzeit- und Kurzzeitpatienten fast ausschließlich darauf zurückzuführen waren, dass in Kurzzeitstationen deutlich mehr mit Gruppentherapie gearbeitet wurde. Patienten, die an einer Gruppentherapie teilgenommen hatten, machten unabhängig davon, ob sie in Kurzzeit- oder Langzeitstationen eingewiesen worden waren, erheblich größere Fortschritte (vor allem hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenzen) als Patienten, die keine Gruppentherapie bekommen hatten.
Dieselbe Forschergruppe führte drei Jahre später erneut eine Untersuchung mit ihren Patienten durch und machte eine weitere interessante Entdeckung: Die Patienten, die an einer stationären Gruppentherapie teilgenommen hatten, entschieden sich im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt auch bei der ambulanten Nachsorge eher für eine Gruppentherapie. Diese Erkenntnis ist ausgesprochen bedeutsam, da kurzzeitige stationäre Einweisung nur Wirkung zeigt, wenn nach dem Krankenhausaufenthalt die Behandlung fortgesetzt wird. Und wie umfangreiche Forschungsergebnisse beweisen [G], ist die Gruppentherapie eine besonders erfolgreiche Form der Anschlusstherapie.
Andere Studien belegen, dass die stationäre Gruppentherapie auf einer offenen Akutstation die Notwendigkeit von Einweisungen in geschlossene Anstalten erheblich reduzierte (obgleich die Gruppentherapie die Entlassungsquote insgesamt nicht beeinflusste) [H] und dass sie bei Patienten mit einer Erstdiagnose von Angstreaktion (jedoch nicht bei Alkoholikern oder chronisch schizophrenen Reaktionen) Rückfälle verminderte [I].
Da man kaum weitere Informationen [J] zur Frage nach der Effizienz der stationären Gruppentherapie erhält, stellt man besser die nicht so elementare und im klinischen Alltag wichtigere Frage, welche Art von stationärer Gruppentherapie sich für welche Art von Patienten eignet.
Eine gut angelegte Studie [K] verglich die Effizienz von vier verschiedenen Gruppentypen:
Eine »prozess- und personzentrierte Gruppe«: eine stützende Gruppe, in welcher der Leiter versuchte, die Interaktion zwischen den Patienten zu klären und zu deuten.