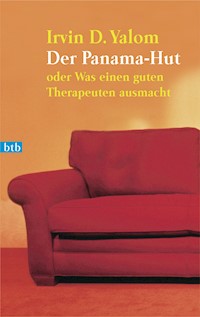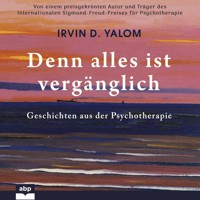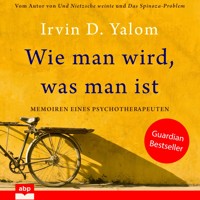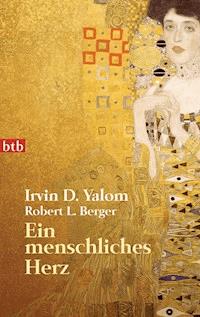
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über eine tiefe Freundschaft und das Ende eines langen Schweigens
Irvin D. Yalom erzählt in »Ein menschliches Herz« die Geschichte seines guten Freundes Bob Berger, der seit seiner Kindheit während des Holocaust in Ungarn, zwei Leben führte: eines tagsüber als engagierter und exzellenter Herzchirurg – und ein nächtliches, in dem Bruchstücke entsetzlicher Erinnerungen durch seine Träume geisterten. Jahrzehntelang verdrängte Berger durch unermüdlichen Arbeitseifer seine schrecklichen Erlebnisse, bis sie sich während einer nicht ungefährlichen medizinwissenschaftlichen Reise nach Venezuela wieder Bahn brachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Irvin D. Yalom erzählt in »Ein menschliches Herz« die Geschichte seines guten Freundes Bob Berger, der seit seiner Kindheit während des Holocaust in Ungarn zwei Leben führte: eines tagsüber als engagierter und exzellenter Herzchirurg – und ein nächtliches, in dem Bruchstücke entsetzlicher Erinnerungen durch seine Träume geisterten. Jahrzehntelang verdrängte Berger durch unermüdlichen Arbeitseifer seine schrecklichen Erlebnisse, bis sie sich während einer nicht ungefährlichen medizinwissenschaftlichen Reise nach Venezuela wieder Bahn brachen.
IRVIN D. YALOM wurde 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den USA und ist vielfach ausgezeichnet. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine Romane wurden international zu Bestsellern und zeigen, dass die Psychoanalyse Stoff für die schönsten und aufregendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur zu erzählen weiß.
ROBERT L. BERGER ist erfolgreicher Herzchirurg und seit vielen Jahren Professor an der Harvard Medical School. Er hat über 250 Fachartikel veröffentlicht und als erster Arzt weltweit ein künstliches Herz implantiert. Berger ist verheiratet und hat zwei Töchter.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalgeschichte, die auf dem Gespräch mit Robert L. Berger beruht, trägt den Titel »I’m calling the police«.
Genehmigte Taschenbuchausgabe August 2011,
btb Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2008 by Irvin D. Yalom und Robert L. Berger
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009
by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © des Irvin-D.-Yalom-Porträts am Ende des Buches: Annette Schäfer:
Das Porträt: Irvin D. Yalom – der Geschichtenerzähler. Psychologie Heute 2/2009.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion Psychologie Heute.
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © akg-images Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MK Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-11975-1
V004
www.btb-verlag.de
Ein menschliches Herz
Als das Abschiedsbankett zum fünfzigjährigen Approbationsjubiläum meines Studienjahrgangs allmählich zu Ende ging, gab mir Bob Berger, mein alter Freund, mein einzig verbliebener Freund aus den Zeiten meines Medizinstudiums, zu verstehen, dass er unbedingt mit mir reden wolle. Obwohl wir unterschiedliche berufliche Wege eingeschlagen hatten, er zur Herzchirurgie und ich zur Gesprächstherapie für gebrochene Herzen, hatten wir eine enge Beziehung aufgebaut, die, wie wir beide wussten, ein Leben lang halten würde. Als Bob mich nun am Arm nahm und zur Seite zog, wusste ich, dass etwas im Argen lag. Bob berührte mich so gut wie nie. Uns Seelenärzten fällt so etwas auf. Er beugte sich zu mir und krächzte mir ins Ohr: »Etwas Schwerwiegendes passiert gerade ... die Vergangenheit kocht hoch ... meine beiden Leben, Nacht und Tag, fließen ineinander. Ich muss mit dir reden.«
Ich verstand. Seit seiner Kindheit, die er während des Holocaust in Ungarn verbracht hatte, führte Bob zwei Leben: eines tagsüber als umgänglicher, engagierter und unermüdlicher Herzchirurg und ein nächtliches, in dem Bruchstücke entsetzlicher Erinnerungen durch seine Träume geisterten. Ich wusste alles über sein Leben, das er tagsüber führte, aber in unserer fünfzig Jahre dauernden Freundschaft hatte er nie etwas von seinem nächtlichen Leben preisgegeben. Auch hatte er mich niemals ausdrücklich um Hilfe gebeten: Bob war selbstgenügsam, mysteriös, geheimnisvoll. Das hier war ein anderer Bob, der mir ins Ohr flüsterte. Ich nickte, ermutigte ihn. Ich war besorgt. Und ich war neugierig.
Dass wir während unseres Medizinstudiums Freunde geworden waren, war nicht selbstverständlich gewesen. Berger war ein »B« und Yalom ein »Y«, und schon allein das stand einem näheren Kennenlernen entgegen. Normalerweise suchen sich Medizinstudenten ihre Freunde im Bereich ihrer eigenen Anfangsbuchstaben heraus: Leichensektionen, Laborpartner und Klinikdienste werden nach dem Alphabet vergeben, und so hing ich die meiste Zeit mit der Gruppe S bis Z herum – Schelling, Siderius, Werner, Wong und Zuckerman.
Vielleicht lag es an Bobs ungewöhnlicher Erscheinung. Von Anfang an faszinierten mich seine lebhaften, blauen Augen. Noch nie hatte ich einen so tragischen, entrückten Blick gesehen, einen Blick, der faszinierte, der mit meinem Blick spielte, mich aber niemals direkt traf. Sein Gesicht war ungewöhnlich, geradezu kubistisch, hatte scharfe Kanten, wo man hinsah: spitze Nase, spitzes Kinn und sogar spitze Ohren. Seine von Rasurnarben gezeichnete Haut war fahl. Keine Sonne, dachte ich. Keine Karotten. Kein Sport.
Seine Kleidung war verknittert und von einem undefinierbaren Graubraun (noch nie habe ich ihn mit etwas Farbigem gesehen). Und trotzdem fühlte ich mich von ihm angezogen. In späteren Jahren sollte ich Frauen sagen hören, dass er unwiderstehlich unattraktiv sei. Unwiderstehlich ist möglicherweise ein wenig stark, vielleicht trifft verführerisch es besser. Ja, ich war von ihm fasziniert: In meiner provinziellen Highschool in Washington D. C. und an der Universität hatte ich nie jemanden kennengelernt, der Bob auch nur im Entferntesten ähnlich gewesen wäre.
Unser erstes Zusammentreffen? Daran erinnere ich mich gut. Ich saß in der Bibliothek der medizinischen Fakultät, in der er ganze Abende mit Recherchearbeiten für Professor Robbins’ Lehrbuch der Pathologie zubrachte (ein Text, der eine leuchtende Zukunft vor sich hatte, ein Text, der Generationen von Medizinern in der ganzen Welt als Lehrmaterial diente und noch immer dient). Eines Abends kam er in der Bibliothek zu mir herüber und eröffnete mir, dass ich für das Neurologie-Examen am folgenden Tag nun genug studiert hätte.
»Hast du Lust, Geld zu verdienen?«, fragte er. »Robbins hat mir viel zu viel Arbeit aufgehalst, und ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen.«
Auf das Angebot sprang ich sofort an. Abgesehen von einem kleinen Taschengeld, das ich mir mit Blut- und Spermaspenden verdiente – bei Medizinstudenten die klassische Quelle für schnelles Geld –, lebte ich ausschließlich von den Einkünften, die der Lebensmittelladen meiner Eltern abwarf.
»Warum ausgerechnet ich?«, fragte ich.
»Ich habe dich beobachtet.«
»Und?«
»Und du könntest Potenzial haben.«
Bald verbrachten wir drei oder vier Abende die Woche Seite an Seite in der Bibliothek der medizinischen Fakultät der Universität von Boston und arbeiteten für Dr. Robbins, oder wir hingen in meinem Apartment herum, plauderten oder lernten. Meistens war ich es, der lernte – Bob hatte es anscheinend nicht nötig. Abgesehen davon beschäftigte er sich leidenschaftlich mit Solitaire, das er stundenlang spielte, manchmal, wie er behauptete, für die New-England-Meisterschaften, manchmal für die Weltmeisterschaften.
Bald erfuhr ich, dass er ein Flüchtling war, der den Holocaust überlebt und sich im Alter von siebzehn Jahren als Heimatloser mutterseelenallein nach Boston durchgeschlagen hatte.
Ich dachte an mich selbst mit siebzehn Jahren – umgeben von Freunden, gehätschelt von der Familie, beschäftigt mit breiten Krawatten, unbeholfenen Tanzversuchen und Studentenverbindungskram. Ich kam mir naiv, schlapp und schwach vor. »Wie hast du das geschafft, Bob? Wer hat dir geholfen? Konntest du denn überhaupt Englisch?«
»Kein Wort. Mit einem Schulabschluss, der ungefähr eurem Eight-Grade entspricht, fing ich an der Boston Latin Highschool an. Ein Jahr später habe ich mich in Harvard immatrikuliert, und seither studiere ich Medizin.«
»Wie hast du das hingekriegt? Ich wäre bestimmt nie nach Harvard gekommen, wenn ich mich dort beworben hätte. Und wo hast du gewohnt? Mit wem? Hattest du Sponsoren? Verwandte?«
»So viele Fragen. Ich hab’s allein geschafft – das ist die Antwort.«
Auf unserer Approbationsfeier, das weiß ich noch, standen meine Mutter, mein Vater und meine Frau mit unserem Baby im Kreis um mich herum; und dort, ganz hinten, stand Bob, im Abseits, wippte kaum merklich auf den Absätzen und drückte sein Diplom an sich. Nach der Approbation machte er zunächst eine Weiterbildung in der Inneren Medizin, wechselte dann zur Allgemeinchirurgie und schließlich zur Thorax- und Herzchirurgie. Einen Tag nach Beendigung seiner Facharztausbildung wurde ihm der Posten des Leiters der Herzchirurgie am Lehrkrankenhaus in Boston angeboten, und fünf Jahre später war er Professor für Chirurgie und Vorsitzender der Thorax- und Herzchirurgie an der Boston University. Eine Veröffentlichung jagte die andere, er unterrichtete und operierte unermüdlich. Er war der erste Arzt weltweit, der ein teilweise künstliches Herz mit positivem Langzeitverlauf implantierte. Und das alles ganz allein auf sich gestellt – er hatte alle im Holocaust verloren.
Aber er redete nie von seiner Vergangenheit. Ich brannte vor Neugierde, denn ich hatte bis dahin noch nie jemanden getroffen, der die Schrecken der Lager überlebt hatte, aber er würgte meine Fragen mit dem Vorwurf ab, dass ich ein Voyeur sei.
»Wer weiß«, ärgerte er mich, »wenn du dich anständig benimmst, erzähle ich dir irgendwann vielleicht mehr.«
Ich benahm mich anständig, aber dennoch gingen Jahre ins Land, bis er bereit war, Fragen zum Krieg zu beantworten. Als wir die sechzig überschritten hatten, stellte ich einen Wandel fest. Zunächst kam es mir so vor, als wäre er offener geworden und willens zu sprechen, und dann, mit zunehmendem Alter, war er fast schon versessen darauf, mir von den damaligen Schrecknissen zu berichten.
Aber war ich bereit zuzuhören? War ich jemals bereit gewesen zuzuhören? Erst nachdem ich meine psychiatrische Ausbildung begonnen, meine eigene Analyse gemacht und ein paar Feinheiten der zwischenmenschlichen Kommunikation verstanden hatte, begriff ich etwas Entscheidendes über meine Beziehung zu Bob. Es war nicht nur so, dass Bob über seine Vergangenheit schwieg: Es war auch so, dass ich nichts davon hatte wissen wollen. Was sein langes Schweigen betraf, hatten wir beide unseren Teil dazu beigetragen.
Ich weiß noch, wie ich als Teenager erstarrt, entsetzt und krank vor Ekel war, als ich die Nachkriegs-Wochenschauen verfolgte, welche die Befreiung der Konzentrationslager dokumentierten. Ich wollte hinschauen, ich hatte das Gefühl, ich sollte hinschauen. Dies waren meine Leute – ich musste hinschauen. Aber immer, wenn ich hinschaute, war ich bis ins Mark erschüttert, und bis zum heutigen Tag bin ich unfähig, mit diesen grausamen Bildern umzugehen – dem Stacheldraht, den rauchenden Öfen, den paar überlebenden Skelettgestalten in gestreiften Lumpen. Ich hatte Glück: Ich hätte eines dieser Skelette sein können, wären meine Eltern nicht emigriert, bevor die Nazis an die Macht gekommen waren. Und am Grausamsten von allem waren die Bilder der Bagger, die riesige Leichenberge bewegten. Einige dieser Leichen stammten aus meiner Familie: Die Schwester meines Vaters wurde in Polen ermordet und die Frau meines Onkels Abe und drei Kinder ebenso. Er war 1937 in die USA gekommen und wollte seine Familie nachholen, doch die Zeit war ihm davongelaufen.
Die Bilder wühlten so viel Entsetzliches auf und erzeugten so schreckliche Phantasien, dass ich sie kaum ertragen konnte. Wenn sie mitten in der Nacht in meine Gedanken drangen, war es mit dem Schlafen vorbei. Und sie waren unauslöschlich: Sie verblassten nie. Lange bevor ich Bob kennenlernte, hatte ich mich schon entschlossen, diesem Portfolio in meinem Gedächtnis keine weiteren Bilder dieser Art hinzuzufügen, und ich begann, mich Filmen und schriftlichen Abhandlungen über den Holocaust zu verweigern. Von Zeit zu Zeit versuchte ich, mich der Vergangenheit mit größerer Reife zu stellen, was mir aber nicht gelang. Ich zwang mich dazu, ins Kino zu gehen, mir Filme wie »Schindlers Liste« und »Sophies Entscheidung« anzusehen, hielt es aber nie länger als eine halbe, höchstens eine dreiviertel Stunde aus, und jedes Mal, wenn ich das Kino verließ, gelobte ich mir aufs Neue, mir solche Qualen in Zukunft zu ersparen.
Die paar Vorfälle, von denen Bob mir erzählte, waren erschreckend. Eingebrannt in mein Gedächtnis ist eine Geschichte über seinen Freund Miklos, die er mir vor zwanzig Jahren offenbarte. Als Bob damals, im Alter von vierzehn Jahren, in Budapest lebte, wo er sich als Christ ausgab und für den Widerstand arbeitete, war ihm einmal zufällig Miklos über den Weg gelaufen. Er hatte ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Bob war entsetzt vom Aussehen seines Freundes: Er sah abgezehrt aus und war so zerlumpt, als sei er gerade aus einem Ghetto geflohen oder von einem Zug nach Auschwitz abgesprungen. Bob machte Miklos klar, dass er den Nazis so bestimmt schnell in die Hände fallen würde, und beschwor ihn, mit ihm zu kommen, einstweilen bei ihm zu wohnen, sich andere Sachen anzuziehen und sich gefälschte christliche Ausweispapiere zu besorgen. Miklos nickte, sagte aber, dass er zuerst noch etwas erledigen müsse, in zwei Stunden aber wieder an dieselbe Stelle zurückkehren wolle. Bob warnte ihn erneut vor der Gefahr und flehte ihn an, sofort mitzukommen, aber Miklos beharrte darauf, dass er sich mit jemandem wegen einer dringenden Angelegenheit treffen müsse.
Kurz vor der vereinbarten Verabredung gab es jedoch Fliegeralarm, und die Straßen waren wie leergefegt. Eineinhalb Stunden später, sofort nachdem die Sirenen Entwarnung gegeben hatten, rannte Bob zum Treffpunkt, aber Miklos tauchte nicht mehr auf.