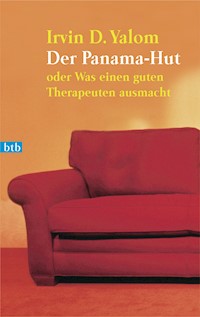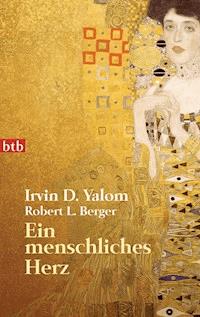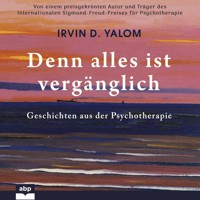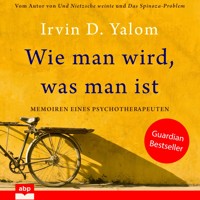10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sehr persönliche Erinnerungen, geschrieben mit der Offenheit, die ihn als Psychotherapeuten so besonders und letztlich weltberühmt machten.
Irvin D. Yalom widmete sein Leben dem seelischen Leid anderer, in diesem Buch erzählt er von sich und den Umbrüchen, die ihn und seine Arbeit geprägt haben. Er berichtet von der Kindheit in prekären sozialen Verhältnissen, dem Minderwertigkeitsgefühl in jungen Jahren, der frühen Eigenwilligkeit, aber auch von den Kämpfen der verschiedenen psychotherapeutischen Schulen in den 1960er Jahren, den Anfängen der Studentenrevolte, der Menschenrechts- und Frauenbewegung, Drogen und Esoterik, und auch Berühmtheiten wie Viktor Frankl oder Rollo May kommen zu Wort.
Entstanden ist so das Porträt eines Mannes, der sein Leben in Gänze ausgekostet und gleichzeitig mit extremen Sinn gefüllt hat – von ausgelassenen Flitterwochen auf dem Motorrad durch Frankreich bis zur therapeutischen Arbeit mit Krebspatienten und dem Reflektieren über den eigenen Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Sehr persönliche Erinnerungen, geschrieben mit der Offenheit, die ihn als Psychotherapeuten so besonders und letztlich weltberühmt machten. Irvin D. Yalom widmete sein Leben dem seelischen Leid anderer, in diesem Buch erzählt er von sich und den Umbrüchen, die ihn und seine Arbeit geprägt haben. Er berichtet von der Kindheit in prekären sozialen Verhältnissen, dem Minderwertigkeitsgefühl in jungen Jahren, der frühen Eigenwilligkeit, aber auch von den Kämpfen der verschiedenen psychotherapeutischen Schulen in den 1960er Jahren, den Anfängen der Studentenrevolte, der Menschenrechts- und Frauenbewegung, Drogen und Esoterik, und auch Berühmtheiten wie Viktor Frankl oder Rollo May kommen zu Wort. Entstanden ist so das Portrait eines Mannes, der sein Leben in Gänze ausgekostet und gleichzeitig mit extremen Sinn gefüllt hat – von ausgelassenen Flitterwochen auf dem Motorrad durch Frankreich bis zur therapeutischen Arbeit mit Krebspatienten und dem Reflektieren über den eigenen Tod.
Zum Autor
IRVIN D. YALOM wurde 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington, D.C. geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten Psychoanalytiker in den USA und ist vielfach ausgezeichnet. Seine Fachbücher gelten als Klassiker. Seine Romane wurden international zu Bestsellern und zeigen, dass die Psychoanalyse Stoff für die schönsten und aufregendsten Geschichten bietet, wenn man sie nur zu erzählen weiß.
Irvin D. Yalom
Wie man wird, was man ist
Memoiren eines Psychotherapeuten
Aus dem Amerikanischenvon Barbara v. Bechtolsheim
Zum Gedenken an meine Eltern Ruth und Benjamin Yalom sowie an meine Schwester Jean Rose.
INHALT
1 DIE GEBURT DER EMPATHIE
2 AUF DER SUCHE NACH EINEM MENTOR
3 ICH WILL SIE LOS SEIN
4 RÜCKBESINNUNG
5 DIE BIBLIOTHEK, A–Z
6 RELIGIÖSER KRIEG
7 DER SPIELER
8 EINE KURZE GESCHICHTE DER WUT
9 DER ROTE TISCH
10 BEKANNTSCHAFT MIT MARILYN
11 COLLEGEZEIT
12 HEIRAT MIT MARILYN
13 MEINE ERSTE PSYCHIATRISCHE PATIENTIN
14 PRAKTIKUM: DER MYSTERIÖSE DR. BLACKWOOD
15 DIE JAHRE AN DER JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
16 INS PARADIES VERSETZT
17 ANKOMMEN
18 EIN JAHR IN LONDON
19 DAS KURZE, TURBULENTE LEBEN DER ENCOUNTERGRUPPEN
20 AUFENTHALT IN WIEN
21 JEDEN TAG EIN BISSCHEN NÄHER
22 OXFORD UND DIE VERZAUBERTEN MÜNZEN DES HERRN SFICA
23 EXISTENTIELLE THERAPIE
24 MIT ROLLO MAY DEM TOD GEGENÜBER
25 TOD, FREIHEIT, ISOLATION UND SINN
26 STATIONÄRE GRUPPEN UND PARIS
27 REISE NACH INDIEN
28 JAPAN, CHINA, BALI UND DIE LIEBE UND IHR HENKER
29 UND NIETZSCHE WEINTE
30 DIE ROTE COUCH
31 DIE REISE MIT PAULA
32 WIE MAN GRIECHE WIRD
33 DER PANAMA-HUT
34 ZWEI JAHRE MIT SCHOPENHAUER
35 IN DIE SONNE SCHAUEN
36 SPÄTWERKE
37 SMS-THERAPIE
38 MEIN LEBEN IN GRUPPEN
39 ÜBER IDEALISIERUNG
40 NOVIZE IM ALTERN
DANK
1 DIE GEBURT DER EMPATHIE
Ich wache um drei Uhr morgens aus einem Traum auf, in mein Kissen weinend. Ganz leise, um Marilyn nicht zu stören, verlasse ich das Bett und gehe ins Badezimmer, trockne mir die Augen und befolge den Rat, den ich meinen Patienten seit fünfzig Jahren gebe: Schließen Sie die Augen, gehen Sie den Traum noch einmal in Gedanken durch und schreiben Sie auf, was Sie in Erinnerung haben.
Ich bin etwa zehn, vielleicht elf. Ich fahre mit dem Fahrrad einen Hügel hinunter, ganz in der Nähe unseres Hauses. Ich sehe ein Mädchen namens Alice vor ihrem Haus sitzen. Sie scheint etwas älter zu sein als ich, und sie ist hübsch, obwohl ihr Gesicht mit roten Flecken übersät ist. Im Vorbeiradeln rufe ich ihr zu: »Hallo, Masern.«
Plötzlich steht ein ziemlich großer und kräftiger Mann vor meinem Fahrrad und stoppt mich, indem er meinen Lenker packt. Ich weiß, dass es der Vater von Alice ist.
Er schreit mich an: »He, du, wie immer du auch heißt. Denk doch mal eine Minute nach – wenn du überhaupt denken kannst – und beantworte mir eine Frage. Überleg mal, was du gerade zu meiner Tochter gesagt hast, und sag mir nur eins: Wie fühlt sich jetzt wohl Alice?«
Ich bin so erschrocken, dass ich nicht antworten kann.
»Na los, antworte mir. Du bist der Junge von Bloomingdale (das Lebensmittelgeschäft meines Vaters hieß Bloomingdale Market, und viele Kunden dachten, wir hießen Bloomingdale), und ich wette, du bist ein schlauer Jude. Also los, rate mal, wie Alice sich fühlt, wenn du das zu ihr sagst.«
Ich zittere. Mir fehlen vor Angst die Worte.
»Ist ja schon gut. Beruhig dich. Ich mach es mal einfach. Sag mir bloß, ob Alice sich nun, nachdem du ihr das gesagt hast, gut oder schlecht fühlt.«
Ich kann gerade noch murmeln: »Weiß ich nicht.«
»Kannst wohl nicht klar denken, was? Gut, ich werd dir schon auf die Sprünge helfen. Angenommen, ich würde dich anschauen und mir irgendein unschönes Merkmal von dir ausgucken und immer, wenn ich dich sehe, etwas dazu sagen?« Er mustert mich sehr genau. »Vielleicht ein kleiner Rotz an der Nase? Wie wär’s mit ›Rotzi‹? Dein linkes Ohr ist größer als das rechte. Angenommen ich sage, immer wenn ich dich sehe, ›He, Dumpfbacke?‹ Oder wie wär’s mit ›Judenbengel?‹ Na, wie wär das? Wie würde dir das gefallen?«
Ich realisiere im Traum, dass ich nicht zum ersten Mal an diesem Haus vorbeifahre, dass ich schon tagelang hier mit dem Rad vorbeikomme und Alice jedes Mal dasselbe zugerufen habe, um ins Gespräch zu kommen, um sie kennenzulernen. Und jedes Mal, wenn ich »Hallo, Masern« gerufen habe, habe ich sie beleidigt, habe ich sie gekränkt. Ich bin entsetzt, wie sehr ich sie dauernd verletzt habe, und darüber, dass mir das überhaupt nicht bewusst war.
Als ihr Vater mit mir fertig ist, kommt Alice die Veranda herunter und sagt mit sanfter Stimme: »Möchtest du reinkommen und mit mir spielen?« Sie schaut ihren Vater an. Er nickt.
»Ich fühle mich so schrecklich«, antworte ich. »Ich schäme mich so, ich schäme mich so. Ich kann nicht. Nein, ich kann nicht.«
Seit frühester Jugend lese ich mich immer in den Schlaf, und in den letzten beiden Wochen habe ich ein Buch von Steven Pinker mit dem Titel Our Better Angels gelesen. Gestern Abend, vor dem Traum, habe ich ein Kapitel über die Entstehung der Empathie zur Zeit der Aufklärung gelesen und wie das Aufkommen des Romans, insbesondere des britischen Briefromans à la Clarissa und Pamela, dazu beigetragen haben könnte, dass Gewalt und Grausamkeit abnahmen, weil man mit Hilfe dieser Bücher die Welt aus der Sicht eines anderen wahrzunehmen lernte. Um Mitternacht hatte ich das Licht gelöscht, und ein paar Stunden später wurde ich von meinem Alptraum über Alice geweckt.
Nachdem ich mich beruhigt habe, gehe ich wieder zu Bett, aber ich liege noch lange wach und sinne darüber nach, wie merkwürdig es ist, dass dieser frühe Abszess, diese verkapselte Schuld jetzt nach dreiundsiebzig Jahren so unvermittelt aufgebrochen ist. In der Tat, so erinnere ich mich jetzt, bin ich als zwölfjähriger Junge am Elternhaus von Alice vorbeigeradelt und habe in dem brutalen, furchtbar unsensiblen Bemühen, sie auf mich aufmerksam zu machen, »Hallo, Masern« gerufen. Ihr Vater hatte sich nie mit mir auseinandergesetzt, aber wie ich so mit fünfundachtzig hier im Bett liege und mich von diesem Alptraum erhole, kann ich mir vorstellen, wie sie sich gefühlt haben muss und welchen Schaden ich da angerichtet habe. Verzeih mir, Alice.
2 AUF DER SUCHE NACH EINEM MENTOR
Michael, ein fünfundsechzigjähriger Physiker, ist mein letzter Patient an diesem Tag. Er war vor zwanzig Jahren schon einmal bei mir in Therapie, etwa zwei Jahre lang, und ich hatte bis vor ein paar Tagen, als er mir eine E-Mail schickte, nichts mehr von ihm gehört. »Ich muss Sie unbedingt sprechen – der angehängte Artikel hat vieles aufgewühlt, Gutes und Schlechtes.« So schrieb er mir. Der Link führte zu einem Artikel in der New York Times, der beschrieb, wie ihm kürzlich ein bedeutender internationaler Wissenschaftspreis verliehen worden war.
Während er in meinem Praxiszimmer Platz nimmt, eröffne ich das Gespräch.
»Michael, ich habe Ihre E-Mail erhalten, in der Sie sagen, dass Sie Hilfe brauchen. Es tut mir leid, dass es Ihnen nicht gut geht, aber ich möchte auch sagen, dass ich mich freue, Sie zu sehen und von Ihrem Preis zu erfahren. Ich habe mich oft gefragt, wie es Ihnen wohl geht.«
»Danke, dass Sie das sagen.« Michael schaut sich im Sprechzimmer um – er ist drahtig, aufmerksam, fast kahlköpfig, etwa ein Meter achtzig groß, und seine leuchtend braunen Augen strahlen Kompetenz und Selbstvertrauen aus. »Sie haben die Praxis umgeräumt? Diese Stühle standen früher da drüben? Stimmt’s?«
»Jawohl, ich räume alle fünfundzwanzig Jahre um.«
Er lacht. »Sie haben also den Artikel gelesen?«
Ich nicke.
»Vermutlich können Sie sich vorstellen, wie es mir damit ging: ein ziemlich kurzer Anflug von Stolz und danach beständige Wellen von Selbstzweifeln. Es ist immer noch dasselbe – tief im Innern bin ich hohl.«
»Dann lassen Sie uns gleich mal loslegen.«
Den Rest der Therapiesitzung verbrachten wir damit, die damaligen Themen nochmals durchzugehen: seine ungebildeten Eltern, die irische Immigranten waren, sein Leben in den New Yorker Wohnblocks, seine schlechte Grundschulbildung, der Mangel an einem maßgeblichen Mentor. Er ging ausführlich darauf ein, wie sehr er Menschen beneidete, die von einem erfahrenen Menschen an die Hand genommen und gefördert wurden, während er sich ohne Ende anstrengen und die besten Noten vorweisen musste, um überhaupt bemerkt zu werden. Er musste sich selbst erschaffen.
»Ja«, sage ich, »sich aus eigenen Kräften zu erschaffen, ist ein guter Grund, stolz zu sein, aber es gibt einem auch das Gefühl, keine Basis zu haben. Ich kenne viele Kinder von Immigranten, die sich vorkommen wie Lilien, die in einem Sumpf wachsen – wunderschöne Blumen, aber ohne feste Wurzeln.«
Er kann sich noch entsinnen, wie ich dies schon vor Jahren zu ihm gesagt habe, und meint, er sei froh, daran erinnert zu werden. Wir vereinbaren, dass wir uns für einige Sitzungen treffen wollen, und er erklärt, dass es ihm schon besser geht.
Ich hatte mit Michael immer gut arbeiten können. Wir hatten gleich von der ersten Therapiestunde an einen guten Kontakt zueinander, und er hatte gelegentlich bemerkt, ich sei der einzige Mensch, der ihn wirklich verstehen könne. Im ersten Jahr seiner Therapie sprach er oft von seinem diffusen Identitätsgefühl. War er wirklich der glänzende Schüler, der alle anderen überflügelte? Oder war er der Außenseiter, der sich die Freizeit im Pool-Zimmer oder mit Würfeln vertrieb?
Als er wieder einmal über sein diffuses Identitätsgefühl klagte, erzählte ich ihm eine Geschichte von meiner Abschlussfeier an der Roosevelt High School in Washington, D.C. Einerseits hatte man mir mitgeteilt, dass ich bei der Abschlussfeier mit dem Roosevelt High School Citizenship Award ausgezeichnet werden sollte. Andererseits hatte ich im letzten Schuljahr ein kleines Wettbüro für Baseballwetten laufen: Ich bot die Quote 10:1, dass je drei ausgewählte Spieler an einem Tag keine sechs Hits erzielen. Die Chancen standen zu meinen Gunsten. Ich war bekannt dafür, immer gut dazustehen, und hatte immer genug Geld, um Gardenien-Ansteckblumen für meine feste Freundin Marilyn Koenick zu kaufen. Doch ein paar Tage vor der Feier verlor ich mein Wettbuch. Wo war es nur hingekommen? Ich war verzweifelt und suchte fieberhaft danach bis kurz vor der Abschlussfeier. Sogar als ich hörte, wie mein Name aufgerufen wurde und schon die Bühne betrat, zitterte ich vor Angst: Würde ich die Auszeichnung als bester Schüler der Roosevelt High des Schuljahrgangs 1949 erhalten oder würde ich wegen Wetten der Schule verwiesen werden?
Als ich Michael diese Geschichte erzählte, lachte er schallend und murmelte: »Ein Therapeut nach meinem Geschmack.«
* * *
Nachdem ich mir zu unserer Stunde Notizen gemacht habe, ziehe ich mich um, Freizeitkleidung und Tennisschuhe, und hole mein Fahrrad aus der Garage. Mit vierundachtzig kann ich längst nicht mehr Tennis spielen und joggen, aber ich drehe fast jeden Tag auf einem Radweg in der Nähe unseres Hauses eine Runde. Ich radele zuerst durch einen Park voller Kinderwagen und Frisbees und Kinder, die auf hypermodernen Geräten herumklettern, überquere dann eine einfache Holzbrücke über den Matadero-Creek und fahre einen kleinen Hügel hinauf, der Jahr für Jahr steiler wird. Oben auf der Kuppe entspanne ich mich und beginne die lange Fahrt den Hang hinab. Ich liebe es, dahinzurollen, wenn ein warmer Luftzug mir übers Gesicht streicht. Nur in solchen Momenten beginne ich meine buddhistischen Freunde zu verstehen, die davon sprechen, den Geist zu leeren und sich dem Gefühl des einfachen Daseins hinzugeben. Aber die Ruhe ist immer von kurzer Dauer, und heute spüre ich, wie sich allmählich irgendwo im Kopf ein Tagtraum vorbereitet, auf die Bühne zu treten. In diesem Tagtraum geht es darum, dass ich mir meine Leistungen nur eingebildet habe, vielleicht Hunderte von Malen in meinem langen Leben. Der Traum schlummerte schon seit Wochen in mir, aber Michaels Klage darüber, dass er nie einen Mentor hatte, erweckt ihn nun zum Leben.
Ein Mann mit einer Aktentasche, mit Seersucker-Anzug, Strohhut, weißem Hemd und Krawatte, betritt den kleinen, schäbigen Lebensmittelladen meines Vaters. Ich bin nicht dabei: Ich schaue von oben zu, als würde ich an der Decke schweben. Ich erkenne den Besucher nicht, aber ich weiß, dass er einflussreich ist. Vielleicht ist er der Direktor meiner Grundschule. Es ist ein heißer, schwüler Junitag in Washington, D.C., und er zieht sein Taschentuch heraus, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, ehe er sich meinem Vater zuwendet. »Ich habe etwas Wichtiges wegen Ihres Sohnes Irvin mit Ihnen zu besprechen.« Mein Vater ist konsterniert und erschrocken; so etwas ist ihm noch nie passiert. Mein Vater und meine Mutter, die sich nie an die amerikanische Kultur assimiliert haben, fühlten sich nur im Umgang mit ihresgleichen wohl, mit anderen Juden, die mit ihnen aus Russland emigriert waren.
Obwohl andere Kunden im Laden seine Aufmerksamkeit fordern, weiß mein Vater, dass er diesen Mann nicht warten lassen darf. Er ruft meine Mutter an – wir wohnen in einer kleinen Wohnung über dem Geschäft –, und außer Hörweite sagt er ihr auf Jiddisch, sie möge schnell herunterkommen. Ein paar Minuten später erscheint sie und kümmert sich rasch um die Kunden, während mein Vater den Fremden in einen kleinen Lagerraum im hinteren Teil des Ladens führt. Sie nehmen auf Kisten mit leeren Bierflaschen Platz und unterhalten sich. Zum Glück tauchen keine Ratten oder Kakerlaken auf. Meinem Vater ist die Situation offensichtlich unangenehm. Ihm wäre es wesentlich lieber gewesen, wenn meine Mutter das Gespräch übernommen hätte, aber es wäre nicht schicklich, öffentlich zuzugestehen, dass sie und nicht er die Geschäfte in der Hand hat und alle wichtigen Familienentscheidungen trifft.
Der Mann in dem Anzug berichtet meinem Vater erstaunliche Dinge. »Die Lehrer in meiner Schule sagen, dass Ihr Sohn Irvin ein exzellenter Schüler ist und das Zeug hat, einen außergewöhnlichen Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten. Aber das wird nur dann geschehen, wenn ihm eine gute Bildung zuteil wird.« Mein Vater wirkt wie erstarrt, seine schönen Augen mit dem eindringlichen Blick sind auf den Fremden fixiert, der fortfährt: »Heutzutage ist das Schulsystem in Washington, D.C. gut aufgestellt und für den durchschnittlichen Schüler zufriedenstellend, aber es ist nicht für Ihren Sohn geeignet, nicht für einen sehr begabten Schüler.« Er öffnet seine Aktentasche und überreicht meinem Vater eine Liste von mehreren Privatschulen in D.C. und fährt fort: »Ich rate Ihnen dringend, ihn für seine weitere Schulzeit auf eine von diesen Schulen zu schicken.« Er holt aus seiner Brieftasche eine Visitenkarte und überreicht sie meinem Vater. »Wenn Sie mit mir Verbindung aufnehmen, werde ich mich dafür einsetzen, dass er ein Stipendium bekommt.«
Als er die Verwirrung meines Vaters sieht, erklärt er: »Ich werde versuchen, dass er Unterstützung für das Schulgeld bekommt – diese Schulen sind nicht kostenfrei wie die öffentlichen Schulen. Bitte, Ihrem Sohn zuliebe sollten Sie dem höchste Priorität einräumen.«
Schnitt! Der Tagtraum endet immer an dieser Stelle. Meine Phantasie scheut davor zurück, die Szene zu beenden. Nie sehe ich, wie mein Vater reagiert oder wie er anschließend das Gespräch mit meiner Mutter führt. Der Tagtraum bringt meine Sehnsucht zum Ausdruck, gerettet zu werden. Als Kind gefiel mir mein Leben gar nicht, mein Viertel, meine Schule, meine Spielgefährten – aus all dem wollte ich gerettet werden, und in dieser Geschichte werde ich zum ersten Mal als besonders erkannt, und dies von einem wichtigen Repräsentanten der Welt da draußen, der Welt jenseits des kulturellen Ghettos, in dem ich aufwuchs.
Wenn ich jetzt zurückblicke, erkenne ich diese Vision von Rettung und Anerkennung in meinem ganzen Schreiben. Im dritten Kapitel meines Romans Das Spinoza-Problem verliert sich Spinoza auf dem Weg zu seinem Lehrer Franciscus van den Enden in einen Tagtraum, der ihre erste Begegnung einige Monate zuvor in Erinnerung ruft. Van den Enden, ein ehemaliger Jesuit und Lehrer alter Sprachen, der eine private Lateinschule leitete, betrat Spinozas Geschäft, um Wein und Rosinen zu kaufen, und war verblüfft über die Tiefe und Weite von Spinozas Denken. Er bedrängte Spinoza, in seine Privatschule zu kommen, damit er dort die nicht-jüdische Welt der Philosophie und Literatur kennenlernt. Auch wenn der Roman natürlich fiktiv ist, habe ich versucht, die historischen Details so genau wie möglich wiederzugeben. Mit Ausnahme einer Stelle: Baruch Spinoza arbeitete nie im Geschäft seiner Familie. Es gab gar kein Familiengeschäft: seine Familie hatte ein Export-Import-Unternehmen, aber kein Einzelhandelsgeschäft. Ich war derjenige, der im Lebensmittelgeschäft der Familie arbeitete.
Diese Sehnsucht, erkannt und errettet zu werden, besteht bei mir in vielfacher Weise. Neulich besuchte ich eine Aufführung von David Ives’ Stück Venus im Pelz. Der Vorhang öffnet sich und zeigt eine Backstage-Szene mit einem müden Regisseur am Ende eines langen Tages, an dem zahlreiche Schauspielerinnen vorsprachen, um die Hauptrolle zu ergattern. Erschöpft und höchst unzufrieden mit allen Schauspielerinnen, die bislang da waren, will er soeben aufbrechen, als eine forsche, ziemlich aufgeregte Schauspielerin hereinplatzt, mit einer Stunde Verspätung. Er sagt ihr, dass er für den heutigen Tag abgeschlossen hat, aber sie bittet und bettelt um ein Vorsprechen. Da er sie offensichtlich für naiv, respektlos, ungebildet und für die Rolle völlig ungeeignet hält, lehnt er dies ab. Aber sie weiß ihn um den Finger zu wickeln; sie ist sehr geschickt und hartnäckig, und schließlich gibt er nach, um sie loszuwerden, und gewährt ihr ein Vorsprechen, und sie beginnen nun, das Skript gemeinsam zu lesen. Als sie liest, ist sie wie verwandelt, ihr Akzent ändert sich, ihre Redeweise wirkt reif, sie spricht wie ein Engel. Er ist sprachlos; er ist überwältigt. Sie ist das, wonach er gesucht hat. Sie ist mehr, als er sich hätte träumen lassen. Wie kann dies dieselbe ungepflegte, vulgäre Frau sein, die ihm erst vor dreißig Minuten begegnet ist? Sie fahren fort mit dem Lesen. Sie hören nicht auf, bis sie das ganze Stück aufs Beste aufgeführt haben.
Mir gefiel alles an der Aufführung, aber jene ersten Minuten, in denen er ihre wirkliche Begabung zu schätzen lernt, gingen mir besonders nahe: Mein Tagtraum darüber, erkannt zu werden, war hier auf der Bühne ausagiert, und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, sie liefen mir übers Gesicht, als ich mich als Erster im Theater erhob und den Schauspielern applaudierte.
3 ICH WILL SIE LOS SEIN
Eine meiner Patientinnen, Rose, hatte in letzter Zeit im Wesentlichen über die Beziehung zu ihrer schon erwachsenen Tochter gesprochen, ihr einziges Kind. Rose war kurz davor, ihre Tochter aufzugeben, die sich nur für Alkohol, Sex und die Gesellschaft von anderen hemmungslosen Teenagern begeisterte.
Bisher hatte Rose sich mit ihrem eigenen Versagen als Mutter und Ehefrau auseinandergesetzt, mit ihrer wiederholten Untreue, wie sie die Familie vor einigen Jahren wegen eines anderen Mannes verlassen hatte und dann ein paar Jahre später zurückkam, als die Affäre zu Ende war. Rose war eine starke Raucherin gewesen und hatte dadurch ein schweres Lungenemphysem entwickelt, aber trotzdem hatte sie sich in den letzten Jahren sehr bemüht, ihr Verhalten wiedergutzumachen und sich ihrer Tochter noch einmal zu widmen. Aber es brachte nichts. Ich plädierte sehr für eine Familientherapie, aber die Tochter weigerte sich, und Rose stand jetzt an einem Wendepunkt: Jeder Hustenanfall und jeder Besuch bei ihrem Lungenarzt erinnerten sie daran, dass ihre Zeit begrenzt war. Sie wollte nur Erleichterung: »Ich will sie los sein«, sagte sie zu mir. Sie zählte die Tage, bis ihre Tochter mit der Schule fertig war und aus dem Haus ging – aufs College, zur Arbeit, irgendwohin. Inzwischen war es ihr gleichgültig, welchen Weg ihre Tochter wählen würde. Immer wieder sagte sie zu sich selbst und zu mir: »Ich will sie los sein.«
Ich setze in meiner Praxis alles daran, Familien zusammenzuführen, Brüche zwischen Geschwistern und zwischen Eltern und Kindern zu heilen. Aber meiner Arbeit mit Rose war ich allmählich müde und hatte alle Hoffnung für diese Familie fahren lassen. In den letzten Therapiesitzungen hatte ich versucht, ihre Zukunft ins Zentrum zu rücken, falls sie sich ganz von ihrer Tochter distanzieren würde. Würde sie sich nicht schuldig und einsam fühlen? Aber dies half alles nicht weiter, und jetzt wurde die Zeit knapp: Mir war klar, dass Rose nicht mehr lange leben würde. Nachdem ich ihre Tochter an einen ausgezeichneten Therapeuten überwiesen hatte, konzentrierte ich mich jetzt ganz auf Rose und schlug mich vollkommen auf ihre Seite. Mehr als einmal sagte sie: »Noch drei Monate, und dann schließt sie die Schule ab. Und dann ist sie weg. Ich will sie los sein. Ich will sie los sein.« Allmählich hoffte ich, ihr Wunsch möge sich erfüllen.
Als ich später an diesem Tag mein Fahrrad herausholte, gingen mir Rose’ Worte noch einmal durch den Sinn, »Ich will sie los sein. Ich will sie los sein«, und schon bald dachte ich an meine Mutter, sah die Welt durch ihre Augen, vielleicht zum allerersten Mal. Ich stellte mir vor, wie sie in ähnlichen Worten über mich gedacht und gesprochen haben mochte. Und wenn ich jetzt so darüber nachdachte, konnte ich mich nicht erinnern, dass meine Mutter sonderlich betrübt wirkte, als ich endlich und für immer das Elternhaus verließ und zum Medizinstudium nach Boston ging. Ich erinnere mich noch an die Abschiedsszene: meine Mutter auf der Eingangstreppe des Hauses, wie sie zum Abschied winkt, während ich in meinem vollgepackten Chevrolet losfahre, und dann, als ich nicht mehr zu sehen bin, nach drinnen geht; ich stelle mir vor, wie sie die Haustür schließt und tief ausatmet. Dann, zwei oder drei Minuten später, steht sie aufrecht da, lächelt breit und lädt meinen Vater ein, mit ihr jubelnd einen »Hava Nagila« zu tanzen.
Der Autor mit seiner Mutter und seiner Schwester, um 1934.
Ja, meine Mutter hatte allen Grund, erleichtert zu sein, als ich mit einundzwanzig für immer aus dem Haus ging. Ich war ein Störenfried. Sie hatte nie ein positives Wort für mich, und ich stand ihr da in nichts nach. Während ich auf meinem Rad eine lange Strecke abwärts fahre, schweifen meine Gedanken zurück zu der Nacht, als ich vierzehn war und mein Vater, damals sechsundvierzig Jahre alt, nachts mit heftigen Schmerzen in der Brust erwachte. In jenen Tagen machten Ärzte noch Hausbesuche, und meine Mutter rief umgehend unseren Hausarzt Dr. Manchester an. In der Stille der Nacht warteten wir drei – mein Vater, meine Mutter und ich – besorgt auf den Arzt. (Meine sieben Jahre ältere Schwester Jean war auf dem College und schon aus dem Haus.)
Immer wenn meine Mutter angespannt war, verfiel sie in primitive Denkmuster: Wenn etwas Schlimmes passierte, musste jemand die Schuld dafür haben. Und dieser Jemand war ich. Mehr als einmal an jenem Abend, als mein Vater sich in Schmerzen wand, schrie sie mich an: »Du – du hast ihn umgebracht!« Sie machte mir klar, dass mein Ungehorsam, meine Respektlosigkeit, mein Stören – all dies – ihn zugrunde gerichtet hätten.
Jahre später, als ich während meiner Analyse auf der Couch lag, brachte das Beschreiben dieses Erlebnisses meine ultraorthodoxe Psychoanalytikerin Olive Smith zu einem seltenen kurzen Ausbruch von Zärtlichkeit. Sie schnalzte mit der Zunge, tsk, tsk, beugte sich zu mir vor und sagte: »Wie schrecklich. Wie furchtbar muss das für Sie gewesen sein.« Sie war eine strenge Lehranalytikerin an einem strengen Institut, wo man Interpretation als das einzig effektive Tun des Analytikers ansah. Von ihren durchdachten, dichten und sorgfältig formulierten Interpretationen kann ich mich an keine einzige erinnern. Aber als sie damals auf diese warmherzige Art auf mich einging – das weiß ich noch heute, fast sechzig Jahre später, zu schätzen.
»Du hast ihn umgebracht, du hast ihn umgebracht.« Ich kann noch immer die schrille Stimme meiner Mutter hören. Ich erinnere mich, wie ich mich, gelähmt von Angst und Wut, zusammenkauerte. Am liebsten hätte ich zurückgeschrien: »Er ist nicht tot! Halt den Mund, du dumme Ziege.« Sie strich meinem Vater ständig über die Stirn und küsste seinen Kopf, während ich in einer Ecke auf dem Boden hockte, bis ich endlich, endlich, gegen drei Uhr morgens, hörte, wie Dr. Manchesters großer Buick die Herbstblätter auf der Straße zerknirschte, und ich flog die Treppe hinunter, drei Stufen auf einmal, um ihm die Tür zu öffnen. Ich mochte Dr. Manchester sehr, und bei dem vertrauten Anblick seines großen, runden lächelnden Gesichts verflog meine Panik. Er legte mir die Hand auf den Kopf, zerzauste mir die Haare, beruhigte meine Mutter und gab meinem Vater eine Spritze (vermutlich Morphium), hielt ihm das Stethoskop auf die Brust und sagte dann zu mir: »Schau, Sonny, es tickt weiter, kräftig und regelmäßig wie eine Uhr. Keine Sorge. Er wird wieder gesund werden.«
In jener Nacht spürte ich, wie nahe mein Vater dem Tod war, und war Zeuge der eruptiven Wut meiner Mutter und beschloss aus Selbstschutz, die Tür zu ihr zu schließen. Ich musste aus dieser Familie herauskommen. In den nächsten zwei bis drei Jahren sprach ich kaum mit ihr – wir lebten wie Fremde im selben Haus. Und vor allem erinnere ich mich an meine große, enorme Erleichterung, als Dr. Manchester unser Haus betrat. Niemand hatte mich je so beschenkt. Hier und jetzt beschloss ich, ihm nachzueifern. Ich wollte diesen Trost, den er mir gespendet hatte, an andere weitergeben.
Mein Vater erholte sich allmählich, und auch wenn er bei fast jeder Anstrengung weiterhin Schmerzen in der Brust hatte, selbst wenn er nur eine Straßenecke weiter ging und dann sofort nach seinem Nitroglycerin griff und eine Tablette schluckte, lebte er noch dreiundzwanzig Jahre. Mein Vater war ein sanfter, großzügiger Mann, dessen einziger Fehler meiner Meinung nach war, dass er sich meiner Mutter nicht widersetzte. Meine Beziehung zu meiner Mutter war mein ganzes Leben lang eine offene Wunde, und doch ist es paradoxerweise ihr Bild, das mir fast jeden Tag durch den Sinn geht. Ich sehe ihr Gesicht: Sie ist nie im Frieden mit sich, sie lächelt nie, ist niemals glücklich. Sie war eine intelligente Frau, und auch wenn sie jeden Tag ihres Lebens hart arbeitete, war sie ganz und gar unausgefüllt und hatte selten etwas Freundliches, Positives zu sagen. Aber inzwischen, auf meinen Radtouren, denke ich anders über sie: Ich denke daran, wie wenig Freude ich ihr gemacht habe, solange wir zusammen lebten. Ich bin dankbar, dass ich ihr später zu einem netteren Sohn wurde.
4 RÜCKBESINNUNG
Ab und zu lese ich Charles Dickens noch einmal, ein Autor, der für mich in meinem Pantheon von Schriftstellern immer eine zentrale Figur war. Kürzlich fiel mir in Eine Geschichte zweier Städte eine außerordentliche Passage ins Auge: »Denn wie ich dem Ende näher und näher komme, wandere ich im Kreis, immer weiter dem Anfang zu. Das scheint eine der freundlichen Erleichterungen und Vorbereitungen des Abgangs zu sein. Jetzt rühren mir viele Erinnerungen ans Herz, die lange geschlummert hatten …«
Diese Passage bewegt mich zutiefst: Indem ich tatsächlich dem Ende näher komme, wandere auch ich im Kreis, immer weiter dem Anfang zu. Die Erinnerungen meiner Klienten stoßen oft meine eigenen an, meine Arbeit an ihrer Zukunft appelliert an meine Vergangenheit und wühlt sie auf, und ich merke, wie ich meine eigene Geschichte noch einmal überdenke. Meine Erinnerungen an die frühe Kindheit waren immer bruchstückhaft, wahrscheinlich, so dachte ich immer, weil ich so unglücklich war und wir in solcher Armut lebten. Jetzt, da ich Mitte achtzig bin, drängen sich immer mehr Bilder aus meinen frühen Lebensjahren in meine Gedanken. Die Betrunkenen, die in ihrem Erbrochenen in unserem Windfang schliefen. Meine Einsamkeit und Isolation. Die Kakerlaken und die Ratten. Der rotbackige Friseur, der mich »Judenbengel« nannte. Meine geheimnisvollen, mich quälenden und unerfüllten sexuellen Begierden als Teenager. Fehl am Platze. Immer fehl am Platze – das einzige weiße Kind in einem schwarzen Stadtteil, der einzige Jude in einer christlichen Welt.
Ja, die Vergangenheit holt mich ein, und ich weiß, was »Glätten« bedeutet. Deutlicher als je zuvor stelle ich mir vor, wie meine verstorbenen Eltern zuschauen und es ihnen Stolz und Vergnügen bereitet, mich vor einer Menschenmenge sprechen zu sehen. Als mein Vater starb, hatte ich erst ein paar Beiträge für medizinische Zeitschriften geschrieben, Fachartikel, die er nicht verstand. Meine Mutter überlebte ihn um fünfundzwanzig Jahre, und auch wenn ihr unzureichendes Englisch und später ihre Erblindung es ihr nicht erlaubten, meine Bücher zu lesen, bewahrte sie sie neben ihrem Sessel auf und strich mit der Hand darüber, und wenn sie in ihrem Altenheim Besuch bekam, machte sie viel Aufhebens darum. So viel zwischen meinen Eltern und mir ist unvollständig. So viele Dinge unseres gemeinsamen Leben wurden nie erörtert, die Spannung und das Unglück in unserer Familie, meine Welt und ihre Welt. Wenn ich mir ihr Leben vor Augen führe, wie sie in Ellis Island ankamen, ohne einen Penny, ohne Schulbildung, ohne ein Wort Englisch, kommen mir die Tränen. Ich möchte ihnen sagen: »Ich weiß, was ihr durchgemacht habt. Ich weiß, wie hart es war. Ich weiß, was ihr für mich getan habt. Bitte, verzeiht mir, dass ich mich euretwegen geschämt habe.«
Vater und Mutter des Autors, um 1930.
In meinem Alter jetzt auf mein Leben zurückzublicken, ist eine herausfordernde und manchmal einsame Sache. Mein Gedächtnis ist unzuverlässig, und es gibt nur noch so wenige lebende Zeugen meiner frühen Kindheit. Meine sieben Jahre ältere Schwester ist kürzlich verstorben, und viele alte Freunde und Bekannte leben auch nicht mehr.
Als ich achtzig wurde, weckten einige unerwartete Stimmen aus der Vergangenheit Erinnerungen. Zuerst einmal war da Ursula Tomkins, die mich über meine Website gefunden hatte. Wir waren gemeinsam in Washington, D.C., auf die Grundschule gegangen, und ich hatte seitdem nicht mehr an sie gedacht. Ihre E-Mail lautete: »Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag, Irvin. Ich habe mit Vergnügen zwei Bücher von dir gelesen und unsere Bibliothek in Atlanta gebeten, noch ein paar mehr zu bestellen. Ich erinnere mich an dich aus der vierten Klasse von Miss Fernald an der Gage Elementary School. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst – ich war etwas mollig mit roten krausen Haaren, und du warst ein gutaussehender Junge mit kohlrabenschwarzem Haar!«
Ursula, an die ich mich gut erinnern konnte, fand also, ich sei ein gutaussehender Junge mit kohlrabenschwarzem Haar gewesen! Ich? Gutaussehend? Wenn ich das nur gewusst hätte! Nie, nicht einen Moment lang, hatte ich mich für einen gutaussehenden Jungen gehalten. Ich war schüchtern, verträumt, ohne Selbstbewusstsein und hätte nie gedacht, dass irgendwer mich attraktiv fand. Ach, Ursula, wie lieb von dir, zu sagen, dass ich gut aussah. Aber warum, warum nur hast du das nicht früher gesagt? Vielleicht hätte es meine ganze Kindheit verändert.
Und dann fand ich vor zwei Jahren eine Nachricht aus der tiefen Vergangenheit auf dem Anrufbeantworter vor, die folgendermaßen begann: »Hier spricht Jerry, dein alter Schachkumpel!« Obwohl ich seine Stimme siebzig Jahre nicht mehr gehört hatte, erkannte ich sie sofort. Es war Jerry Friedlander, dessen Vater ein Lebensmittelgeschäft an der Ecke Seaton und North Capital Street besessen hatte, eine Straße vom Laden meines Vaters entfernt. In seiner Nachricht berichtete er, dass seine Enkelin in einem Psychologiekurs ein Buch von mir las. Er konnte sich noch erinnern, dass wir zwei Jahre lang regelmäßig miteinander gespielt hatten, ich war zwölf und er vierzehn, eine Zeit, die ich nur als eine einzige Ödnis von Unsicherheit und Selbstzweifel in Erinnerung habe. Da ich mich an so wenig aus jenen Jahren erinnern konnte, ergriff ich die Chance und zapfte Jerrys Gedächtnis an und fragte nach den Eindrücken, die er von mir hatte (natürlich nachdem ich ihm meine Eindrücke von ihm mitgeteilt hatte).
»Du warst ein netter Kerl«, sagte er, »sehr friedlich. Ich erinnere mich, dass wir nie Streit hatten.«
»Erzähl mir mehr«, sagte ich gierig. »Meine Erinnerungen an die Zeit sind so blass.«
»Du hast manchmal herumgetrödelt, aber im Wesentlichen warst du wirklich ernsthaft und strebsam. Eigentlich sehr strebsam. Immer wenn ich zu euch kam, hast du gerade ein Buch gelesen – ich erinnere mich genau –, Irv und seine Bücher. Du hast immer schwieriges Zeug und gute Literatur gelesen – viel zu hoch für mich. Comics waren nichts für dich.«
Das stimmte nur zum Teil – eigentlich war ich damals ein großer Fan von Captain Marvel, Batman und Green Hornet. (Allerdings nicht von Superman: seine Unverletzbarkeit nahm alle Spannung aus seinen Abenteuern.) Jerrys Worte erinnerten mich daran, dass ich in jenen Jahren oft in einem Buchladen in der 7th Street unweit der Bücherei gebrauchte Bücher gekauft hatte. Während ich so in Erinnerungen schwelgte, tauchte ein Bild von einem großen, rostfarbenen, geheimnisvollen Buch über Astronomie vor meinem geistigen Auge auf. Auch wenn ich nicht viel von der Optik verstand, um die es da ging, passte das Buch genau zu einem anderen Thema: Ich ließ es gut sichtbar für die attraktiven Freundinnen meiner Schwester liegen, in der Hoffnung, dass sie es entdecken würden und von meinen frühreifen Interessen beeindruckt wären. Wenn sie mir den Kopf tätschelten oder mich gelegentlich umarmten oder küssten, genoss ich das sehr. Mir war nicht klar gewesen, dass Jerry das Buch auch bemerkt hatte – wobei es ihn weitgehend kalt gelassen hatte.
Jerry erzählte mir, dass ich unsere Schachspiele meistens gewann, aber dass ich kein guter Verlierer war: Am Ende eines Marathonspiels, das er in einem hart erkämpften Endspiel gewonnen hatte, grollte ich und bestand darauf, dass er mit meinem Vater spielte. Und das tat er dann auch. Am folgenden Sonntag kam er zu uns und schlug auch meinen Vater, war dann allerdings sicher, dass mein Vater ihn hatte gewinnen lassen.
Diese Anekdote verblüffte mich. Ich hatte eine gute, wenngleich distanzierte Beziehung zu meinem Vater, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich erwartet hatte, dass er sich für mein Verlieren rächen würde. Nach meiner Erinnerung hatte er mir Schachspielen beigebracht, aber nachdem ich etwa elf war, schlug ich ihn immer und suchte nach stärkeren Gegnern, insbesondere kam da sein Bruder in Frage, mein Onkel Abe.
Ich hegte immer einen unausgesprochenen Groll gegen meinen Vater – dass er meiner Mutter nie, nicht ein einziges Mal, Kontra bot. In all den Jahren, in denen meine Mutter mich diskreditierte und kritisierte, widersprach mein Vater nie. Er ergriff nie Partei für mich. Ich war enttäuscht von seiner Passivität, von seiner Unmännlichkeit. Daher war ich erstaunt: Wie hätte ich an ihn appellieren können, mein Versagen mit Jerry wiedergutzumachen? Vielleicht täuschte sich mein Gedächtnis. Vielleicht war ich stolzer auf ihn, als ich gedacht hatte.
Diese Möglichkeit gewann Glaubwürdigkeit, als Jerry im Folgenden seine eigene Lebensodyssee erzählte. Sein Vater war als Geschäftsmann nicht erfolgreich gewesen, und dreimal zwangen Geschäftseinbrüche die Familie zum Umzug, jedes Mal ging es gesellschaftlich abwärts, in weniger angenehme Wohnviertel. Außerdem musste Jerry nach der Schule und jeden Sommer arbeiten. Mir wurde klar, dass ich viel mehr Glück gehabt hatte: Auch wenn ich oft im Geschäft meines Vaters mithalf, war dies nie eine Notwendigkeit, sondern immer zu meinem eigenen Vergnügen gewesen – ich fühlte mich erwachsen, wenn ich Kunden bediente, die Preise zusammenzählte, Geld entgegennahm und ihnen Wechselgeld herausgab. Und Jerry hatte im Sommer gearbeitet, während meine Eltern mich in zweimonatige Sommer-Camps geschickt hatten. Ich hatte meine Privilegien für selbstverständlich gehalten, aber in meinem Gespräch mit Jerry wurde mir klar, dass mein Vater viele Dinge ganz richtig gemacht hatte. Offensichtlich war er ein fleißiger, intelligenter Geschäftsmann. Seine (und meiner Mutter) harte Arbeit und sein Geschäftssinn hatten mein Leben leichter gemacht und meine Ausbildung erst ermöglicht.
Der Vater des Autors in seinem Lebensmittelgeschäft, um 1930.
Als ich nach dem Gespräch mit Jerry den Hörer auflegte, tauchten andere vergessene Erinnerungen auf. Eines regnerischen Abends, als das Geschäft voller Kunden war, schnappte sich ein riesiger, bedrohlich aussehender Mann eine Kiste Alkoholika und lief damit auf die Straße. Ohne zu zögern, ließ mein Vater alles stehen und liegen, und meine Mutter und ich blieben in einem Geschäft zurück, in dem sich die Kunden drängten. Fünfzehn Minuten später kam mein Vater mit der Kiste Alkohol zurück – der Dieb hatte nach zwei oder drei Straßenblocks aufgegeben, seine Beute fallen lassen und sich aus dem Staub gemacht. Eine reife Leistung meines Vaters. Ich bin nicht sicher, ob ich den Mut zu dieser Jagd gehabt hätte. Ich muss stolz auf ihn gewesen sein – wie hätte es anders sein können? Aber merkwürdigerweise hatte ich diese Erinnerung nicht zugelassen. Hatte ich mich je hingesetzt und darüber nachgedacht, wirklich darüber nachgedacht, wie sein Leben so war?
Der Vater des Autors, um 1927.
Ich weiß, dass mein Vater morgens um fünf mit der Arbeit begann, um Ware beim Großmarkt Washington, D.C., Südost zu kaufen, und er schloss den Laden wochentags um zweiundzwanzig Uhr und freitags und samstags um Mitternacht. Sein einziger freier Tag war der Sonntag. Manchmal begleitete ich ihn auf den Großmarkt, und es war eine harte, strapaziöse Arbeit. Aber ich habe ihn nie klagen hören. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem »Onkel Sam«, seinem besten Freund noch aus der Kindheit in Russland, sprach (für mich war jeder aus dem Kreis derer, die aus Cielz, ihrem Schtetl in Russland, emigriert waren, Onkel oder Tante). Sam erzählte mir von meinem Vater, wie er stundenlang auf dem winzigen kalten Dachboden ihres Hauses saß und Gedichte schrieb. Aber das hatte ein Ende, als er im Ersten Weltkrieg als Teenager von der russischen Armee eingezogen wurde, um beim Bau von Eisenbahngleisen zu helfen. Nach dem Krieg kam er mit Hilfe seines älteren Bruders, Meyer, der schon früher emigriert war und ein kleines Lebensmittelgeschäft in der Volta Street in Georgetown eröffnet hatte, in die Vereinigten Staaten. Seine Schwester Hannah und sein jüngerer Bruder Abe folgten. Abe kam 1937 allein und hatte vor, seiner Familie Geld zu schicken, aber es war zu spät: Die Nazis brachten alle, die zurückgeblieben waren, um, einschließlich der älteren Schwester meines Vaters und deren beiden Kinder, der Frau seines Bruder Abe und deren vier Kinder. Aber über all dies sprach mein Vater nie, auch nicht über den Holocaust oder sonst etwas aus seiner früheren Heimat. Auch seine Gedichte gehörten der Vergangenheit an. Nie sah ich ihn schreiben. Nie sah ich ihn ein Buch lesen. Nie sah ich ihn irgendetwas außer der jüdischen Tageszeitung lesen, nach der er griff, sobald sie ankam, und die er überflog. Erst jetzt wird mir klar, dass er nach Informationen über seine Familie und Freunde suchte. Ein einziges Mal spielte er auf den Holocaust an. Als ich etwa zwanzig war, gingen er und ich einmal zusammen zum Lunch, nur wir beide. Dies war etwas Seltenes: auch wenn er zu dem Zeitpunkt das Geschäft schon verkauft hatte, war es immer noch schwer, ihn von meiner Mutter zu trennen. Er begann das Gespräch nie von sich aus. Er ging nie auf mich zu. Vielleicht fühlte er sich mir gegenüber unsicher, obgleich er bei seinen Männerfreunden keineswegs schüchtern oder gehemmt war – ich mochte es, wenn ich ihn mit ihnen lachen und Geschichten erzählen sah, wenn sie Binokel spielten. Vielleicht haben wir beide versagt: Er hat sich nie nach meinem Leben oder nach meiner Arbeit erkundigt, und ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn liebte. Unser Mittagsgespräch ist mir noch deutlich in Erinnerung. Wir unterhielten uns eine Stunde lang als Erwachsene, und es war ganz wunderbar. Ich erinnere mich noch, dass ich ihn fragte, ob er an Gott glaube, und er antwortete: »Wer kann denn nach der Shoah noch an Gott glauben?«
Ich weiß, dass es jetzt an der Zeit ist, schon über die Zeit, ihm sein Schweigen zu vergeben, auch dass er ein Immigrant war, seine mangelnde Bildung und seine Achtlosigkeit gegenüber den trivialen Enttäuschungen seines einzigen Sohnes. Es ist Zeit, dass ich aufhöre, ihm seine Unwissenheit vorzuwerfen, und mich an sein schönes Gesicht erinnere, an seine Sanftmut, seinen herzlichen Umgang mit seinen Freunden, seine melodiöse Stimme, mit der er jiddische Lieder sang, die er als Kind im Schtetl gelernt hatte, an sein Lachen, wenn er mit seinem Bruder und den Freunden Binokel spielte, sein elegantes Seitenschwimmen am Bay Ridge Beach und an seine liebevolle Beziehung zu seiner Schwester Hannah, meiner über alles geliebten Tante.
5 DIE BIBLIOTHEK, A–Z
Bis zu meinem Ruhestand bin ich viele Jahre lang jeden Tag zwischen Stanford und unserem Zuhause hin und zurück geradelt, und so manches Mal habe ich angehalten, um die Rodin-Statuen der Bürger von Calais oder die funkelnden Mosaiken der Memorial Church, die den Quad dominieren, als Blickfang des zentralen Platzes zu bewundern oder um in der Universitätsbuchhandlung zu stöbern. Auch nach der Pensionierung bin ich immer noch mit dem Rad durch Palo Alto gefahren, um Dinge zu erledigen oder Freunde zu besuchen. Aber seit Kurzem habe ich kein gutes Gleichgewichtsgefühl mehr, und daher vermeide ich es, im Verkehr Rad zu fahren, und beschränke mich darauf, dreißig oder vierzig Minuten in der Abenddämmerung auf den Radwegen unterwegs zu sein. Auch wenn die Strecken sich geändert haben, so verbinde ich das Radfahren doch immer mit einem Gefühl von Freiheit und Meditation, und in letzter Zeit versetzen mich der Fahrtwind im Gesicht und die langsame Bewegung in die Vergangenheit zurück.
Abgesehen von einer zehnjährigen Affäre mit einem Motorrad Ende zwanzig, Anfang dreißig bin ich dem Radfahren treu geblieben, seit ich zwölf war, als ich meine Eltern nach einer langen, mühsamen Kampagne dazu überreden konnte, mir zum Geburtstag ein leuchtend rotes American-Flyer-Rad zu schenken. Ich war ein raffinierter Bettler und entdeckte schon früh eine äußerst effektive Technik, eine Technik, die immer funktionierte: einfach einen Bezug zwischen dem begehrten Objekt und meiner Bildung herzustellen. Meine Eltern gaben kein Geld für irgendetwas Extravagantes aus, aber wenn es um etwas ging, das auch nur entfernt mit Lernen und Bildung zu tun hatte – Stifte, Papier, Lineale (erinnern Sie sich daran?) und Bücher, vor allem Bücher –, dann gaben sie mit beiden Händen. Als ich ihnen also sagte, ich würde das Fahrrad brauchen, um häufiger die wunderbare Washington Central Bibliothek an der Ecke Seventh und K Street besuchen zu können, konnten sie meinen Wunsch nicht ablehnen.
Der Autor im Alter von zehn Jahren.
Ich hielt mein Versprechen: jeden Samstag, ohne Ausnahme, füllte ich die Satteltaschen meines Fahrrads mit sechs Büchern (das Limit der Bibliothek), die ich seit dem vorigen Samstag verschlungen hatte, und machte mich auf die vierzigminütige Fahrt, um für Nachschub zu sorgen.
Die Bibliothek wurde zu meinem zweiten Zuhause, und ich verbrachte dort jeden Samstag Stunden. Meine langen Nachmittage erfüllten einen doppelten Zweck: Die Bibliothek brachte mich mit der weiten Welt, nach der ich mich sehnte, in Kontakt, der Gedankenwelt von Geschichte und Kultur. Und zugleich beruhigte es meine Eltern und befriedigte ihr Bedürfnis, einen Gelehrten gezeugt zu haben. Außerdem war es von ihrem Standpunkt aus umso besser, je mehr Zeit ich drinnen mit Lesen verbrachte: Unser Viertel war gefährlich. Der Laden meines Vaters und unsere Wohnung in der ersten Etage lagen in einem einfachen Stadtteil von Washington, D.C., wo noch die Rassentrennung galt, nicht weit von der Grenze zu den weißen Stadtteilen. Auf den Straßen herrschten Gewalt, Diebstahl, Rassenunruhen und Trunksucht (vieles davon angefeuert vom Alkohol aus dem Geschäft meines Vaters). Während der Sommerschulferien waren sie klug genug, mich von den gefährlichen Straßen fernzuhalten (und von sich selber), indem sie mich, ab dem Alter von sieben Jahren, zu Sommercamps nach Maryland, Virginia, Pennsylvania oder New Hampshire schickten, was mit hohen Kosten verbunden war.
Die riesige Eingangshalle der Bibliothek beeindruckte mich so, dass ich sie nur auf Zehenspitzen zu durchqueren wagte. Mitten im Erdgeschoss stand ein gewaltiges Regal mit Biographien, alphabetisch nach Themen geordnet. Erst nachdem ich viele Male darum herum geschlichen war, fasste ich mir ein Herz und bat die beflissene Bibliothekarin um Hilfe. Wortlos brachte sie mich mit einem Zeigefinger auf den Lippen zum Schweigen und zeigte auf die große Marmortreppe, die zu den Kinderbüchern in der ersten Etage führte, wo ich hingehörte. Tief enttäuscht folgte ich ihren Anweisungen, aber trotzdem inspizierte ich das Biographien-Regal jedes Mal, wenn ich in die Bibliothek kam, und nach einiger Zeit machte ich einen Plan: Ich würde jede Woche eine Biographie lesen, beginnend mit einer Persönlichkeit, deren Name mit »A« anfing, und würde mich so durch das Alphabet arbeiten. Als erstes war Henry Armstrong dran, ein Leichtgewichtboxer der 1930er Jahre. Von den Bs erinnere ich mich an Juan Belmonte, den begabten Stierkämpfer des frühen 20. Jahrhunderts, und dann Francis Bacon, den Renaissance-Gelehrten. Bei C war Ty Cobb dran, bei E Thomas Edison, bei G Lou Gehrig und Hetty Green (die »Hexe der Wall Street«), und so ging es weiter. Unter J entdeckte ich Edward Jenner, der mein Held wurde, weil er die Pocken besiegte. Bei K begegnete ich Dschingis Khan, und wochenlang fragte ich mich, ob Jenner mehr Leben gerettet als Khan vernichtet hatte. Unter K stand auch Paul de Kruifs Mikrobenjäger, das mich anregte, viele Bücher über die mikroskopische Welt zu lesen; und im darauffolgenden Jahr arbeitete ich an den Wochenenden als Getränkeverkäufer im Drogeriemarkt Peoples und konnte dadurch genug Geld sparen, um mir ein poliertes Messingmikroskop zu kaufen, das ich bis heute noch besitze. N bot mir den Trompeter Red Nichols und machte mich mit einem komischen Vogel namens Friedrich Nietzsche bekannt. Die Ps brachten mich auf den Heiligen Paulus und Sam Patch, den ersten, der einen Sprung in die Niagarafälle überlebte.
Ich erinnere mich, dass ich mein Biographienprojekt mit den Ts beendete, wo ich Albert Payson Terhune entdeckte. Dadurch wurde ich in den Folgewochen abgelenkt, weil ich seine vielen Bücher über so außergewöhnliche Collies namens Lad und Lassie verschlang. Heute bin ich mir sicher, dass ich durch diese ungeordneten Lektüren keinen Schaden nahm, es schadete mir nicht, das einzige zehn- oder elfjährige Kind in der Welt zu sein, das so viel über Hetty Green oder Sam Patch wusste, aber trotzdem, was für eine Verschwendung! Ich sehnte mich nach einem Erwachsenen, nach irgendeinem amerikanischen Mentor des Mainstream, jemanden wie den Mann in dem Seersucker-Anzug, der in das Lebensmittelgeschäft meines Vater käme und verkündete, dass ich ein Kind mit viel Talent sei. In der Rückschau spüre ich zärtliche Zuneigung zu diesem einsamen, verängstigten und zielstrebigen kleinen Jungen und staune, dass er ohne Ermutigung, Vorbilder oder Anleitung irgendwie seinen Weg gemacht hat.
6 RELIGIÖSER KRIEG
Schwester Miriam, eine katholische Nonne, war von ihrem Beichtvater, Bruder Alfred, der vor vielen Jahren nach dem Tod seines tyrannischen Vaters bei mir in Therapie gewesen war, an mich überwiesen worden. Bruder Alfred hatte mir eine kurze Nachricht geschickt:
Lieber Dr. Yalom, (Verzeihen Sie, aber ich kann Sie immer noch nicht Irv nennen – dafür wären noch ein oder zwei Jahre Therapie nötig.) Ich hoffe, Sie können Schwester Miriam behandeln. Sie ist eine liebevolle, großherzige Seele, aber ihrer Gelassenheit stehen viele Hindernisse im Wege.
Schwester Miriam war eine sympathische, aber irgendwie mutlose Frau in mittleren Jahren, und so wie sie sich kleidete, hätte man nicht auf ihre Berufung schließen können. Offen und direkt kam sie schnell und ohne Scheu auf ihre Themen zu sprechen. Ihre ganze Laufbahn in der Kirche war für sie durch ihre praktische karitative Arbeit mit den Armen sehr befriedigend gewesen, aber wegen ihres scharfen Verstandes und ihrer entsprechenden Fähigkeiten hatte man ihr immer höhere Verwaltungsaufgaben in ihrem Orden übertragen. Auch wenn sie sich in diesen Positionen außerordentlich gut bewährte, ging dies auf Kosten ihrer Lebensqualität. Sie hatte nur noch wenig Zeit für Gebet und Meditation, und fast täglich geriet sie mit anderen Verwaltungskollegen in Konflikt, die nach mehr Macht hungerten. Sie fühlte sich sündig wegen ihrer Wut auf sie.
Ich mochte Schwester Miriam von Anfang an, und als wir uns dann wöchentlich trafen, empfand ich immer größeren Respekt vor dieser Frau, die ihr Leben – mehr als jeder andere, den ich kannte – ganz dem Dienen geweiht hatte. Ich war entschieden, mein Möglichstes zu tun, um ihr zu helfen. Sie war unglaublich intelligent und außerordentlich fromm. Sie fragte nie nach meiner religiösen Einstellung, und nach einigen Monaten Therapie hatte Schwester Miriam genug Vertrauen aufgebaut, um ihr privates Tagebuch in die Stunde mitzubringen und mir einige Passagen daraus vorzulesen. Sie gestand ihre tiefe Einsamkeit, wie plump sie sich fühlte und wie neidisch sie auf andere Schwestern war, die mit Schönheit und Anmut gesegnet waren. Als sie zu ihrer Traurigkeit darüber kam, was ihr alles entgangen war – Ehe, ein sexuelles Leben und Mutterschaft –, brach sie in Tränen aus. Sie tat mir so leid, als ich an meine Frau und meine Kinder dachte und an die wertvollen Bindungen zu ihnen.
Schwester Miriam gewann schnell wieder die Fassung und brachte ihre Dankbarkeit für die Gegenwart Christi in ihrem Leben zum Ausdruck. Sie sprach sehnsüchtig über ihre allmorgendlichen Gespräche mit ihm, die ihr seit ihren Teenagerjahren in der Klosterschule Kraft und Trost gegeben hatten. Seit Kurzem waren diese Morgenmeditationen wegen ihrer vielen Verwaltungsaufgaben zu selten geworden, und sie fehlten ihr sehr. Mir lag viel an Schwester Miriam, und ich war entschlossen, ihr zu helfen, zu ihren morgendlichen Begegnungen mit Christus zurückzufinden.
Eines Tages fiel mir nach unserer Therapiestunde auf meiner Radtour auf, wie konsequent ich meine eigene religiöse Skepsis verschwieg, wenn ich mit Schwester Miriam zusammen saß. Mir war noch nie zuvor eine solche Aufopferung und solche Hingabe begegnet. Selbst wenn ich meine therapeutische Tätigkeit ebenfalls als ein Leben im Dienst meiner Patienten ansah, war mir klar, dass diese Hingabe nicht mit ihrer vergleichbar war; ich bestimmte meinen Terminkalender und wurde für meine Leistungen bezahlt. Wie kam sie zu dieser Selbstlosigkeit? Ich dachte über ihre frühen Jahre und ihre Entwicklung nach. Ihre Eltern waren in Armut verfallen, nachdem ihr Vater durch einen Unfall in der Kohlemine eine Behinderung davongetragen hatte, und hatten sie mit vierzehn auf eine Klosterschule geschickt und sie nur selten besucht. Seither war ihr Leben morgens, mittags und abends von Gebeten, intensiven Bibelstudien und vom Katechismus bestimmt. Für Spiel, Spaß oder gesellige Aktivitäten gab es kaum Zeit, und natürlich hatte sie keinen Kontakt mit Männern.
Nach unseren Therapiesitzungen dachte ich oft über die Bruchstücke meiner eigenen religiösen Erziehung nach. Junge Juden waren in Washington, D.C., zu meiner Zeit mit einem veralteten doktrinären Ansatz konfrontiert, der in der Rückschau eher dazu geeignet war, uns sämtliches religiöse Leben zu vermiesen. Meines Wissens hat niemand aus meiner damaligen Altersgruppe irgendwelche religiösen Bindungen beibehalten. Meine Eltern waren ethnische Juden: Sie sprachen jiddisch, sie richteten sich genau nach den koscheren Essensregeln, und wir hatten in der Küche vier verschiedene Arten von Geschirr (jeweils für Milchprodukte und Fleisch im Alltag und anderes Geschirr für Pessach), sie begingen die hohen Feiertage und waren glühende Zionisten. Sie und ihre Verwandten und Freunde bildeten eine feste Gruppe und schlossen fast nie Freundschaft mit Nicht-Juden oder hatten eigentlich auch nichts mit dem amerikanischen Mainstream zu tun.
Doch trotz ihrer strengen jüdischen Identität war für mich wenig wirkliches religiöses Interesse erkennbar. Abgesehen von ihrem unerlässlichen Gang zur Synagoge an den hohen Feiertagen, dem Fasten an Yom Kippur und dem Verbot von gesäuertem Brot an Pessach, nahm keiner die Religion wirklich ernst. Niemand betete täglich oder las regelmäßig in der Bibel, niemand legte Tefillin an oder zündete am Sabbat Kerzen an.
Die meisten Familien hatten kleine Unternehmen, zumeist Lebensmittel- oder Getränkegeschäfte oder Delikatessenläden, die nur sonntags und an Weihnachten, am Neujahrstag und an den wichtigen jüdischen Feiertagen geschlossen waren. Mir ist noch sehr genau in Erinnerung, wie es in der Synagoge am höchsten Feiertag aussah: Die männlichen Freunde und Verwandten meines Vaters saßen unten in einer Reihe, und die Frauen, einschließlich meiner Schwester und meiner Mutter, oben. Ich erinnere mich noch, wie ich neben meinem Vater saß und mit den Fransen seines blau-weißen Gebetsschals spielte und dabei den Geruch von Mottenkugeln in seinem selten getragenen Festtagsanzug einatmete, während ich mich über seine Schulter beugte, wenn er auf die hebräischen Worte zeigte, die vom Kantor oder vom Rabbi gesungen wurden. Weil dies für mich nur sinnlose Silben waren, konzentrierte ich mich möglichst intensiv auf die englische Übersetzung auf der Seite gegenüber, die voll war von grausamen Kämpfen und Wundern und endlosem Gotteslob. Keine Zeile davon hatte irgendetwas mit meinem Leben zu tun. Nach einer angemessenen Zeit an der Seite meines Vaters zog es mich nach draußen in den kleinen Innenhof, wo alle Kinder sich zum Reden und Spielen und Flirten trafen.
So also sah meine religiöse Prägung in der Kindheit aus. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum meine Eltern nie, nicht ein Mal, versucht haben, mir Hebräisch beizubringen oder wichtige religiöse Lehren zu vermitteln. Aber als mein dreizehnter Geburtstag und meine Bar Mizwa nahten, änderten sich die Dinge, und ich wurde in die Sonntagsschule geschickt, wo ich für meine Verhältnisse sehr schwierig im Unterricht war und mich auf so unangemessene Fragen versteifte wie: »Wenn Adam und Eva die ersten Menschen waren, wen heirateten dann ihre Kinder?« Oder: »Wenn der Brauch, Milchprodukte und Fleisch nicht zusammen zu essen, verhindern sollte, dass das Kalb in der Milch seiner Mutter gekocht wurde, warum, Rabbi, soll diese Regel dann auch für Hühner gelten?« Und ich ging allen mit »Hühner geben keine Milch« auf die Nerven. Am Ende hatte der Rabbi es satt und verwies mich von der Schule.
Aber das war noch nicht das Ende. Um die Bar Mizwa kam man nicht herum. Meine Eltern schickten mich zu einem Privatlehrer, Mr. Darmstadt, ein aufrechter, würdiger und geduldiger Mann. Die Hauptaufgabe bei der Bar Mizwa, die jeder dreizehnjährige Junge an seinem Geburtstag bewältigen muss, besteht darin, vor der ganzen Synagogengemeinde auf Hebräisch laut das Haftarah der Woche (eine Auswahl aus dem Buch der Propheten) zu singen.
In meiner Arbeit mit Mr. Darmstadt ergab sich ein echtes Problem: Ich konnte nicht (oder wollte nicht) Hebräisch lernen! Ich war in allen anderen Bereichen ein sehr guter Schüler, immer an der Klassenspitze, aber bei dieser Aufgabe stellte ich mich plötzlich völlig dumm an: Ich konnte mir die Buchstaben oder die Laute oder die Melodie der Lesung nicht merken. Schließlich gab der geduldige und überlastete Mr. Darmstadt es auf und ließ meinen Vater wissen, dass es unmöglich sei: Ich würde die Haftarah nie lernen. Folglich sang dann bei meiner Bar Mizwa der Bruder meines Vaters, mein Onkel Abe, an meiner Stelle. Der Rabbi bat mich, die wenigen Segensworte auf Hebräisch zu lesen, aber bei der Probe wurde klar, dass ich nicht einmal dies konnte, und bei der Zeremonie hielt der Rabbi mir resigniert Stichwortkarten hin, die ich analog zum Hebräischen auf Englisch lesen musste.
Meine Eltern müssen sich an diesem Tag sehr geschämt haben. Wie hätte es anders sein können? Aber ich kann mich an nichts erinnern, was ihre Beschämung gezeigt hätte – kein Bild, kein einziges Wort, das mit meinem Vater oder meiner Mutter gewechselt wurde. Ich kann nur hoffen, dass ihre Betroffenheit einen Ausgleich fand durch die glänzende Rede (auf Englisch), die ihr Sohn danach während des festlichen Abendessens hielt. Jetzt, im Nachhinein, frage ich mich oft, warum eigentlich mein Onkel und nicht mein Vater meinen Teil übernommen hatte. War mein Vater so überwältigt vor Scham? Wie gerne würde ich ihm diese Frage stellen. Und was war mit meiner monatelangen Arbeit mit Mr. Darmstadt? Ich habe unseren Unterricht fast vollkommen vergessen. Ich erinnere mich lediglich daran, dass ich eine Haltestelle früher aus der Straßenbahn ausstieg, um bei einem Little Tavern Hamburger Stand anzuhalten – eine der Hamburger-Ketten in Washington, D.C., alle mit einem grünen Schindeldach, wo es drei Burger für 25 Cent gab. Dass sie verboten waren, machte sie erst recht köstlich: es war das erste nicht-koschere Essen, das ich aß!
Wenn ein Jugendlicher wie der junge Irvin, mitten in einer Identitätskrise, von mir professionelle psychologische Hilfe suchen und mir erzählen würde, er könne kein Hebräisch lernen (obwohl er ein glänzender Schüler ist) und sei vom Religionsunterricht verbannt worden (obwohl er sonst nie nennenswerte Verhaltensauffälligkeiten zeigte) und habe dann auch noch sein erstes nicht-koscheres Essen auf dem Weg zu seinem Hebräischlehrer gegessen, dann würde unser Therapiegespräch wohl folgendermaßen verlaufen:
Dr. Yalom: Irvin, alles, was du mir über deine Bar Mizwa gesagt hast, bringt mich zu der Frage, ob du unbewusst gegen deine Eltern und deine Kultur aufbegehrst. Du sagst, du bist ein glänzender Schüler, immer an der Klassenspitze, und dann entwickelst du, genau zu diesem wichtigen Zeitpunkt, wenn du ein jüdischer Erwachsener werden sollst, plötzlich eine unerklärliche Pseudo-Demenz und kannst keine andere Sprache lernen.
Irvin: Bei allem gebührenden Respekt, Dr. Yalom, da bin ich anderer Meinung: Es ist durchaus zu erklären. Tatsache ist, dass ich sehr schlecht in Sprachen bin. Tatsache ist, dass ich nie in der Lage war, eine andere Sprache zu lernen, und ich glaube, das werde ich auch nie können. Tatsache ist, dass ich in allen Fächern in der Schule sehr gut bin, außer einem Gut in Latein und einem Befriedigend in Deutsch. Und Tatsache ist auch, dass ich kein musisches Gehör habe und nicht singen kann. Beim Singen in der Klasse bat mich der Musiklehrer ausdrücklich, nicht zu singen, sondern leise zu summen. Alle Freunde von mir wissen das, und sie wissen auch, dass ich niemals die Melodie einer Bar Mizwa-Lesung hätte singen oder eine fremde Sprache hätte erlernen können.
Dr. Yalom: Aber, Irvin, ich möchte dich daran erinnern, dass es nicht um das Erlernen einer Sprache geht – vermutlich verstehen nicht einmal fünf Prozent der amerikanischen jüdischen Jungen den hebräischen Text, den sie bei ihrer Bar Mizwa lesen. Deine Aufgabe war nicht, Hebräisch sprechen oder verstehen zu lernen, deine einzige Aufgabe war, ein paar Laute zu lernen und ein paar Seiten vorzulesen. Wie schwer kann das sein? Es ist eine Aufgabe, die jedes Jahr Zehntausende von Dreizehnjährigen meistern. Und davon sind viele gar keine Spitzenschüler, sondern mittelmäßige oder sogar schlechte Schüler. Nein, ich wiederhole es, dies ist kein Fall von akutem Gedächtnisverlust mit fokalen Ausfällen: Ich bin sicher, es gibt eine bessere Erklärung. Erzähl mir mal mehr über deine Gefühle darüber, ein Jude zu sein, und über deine Familie und deine Kultur.
Irvin: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Dr. Yalom: Denk einfach mal laut darüber nach, wie es ist, mit dreizehn Jahren ein Jude zu sein. Lass deinen Gedanken freien Lauf, ohne sie zu zensieren – sag, was dir in den Sinn kommt. Wir Therapeuten nennen das freie Assoziation.
Irvin: Freie Assoziation, puh. Einfach laut denken? Wow! Also, ich versuch’s mal. Jüdisch sein …das auserwählte Volk Gottes … was für ein Witz für mich – auserwählt? Nein, im Gegenteil … jüdisch sein hat für mich keinen einzigen Vorteil … ständige antisemitische Äußerungen … sogar Mr. Turner, der blonde, rotbackige Friseur nur drei Läden vom Geschäft meines Vaters entfernt, nennt mich »Judenbengel«, wenn er mir die Haare schneidet … und Unk, der Sportlehrer, ruft »Mach schon, Judenjunge«, wenn ich vergeblich versuche, das Seil, das von der Decke der Turnhalle hängt, hochzuklettern. Und die Beschämung an Weihnachten, wenn andere Kinder in der Schule von ihren Geschenken erzählen – ich war das einzige jüdische Kind in meiner Grundschulklasse, und ich habe immer gelogen und so getan, als hätte ich Geschenke bekommen. Ich weiß, dass meine Cousinen Bea und Irene ihren Klassenkameradinnen erzählen, dass ihre Chanukka-Geschenke Weihnachtsgeschenke sind, aber meine Familie hat im Laden zu viel zu tun, so dass es an Chanukka keine Geschenke gibt. Und in meiner Familie runzeln sie die Stirn darüber, dass ich nicht-jüdische Freunde habe, insbesondere schwarze Kinder, die ich nicht mit nach Hause bringen darf, obwohl ich regelmäßig bei ihnen zu Hause spiele.
Dr. Yalom: Also, mir scheint klar, dass du unbedingt dieser Kultur entfliehen willst und dass deine Weigerung, Hebräisch für deine Bar Mizwa zu lernen, und dass du Traif auf dem Weg zum Hebräischunterricht isst, alles in allem nur eines sagen, und das laut und deutlich: »Bitte. Bitte. Holt mich hier raus!«
Irvin: Dagegen lässt sich schwer etwas sagen. Und meine Familie muss das Gefühl haben, dass sie in einem schrecklichen Dilemma ist. Sie wünschen sich etwas anderes und Besseres für mich. Sie wollen, dass ich in der Welt da draußen Erfolg habe, und zugleich haben sie Angst vor dem Ende ihrer eigenen Welt.
Dr. Yalom: Haben sie dir das je gegenüber zum Ausdruck gebracht?
Irvin: