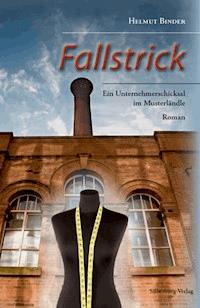5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie war es, in den Vorkriegsjahren Kind und im Krieg Jugendlicher zu sein? Widersprüche, Annahmen, Gepflogenheiten - Wilhelm hat viel nachgedacht und schildert die Jahre zwischen etwa 1933 (er ist 1927 geboren) und 1948 aus seiner Sicht als Kind und Heranwachsender, als Abiturient und Student. In der Zwischenzeit hat Helmut Binder alias Wilhelm Debrin viel gelesen und flicht Erkenntnisse und Einschätzungen in den Text, die er in 95 Lebensjahren gewonnen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Unpassende Fragen
Ein Zeitzeuge des Alltags zwischen den Frieden
1927 - 1948
Binder, seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht eines Tages im Zuchthaus landen
Inhalt
Cover
Titelblatt
Zwischen den Frieden
Nie wieder Krieg
Doch die Frauen weinten
Unpassende Fragen
Identität und Kritik
Wilhelm Debrin
Plötzlich „dabei“
Erscheinungsfest
Bibel und Krippenspiele
Warum hat Gott nicht geholfen?
Langeweile war strafbar
Neid ist Dummheit
„Im Dienst“
Auf dem Dorf
Das Husele
Gemeinsam geschafft
Zum Dritten Reich
Schicksalsjahr 1933
Die eigene Ansicht
Feiertage
Evangelische Feiertage
Fasnet
Maientag
Ofentüren sind offen
Nach der Machtübernahme
Volksgenossen
Der Bessere hat Pflichten
Gute Zeiten, bessere Zeiten
Mit freundlichen deutschen Grüßen
Olympiade
Die Synagoge brennt
Die katholische Hochzeit
Gemeinde und Partei
Christus wurde arisiert
Wohlzutun vergesset nicht
Juden verschwinden
Der Judenstern
Garnisonsstadt
Wer Erfolg hat, hat Recht
Seid untertan der Obrigkeit
Inland
England als Vorbild
Sieger sind harte Männer
Oberschule
Lehrer
Die neue Schrift
Sport
Jungvolk
Vom Kind zum Mann
Die Nachrichten-HJ
„Der“ Radio
Zwischen Himmel und Erde
Gemeinnutz geht vor Eigennutz
Das gefüllte Täubchen
Volk ohne Raum
Hitlers Ost-Pläne
Vom Glauben an das Gute
Gerüche und Erinnerungen
Eintopfsonntag
Der Quartalssäufer
Die Zeitung
Die verpönte Zeitung
Vor dem Kriegsausbruch
Es wird ernst
Doch die Frauen weinten
Seit vier Uhr fünfundvierzig wird zurückgeschossen
Der Sarrasani und „die Welt“
Friedenserwartungen
Norwegen
Frankreichfeldzug
Waffenstillstand von Compiegne
Italienische Probleme
Altmaterial sammeln
Energiesparen
Räder Müssen rollen für den Sieg
Geheimhaltung
Luftschutz
Schutzgesetze
Waffen-SS
Der Flug des Rudolf Heß
Russland
Landkarten
Skispende
Kleines Tapferkeitsprogramm
Ferienarbeit
Das Mädchen mit dem Wassermann
Der Erzfeind?
Kartoffelkäfer
Stalingrad
Ende der Produktion
Erntehilfe
Der erste Kuss
Luftwaffenhelfer
Soldat im Werden
Die Kanone auf dem Turm
Hitlers Elitesoldaten
Gastspiel zu Hause
Reise nach München
Gastspiel als HJ-Führer
Not macht fleißig
Rache – wozu?
RAL Prinz Eugen
Hat Gott selber ihn beschützt?
Das Attentat
Die SS und andere
„Die Bombe hat nichts getaugt“
Von der Propaganda
Der Krieg kommt näher
Und daheim?
Letztes Aufgebot?
Das Aus
Ardennenoffensive
Dresden
Rekrut in Halle an der Saale
Brautpflege
Die Braut des Soldaten ist sein Gewehr!
Und in der Heimat …
Wachdienst
Jabo-Angriff
Wo bitte geht 's zur Front?
Was ist Moral?
Das Organisieren beginnt
Aussichtslos?
Hilfsbereitschaft
Hitler ist tot
Frei vom Fahneneid
Heimkehr
Nachkriegszeit
The war has end
Frauen als Kriegsbeute
Kriegsgefangenenpost
PG ins KZ
Einbahnstraße für die Wahrheit
Arbeit als „Stromer"
Nach Vorne blicken
Schule beginnt
Tanzstunde
Die Zwei im Jeep
Schülerstreiche
Die neuen Zeitungen
Schule und Studium
Der Führerschein
Abitur, 12.06.1946
Zwengers Sieg?
Studium
Entnazifizierung
Beginn des Studiums
Pritsche und Plumpsklo
Der vermisste Freund
Die Eier der Frau Krieg
Der Unbekannte
Herbert Wehner
Fröhliche Endzeitstimmung
12. Juni 1948 – 21. Geburtstag
Das flotte Mädchen
Währungsreform
Soziale Marktwirtschaft
Das Jedermannprogramm
Diplomarbeit
Ab in die Realität
Urheberrechte
Unpassende Fragen
Cover
Titelblatt
Zwischen den Frieden
Ab in die Realität
Urheberrechte
Unpassende Fragen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Zwischen den Frieden
Der New Yorker Börsenkrach von 1929 hat den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland und Europa beendet.
Die neue Not hat den Boden bereitet für alles was danach gefolgt ist.
Die Kriegseröffnung am 1. und 3. September 1939 hat den Frieden beendet.
Der Kriegsbeginn mit Amerika im Dezember 1941 hat den Krieg zum Weltkrieg gemacht.
Der Tod Hitlers am 30. April 1945 hat die Diktatur in Deutschland beendet.
Die Kapitulation Großdeutschlands am 8. Mai 1945 hat die Kriegshandlungen beendet.
Die Währungsreform vom 20. Juni 1948 hat die Kriegswirtschaft beende
Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag
Der Elysée-Vertrag von 1963 begründete den Frieden im Herzen Europas.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 beendete den Kalten Krieg und sicherte den Frieden in Europa für weitere drei Jahrzehnte.
Wir waren in Verdun und haben Mehr als 300 000 Gräber gesehen Und wir haben geweint.
Wir haben das Grab von De Gaulle besucht Und wir haben uns verneigt
Usch und Helmut Binder, 25. Juli 1996
Nie wieder Krieg
Es war eine der ersten politischen Parolen, an die ich mich erinnere: Nie wieder Krieg! Von wem ich sie zuerst gehört habe, weiß ich nicht mehr so richtig. Halt jemand von „den Älteren“. Damals, als es mit meiner Schreibkunst noch nicht weit her war, waren „die Älteren“ solche, die etwa so alt waren wie meine Eltern, also Onkel und Tanten, die Nachbarn und wer sonst noch gelegentlich von „damals“ erzählte, als die Leute nichts zu essen hatten und frieren mussten, weil es auch keine Kohlen gab zum Heizen.
Ich war fünf Jahre alt und konnte schon ein bisschen lesen. Eben das, was so auf den Plakaten stand, die wegen der Wahlen an den Litfaßsäulen klebten. Mein Vater war im Krieg gewesen. So viel wusste ich. Auch die Väter der Nachbarskinder, der Herr Schmid, der Herr Schaile, oder wie sie sonst noch hießen. Die Häuser auf unserer Straßenseite waren von Handwerkern aus der Bauwirtschaft erbaut worden, die sich zusammengeschlossen haben, um sich selbst Aufträge zu geben, als das Geld zum Bauen knapp war. Die Häuser auf der anderen Seite soll die Stadt gebaut haben für Kriegsinvaliden und Hinterbliebene.
In der Nachbarschaft gab es auch einige Frauen, von denen ich hörte, dass ihre Männer im Krieg gefallen seien. Gefallen sind wir Kinder ja auch oft, aber das war gar nicht schlimm. Man stand wieder auf und lief weiter. Aber die im Krieg gefallen waren, die gab es gar nicht mehr. Die waren tot, erschossen von den Feinden. Und irgendwo begraben, in Frankreich, wo die Feinde wohnten. Die hatten jahrhundertelang immer wieder Deutschland überfallen, weil ihre Könige bei uns herrschen wollten. Napoleon und ein König Ludwig waren die Namen, die man in diesem Zusammenhang so hörte. Früher, also lange bevor es mich überhaupt gab, hatten die Franzosen auch unser Land besetzt. Manche Worte aus der schwäbischen Alltagssprache erinnerten daran: Plafo, Suttrai oder Waschlavor. Wie man die schreibt, habe ich später in der Schule nicht gelernt. Denn dort sagte man dazu korrekt Zimmerdecke, Untergeschoss oder Waschbecken.
Wann man das gehört hat, also wann ich das gehört habe, also vom Krieg, von den Franzosen und von deren Wörtern, kann ich nicht mehr sagen. Wohl so im Lauf der Jahre, immer mal wieder in einem anderen Zusammenhang und immer wieder von anderen Leuten. Als ich dann fünf Jahre alt war, sechs und noch älter, war ich sicher, dass Krieg etwas Böses ist, das von den Franzosen kam. Irgendwann konnte ich die Zeitung lesen und sogar Bücher. Und irgendwie hatte ich auch erfahren, dass jetzt auch diese Franzosen keinen Krieg wollten. Das sagten die Erwachsenen, die zur gleichen Zeit lebten wie ich, also die Leute, die so alt waren wie meine Eltern oder wie meine Großmutter. Also jene, die auch im Krieg gewesen waren und wussten, wie schlimm so etwas ist.
Krieg bedeutete nicht nur Tote und Verwundete. Krieg brachte auch Hunger mit, von dem die Älteren manchmal erzählten. In diesen Erzählungen kam immer wieder das Wort Rübenwinter vor. Der muss schrecklich gewesen sein. Ein Jahrhundert später hat ein großes Nachschlagewerk noch darüber berichtet.
Doch die Frauen weinten
Wie ich darauf gekommen bin, mit 95 Jahren – in Worten: fünfundneunzig – also weit nach der Pensionsgrenze und keiner weiß, wie viele oder wenige Monate vor dem Tod – ein Buch über meine Jugend zu veröffentlichen, ein Buch, das vor vielen Jahrzehnten begonnen worden ist.
Gute Frage. Ich habe eine gute Antwort dazu:
Als Zwölfjähriger war ich dabei, als man aus dem Radio hörte, es sei jetzt Krieg. Minutengenau hatte es Hitler angegeben:
„Seit fünf Uhr fünfundvierzig wird zurückgeschossen“.
Tag für Tag, Stunde um Stunde, war man seit Wochen gespannt, was die Zeitung oder das Radio als neue Nachrichten bringen würden. Die Namen von Ministern in Frankreich und England waren so oft genannt worden, dass ich ein paar davon noch heute weiß: Churchill, Daladier, Henderson, Mister Chamberlain, der mit dem Regenschirm, und Antony Eden, der Schöne. Dann auch der deutsche Außenminister von Ribbentrop und eines Tages ganz überraschend, der schnauzbärtige Molotow aus Russland. Dem sein Chef, der Stalin, von dem und seinen Bolschewiken uns Kindern schon in einer der ersten Volksschulklassen ganz böse Sachen erzählt worden waren, war plötzlich Partner eines Freundschaftsvertrages mit unserem Führer geworden.
Sie hatten alle ihren Friedenswillen beteuert. So wie zweiundzwanzig Jahre später Ulbricht versichert hat: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, während er schon das Baumaterial dafür bereitlegen ließ.
Nach allem, was ich in den Jahrzehnten danach erlebt, gehört, geglaubt habe oder gleich als Lüge ansehen musste, neige ich heute der Ansicht zu, dass fast alle tatsächlich den Frieden wollten – falls die Anderen taten, was man man von ihnen verlangte.
Heute versichern wieder alle, selbst ganz friedenswillig zu sein, aber die Anderen seien unberechenbar, mal ist es Putin, mal Kim in Korea oder Erdogan in der Türkei, der Herrscher im Iran oder sein Gegenspieler in Tel Aviv.
Gorbatschow, dessen besonnenes Handeln vor drei Jahrzehnten Schlimmes verhütet und Gutes bewirkt hat, ist heute sehr besorgt und warnt vor einem Atomkrieg. Und Israels Netanjahu sieht einen Atomkrieg heraufziehen, falls der Westen Frieden mit dem „Gottesstaat“ Iran schließt. Er muss es ja wissen, denn er hat sie schon, die Bombe.
Ganz ehrlich – ich habe Angst. Nicht als Einziger, wie die Inhalte mancher Marginalien in diesem Buch beweisen. Doch einer meiner zwölf Enkel wies einst solche Bedenken beruhigend zurück mit den Worten: „Bis die ersten Bomben fallen, hast Du ein mehr als nur stattliches Alter erreicht.“ Eigentlich wollte er wohl sagen „… bist du sowieso schon tot.“
1939 hatte auch ich so eine fröhliche Meinung meinem Vater gegenüber, der damals allerdings gerade 42 Jahre alt war. Er hatte als junger Soldat in den verschlammten Schützengräben an der Somme seine Kameraden sterben sehen. Einen nach dem anderen.
Als ein Gesetz vorschrieb, dass er als Reservist Wehrübungen machen müsse, wählte er den Dienst beim Wehrmeldeamt seiner Stadt, in der Meinung, dass er dort geborgen sei. Er hatte Pech. Dort brauchte man ihn lange vor allen anderen. Er wusste damals mehr als andere. Doch im Krieg ersetzte man ihn dort, und er musste fern der Heimat Soldat sein.
Unpassende Fragen
Vorlaut?
„Binder, seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht eines Tages im Zuchthaus landen“. Der das sagte, war ein mir durchaus wohl gesonnener Lehrer, Parteigenosse mit dem runden Parteiabzeichen am Revers, wie viele meiner Lehrer, von denen einer sogar die Meinung vertrat, der Führer sei ein Prophet. Andere sagten dazu gar nichts. Stramme Parteigenossen oder Hundertfünfzigprozentige nannte man die einen. „Der muss halt dabei sein“, hieß es von anderen. Von denen, die weder
„dabei“ sein wollten, noch mussten, sprach man nicht in diesem Zusammenhang. So wie von den vielen Onkeln und Tanten in meiner Familie.
Aber - ich hatte wieder einmal eine unpassende Frage gestellt. An einen, der „dazu gehörte“. Ich wollte wissen, wie die Polen zu den deutschen Plänen stehen, ihr Land zu einer deutschen Kolonie zu machen und die früheren Besitzer zu Landarbeitern, zu Sklaven.
Nach dem Vorbild großer europäischer Staaten, z. B. England, Frankreich, Italien und Belgien wollte Hitler im Osten Gebiete erobern, das Land an Deutsche verteilen und die ursprüngliche Bevölkerung dazu zwingen, dieses Land zu bearbeiten - als Sklaven, wie in Europas Mittelalter oder Amerikas ganz großer Zeit.
Ich stellte ab und zu unpassende Fragen und brachte meine Umgebung in Verlegenheit. Denn manche Antwort konnte auch gefährlich sein. Oder unbequem. Nicht nur wegen der Partei. Auch die sich an die Bibel hielten, flüchteten sich gar zu leicht in die Antwort: „Das verstehst du noch nicht.“
Identität und Kritik
„Jetzt send die emmer no net fertig.“ So lautete mein erster Satz, an den ich mich erinnern kann. Und zwar ganz genau. Ich saß im Sportwagen, den meine Mutter zum Neubau meiner Eltern geschoben hatte. Als wir ankamen, waren Arbeiter dabei, im Pfosten des Gartentors den Briefkasten zu montieren.
Diese Szene hatte ich schon so oft vor Augen, dass ich sicher bin: sie stimmt. Damals war ich zwei Jahre alt. Vor einiger Zeit habe ich nachgeprüft, was zu prüfen war, fand auf Fotos den Briefkasten im Pfosten des Tores und den Gang zur Haustüre des Gebäudes, das seit mehr als fünfzig Jahren in fremden Händen ist. Und ich bin hingefahren und habe mir jenen Pfosten angesehen. Der Briefkasten ist darin auch heute noch so eingebaut wie damals.
„Du nimmst den Leser mit in die Gedankenwelt eines kleinen Jungen, eines Halbwüchsigen, eines an Erfahrung gereiften jungen Mannes. Dabei sieht man die Welt mit den Augen eines damals lebenden Menschen.“
So schrieb mir eine belesene Freundin, der ich das erste Manuskript zum Lesen gegeben hatte.
Wilhelm Debrin
Mehr als hundert Briefe aus jener Zeit sind es, und manches lässt sich an Hand von Belegen und Nachschlagewerken oft auf die Stunde genau zuordnen. Denken und Fühlen jedoch haben sich langsam entwickelt. Der „Ich“ von vor siebzig, achtzig oder gar neunzig Jahren ist der Selbe wie der Erzähler und doch nicht der Gleiche, der Mann im Greisenalter ist nicht mehr der plappernde Zweijährige, nicht mehr der stolze ABC-Schütze und nicht mehr der Schüler und Pimpf, der gleichermaßen pflicht- wie selbstbewusste Soldat, auch nicht der Achtzehnjährige, der nach zwei Jahren Soldatenzeit wieder die Schulbank drückt und Schülerstreiche genießt, daneben aber politische Aufsätze schreibt, nicht mehr der unerfahrene Student. Doch die Neugier ist geblieben. Und die Selbstständigkeit im Denken, die in Schulzeugnissen erwähnt ist.
Alles habe ich einem Alter Ego zugeordnet. Der ist ein junger Mensch von zwei bis zweiundzwanzig Jahren, ohne besondere Auffälligkeiten, und trägt darum einen Vornamen, wie er damals häufig war. Er hat das Wissen, das zu seinem jeweiligen Alter und Umgebung gehörte, das Denken und die Logik von damals und auch die Gefühle.
Ab jetzt ist von Wilhelm Debrin die Rede.
Und der alte Mann, der ich heute bin, erklärt manches aus der Zeit des Wilhelm Debrin etwas ausführlicher, um den Leser in die damalige Zeit vor und während des Krieges und die Zeit danach zu führen, und in ihm das Verständnis zu wecken für jene, die in diesen Verhältnissen zurecht kommen mussten. Und immer wieder war „eine neue Zeit“ mit neuen Anforderungen an uns Menschen, die sich anpassen mussten, als säßen sie auf einem Uhrzeiger, der sie hoch führt und abstürzen lässt – und dazwischen eine Ebene bildet zum Ausruhen.
Plötzlich „dabei“
Onkel Willy war bereits über neunzig, als er mir eine Geschichte dazu erzählt hat. Und ich war gute siebzig. Dass vorher jemand in der Familie davon gewusst hat, halte ich für unwahrscheinlich. Falls ja, wurde diese Sache bestimmt nur nach der Warnung wegen „offener Ofentüren“ besprochen, In Uniform hat ihn jedenfalls nie jemand gesehen. Ob er überhaupt eine hatte? Es war nämlich so: Er brauchte verschiedene Genehmigungen und Stempel von den Behörden, und da haperte es aus ihm unerklärlichen Gründen an einer Stelle. Als er einmal einen Schulkameraden traf, der es unter der neuen Regierung zu einem Posten gebracht hatte, klagte er dem sein Leid. „Weißt du, Willy“, sagte der, „wenn du mitmachen würdest, ginge die Sache besser voran. Ich gebe dir da einen Tipp.“ Und danach trat er dem harmlosesten „Verein“ bei, den es gab, dem NSKK – Nationalsozialistisches Deutsches Kraftfahrer Korps.. Und die Genehmigung kam.
Hier konnte man auf unverfängliche Weise dem Druck ausweichen, „beizutreten", womit die Partei selbst oder ihre SA gemeint waren. Ähnlich waren auch Fliegergruppen und ganz besonders das NSKK, Sammelbecken derer, die nach außen hin „mitmachen" mussten oder sollten, aber partout nicht wollten. Im NSKK versammelten sich, oft an Sonntag-Vormittagen, meist Geschäftsleute, auch solche, die gar kein Auto hatten.
Erscheinungsfest
Der sechste Januar war nicht nur als Endpunkt ein besonderes Fest, sondern auch im Wortsinne markant. Eigentlich heißt er ja so, weil da die Drei Könige erschienen seien. Bei den Debrin-Familien – nach und nach waren alle acht Geschwister verheiratet - "erschienen" die Verwandten aus Stuttgart. Und die aus Bad Cannstatt. Sie hatten ihre Touren rundum zu Mittagessen, zu Kaffee und Kuchen und zum Vesper. Alle freuten sich darauf, doch die "Cannstätter Tante" war ein bisschen gefürchtet. Vielleicht hatte sie nach dem frühen Tod ihres Halbbruders, dem Großvater Johannes, die Verpflichtung gefühlt, dessen Kindern das beizubringen, was sie, die Städterin aus Bad Cannstatt, deren Mutter vom Dorf wohl nicht zutraute. Noch ein Vierteljahrhundert später beurteilte sie Haushalt und Kochkünste von angeborenen und angeheirateten Nichten mit der Strenge einer Gutsherrin. "Keine macht so guten Kartoffelsalat wie die Cannstatter Tante", war geflügelter Spott in der Familie, wenn einer zu kritisieren anfing. Ihr Mann, ein Schuhmacher, war ein liebenswerter ruhiger Mensch.
Auch Vaters Onkel Friedrich kam regelmäßig während der Feiertage. Er war ein jovialer Mann, den alle gern mochten. Außer einigen Basen von Wilhelm. Die behaupteten, er wolle sie dauernd abküssen. Und dabei täte er auch noch fürchterlich sabbern. Wenn der kam, flüchteten sie. Als ich schon weit über achtzig war, hat mir ein Bäsle erzählt, dass sie sich aus Furcht vor ihm einmal eine halbe Stunde lang zu dritt ins Klo eingeschlossen haben.
Tante Berta, die Frau von Onkel Friedrich, sprach ein vornehmes „Frau-Oberlehrer-Schwäbisch“ mit einem ganz bestimmten Singsang, der Wilhelm vorkam wie ein abgespreizter Kleiner Finger an der Kaffeetasse, damals als „Stuttgarter Hochdeutsch" bespöttelt. Das war sie ihrer Stellung schuldig. Ihr Gatte war nämlich ein hoher „Beampter“ in Stuttgart - mit dem Titel „Herr Präsident". Die Stuttgarter Tante war die Schwester von Tante Julie, der Frau von Vaters Freund Gustav, der auch ein Beamter war. Zu dieser Familie gehörte nicht nur Erich, der mit seiner Kanone die Christbaumkugel abgeschossen hatte, sondern auch der Vater von der Tante Julie, mit dem schönen Namen Schäpperle.
Warum ist Abel tot?
Bibel und Krippenspiele
Über die Einleitung in den Krippenspielen musste Wilhelm immer wieder nachdenken. Denn alle diese Aufführungen begannen damit, dass ein hartherziger Wirt der hochschwangeren Maria Unterkunft und Hilfe verweigerte. Das stand aber gar nicht in der Bibel. Es kam ihm vor, als suchten fromme Pharisäer einen, auf den sie zeigen könnten mit den Worten: „Seht diesen geldgierigen Wirt - ich an seiner Stelle wäre ein viel besserer Mensch gewesen“. Zum Glück fiel nie auf ihn das Los, diesen bösen Menschen zu spielen. Ohnehin drängte es ihn keineswegs auf die Bühne, und so blieb er ein ruhiger Zuschauer, der nicht einmal seine Kritik am Stück laut sagte, denn er hatte gelernt, dass man alles, was mit der Kirche zu tun hatte, als gottgegeben hinzunehmen habe. So musste er allein und ungeprüft vor sich hin grübeln. Stoff genug gab es.
Zu der gängigen Behauptung, Josef und Maria seien arm gewesen, fiel ihm ein, dass doch Josef ein Zimmermann gewesen war, also ein Handwerker. Handwerker waren nie arm, denn es hieß doch immer, Handwerk habe einen goldenen Boden. Und in der Bibel stand sowieso kein Wort darüber, ob der Josef Geld hatte oder nicht. Und wenn ein Gasthaus belegt ist, ist eben kein Platz mehr da, ob der Wirt ein weiches oder ein hartes Herz hat. Und da „alle Welt“ unterwegs war um sich schätzen zu lassen, wie es bei Lukas hieß und wohl begründet war, wäre das gar nicht ungewöhnlich gewesen.
Außerdem wusste Wilhelm aus Geschichten von Missionaren, die in der Kirche von fernen Ländern erzählt hatten, aus Büchern, die Forschungsreisende geschrieben hatten, auch von Karl May, dass noch im neunzehnten Jahrhundert im Orient die Reisenden oft in Karawansereien übernachteten, wo sie im Freien, in Zelten oder in offenen Schuppen kampierten und für ihre Verpflegung oft selbst sorgten. Nach der Bibel waren Maria und Josef offensichtlich in einer solchen Herberge. Das muss damals ganz normal gewesen sein. Gleich daneben standen dann wohl die Reit- und Lasttiere der Gäste, falls sie beritten waren – auch Marias Esel. Für die Tiere gab es dann wohl Futterkrippen. So eine Krippe war doch ein geradezu ideales Kinderbettchen. Und auf Stroh schlief man ja sowieso. Auch in Europa noch zweitausend Jahre später. Was war daran schlimm?
Der Vater erzählte gerne aus der Sonntagsschule. Als er einmal einen seiner kleinen Schüler bat, die Lektion von der vorigen Stunde zu wiederholen, sprach der vom Kindermord zu Bethlehem durch den König Rodes. Vater Debrin verbesserte: Herodes. „Nein“, sagte der Bub trotzig, „zu dem Lumpen sage ich doch nicht Herr“.
Auch dieses Thema regt Fragen an: Die Weisen aus dem Morgenland hatten wertvolle Geschenke gebracht, vor allem Gold, mit dem sich die neugebackenen Eltern das Leben erleichtern sollten und das leicht einzutauschen war. Wieso also waren Maria und Josef in den Weihnachtsspielen als Flüchtlinge plötzlich arm, zogen zu Fuß und mit nur einem Esel nach Ägypten, stets in Angst vor den berittenen Schergen des Königs, der zu Bethlehem andere Kinder hatte umbringen lassen? Sie hätten sich doch einen zweiten Esel leisten können für Josef, und einen dritten für Gepäck und ein bisschen Komfort für das wertvolle Kind. Vielleicht hatten sie das vernünftigerweise auch getan, denn die wertvollen Geschenke hatten sie ja wohl kaum achtlos in der Herberge liegen lassen.
Warum hat Gott nicht geholfen?
„Warum hat Gott dem Abel nicht geholfen? Als der Kain kam und zugeschlagen hat, hat Abel doch gerade gebetet. Näher kann man Gott doch nicht sein? Warum, hat Gott nicht eingegriffen?“
Als er im Konfirmandenunterricht diese als eine seiner unpassenden Fragen an des Pastor stellte, wehrte der unwillig ab, als habe sich eine lästige Fliege auf seine Nase gesetzt.
Langeweile war strafbar
Geheizt wurde mit Holz und Kohle. Bauern aus dem Schurwald oder von der Alb zogen mit ihren Fuhrwerken durch die Straßen, um Brennholz zu verkaufen. Hinterher kam "die Säge" angefahren. Mit „Holz vor dem Haus“ verdiente ihr Besitzer sein Geld. Die Säge war ein Gefährt, das aus einer Eisenplatte, einem lauten Dieselmotor und vier Rädern bestand. Wenn sie durch die Straßen fuhr, saß der Fahrer auf der Eisenplatte, von wo aus er ein kleines Lenkrad bedienen konnte. An der Arbeitsstelle wurde dann an gleicher Stelle ein Sägeband aufgelegt. Es war endlos und lief über zwei große Räder. Man zersägte die Meterstücke vom Bauern zu handlichen „Rugeln“. Die haben dann abends die Väter mit Axt und Beil zu Scheitern gespalten. Natürlich war ein Bub unendlich stolz, wenn ihm der Vater zum ersten Mal ein Beil in die Hand gab, damit er es auch mit dem Holzspalten versuche. Wilhelm erinnerte sich lange an die sommerliche Hitze, bei der es zum Trocknen auf die Bühne getragen werden musste. Man musste es zu mannshohen Stapeln beigen mit sorgfältig geschichteten stabilen Pfeilern an den Enden: immer eine Schicht gleichmäßiger Scheite längs und dann eine quer. Der Spaltblock hatte seinen Platz neben der Hauswand, denn im Winter durfte Wilhelm aus den Scheitern Spächele machen zum Anfeuern, was einige Geschicklichkeit erforderte. Er empfand es daher als Ehre, dass der Auftrag dafür immer an ihn ging. Dafür bekam er dann allemal ein leichtes Küchenbeil in die Hand gedrückt, dessen lange Schneide auch die Treffsicherheit erhöhte.
Kohlen kamen erst kurz vor dem Winter, denn das Geld dafür gab man erst aus, wenn es nötig war. Nur wenige Nachbarn ließen sich die Kohlen von den Fahrern in schweren Säcken gleich in den Keller tragen. Das kostete nämlich extra. Meist wurden die Kohlen aber auf der Straße abgekippt und die Kinder hatten mit dem Transport wieder etwas zu tun. „Ihr sollt ruhig wissen, dass es nichts umsonst gibt, und im Winter wollt ihr es doch warm haben“.
Oft halfen die Buben aus der Nachbarschaft, denn auch die kriegten Holz und Kohle. Die Hilfe ging reihum. Über Nacht durfte nichts liegen bleiben. Zur Belohnung gab es hinterher ein kleines Vesper und ein Zehnerle. Bei manchen Müttern gab es auch nur ein Gsälzbrot, ohne Butter. Die hatten halt nicht so viel und das war dann auch recht.
Kohle hatte man in drei Formen: Schwarzglänzendes Anthrazit, Eierkohlen und Braunkohlebriketts. Die Briketts mussten im Keller raumsparend zu ordentlichen Mauern aufgesetzt werden.
Holzbeigen oder Brikettbeigen, war eine übliche Kinderarbeit für Regentage - und manchmal auch Strafarbeit für solche, die herumlungerten oder sich gar dazu verleiten ließen, über Langeweile zu klagen. Langeweile zu haben war ein strafbares Vergehen. Beim ersten Anzeichen davon reagierte Mutter sensibel: „Dir hab' ich ein Gschäftle“. Man sagte nicht Arbeit, sondern Geschäft, was mit schwäbischem Schaffen zu tun hat.
Mutter wusste immer, wo eine fleißige Kinderhand gebraucht wurde.
Neid ist Dummheit
Die Buben trugen sonntags Studentenmützen. Das war schick. Das Mädchen hatte nur Zöpfe. Buben trugen hohe Schnürstiefel. Das galt als wichtig für gesunde Füße. Auf den Fotos von damals hat Wilhelm eine "Radelrutsch" dabei, einen einfachen Roller aus Holz. Andere Kinder hatten damals Dreiräder, Tretroller und "Holländer", vierrädrige Gefährte, die vom Fahrer mit pumpenden Bewegungen über eine Kurbelwelle oder gar mit modernster Technik, über Kegelzahnräder angetrieben wurden. Diese Fahrzeuge waren natürlich viel schöner als das wackelige Dreirad oder die Radelrutsch, wie man damals die Kinderroller nannte. Aber sie waren zu teuer für eine Familie mit drei Kindern, deren Oberhaupt gerade dabei war, eine neue Existenz zu gründen. Da gingen die Debrins nicht mit der Zeit.
„Wenn andere etwas haben, ist das kein Grund dafür, dass ihr das auch haben müsst.", hieß es. Dahinter steckte nicht nur die dringend nötige Sparsamkeit, das war auch konsequente Erziehung zur unabhängigen Persönlichkeit, denn es galt als deutlicher Mangel von Selbstbewusstsein, wenn man etwas haben wollte, nur weil andere es haben. „Dafür sind wir uns zu gut", sagten übereinstimmend und sehr bestimmt die Eltern.
Diese Einstellung setzt aber gleichzeitig ein klares Maß an Toleranz und Großzügigkeit voraus. Denn weder soll das Ansehen anderer beschädigt werden, das die durch den Besitz genießen, noch darf die Selbstbewertung durch einen Mangel an vergleichbarem Besitz negativ beeinflusst werden.
„Wenn einer etwas Schönes hat, das du selber nicht bekommen kannst, dann gönne ihm das. Mache nie den Fehler von Dummen, die das dann heruntersetzen. Lass dich nie dazu hinreißen, anderen etwas zu missgönnen, denn Neid tut weh und bringt nur Feindschaft, aber keine Vorteile. Neid ist Dummheit“.
„Im Dienst“
Großmutter, eine zierliche Frau, die nach Großvaters Tod nur noch in schwarz ging, stammte aus dem sonnigen Markgräfler Land jenseits des Schwarzwaldes. Dort mag man es französisch und wohl darum hatte sie bei der Taufe auch die französische Namensvariante Marie erhalten. Sie war zum obligaten „Dienst" als Kindermädchen in Paris gewesen. Heute nennt man das Au-pair-Mädchen. Die Arbeit in einem möglichst vornehmen Haushalt galt als Ausbildung in Hauswirtschaft und Voraussetzung für eine gute Ehe. Großmutter konnte wunderschöne Handarbeiten machen. Vor allem auch lustige Scherenschnitte und andere Papierkunstwerke falten, mit denen sie die Kinder begeistert hat.
Einmal brachten ihr die Debrins ihre Minka mit zum Mäusefangen, eine grau getigerte Katze. Die Buben trugen sie abwechselnd in einem Sack bis zur Karlstraße. Nach drei Tagen war die Minka wieder zu Hause. Sie hatte sich ganz allein quer durch die Stadt gesucht. Das imponierte den Kindern mächtig. Doch wie sie das geschafft hatte, wusste keiner.
Auch die Großeltern hatten ihre Tochter Pauline, das Päule, "in Stellung" geschickt, in einen vornehmen Villenhaushalt in Mannheim. Erstklassige Schulzeugnisse des Mädchens und einwandfreier Leumund der ganzen Familie seien Bedingung für eine solche Anstellung gewesen. Sie galt als Auszeichnung. Bei der Herrschaftsköchin lernte Päule hervorragend kochen und wirtschaften. Und nach einige Jahren "im Dienst" war der Grundstock verdient für eine kleine Aussteuer, deren Qualität an der vom Herrschafts-Haushalt gemessen wurde, wo solide und schön hoch gehalten wurden. Manch gutes Stück darin war ein Geschenk „ihrer Herrschaft“, wie die Mutter von diesen Leuten sprach, auch als sie schon längst selber zu den Arbeitgebern zählte. Dass das Juden waren, störte niemand, auch nicht als „Die“ über die Juden schimpften. Über so etwas stand man in der Familie, denn mit „Denen“ hatte man nichts gemein. Tante Lydia war bei Lenz angestellt, einem großen Kaufhaus. Und dort war sie eng befreundet mit der gleichaltrigen Tochter. Bis 1938, als die jüdische Familie emigrierte und vorher das Geschäft an einen Angestellten verkaufte, der es wohl verwahren sollte bis in die Zeit „danach“.
Die ältere Schwester von Mutter, die Tante Marie, war sogar in einem richtigen Schloss bei einer Familie von altem Adel im Dienst gewesen. Dabei hatte sie einen strammen Handwerksmeister kennen gelernt und geheiratet, den Onkel Fritz, der sein großes Installationsgeschäft gegenüber vom Schloss hatte und immer so lustig war.
Auf dem Eckgrundstück neben den Großeltern war der Gäules-Keller, eine Fabrik, die Holzpferde herstellte. Im Sommer konnte man durch ein offenes Fenster in den Raum sehen, in dem die Schaukelpferde weiß gestrichen wurden. Am nächsten Tag war die Farbe getrocknet. Dann wurden schwarze Punkte aufgemalt, sowie Satteldecke und ein brauner Sattel. Ganz zum Schluss bekamen die Apfelschimmel auch noch ein rotes Zaumzeug aus Lederriemen angenagelt und wurden auf ihre Kufen montiert. Gar zu gerne hätten die Buben so ein Pferd gehabt, aber dafür hatten die Eltern kein Geld. In der „Gäulesfabrik“ schreinerten die Arbeiter auch Steckenpferde und Spielzeugpferde mit richtigen kleinen Wagen, auf die man Sachen laden konnte. Und einmal sahen die Kinder durchs Werkstattfenster sogar Pferde für ein Karussell, herrliche weiße Pferdchen zum Draufsitzen. Zum Jahrmarkt, der auf der Freifläche der Karlsallee abgehalten wurde, kam jedes Jahr so ein Karussell.
Dann schenkte der Großvater den Kindern ein „Zehnerle“ als „Marktromet“, womit sie einmal Karussell fahren oder türkischen Honig kaufen konnten, oder Zuckerwatte. An einem Stand gab es auch einen Taucher zu kaufen. Das war ein fingergroßes Männchen aus Glas, das man in eine mit Wasser gefüllte Flasche steckte. Oben drauf kam eine Gummikappe. Wenn man auf die drückte, ging das Männchen nach unten, wenn man losließ, kam es wieder hoch.
Manchmal gab auch der Herr Schwab noch eine Kleinigkeit. Der musste überhaupt etwas Besseres sein. Wilhelm schloss das aus dem Firmenschild neben der Haustüre. Er hieß Viktor mit Vornamen. Nach dem schönen Lied, wo es drin hieß "Gloria Viktoria, mit Herz und Hand fürs Vaterland", oder so ähnlich. Wilhelm kannte es von Großvaters Schallplatten. Auch wenn Vaters Geschwister sangen, hatte er das Lied ab und zu gehört.
Herr Schwab hatte einen Raum im Parterre gemietet. An dessen Tür war ein Schild, auf dem stand „Comptoir“. Seine Ware, Fässer mit Öl, stand im Hinterhof. Wenn Kunden mit ihren Kannen zu ihm kamen, zog er mit einer Handpumpe das Gewünschte aus dem richtigen Fass, dickes Schmieröl für schwere Maschinen, Knochenöl für feine Getriebe und Motorenöl für die Automobile.
Vor Ostern schenkte Herr Schwab den Kindern immer Matzen. Mit Begeisterung aßen die Kinder die dünnen weiß-braunen trockenen Fladen. Es war ein ganz besonderes Brot, das es nur bei Juden gab, zum Gedenken an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Damals hatte es nämlich so pressiert, dass keine Zeit geblieben war, den Brotteig für die Marschverpflegung vor dem Backen ordentlich gehen zu lassen, erklärte der Vater.
Irgendwann erfuhren die Kinder, dass der Herr Schwab nach Amerika ausgewandert sei. Das Geschäft habe er dem Fräulein Nill überschrieben, das war die Blonde im Büro. Die Ölfässer waren aber eines Tages nicht mehr da. Auch das Fräulein Nill sah man nicht mehr.
Auf dem Dorf
Das Husele
Wilhelm verlebte die schönsten Ferien in Schlat, dem Dorf, aus dem die Mutter seines Vaters stammte. Nur wenige Bauern dort konnten sich Pferde leisten. Man nannte sie Gäulbauern. Die anderen, die Kühbauern, spannten Kühe vor den Wagen, Allzwecktiere, gut für das Ziehen von Pflug und Wagen, zur Milcherzeugung und Kalbsbratenproduktion und zum Schluss für Suppenfleisch.
Als Stadtkind hatte Wilhelm keine Ahnung von den beiden letzten Punkten. So konnte sich Wilhelm, auf Ferien bei Vaters Bases, der Tante Rosa, unbefangen anfreunden mit einem neugeborenen Kälbchen, in der freundlichen Bauernsprache des Dorfs als Husele bezeichnet. Er war glücklich, wenn die raue Zunge an seiner Hand nuckelte und die großen Augen ihn anguckten. In akustischem Missverständnis rief er das Kälbchen Susele.
Dieser Kinderfreundschaft zuliebe wurde das Tierlein nicht verkauft und als Susi eine Prachtkuh, der noch fünfzig Jahre später die Tante besondere Intelligenz nachrühmte. Als sie, die Tante, schon neunzig war und nach der Pensionierung ihres Schwiegersohns, einem Pfarrer, wieder in ihr geliebtes Schlat zurückgekehrt war, hat Wilhelm sie besucht. Und da war es ihr ganz wichtig, ihm eine kleine Geschichte über seinen damaligen Liebling zu erzählen. So habe sie eines Tages auf der Heimfahrt vom Feld ihrer Leitkuh Susi mit dem Leitseil den Befehl gegeben, vom gewohnten Weg nach rechts abzubiegen. Die aber sei stur geradeaus weiter gegangen. Mit der Peitsche habe sie ihr Gespann dann zum Gehorsam gezwungen. Von da ab habe die Susi an jener Wegkreuzung - und nur an dieser – jedes Mal gewartet und den Kopf gedreht, als wolle sie fragen, wohin es heute gehen soll.
Als Wilhelm diese Geschichte hörte, fragte er sich, ob ihn die Kuh vielleicht doch erkannt hat, als er nach dem Krieg einmal nach Schlat gekommen war und die Tante ihn in den Stall führte. Susi hatte auffällig oft zu ihm hergeschaut.
Gemeinsam geschafft
Als kleiner Bub marschierte Wilhelm damals zur Heuernte in aller Frühe tapfer mit aufs Feld, zwischen Tante Rosa und dem Bäsle Lina. Dabei waren noch die Hirschwirts-Rosa und ihre Hilde. Verwandte schafften zusammen nach dem Motto: Heute euer Feld und morgen unseres. Falls die Männer, der kurzbeinige Onkel Michel, der schnauzbärtige Hirschwirt und der große Vetter Ernst, nicht schon um vier „zum Schneiden“ gegangen waren, gingen alle miteinander, die Männer mit ihren Sägetsa wie die Sensen genannt wurden. Die Mannda, also die Männer, wussten rein gar nichts anzufangen mit dem kleinen Feriengast. Der durfte nur bei den Frauen mit. Und so trug er voller Stolz einen Rechen geschultert wie Tante und Base, trotzdem das lange Ding dauernd Übergewicht kriegen wollte. Zuerst ging es allemal auf die am Vortag gemähte Wiese zum Spreizen. Da wurden die Schochen auseinander gerissen und das halbtrockene Gras auf der Wiese ausgebreitet. Am Hang, und da lagen fast alle Wiesen, weil das Gelände dort halt buckelig ist, fing man unten an und wenn man oben war, gab es Vesper aus dem Henkelkorb, der mit einem rot-weiß karierten Tuch zugedeckt war. Den Most und das Wasser hatte man gleich bei der Ankunft in einem Wassergraben oder sonst wo im Schatten kühl gelagert.
Danach ging die zweite Runde los, das Wenden. Dabei war der Holzrechen flach und schnell über den Boden zu ziehen und mit einem Ruck so abzuheben, dass er mit seinen dicken Holzzähnen einen Schwaden Heu mitnahm und und wendete, um die bisherige Unterseite nach oben zu bringen. Das Wort Ergometrie kannte zwar außer den Gelehrten damals kein Mensch, aber der Anstellwinkel der Heurechen war in Jahrhunderten ergometrisch genau richtig entwickelt worden - für Erwachsene. Der kleine Junge aber erntete nur Frust damit, weil er im Boden hängen blieb. Denn um den richtigen Anstellwinkel zu haben, musste er den Stiel ganz unten anfassen, konnte nur kurze Züge damit ausführen und riskierte bei jeder Bewegung, dass der lange Rechenstiel das Übergewicht kriegte. Manchmal ging es zuerst auf die von den Männern frisch gemähte Wiese. Dort lag das taufeucht gemähte Gras in Schwaden, die mit Rechen und Gabeln ausgebreitet – gespreizt - wurden. Zum Mittagessen gingen alle heim, jede Familie zum eigenen Herd, zu dem die Hausfrau sich schon früher auf den Weg gemacht hatte. Und am Nachmittag war vielleicht zuerst eine andere Wiese dran. Gegen Abend rechten alle miteinander das halbfertige Heu zu Reihen zusammen und daraus wieder schob man für die Nacht kleine Haufen zusammen. Das nannte man „Heu häufala“. Falls aber Regen zu befürchten war, machte man möglichst große Schochen, damit im Falle des Falles nicht zu viel von der kostbaren Ernte nass werde.
Ein kleines Fest war das Einfahren von Heu. Aus den kompakten Transportwagen für Mist und Saatgut im Frühjahr waren Leiterwagen mit enormem Fassungsvermögen geworden. Die Männer hatten die stabilen Seitenbretter der hochrädrigen Wagen im Umbausatz gegen breite Leitern getauscht. Zwei kräftige Männer gabelten das Heu von links und rechts auf den Wagen, wo es Erwachsene abnahmen und fachgerecht so setzten, dass die Ladung ein großes Rechteck bildete. Zum guten Schluss legte man den Ladebaum auf, eine dicke Holzstange, die vorn und hinten so weit über die Ladung ragte, dass man sie mit Stricken mit den Enden der Leitern verbinden und ordentlich festzurren konnte. So wurde die ganze Ladung zusammengepresst und stabilisiert. Falls der Lader nicht sauber arbeiten würde, könnte der Wagen auf dem Heimweg kippen. Wer aber „umkeie dät“, hätte nicht nur die Mehrarbeit sondern müsste noch jahrelang den Spott des Dorfes fürchten. Die gefügigen Kühe des Gespanns durfte Wilhelm auf dem Feld in passenden Abständen um jeweils eine Wagenlänge nach vorne dirigieren und dazwischen mit dem Breamawedel - einer Art Besen oder auch nur ein Zweig vom nächsten Busch - übelriechendes braunes Öl – Breama-Öl - auf ihrem Fell verteilen, um ihnen so die geflügelten Quälgeister, die Bremsen – d' Breama - vom Leibe zu halten. Es gab da riesige Exemplare, die größer waren als der Daumen eines kleinen Buben. Wo die gestochen hatten, quoll oftmals das Blut in dicken Tropfen. Wenn sich so ein hässliches Insekt am Hals oder einer anderen großen Fläche der Kuh festgesaugt hatte, konnte man es totschlagen. Dann spritzte Blut aus dem heraus. Oft flogen auch ganze Schwärme von ekligen Schmeißfliegen an, die in allen Regenbogenfarben schillerten. Diese Insekten saßen besonders viel an empfindlichen Stellen, den Nüstern und Augen, wo man nicht hinschlagen konnte und denen man mit dem Giftzeug nicht zu nahe kommen durfte. Diese Stellen suchte Wilhelm darum voller Mitleid mit einem frischen Zweig freizuhalten. Dabei fand er die Redewendung, „soviel geht auf keine Kuhhaut“, sichtbar begründet. Man sagte doch so, wenn einer ganz viele Lügen erzählte - Lügen waren wie Schmeißfliegen – in vielen Farben schillernd und schwer zu fassen. Der kleine Mann war auch mit Nachdenken voll beschäftigt.
Ein Heuwagen konnte noch so schwer sein, auf dem Heimweg brauchte man die Zugtiere nicht anzutreiben. Die Kühe zogen ihre Last dem kühlen Stall zu, so schnell sie nur konnten. War der Wagen glücklich in der Scheuer, wurde erst einmal das Vieh versorgt.
Zum Dritten Reich
Dem „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“, das bis zur Auflösung durch Napoleon im Jahr 1806 bestanden hatte, war 1871 die Neugründung als Zweites Deutsches Reich gefolgt. Mit dem Rücktritt des Deutschen Kaisers 1918 war es zu Ende gegangen. Hitler wollte es wieder auferstehen lassen und seine Anhänger führten mit seinem Machtantritt die Bezeichnung „Drittes Reich“ ein.
Schicksalsjahr 1933