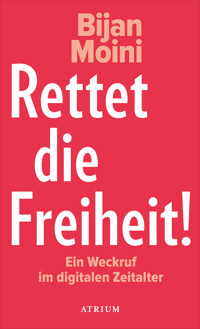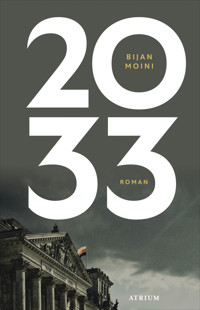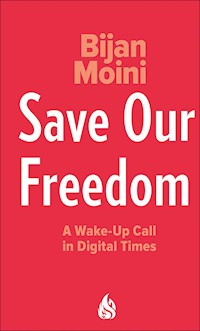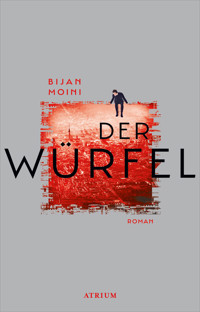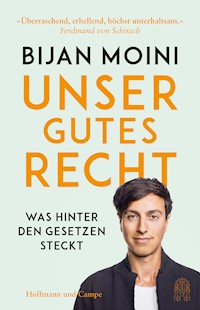
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Überraschend, erhellend und höchst unterhaltsam." – Ferdinand von Schirach In diesem Buch erzählt der Anwalt und preisgekrönte Autor Bijan Moini, was es mit unserem Recht auf sich hat: wer hat es sich wann und warum ausgedacht und wie bestimmt es ganz konkret unser Leben? Unschuldsvermutung, Streik oder Meinungsfreiheit – viele rechtliche Errungenschaften sind für uns heute selbstverständlich. Bijan Moini erzählt anschaulich von dem weiten Weg, den wir zurückgelegt haben, um zu unserem Recht zu kommen – und von den Menschen, die es formten. Anhand vieler Beispiele zeigt er, dass unser Rechtssystem entgegen mancher Unkenrufe von Gerechtigkeit geprägt ist – indem es Einzelne vor dem Staat schützt, die Schwachen vor den Mächtigen oder Verdächtige vor dem Mob. Ein spannender Blick auf Geschichte und Gegenwart unserer Gesetze.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bijan Moini
Unser gutes Recht
Was hinter den Gesetzen steckt
Hoffmann und Campe
Für meine Familie
Einleitung
Die wichtigsten Dinge im Leben wissen wir oft erst zu schätzen, wenn sie verloren sind. Gesundheit, Liebe, Sinn. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist schade, denn sie sind die Quellen unseres Glücks. Quellen, die heute reicher sprudeln als je zuvor: Wir leben gesünder, lieben freier, und unserem Streben sind kaum Grenzen gesetzt. Krieg ist den meisten von uns fremd geworden, Freiheit dafür selbstverständlich. Und Gerechtigkeit ist heute nichts, was nur ein Adliger von einem anderen verlangen kann, sondern jeder Mensch von jedem anderen. Dieses Buch handelt vom Anteil unseres Rechts an diesem Glück.
Die heutigen Gesetze sind die Früchte langer Kämpfe, ein Sieg der Vernunft über den Instinkt, des Friedens über den Krieg, der Freiheit über den Zwang und der Gerechtigkeit über die Willkür. In ihnen steckt viel Geschichte, stecken menschliche Schicksale voller Freude und Leid, Triumph und Niederlage. Das Ergebnis dieses Prozesses hält die Gesellschaft zusammen wie wenig sonst. Und doch wird unser gutes Recht kaum geschätzt, im Gegenteil: Oft löst es Unbehagen aus, weil es als anstrengend und unzugänglich empfunden wird. Das ist nicht nur schade, sondern auch gefährlich. Denn wenn wir das Recht nicht schätzen, halten wir auch nicht an ihm fest. Und das kann uns kosten, was wir eben noch für selbstverständlich gehalten haben.
Schätzen kann man besser, was man versteht. Warum ist unser Recht so, wie es ist? Und wie sichert es Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit? Das sind die zentralen Leitfragen dieses Buchs. Die Antworten darauf finden sich in der Vergangenheit und in der Gegenwart, sie sind kreuz und quer durch alle Rechtsgebiete verteilt und eng verbunden mit den Schicksalen bedeutender und weniger bedeutender Menschen. All diese Hintergründe liegen nur selten auf der Hand. Selbst Jurist*innen, mich eingeschlossen, sind sie nicht immer bewusst.
Manches in diesem Buch wird Sie überraschen. Zum Beispiel der positive Einfluss der Inquisition auf das Strafverfahren. Oder der steinige Weg des Bundesverfassungsgerichts zum wohl mächtigsten Gericht der Welt. Oder die rechtlich abgesicherte Ausbeutung von Erwachsenen und Kindern in den Fabriken des 19. Jahrhunderts. Und auch für uns so Selbstverständliches bekommt ein ganz anderes Gewicht, wenn es im geschichtlichen Zusammenhang betrachtet wird. Heute ist es rechtlich irrelevant, ob jemand als Frau oder als Jude, außerhalb einer Ehe oder in einfache Verhältnisse geboren wurde. Vor gar nicht allzu langer Zeit war das noch völlig anders. Heute werden wir bei Zweifeln über unsere Schuld freigesprochen und nicht gefoltert, bis wir gestehen. Diese Errungenschaft ist jünger, als Sie denken. Auch dass Streit – sogar Streit zwischen Staaten – in aller Regel nicht mit Gewalt endet, sondern vor Gericht, ist eine moderne Erfindung. Und Sie werden erstaunt darüber sein, was uns das Schicksal des hochstaplerischen Hauptmanns von Köpenick über die Entwicklung des Strafens lehrt.
Bei unserer Reise durch seine Geschichte und Gegenwart wird aber auch immer wieder deutlich werden, dass das Recht eine zweischneidige Angelegenheit ist. Es kann dem Täter ein Schwert sein oder dem Opfer ein Schild, ein Instrument der Mächtigen oder der Schwachen, eine Fessel der Gesellschaft oder ihr Antrieb, es verbindet Menschen und Nationen, oder es trennt sie. Doch unser Recht heute hat sich in all diesen Fragen für die richtige Seite entschieden, auch wenn das nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist. Die hohe Komplexität unseres Rechtssystems aber ist kein Fluch, sie ist eine zivilisatorische Meisterleistung. Sein Schutz vor staatlicher und privater Willkür ist unsichtbar, aber wirksam. Und seine Schwächen sind zwar nicht kleinzureden, aber wir müssen über sie nicht verzweifeln. Sie dürfen uns Ansporn sein, das Recht stetig zu verbessern.
In meinem Hauptberuf bei der »Gesellschaft für Freiheitsrechte« führen wir ganz in diesem Sinne strategische Prozesse: Wir klagen gegen ungerechtfertigte Überwachung, gegen Diskriminierung oder für ein würdevolles Leben. Dass wir das tun können, ist ein unfassbar großes Privileg. In kaum einem anderen Staat der Welt können Menschen ihr Recht besser durchsetzen oder ändern als hier. Daran müssen wir uns auch selbst immer wieder erinnern.
Es überrascht mich nicht, dass dieses Bewusstsein nicht weiter verbreitet ist: In der Schule lernen wir so gut wie nichts über das Recht. In den Nachrichten erfahren wir nur, was gerade aktuell ist. Welche Gesetze unseren Alltag bestimmen, merken wir erst, wenn Streit ausgebrochen ist. Und es stimmt ja, dass das Recht komplex und unzugänglich ist. Aber nur in den Details. In der Mathematik kommt man mit den vier Grundrechenarten weiter als mit dem Auswendiglernen des Einmaleins. Ähnliches gilt für das Recht: Wer seine Grundzüge beherrscht, kann sich vieles selbst erschließen. Und diese Grundzüge lassen sich jeder und jedem vermitteln. Und zwar auf verständliche und unterhaltsame Weise.
Ich will nicht verhehlen, dass dieses Buch von der Faszination für seinen Gegenstand getragen ist. Für mich ist das Recht wie ein schönes großes Haus, in dessen Konstruktion und Gestaltung mehrere Tausend Jahre Erfahrung eingeflossen sind. Wir könnten auch außerhalb dieses Hauses leben, aber es wäre sehr viel ungemütlicher, bei schlechtem Wetter sogar lebensbedrohlich. Und ständig müssten wir auf der Hut sein. Es ist nicht unzerstörbar, dieses Haus, hält aber doch einiges aus. Wenn etwas kaputtgeht, lässt es sich mit ein wenig Mühe wieder reparieren. Wichtig ist nur, dass sein Fundament und die tragenden Wände bestehen bleiben; alles andere darf sich wandeln, muss dies gelegentlich sogar, damit sich all seine Bewohner*innen darin noch – oder endlich – wohl- und sicher fühlen.
Darf ich Sie in diesem Haus herumführen? Ich kann Ihnen auf die Schnelle nicht alles zeigen, aber das ist nicht weiter schlimm. An den langweiligen Räumen laufen wir einfach vorbei. Es gibt schließlich genügend schöne und spannende Winkel zu erkunden. Und vielleicht gelingt es mir, Sie mit meiner Faszination anzustecken. Unserem Recht täte das gut.
Teil 1Recht allgemein
Von Natur und Wandel
Stellen Sie sich vor, Sie hätten vergessen, wer Sie sind. Sie wüssten nicht, wann und wo, nicht einmal, mit welchem Geschlecht Sie geboren wurden. Nicht, wie klug, gesund und reich Sie sind, ob Sie eine Familie haben oder Freunde. Sie wüssten lediglich, dass Sie ein Mensch sind. Und stellen Sie sich weiter vor, nicht nur Ihnen ginge es so, sondern auch 99 weiteren Menschen, die sich mit Ihnen unter einem Schleier des Nichtwissens versammelt hätten. Stellen Sie sich vor, Sie alle wären ausgewählt, Regeln für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu formulieren. Ohne Kenntnis des geltenden Rechts – und eben ohne zu wissen, ob Sie in dieser Gesellschaft zu den Starken oder den Schwachen gehören würden.
Welche allgemeingültigen Regeln würden Sie uns geben?
Kapitel 1Der Zauber des Rechts
Was Recht ist und woher es kommt
Recht ist wie Zauberei. Mit Worten erschaffen wir aus dem Nichts Rechte und Pflichten. Eigentum und Ehre. Ehen, Unternehmen, ganze Staaten. Selbst Frieden und Regeln für den Krieg.
All diese Dinge sind physisch nicht greifbar. Menschen kann man sehen – eine Ehe, die sie verbindet, nicht. Den Boden unter den Füßen kann man spüren – nicht aber das Eigentum, das jemand an ihm geltend macht. Felder, Wiesen, Wälder kann man riechen – aber nicht den Staat, der sie zu seinem Territorium erklärt.
Und doch ist all das bedeutungsvoll, der Zauber wirkt. Entscheidend für seine Wirkung ist nicht, dass er in Gesetzen oder Verträgen geschrieben steht, sondern dass wir an ihn glauben, ihn verinnerlichen. Dieser Glaube macht die Dinge, die wir regeln, echt. Auf seiner Grundlage üben wir unsere Rechte aus und verlangen von anderen, ihre Pflichten zu erfüllen.
Damit sich aber der Zauber des Rechts voll entfalten kann, bedarf der Glaube auch der Durchsetzung. Denn anders als Naturgesetze sind menschliche verletzlich. Sie beschreiben nicht, was ist, sondern, wie es sein soll. Niemand kann die Schwerkraft ignorieren, wohl aber einen Vertrag. Deshalb führt seine Verletzung zu Schadensersatz, ein Knochenbruch zu Schmerzensgeld, Mord zu lebenslanger Haft. Die Folgen einer Rechtsverletzung gehören zum Recht wie der Fall zum Wurf. Es gilt nicht nur, Recht wird auch gesprochen und – zur Not – vollstreckt.
Die Wurzeln des Rechts
Dass wir mit dem Recht eine Welt jenseits des Greifbaren erschaffen haben, in der sich Eheleute, Aktiengesellschaften und Staatenbünde tummeln, hängt eng mit der menschlichen Vorstellungskraft zusammen. Doch Vorstufen des Rechts herrschen auch in der Natur. Tiere setzen und befolgen Regeln, ahnden Verstöße mit Drohung und Gewalt. Wolfsrudel etwa markieren mit Harn, Kot und durch Heulen Jagdreviere, die sich über ein paar Dutzend bis zu mehreren Tausend Quadratkilometern erstrecken können. Sie verteidigen ihr Territorium gegen andere Wölfe, oft bis auf den Tod. Auch viele andere Tiere – neben weiteren Raubtierarten zum Beispiel Fische, Vögel, sogar Insekten – besitzen und verteidigen Jagd-, Balz- oder Brutreviere. Beute wird ebenfalls verteidigt. Bis zu 60 Hyänen stehen zusammen, wenn Löwen sich ihnen nähern.
Dem Revier im Tierreich entspricht beim Menschen die (Staats-)Grenze, der Beute das Eigentum. Der Unterschied zwischen tierischen Regeln und menschlichem Recht liegt darin, dass wir es bewusst als Instrument einsetzen. Keine andere Spezies hat sich die Natur so radikal untertan gemacht wie wir. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) unterstützt das zum Beispiel durch Regeln dafür, wie Eigentum an beweglichen Sachen erworben wird und verloren geht, nämlich durch Übertragung, Ersitzung, Verbindung, Vermischung, Verarbeitung, Aneignung oder Fund. Das BGB regelt auch, was Eigentum überhaupt bedeutet, wie wir es verteidigen dürfen oder welche Rechte daran wir anderen einräumen können, zum Beispiel in Form von Miete oder einer Hypothek. Und dass selbst lebendige Tiere eigentumsfähig sind. Auf diese Idee ist sonst kein Lebewesen gekommen.
Auch jenseits von Revier und Beute leben Tiere nach festen Regeln.[1] Und zwar nicht nur nach deskriptiven, die nur ein vorhersagbares Verhalten beschreiben, wie die mütterliche Beschützerhaltung. Sondern auch nach präskriptiven, also vorschreibenden Regeln, die über Belohnung und Bestrafung aufrechterhalten werden. Besonders ausgeprägt sind auf Hierarchien gestützte Regeln, die den Höherrangigen einer Gruppe besondere Vorrechte für die Nahrungsaufnahme oder die Paarung einräumen. Oder die Rangkonflikte steuern: Nicht schon die Niederlage, erst die Unterwerfung des Unterlegenen beendet den Konflikt; so wie bei uns die Kapitulation. Nicht nur hierarchisch-vertikale, auch horizontale Regeln existieren, zum Beispiel bei Menschenaffen das Prinzip der Wechselseitigkeit: Wenn ich dir helfe, etwa bei einer Auseinandersetzung mit einem Artgenossen, hilfst du mir bei der nächsten. Mal gebe ich dir etwas von meinem Essen ab, mal ist es umgekehrt.
Interne Konflikte schlichtet oft das Alphamännchen, ganz neutral, also ohne Berücksichtigung des Verwandtschafts- oder Freundschaftsgrads und meist zugunsten des schwächeren Beteiligten.[2] Sogar in Gefangenschaft erzwingen Tiere die Befolgung von Regeln. Der Ethologe Frans de Waal berichtet von der vom Arnheimer Zoo gesetzten Regel, dass keiner der Affen etwas zu fressen bekam, ehe nicht alle ins Schlafquartier zurückgekehrt waren. Deshalb halfen die Schimpansen bei der Durchsetzung dieser Regel. Wer trödelte, wurde gejagt, sogar verprügelt.[3] In Experimenten bestrafte eine andere Schimpansengruppe Futterdiebstahl – und sogar versuchten Diebstahl – häufig mit Protest, Drohungen und körperlichen Angriffen; gelegentlich intervenierten auch Dritte zur Streitschlichtung oder Bestrafung des Übeltäters.[4]
Die Wurzeln für unser Leben nach Regeln reichen also tief. Den Baum, der sich daraus entwickelte, nennen wir Recht. Aber warum ist er überhaupt gewachsen? Warum gelten in Deutschland Abertausende von Gesetzen, allesamt mit einer Vielzahl von Artikeln und Paragraphen? Warum halten wir uns an sie, warum setzen wir sie durch?
Der Schlüssel zur Antwort auf diese Fragen liegt in der Gemeinschaft. Ein einzelnes Lebewesen braucht keine Regeln. Eine Gemeinschaft schon. Die Gemeinschaft bietet viele Vorteile, die wichtigsten darunter sind – wie auch im Tierreich – die besseren Aussichten, genug Nahrung zu haben und sich gegenüber Feinden und Konkurrenten behaupten zu können, das heißt zu überleben. Aber diese Vorteile können Gruppen nur nutzen, wenn sie sich organisieren. Dafür brauchen sie Regeln.
Regeln gleichen widerstreitende Interessen aus. Diese Interessen können zwischen einzelnen Menschen bestehen, zwischen diesen Menschen und der Gemeinschaft (in der Moderne also dem Staat), aber auch zwischen verschiedenen Gemeinschaften. Die Teilbereiche des modernen Rechts regeln den Ausgleich der Interessen in diesen unterschiedlichen Verhältnissen: Das öffentliche Recht beschreibt unsere Beziehungen zum Staat. Das Privatrecht (oder: Zivilrecht) regelt unsere Beziehungen zueinander. Das Strafrecht als Unterform des öffentlichen Rechts bestimmt unseren Umgang mit besonders schweren Rechtsverletzungen. Und das internationale Recht ordnet die Beziehungen zwischen Staaten. Dieser Aufteilung folgt das vorliegende Buch.
Indem das Recht die Regeln für unseren Interessenausgleich definiert, verfolgt es aber ein noch höheres Ziel: Frieden. Denn herrscht nicht das Recht, drohen Rache und Gewalt. In rechtlosen Gesellschaften praktisch allen: den Schwachen, weil sie ihre Interessen nicht durchsetzen können; den Starken, weil sie Angst vor einem Umsturz haben; und allen gemeinsam, weil nach einem Fehltritt die Rache des Verletzten droht. Untersuchungen von lange Zeit noch ursprünglich lebenden indigenen Gesellschaften in Lateinamerika und Afrika zeigen, wie hoch der Blutzoll dafür sein kann. Der Anthropologe Napoleon Chagnon schätzte 1988, dass bei den Yanomami-Indios am Amazonas annähernd 30 Prozent der erwachsenen Männer eines gewaltsamen Todes starben,[5] bei prähistorischen Gesellschaften geht man von ähnlich hohen Quoten aus.[6] Wer diesen Befund in Frage stellt – wie etwa der Historiker Rutger Bregman in seinem Buch Im Grunde gut –, findet den Beweis für den Wert der Geltung des Rechts in der jüngeren Vergangenheit, etwa in der Antike oder im Mittelalter. Selbst in undemokratischen Gesellschaften vermeidet das Recht zumindest oft Gewalt. Auch dort gelten Gesetze, an die sich Kauf- und Eheleute, Nachbarschaft und Firmen halten müssen, die ein bestimmtes Verhalten unter Strafe stellen und deren Vollstreckung dem Staat vorbehalten.
In unserer Vorstellung soll Recht aber neben der Vermeidung von Gewalt noch eine weitere Funktion erfüllen: Es soll die Interessen nicht nur irgendwie ausgleichen und dadurch den Frieden erhalten, sondern dieser Ausgleich soll gerecht sein. Ein Anspruch, den übrigens wiederum auch viele Tierarten etwa an die Verteilung von Nahrung haben.
Warum ist ein gerechter Ausgleich wichtig? Können wir nicht darauf vertrauen, dass uns andere nicht übervorteilen? Zwischen Menschen, die sich gut kennen oder die aus anderem Grund miteinander verbunden sind, ist Vertrauen auf Fairness begründet. Zwischen Fremden oder Entfremdeten nicht. An seine Stelle tritt das Vertrauen in gerechte Regeln und ihre Durchsetzung. Je flüchtiger oder zerrütteter die Beziehung, desto mehr regelt das Gesetz. Kaufen wir ein Auto, definiert das BGB, was als Mangel gilt, welche Ansprüche der Mangel auslöst, sogar wer vor Gericht für welchen Umstand den Beweis zu führen hat. Für die innere Organisation von Vereinen gibt das Gesetz deutlich weniger vor. Und die Kindererziehung ist weitgehend Elternsache. Erst wenn es ums Geld geht – den Unterhalt, das Erbe – oder Familien zerbrechen, regeln die Gesetze mehr.
Das Recht stiftet auch Vertrauen in den Staat. In einem Stamm aus nur einigen Dutzend Personen genießt das Oberhaupt kraft enger Verbundenheit Vertrauen, die Interessen der Übrigen zu wahren. Das gilt auch für nicht verwandtschaftlich, sondern durch das Schicksal verbundene kleine Gemeinschaften, was besonders plakativ durch die maritime Regel ausgedrückt wird, der Kapitän gehe als Letzter von Bord.[7] In einem Staat aus mehreren Millionen Menschen ist persönliches Vertrauen in die Führung unbegründet. Solange aber das Recht gilt, ist ihre persönliche Vertrauenswürdigkeit nicht ganz so wichtig.
Wandel bringt Wandel
Die ersten sozialen Regeln sind in den Gemeinschaften unserer ältesten Vorfahren entstanden. Wann die Geschichte des modernen Rechts beginnt, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Zu der Zeit, aus der die ältesten erhaltenen Rechtssammlungen der Welt stammen, war es aber schon ein fester Bestandteil der menschlichen Zivilisation. Vor knapp 4000 Jahren wurde eine der ältesten Sammlungen geschrieben, der Codex Hammurabi.
Im Pariser Louvre kann man ihn sehen – auf einer Stele aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, in die in altbabylonischer Monumentalkeilschrift 282 Rechtssätze eingraviert sind. Diese und andere Stelen, so vermutet man, ließ König Hammurabi im ganzen babylonischen Reich verteilen. Sie dienten wohl eher als Anleitung denn als Gesetzbuch im modernen Sinne. Der Codex behandelt diverse Rechtsgebiete, die bereits im alten Mesopotamien eine Rolle spielten, vom Erb- und Familienrecht über das Eigentumsrecht bis hin zum Strafrecht. Wer jemanden fälschlich eines Mordes bezichtigt – so der erste Rechtssatz –, wird selbst getötet. Wer einen entflohenen Sklaven zurückbringt, erhält Finderlohn. Wer beraubt wird, dem ersetzt die Stadt, die den Raub nicht verhindert hat, den Wert des Gestohlenen.
Der Codex legt auch fest, wem eine gestohlene Sache gehört, die ein Dritter gekauft hat: Das ursprüngliche Eigentum wirkt fort, selbst wenn der Käufer vom Diebstahl nichts wusste. Immerhin erhält er dann das gezahlte Geld vom Verkäufer zurück. Kaum zu glauben: Das gegenwärtige deutsche Recht regelt den Umgang mit gestohlenen Sachen genauso.
Es ist nicht zwingend, dass gestohlene Sachen von einem gutgläubigen Erwerber an die Bestohlenen zurückzugeben sind. Ebenso gut könnte das Recht die Sache demjenigen belassen, der eine Sache kauft, ohne zu wissen, dass sie gestohlen ist. Aber offenkundig hielten die alten Babylonier ebenso wie wir ein solches Ergebnis für ungerecht. Erstaunlich ist nicht nur dieser Gleichlauf, sondern auch, dass Menschen zu solch komplexen Fragen schon vor so langer Zeit Rechtssätze formulierten.
In mancher Hinsicht galt also vor 4000 Jahren dasselbe wie heute; in anderer hat sich das Recht stark gewandelt. Zum Beispiel hinsichtlich der Folgen für den Verkäufer des Diebesguts: Schon dass der Gerichtsprozess um die Herausgabe des Diebesguts wie im alten Babylon mit der Bestrafung des Verkäufers zusammenfällt, ist heute ausgeschlossen. Vielmehr wären im Streitfall drei Gerichtsverfahren nötig: Die Eigentümerin würde den Käufer vor einem Zivilgericht auf Herausgabe der Sache verklagen, der Käufer vom Verkäufer (dem Dieb?) in einem weiteren Zivilprozess Schadensersatz für den Verkauf einer gestohlenen Sache verlangen. Und dem Verkäufer würde vor einem Strafgericht der Prozess gemacht werden. In Letzterem müsste ihm die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass er die Sache entweder selbst gestohlen hatte, sie hatte stehlen lassen oder er zumindest wusste, dass sie gestohlen worden war; im ersten Fall würde er wegen Diebstahls, im zweiten wegen Anstiftung zum Diebstahl, im dritten wegen Hehlerei verurteilt werden. Vor allem aber drohte ihm nicht wie dem babylonischen Hehler die Todesstrafe, sondern nur eine Geld-, höchstens eine Freiheitsstrafe.
Dass das Recht sich wandelt, ist kein Wunder. Die Menschen in der Steinzeit bedurften nur sehr weniger Regeln. Die Interessen innerhalb einer Horde waren nicht besonders ausgefallen und meist gleichgerichtet. Erst als die Menschen sesshaft wurden und Land und andere Dinge ihr Eigen nannten, wuchs das Regelwerk. Aus Vernunft trat starkes Recht an die Stelle des »Rechts« des Stärkeren. Zu einem weiteren Schub kam es, als sich ein Gemeinwesen entwickelte, das mehr als nur ein paar Familien umfasste, nämlich viele Hundert oder Tausend, schließlich Millionen Menschen, die sich nicht kannten, die die Arbeit unter sich aufteilten und miteinander Handel trieben. Und die sich zusehends voneinander entfremdeten – oder besser: von sie einenden Erzählungen, ob nun religiöser oder weltlicher Natur – und sich auf sich selbst, auf ihre Individualität zurückbezogen.
Heute gibt es so viele Regeln, dass niemand mehr als nur einen Bruchteil von ihnen kennt. Ihre Menge und Detailliertheit werden oft beklagt. Sie sind aber nur Ausdruck der beständig zunehmenden Komplexität unseres Lebens selbst: Es gibt heute nicht nur Allgemeinärzte, sondern Kardiologinnen, Orthopäden, Internistinnen, Anästhesisten und Spezialisierungen in über vierzig weiteren medizinischen Fachbereichen. Ein Atomkraftwerk ist mehrere Hunderttausend Mal leistungsstärker als ein Kaminofen, kostet vier Millionen Mal mehr, ist ungleich komplexer – und unendlich gefährlicher. Und selbst in der noch jungen Informationstechnik gibt es niemanden, der auch nur alle Programmzeilen von Microsoft Windows kennt (es sind um die 50 Millionen).
Diese Entwicklung prägt das moderne Recht enorm. Es bedurfte Vorschriften für die ärztliche Heilbehandlung, begonnen bei den Anforderungen an die Ausbildung über die Hygiene in Praxen und Kliniken bis hin zu den Vorgaben für eine ordentliche Aufklärung von Patient*innen und die Haftung bei Behandlungsfehlern. Atomkraftwerke müssen eine Unmenge komplizierter Anforderungen erfüllen, damit sie sicher errichtet und betrieben werden. Und selbst IT-Konzerne werden – nachdem das Internet lange Zeit dem Wilden Westen glich – immer stärker reguliert. Mit dem Recht reagieren wir also auf die vielfältigen neuen Herausforderungen, die die menschliche Entwicklung mit sich bringt.
Bisweilen viel zu spät. Wir haben Jahrtausende gebraucht, um einigermaßen mit der Macht von Staaten umzugehen, mit dem Zerstörungspotenzial, das große Armeen nach außen und tyrannische Herrscher nach innen haben. Zunächst wurde dazu in der Antike das Konzept des »gerechten Kriegs« entwickelt, die Vorstellung also, dass es für einen Angriff eines guten Grundes bedarf – wobei die Gründe, die damalige Herrscher für Kriege fanden, uns heute nicht mehr überzeugen. Schrittweise kam zur Begrenzung des Rechts zum Krieg (ius ad bellum) das Recht im Krieg (ius in bello) hinzu, also Regeln für die Kriegsführung, die vor allem die Schonung der Zivilbevölkerung, den Umgang mit Kriegsgefangenen und das Verbot bestimmter Waffen regelten. Heute bezeichnen wir das als humanitäres Völkerrecht. Noch später, nämlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg, ist Gewalt zwischen Staaten ausdrücklich verboten. Es gibt noch immer Kriege, aber immerhin zwischen Staaten sind sie selten geworden.
Die Macht des Staates gegenüber der Bevölkerung wurde noch später eingeschränkt, durch demokratische Verfassungen. Entscheidend dafür war, das Volk in den Mittelpunkt zu stellen, nicht den Herrscher. Wie, das ist Thema des zweiten Teils dieses Buchs.
Zu Beginn dieses Teils hatte ich Sie gebeten, sich vorzustellen, Sie seien von einem Schleier des Nichtwissens umhüllt und damit beauftragt, Regeln für unsere Gemeinschaft zu formulieren. Der US-amerikanische Philosoph John Rawls, der dieses Gedankenexperiment in seinem Buch A Theory of Justice (dt.: Eine Theorie der Gerechtigkeit) 1971 formulierte, sah im Schleier des Nichtwissens eine Gewähr dafür, dass Ihre Regeln gerecht wären. Weil Sie nicht wüssten, welches Schicksal Ihnen blühte, würden Sie Regeln formulieren, die selbst aus Sicht der Schwächsten in der Gesellschaft fair sind.
Ich finde dieses Gedankenexperiment sehr überzeugend. Und ich möchte Sie dazu einladen, auf dem weiteren Weg durch dieses Buch immer wieder zu überprüfen, ob das beschriebene Recht unter dem Schleier des Nichtwissens entwickelt worden wäre.
Am Anfang soll eine der bedeutendsten Rechtsfragen überhaupt stehen. Sie durchzieht die lange Geschichte des Rechts und berührt mehrere Rechtsgebiete zugleich, ist deshalb besonders für einen ersten Einblick in unsere Gesetze geeignet: Wann und wem erlaubt das Recht zu töten?
Kapitel 2Leben und Tod
Das Recht zu töten
Am 18. Februar 1949 läutete um 6 Uhr morgens außerplanmäßig das Armsünderglöckchen des Tübinger Rathauses. Zwölf Vertreter der Stadtgemeinde standen im Innenhof des Gefängnisses in der Doblerstraße 18, außerdem der Oberstaatsanwalt, ein Pfarrer, der Scharfrichter und einige weitere Personen. Vor ihnen war ein Mann bäuchlings auf der Bank der Guillotine festgebunden, den Kopf durch das Loch im Halsbrett gestreckt.
Der Mann war der 28-jährige Richard Schuh. Er hatte im Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe gedient und sich danach mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Als er Ende Januar 1948 auf dem Heimweg vom Stuttgarter Arbeitsamt war, nahm ihn ein Lastwagenfahrer mit. Schuh erschoss ihn mit seiner alten Wehrmachtspistole und montierte die neuen Reifen des Lasters ab, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
Er wurde schnell gefasst. Das Landgericht Tübingen verurteilte ihn am 14. Mai 1948 wegen Mordes zum Tode. Zwar erkannte das Gericht an, dass Schuh »infolge des langen Krieges und der unseligen, verwirrten Nachkriegsverhältnisse den Respekt vor dem Menschenleben und die Achtung vor den Gesetzen verloren und durch seinen vieljährigen Kriegsdienst mehr eine Erziehung zu Gewalt und Unrecht als eine solche zu Ordnung und Moral genossen« habe. Aber das falle nicht zu seinen Gunsten ins Gewicht, denn »dieses Schicksal teilt er mit Unzähligen«.[8] Als Sühne für die Schwere seiner Schuld erscheine deshalb nur die Todesstrafe angemessen.
Seine Revision zum Oberlandesgericht scheiterte. Es blieb nur ein Gnadengesuch, das die Landesregierung in einer Kabinettssitzung am 15. Oktober 1948 diskutierte. Landesjustizminister Carlo Schmid fehlte in der Sitzung. Vielleicht hätte der SPD-Politiker die Entscheidung in eine andere Richtung gelenkt: Wenige Monate zuvor hatte er noch den damaligen Regierungschef der CDU, Lorenz Bock, davon überzeugt, andere zum Tode Verurteilte zu begnadigen. Die Todesstrafe sei nicht mehr zeitgemäß, hatte er argumentiert, sie degradiere die menschliche Gesellschaft.
Aber Bock war zwei Monate zuvor verstorben, als Staatspräsident folgte ihm Gebhard Müller, der später Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden sollte. Müller, wie sein Vorgänger CDU-Mitglied, war von der Notwendigkeit der Todesstrafe überzeugt. Er lehnte das Gnadengesuch ab.
Für die Vollstreckung des Urteils war jedoch Schmids Justizministerium zuständig. Es ließ sich damit Zeit. Vielleicht, weil Schmid zur selben Zeit in Bonn im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz ausarbeitete. Er hatte schon an den Vorberatungen in Herrenchiemsee teilgenommen und dort für ein Ende der Todesstrafe geworben. In Bonn beantragte am 18. Januar 1949 aber nicht er, sondern Hans-Christoph Seebohm, ein Verbot der Todesstrafe in das Grundgesetz aufzunehmen.
Seebohm war Mitglied der nationalkonservativen Deutschen Partei. Manche mutmaßten, er wolle mit seinem Vorstoß Naziverbrecher vor dem Tode bewahren. Der Antrag wurde abgelehnt. Am 10. Februar, acht Tage vor Richard Schuhs geplanter Hinrichtung, diskutierte der Hauptausschuss des Parlamentarischen Rats das Thema erneut. Carlo Schmid leitete die Sitzung.
Über 16000 Menschen, so schätzt man heute, wurden während der Zeit des Nationalsozialismus aufgrund von Strafgerichtsurteilen hingerichtet. Zum Vergleich: In den fünfzig Jahren zuvor wurden nur etwa 400 Todesurteile vollstreckt, zuletzt so gut wie gar keine mehr. Allein der bayerische Scharfrichter Johann Reichhart vollstreckte dann zwischen 1940 und 1945 über 2800 Todesstrafen, darunter am 22. Februar 1943 an den Mitgliedern der Weißen Rose Hans und Sophie Scholl. Hinzu kamen Abertausende Hinrichtungen nach dem Militärstrafrecht – und Millionen von Menschen, die in Konzentrationslagern und von Einsatzgruppen zu Tode geschunden oder ermordet wurden.
Vor diesem Hintergrund beantragte der SPD-Abgeordnete Friedrich Wilhelm Wagner in der Sitzung des Hauptausschusses erneut das Verbot der Todesstrafe. Eine Zeit der schwersten Barbarei und der tiefsten Erniedrigung des Menschentums liege hinter ihnen, trug er vor. Ihm scheine der Beweis unerlässlich zu sein, dass das deutsche Volk das Recht auf Leben »so hoch schätzt, dass der Staat nicht das Recht haben soll, das Leben – das er nicht gegeben hat – zu nehmen«.[9] Der Hauptausschuss fasste an diesem Tag jedoch keinen Beschluss.
Richard Schuh bekam von alldem vermutlich nichts mit. Am Tag vor seiner Hinrichtung wurde er unter einem Vorwand aus der Landesstrafanstalt Rottenburg nach Tübingen gebracht. Erst um 15 Uhr eröffnete ihm der Oberstaatsanwalt, dass er am nächsten Morgen sterben würde. Er »erschrak in starkem Maße«, heißt es im Protokoll. Die ganze Nacht machte er kein Auge zu, sondern verfasste, betreut von einem Seelsorger, sechs Abschiedsbriefe. Einer ging an seine Tochter Renate. Er legte ihm eine Tafel Schokolade, eine Packung Kekse und eine mit Gebäck bei.
Bald darauf läuteten die Glocken. Richard Schuh war beherrscht und gab keinen Laut von sich, bevor das vierzig Kilogramm schwere Fallbeil seinen Kopf vom Hals trennte. Der Pfarrer sprach noch ein Gebet. Der Leichnam wurde dem Anatomischen Institut der Universität überlassen.
Richard Schuh war der letzte Mensch, den die westdeutsche Justiz hinrichtete. Die Idee, einen Antrag zu stellen, sein Verfahren wieder aufzugreifen, hatte ihm der Oberstaatsanwalt in der Nacht vor seinem Tod ausgeredet. Dieser Antrag hätte ihm vielleicht das Leben gerettet. Denn nur drei Monate später, am 24. Mai 1949, trat mit dem Grundgesetz auch einer seiner wichtigsten Artikel in Kraft. Er trägt die Nummer 102 und ist nur vier Worte lang: »Die Todesstrafe ist abgeschafft.« Nach Jahrtausenden gegenteiliger Rechtspraxis eine Errungenschaft, die man nicht hoch genug schätzen konnte und kann.
Trotzdem kam es auf deutschem Boden noch zu weiteren Hinrichtungen, nämlich von NS-Kriegsverbrechern durch die Alliierten, denn dafür gab es eigene Statute. Und auch in der DDR wurde die Todesstrafe weiter verhängt und mindestens 166 Mal vollstreckt, zuletzt gegen Werner Teske wegen angeblicher Spionage und versuchter Fahnenflucht am 26. Juni 1981.[10] Am 17. Juli 1987 schaffte auch der Staatsrat der DDR die Todesstrafe ab. Nach der Wiedervereinigung galt Artikel 102 des Grundgesetzes für ganz Deutschland.
Die Geschichte der Todesstrafe zeigt, wie das Recht sich wandelt. Und welcher Impulse es dafür bedarf. Dass es einerseits ein Spiegel seiner Zeit ist, andererseits aber auch beharrlich sein kann: Schon 1764 hatte der italienische Gelehrte Cesare Beccaria in seinem Buch Von den Verbrechen und von den Strafen die Abschaffung der Todesstrafe gefordert, mit ganz ähnlichen Argumenten wie spätere Gegner dieser schärfsten aller Strafen. Andererseits hielten selbst im Herbst 1948 noch 74 Prozent der Deutschen die Todesstrafe für richtig.[11] Schon kurze Zeit nach Inkrafttreten des Grundgesetzes – und danach immer wieder – wurde deshalb die Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert. In den fünfziger Jahren gab es dazu fünf Gesetzesinitiativen. Auch in den sechziger Jahren sprachen sich prominente Politiker wie der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer und der damalige Bundesjustizminister Richard Jaeger dafür aus. Erst Ende der sechziger Jahre drehte sich die Stimmung (1973 befürworteten sie nur noch 30 Prozent) – bis der Terror der RAF die Bundesrepublik erschütterte (1977: 45–50 Prozent Zustimmung).[12] Als die RAF am 5. September 1977 den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer entführte und die Freilassung elf inhaftierter RAF-Mitglieder verlangte, lagen die Nerven blank. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann – immerhin der bedeutendste Staatsanwalt des Landes – schlug in dieser Stimmung vor, Artikel 102 abzuändern und die Erschießung der Häftlinge zu erlauben, die von der RAF freigepresst werden sollten.[13]
Alle Initiativen zur Wiedereinführung der Todesstrafe scheiterten. Dafür bot das Grundgesetz eine ganz besondere Gewähr: Die Verfassung lässt sich nämlich nur ändern, wenn zwei Drittel der Mitglieder des Bundestags und des Bundesrats zustimmen. So schützt sie die Begünstigten vor Stimmungsschwankungen der Mehrheit. Bis heute, obwohl sich im Jahr 2016 nur noch 17 Prozent der Deutschen die Todesstrafe zurückwünschten.[14] Denn ihre Geschichte ist nicht zu Ende: Laut dem »Cornell Center on the Death Penalty Worldwide« wird die Todesstrafe noch in 35 Ländern vollstreckt. In weiteren 48 Ländern steht sie noch im Gesetz, wurde aber in den letzten zehn Jahren nicht mehr angewendet.[15] In diese Staaten dürfen deutsche Behörden niemanden abschieben oder ausliefern, sofern der Zielstaat nicht zusichert, dass gegen die Betroffenen die Todesstrafe nicht verhängt oder nicht vollstreckt werden wird.[16]
Töten heute
Jenseits der Todesstrafe erlaubt das Recht durchaus zu töten oder verbietet es zumindest nicht. Etwa im Krieg, worauf im letzten Kapitel des Buchs zurückzukommen ist. Im Inland erlaubt sind insbesondere Tötungen aus Notwehr oder zur Nothilfe. Mit der Notwehr verteidigt sich eine Person gegen einen Angriff. Nothilfe leistet, wer eine andere Person vor einem Angriff schützt. Die Einzelheiten sind kompliziert. Gemeinsam ist beiden Rechtsfiguren, dass der oder die Angreifer*in selbst rechtswidrig handeln muss. Ein Räuber etwa, dessen Opfer sich mit Gewalt zur Wehr setzt, kann sich nicht auf Notwehr berufen, wenn er zurückschlägt und das Opfer tötet; denn sein Opfer hat sich zu Recht gewehrt. Sowohl Notwehr als auch Nothilfe stellen zudem an Angehörige der Staatsgewalt erhöhte Anforderungen, wenn sie tödliche Mittel einsetzen. Eine Polizistin darf sich nicht gegen jeden Faustangriff mit der Dienstwaffe wehren, und wenn, dann vorrangig mit einem nichttödlichen Schuss.
Unter den möglichen Konstellationen, in denen der Staat zur Rettung von Leben tötet, sind in der Vergangenheit zwei besonders diskutiert worden. Die erste ist der gezielte Todesschuss, etwas beschönigend meist »finaler Rettungsschuss« genannt. Die Situation kennt wohl jede*r aus Filmen: Einer Geisel droht der Tod. Mit einem gezielten Schuss tötet die Polizei den Geiselnehmer. Fast alle Polizeigesetze der 16 deutschen Bundesländer haben für diesen Fall eine besondere Erlaubnis formuliert. In Bremen und Hamburg mit der Besonderheit, dass Polizist*innen den Befehl zu töten ignorieren dürfen.
Dass die gezielte Tötung eines Angreifers zur Rettung von Unschuldigen erlaubt sein muss, bezweifelt heute vermutlich niemand. Umstrittener ist die Erlaubnis zur Tötung auch von Unschuldigen, wenn dadurch andere gerettet werden können. Ferdinand von Schirach hat dieser Frage sein Theaterstück Terror gewidmet. Das Bundesverfassungsgericht, Deutschlands höchstes Gericht, hat über sie geurteilt. Anlass war das Luftsicherheitsgesetz aus dem Jahr 2005, das wiederum eine Reaktion auf die Anschläge des 11. September 2001 in den USA war. Das Gesetz erlaubte es, ein entführtes Luftfahrzeug samt Fluggästen abzuschießen, wenn dadurch das Leben anderer Unschuldiger gerettet werden könne.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte diese Abschussermächtigung für verfassungswidrig.[17] Denn die Opfer würden dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt werde, verdinglicht und zugleich entrechtlicht; ihnen werde der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner selbst willen zukomme. Unter der Geltung der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes sei es »schlechterdings unvorstellbar, auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschuldige Menschen, die sich wie die Besatzung und die Fluggäste eines entführten Luftfahrzeugs in einer für sie hoffnungslosen Lage befinden, […] vorsätzlich zu töten«.[18]
Und damit wären wir bei einem Wort, einer Idee, einem Ideal angelangt, das unser Recht wie kein anderes prägt: »Die Würde des Menschen ist unantastbar« lautet der erste Satz des Grundgesetzes. Der Parlamentarische Rat stellte ihn an den Anfang unserer Verfassung, »um den ganzen Geist des neuen Staatswesens in seinem Gegensatz zu der im Mai 1945 vernichteten Staatsordnung darzutun«.[19] Dieser erste und wichtigste Satz rückt den einzelnen Menschen ins Zentrum allen staatlichen Handelns. Nicht den Deutschen, Deutschstämmigen oder gar Arier, sondern den Menschen. Nicht den Staat, eine »Volksgemeinschaft«, die Mehrheit, sondern das Individuum. Der Satz drückt aus, dass Menschen nie nur als Objekt, als Problem, als Produktionsfaktor begriffen werden dürfen, sondern immer als Subjekte zu behandeln sind, als selbstbestimmte Wesen, als Träger von Rechten.
In Extremsituationen wie einer Flugzeugentführung mag es manchen befremden, dass die Menschenwürdegarantie für jede*n und ohne Einschränkungen gilt, also auch für den ohnehin dem Tod geweihten Fluggast. Aber diese unbeschränkte Geltung ist eben die Lehre aus unserer Geschichte, sie ist Ausdruck der Sorge vor einem schleichenden Untergang der Menschlichkeit, wenn wir auch nur ein kleines Leck in dem Bötchen tolerieren, auf dem wir durch die Weltgeschichte schippern. Die Menschenwürdegarantie ist die Antithese zum Holocaust, zu einer menschenverachtenden Kriegsführung nach innen und nach außen, auch zu einer utilitaristischen Weltsicht, in der der vermeintliche Gesamtnutzen gegen das Leid des Einzelnen aufgerechnet wird. Sie ist ein Denkmal für all jene, deren Würde aufs schändlichste missachtet wurde.
Deshalb ist Artikel 1 nur einer von zwei Artikeln des Grundgesetzes, die überhaupt nicht verändert werden können, nicht einmal mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Der andere ist Artikel 20, in dem die fundamentalen Eigenschaften unseres Staats festgeschrieben sind: eine Bundesrepublik, demokratisch und sozial, in der die Staatsgewalt geteilt und an Recht und Gesetz gebunden ist.
Der Weg dorthin war weit und voller Abgründe. Von diesem Weg und dem Ergebnis des langen Ringens mit der Obrigkeit und mit uns selbst handelt der nächste Teil.
Unter Rawls’ Schleier des Nichtwissens versammeln sich keine Unwissenden, im Gegenteil: Alle kennen die Geschichte ihres Landes und der Welt sowie die wesentlichen gesellschaftlichen Zusammenhänge. Es ist deshalb plausibel, dass sich unter dem Schleier des Nichtwissens niemand für die Todesstrafe ausspricht: Zu schwer lastet die Vergangenheit auf diesem schärfsten aller staatlichen Instrumente, zu groß ist das Risiko eines Fehlurteils, zu unerbittlich ist es selbst für einen Schuldigen. Der Abschuss eines Passagierflugzeugs, das als Waffe eingesetzt werden soll, ist dahingegen deutlich schwieriger zu bewerten. Zu welchem Schluss wären Sie gekommen?
Teil 2Unsere Beziehung zum Staat
Das öffentliche Recht
Das Grundgesetz ist teuer erkauft. Bis wir zu ihm fanden, waren eine Revolution und zwei Verfassungen gescheitert, hatten zwei Kriege die Welt verwüstet und unsere Vorfahren systematisch die jüdische und sonst als »nichtarisch« diskriminierte Bevölkerung (darunter insbesondere die Sinti und Roma) ermordet.
Einige der wesentlichen Pfeiler des Grundgesetzes sind Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus und aus den 14 vorangegangenen Jahren der Weimarer Republik. Deshalb stehen die Grundrechte im Grundgesetz an erster Stelle. Deshalb hat es die Todesstrafe abgeschafft. Deshalb hat unser Bundespräsident kaum politische Macht. Deshalb erklärt das Grundgesetz seine zwei wichtigsten Artikel für unveränderlich. Und deshalb räumt es – seit 1968 – ein Widerstandsrecht gegen jeden ein, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen.
Aber das Grundgesetz ist mehr als nur eine Reaktion auf das dunkelste Kapitel unserer Geschichte. Einige der klügsten Köpfe der Nachkriegszeit haben viele Monate Arbeit darin investiert. Sie konnten dabei zurückgreifen auf frühere Verfassungen. Die Öffentlichkeit nahm Einfluss auf seine endgültige Gestalt. Von allen zentralen deutschen Gesetzen ist es das jüngste. Und so ist unser Grundgesetz im besten Sinne modern: offen gegenüber Europa, dem Fortschritt und der Welt, sozial und demokratisch, ausbalanciert und krisenfest.
Nachfolgend soll es um unsere Beziehungen zum Staat und seine Organisation gehen, um Grundrechte also und das Zusammenspiel staatlicher Institutionen, insbesondere die für uns alle so wichtigen Gerichte. Die Gesamtheit der all dem zugrunde liegenden Gesetze nennt man das öffentliche Recht. Ohne einen Blick zurück lassen sich seine vielen, heute selbstverständlich scheinenden Errungenschaften nicht verstehen. Und es lohnt deshalb, ganz von vorn zu beginnen.
Kapitel 3Das Biest
Verfassungsgeschichte
Unter all den Wesen, die Gott erschuf, ist der Leviathan das schrecklichste. Ein Biest mit Zügen eines Krokodils, nein, eines Drachen, einer Schlange, nein, eines Wals, heißt es im Alten Testament. Sein bloßer Anblick bringt zu Fall. Seine Haut ist ein Panzer, Flammen schlagen aus seinem Maul, das Herz ist fest wie Stein. Kein Schwert kann ihm schaden, keine Lanze, kein Pfeil. »Auf Erden gibt es seinesgleichen nicht, [er ist] gemacht, um sich nie zu fürchten. Alles Hohe blickt [ihn] an, König ist [er] über alle Stolzen.« (Hiob 41) Nur Gott ist ihm gewachsen – und wird ihn töten, am Tag des Jüngsten Gerichts (Jesaja 27,1).
Ausgerechnet mit diesem Biest verglich der englische Philosoph Thomas Hobbes den Staat in seinem Standardwerk der Rechtsphilosophie Leviathan (1651). Der Staat als Furcht einflößend, herzloses, unbesiegbares Biest. Warum dieses grauenhafte Bild?
Zwischen 1642 und 1649 herrschte in England Bürgerkrieg. Chaos und Tod prägten das Land. Hobbes stellte sich die Frage, warum Menschen sich überhaupt zu einem Staat zusammenschließen. Dazu stellte er sich eine fiktive Ausgangslage vor, in der es keine Gesetze und keinen Staat gibt. Zwei Menschen, die in diesem »Naturzustand« nach derselben Sache strebten, würden Feinde werden und sich gegenseitig vernichten wollen. Es herrsche ein Krieg aller gegen alle. Niemand könne sich seines Lebens und Eigentums sicher sein. Die Menschen litten.
In dieser Lage seien alle dazu bereit, freiwillig einen Vertrag zu schließen, der Frieden garantiere. Sie würden sich einigen auf die Gründung einer Instanz, die Recht setzt und durchsetzt. Diese Instanz müsse den Menschen übergeordnet sein, allmächtig, nur so könne sie Sicherheit gewährleisten. Diese allmächtige Instanz ist der Staat, der Leviathan. Vom Menschen gewollt, nicht von Gottes Gnaden – das herzuleiten, ist Hobbes’ großes Verdienst.
Doch sein Leviathan ist zugleich Herrscher, Gesetzgeber und Richter. Hobbes bevorzugte als Staatsform die absolutistische Monarchie, in der eine Einzelperson über allem und allen steht. Das könne Gewalt am besten verhindern. Dadurch legitimierte er die Monarchen seiner Zeit.[20]»L’ État c’est moi!« – »Der Staat bin ich!«, rief in dieser Tradition angeblich der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. (1638–1715) und brachte damit das Problem auf den Punkt.
Zum Glück hat sich Hobbes in einem wichtigen Punkt geirrt. Als Kind seiner Verhältnisse betonte er das Element der Sicherheit zu stark. Den Krieg, der Menschen um den Preis ihrer Unterwerfung zum Friedensschluss treibt, begründete er damit, dass im Naturzustand »der Mensch […] ein Wolf für den Menschen [ist]«.[21] Dass zwei Menschen im Naturzustand eine Sache, nach der sie beide streben, um der Gemeinschaft willen teilen könnten, kommt Hobbes nicht in den Sinn. Genau dieses Prinzip der Gegenseitigkeit bildete aber den Kern in der frühmenschlichen Jägergesellschaft.
Dazu kommt, dass Hobbes den Grund des Staats nur darin sah, dass er Eigentum und Leben schützt, um jeden Preis. Wir haben aber mehr Bedürfnisse als nur die Eigentums- und Selbsterhaltung. Nach der berühmten Bedürfnispyramide des Psychologen Abraham Maslow sind dies nach der Gewährleistung von Überleben und Sicherheit: Gemeinschaft, Anerkennung, Selbstverwirklichung.[22] All diese Bedürfnisse lassen sich in Gruppen leichter, also effizienter befriedigen: Niemand könnte die Infrastruktur allein errichten, die eine zuverlässige Versorgung mit Lebensmitteln oder den Schutz vor militärischen Angriffen garantiert. Auch spart es Energie und Zeit für anderes, wenn nicht alle alles machen, sondern sich jede*r auf bestimmte Aufgaben konzentriert. Das gilt für kleine Gruppen, für große aber umso mehr. Im modernen Staat kümmert sich eine um die Kranken, ein anderer um das Maisfeld. Eine spricht Recht, ein anderer schreibt für die Zeitung.
Es ist zwar zweifelhaft, ob die Vorteile der Arbeitsteilung jeden Sprung in der Entwicklung von der Familie zum Stamm, zum Dorf, zur Stadt, zum Land, zum Staat, zur Europäischen Union, zu den Vereinten Nationen erklären können. Denn insbesondere für die Entstehung der ersten Staaten gibt es bessere Erklärungen, darunter prominent die Theorie der Eroberung: Ihr zufolge unterwarfen kriegerische Hirtenvölker friedliche Bauern, forderten von ihnen Tribute und etablierten so ein Herrschaftsverhältnis, woraus sich später Staaten entwickelten.[23] Die Vorteile der Arbeitsteilung können aber wohl erklären, wie sich diese neuen Strukturen und damit letztlich auch der Staat erhalten und beweisen konnten, nämlich durch die möglichst effiziente Befriedigung unserer Bedürfnisse.
Die beste Entsprechung im Tierreich für diese Organisationsform sind übrigens nicht die Rudel-, sondern staatenbildende (oder »eusoziale«) Tiere. Ein Termitenstaat kann mehrere Millionen Individuen umfassen, die jeweils einer von meist drei Kasten angehören: Arbeiter, Soldaten und die allein fortpflanzungsfähigen Geschlechtstiere. Teilweise sind die Kasten weiter differenziert. Einige Termitenarten haben etwa kleine Soldaten, die die Nahrungssuche der Arbeiter begleiten und ihre großen Kastengenossen nur im Notfall zur Hilfe klopfen. Soldaten versprühen häufig Gift; eine Art opfert sich sogar bei der Verteidigung der Kolonie, indem sie die Körperwand aufreißt und das Sekret freisetzt. So werden ihre Königinnen älter als jedes andere Insekt, nämlich bis zu dreißig Jahre.[24] Es ist vermutlich kein Zufall, dass Termiten und erst recht Ameisen zu den erfolgreichsten Insektenarten der Erde gehören.
Es gibt auch eusoziale Säugetierarten, wenngleich sehr wenige. Der Nacktmull etwa, eine Nagetierart, lebt in Kolonien aus ein paar Dutzend Tieren mit einer nach Lebensalter differenzierten Arbeitsteilung: Brutpfleger, Tunnelbauer, Soldaten. Auch Nacktmulle werden von einer Königin regiert.
So gut sich aber die Organisationslogik vergleichen lässt, müssen wir eines bedenken: Menschen sind ursprünglich keine staatenbildenden Tiere gewesen. Biologisch betrachtet sind wir soziale Tiere, unsere moderne Lebensweise aber wirkt eher eusozial. Es erwächst eine erhebliche Spannung daraus, dass wir Abertausende von Jahren in kleinen Gruppen gelebt haben, nun aber in vieltausendfach größeren Strukturen. Dass über lange Zeit – und mancherorts auch heute noch – Menschen nicht sich selbst, sondern Herrscher sie regierten, ist das Relikt aus einer anderen Zeit: Die Hierarchien aus der Steinzeit hätten nie vom Stamm auf den Staat übertragen werden sollen. Im Gegenteil entfiel mit seiner Gründung an sich das Bedürfnis nach einem Herrscher. Denn der Staat konnte nun Recht setzen, sprechen und durchsetzen sowie das Volk nach außen schützen. Ein Herrscher wurde nicht mehr benötigt.
Als immer mehr Menschen erkannten, dass ihr Monarch vielleicht ihr Überleben sichern und sie vor Schaden bewahren, womöglich auch ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen kann, sie aber in einer extrem hierarchischen Gesellschaft keine Anerkennung erfahren oder gar sich selbst verwirklichen können, revoltierten sie. Der Staat sollte ihnen, so der neue Anspruch, die Freiheit zur Befriedigung auch dieser Bedürfnisse gewähren.
Den Weg für diese Entwicklung hatten Hobbes’ Nachfolger bereitet, etwa sein Landsmann John Locke und der Franzose Montesquieu mit der Idee von Grundfreiheiten und der Kontrolle der Staatsgewalt durch ihre Teilung. Der Staat sollte nicht mehr über, sondern für uns herrschen. Ein Diener sein, kein Herr. Der Schöne, nicht das Biest.
Und so korrigierte die Französische Revolution des Sonnenkönigs Selbst- und Staatsverständnis mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. »Der Zweck jeder politischen Vereinigung«, heißt es dort in Artikel 2, »ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte.« Zwei Jahre später erwuchs aus dieser Überzeugung die erste französische Verfassung. Schon 1788 war in den USA eine ähnlich fortschrittliche Verfassung in Kraft getreten, in die allerdings erst 1791 Grundrechte eingefügt wurden.
Und Deutschland? Der erste Versuch, diesen Vorbildern hier zu folgen, scheiterte kläglich. Der zweite mündete in eine Katastrophe.
Scheitern
Die Anteilnahme an der Trauerfeier am 22. März 1848 war gewaltig. Mindestens 100000 Menschen waren auf den Berliner Gendarmenmarkt gekommen. Spontan hielten vor der Kirche ein evangelischer Prediger, ein katholischer Kaplan und ein Rabbiner gemeinsam eine Rede, der »schönste [Augenblick] der ganzen schönen Feier«, ein »historischer Moment, der eben so in der Geschichte ohne Beispiel dasteht, als diese ganze Feierlichkeit selbst«, kommentierte die liberal eingestellte Königlich privilegirte Berlinische Zeitung.[25] Nach einem langen Trauerzug wurden die »Märzgefallenen« auf einem eigens dafür angelegten Friedhof bestattet. In anderen Städten kam es zu ähnlichen Szenen.
Ein paar Tage zuvor waren die Deutschen auf die Barrikaden gegangen. Gepeinigt von Hungersnöten im Jahr zuvor, unterdrückt von Königen und Fürsten, angetrieben von dem Wunsch nach nationaler Einheit forderten die Revolutionär*innen politische Freiheiten und die nationale Einigung der im Deutschen Bund lose organisierten Fürstentümer und freien Städte. Hunderte von Menschen starben allein in Berlin. Die allermeisten waren einfache Leute, darunter auch Kinder.
Die Fürsten mussten reagieren. Sie beendeten die Zensur der Presse und ließen die Gründung einer Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zu, die eine Verfassung für ein vereintes Reich formulieren sollte. Unter den mehreren Hundert Abgeordneten waren bekannte Zeitgenossen wie der Sprachforscher Jacob Grimm (einer der beiden berühmten Märchensammler), der Schriftsteller Ludwig Uhland oder der Politiker Robert Blum, der noch vor Auflösung der Nationalversammlung in Österreich hingerichtet werden würde. »Normale« Leute – Arbeiter, Bauern, Handwerker – waren praktisch überhaupt nicht vertreten, dafür aber sehr viele Beamte, Juristen und Professoren. Sie hatten eine gewaltige Aufgabe vor sich.
Eine Verfassung regelt, wie sich eine Gemeinschaft organisiert und welche übergeordneten Werte sie verbindet. Das ist ein komplexes Vorhaben mit weitreichenden Folgen. In Frankfurt entstand ein für seine Zeit erstaunlich fortschrittliches Dokument, das das Recht auf Gleichheit ebenso enthielt wie starke politische Rechte und eine konsequente Gewaltenteilung. Sogar die Todesstrafe sollte weitgehend abgeschafft werden, ein Jahrhundert vor dem Grundgesetz! Die einzige deutsche Verfassung, die von weiten Teilen der Bevölkerung erzwungen worden war, hätte nach dem Urteil des Schweizer Rechtshistorikers Hans Fehr »den damals modernsten europäischen Staat geschaffen«.[26]
Hätte. Denn obwohl die Paulskirchenverfassung am 28. März 1849 in Kraft trat[27] und die Regierungen dreißig deutscher Staaten sie akzeptierten, erkannten der Kaiser Österreichs und der König Preußens sie nicht an, Letzterer sogar gegen den erklärten Willen seines eigenen, also des preußischen Parlaments. Im Frühjahr 1849 eskalierte die Situation, immer mehr Abgeordnete verließen die Nationalversammlung, bis schließlich ein etwa hundertköpfiges Rumpfparlament in Stuttgart mit Waffengewalt aufgelöst wurde. Im Laufe der Zeit wurden Dutzende der ehemaligen Frankfurter Abgeordneten politisch verfolgt, manche flohen mit anderen Revolutionär*innen ins Ausland, insbesondere in die USA, wo man sie die »Forty-Eighters« nannte.
Das Biest hatte gesiegt, die Paulskirchenverfassung war gescheitert und mit ihr der erste gesamtdeutsche Demokratieversuch. Ohne Wirkung aber blieb sie nicht, denn sie inspirierte die Verfassungen vieler deutscher Einzelstaaten – und stand siebzig Jahre später dem nächsten großen Verfassungsprojekt Pate.
Katastrophe
Am 19. Februar 1919 sprach auf der elften Sitzung der Nationalversammlung in Weimar die Sozialdemokratin Marie Juchacz: »Meine Herren – und Damen!«, begann sie und löste mit dieser Anrede laut Protokoll Heiterkeit aus. »Ich möchte hier feststellen«, fuhr sie fort, »daß wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.«[28]
Gemeint war das Frauenwahlrecht. Juchacz’ Rede war die erste einer Frau vor einem deutschlandweiten Parlament.[29] (Die erste Frau, die überhaupt vor einem Parlament in Deutschland redete, war die Heidelbergerin Marianne Weber. Sie adressierte am 15. Januar 1919 in Karlsruhe die Verfassunggebende Versammlung der Republik Baden.) Sage und schreibe 90 Prozent der Frauen hatten sich an der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 beteiligt, ein deutlich höherer Anteil als bei den Männern. Der Wahl vorausgegangen war die Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg und im November 1918 eine Revolution, auf deren Höhepunkt die Republik ausgerufen worden und Kaiser Wilhelm II. ins Exil gegangen war. Mit seinem Abgang endete eine mehr als tausendjährige monarchische Tradition in Deutschland.
Ein Rat der Volksbeauftragten, bestehend aus sechs Sozialdemokraten,[30] übernahm am 10. November provisorisch die Regierungsgeschäfte; faktischer Vorsitzender war der spätere erste Reichspräsident Friedrich Ebert. Dass die Volksbeauftragten rasch eine landesweite Wahl anberaumten, statt über längere Zeit selbst zu regieren, ist maßgeblich ihm zu verdanken. Der Rat führte nur zwei Tage nach seiner Gründung das Frauenwahlrecht ein. Dem war ein jahrzehntelanger Kampf der Frauenbewegung vorausgegangen, der in den 1890er Jahren an Fahrt aufgenommen und sich seit 1917 gehörig zugespitzt hatte. Die SPD hatte das Frauenwahlrecht 1891 als einzige Partei in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Nun setzte sie es um.
Die in Weimar tagende Nationalversammlung hatte als wichtigste Aufgabe, eine Verfassung auszuarbeiten. Unter den 423 Abgeordneten waren 37 Frauen – eine Quote, die erst im Deutschen Bundestag von 1953 wieder erreicht wurde. Das hielt aber den Berliner Abgeordneten und Kirchenrechtslehrer Wilhelm Kahl nicht davon ab, die Nationalversammlung bei seinen Reden mit »Meine Herren!« anzusprechen, um diese Wortwahl auf den offenbar erwarteten Protest (»und Damen!«) mit dem absurden Argument zu begründen, schon dem römischen Recht zufolge seien durch die Ansprache des männlichen Geschlechts in einer Rede beide Geschlechter zu verstehen gewesen. Außerdem sei das Wort Dame nicht ernsthaft genug, weil es ein französischer Begriff sei und »unwillkürlich jedesmal die Erwartung einer Tischrede erregt«. Nur konsequent, dass er anschließend das Frauenwahlrecht damit kommentierte, dass »für den größeren Teil der Frauen […] diese Ausstattung mit der ganzen politischen Vollmacht jetzt doch eine zu verantwortungsvolle« war und dass manche Mühe hätten, »sich in die große neue Gedankenwelt einzuleben«.[31]
Das Frauenwahlrecht wieder abzuschaffen wollte jedoch selbst er nicht fordern. Und auch in dem ersten Verfassungsentwurf des jüdischen Staatsrechtlers Hugo Preuß war ein allgemeines Wahlrecht vorgesehen. Preuß, bei seiner Ausarbeitung unterstützt unter anderem von dem berühmten Soziologen Max Weber[32] (dem Mann von Marianne Weber), war einer der talentiertesten Juristen seiner Generation und hatte so großen Einfluss auf die Weimarer Verfassung, dass er heute als ihr »Vater« gilt.[33] Dass es so weit kam, war eigentlich unwahrscheinlich gewesen. Zwar waren schon im Kaiserreich die rechtlichen Schranken für jüdische Menschen gehoben worden, nicht aber die Schranken in den Köpfen: Antisemitismus war weitverbreitet und trug sicher dazu bei, dass Preuß trotz herausragender akademischer Leistungen nie Professor an einer staatlichen Universität wurde.[34]
Das hielt ihn nicht davon ab, noch vor Ende des Krieges Änderungen am geltenden Recht vorzuschlagen, die die Monarchie demokratisiert hätten. Bei diesen wie bei seinem späteren ersten Entwurf der Weimarer Verfassung schöpfte Preuß auch aus der Paulskirchenverfassung. Allerdings sparte er die Grundrechte weitgehend aus,[35] er wollte die Verhandlungen über die Verfassung damit nicht belasten; auf die Einfügung eines Grundrechtekatalogs drängten andere.[36]
Sein Judentum nutzten rechte Kräfte noch zu Preuß’ Lebzeiten – und erst recht später – dazu, die Weimarer Verfassung als »undeutsch« zu verunglimpfen.[37] Das waren nur die Vorboten eines Judenhasses, dessen Zerstörungskraft Preuß’ Lebenswerk nichts entgegensetzen konnte. Denn das Biest hatten auch er und die Weimarer Nationalversammlung, die das Dokument in seine endgültige Form brachte und verabschiedete, nicht gezähmt.
Es ist zwar fraglich, welchen Anteil an Adolf Hitlers Machtergreifung und »Politik« die Weimarer Verfassung hatte neben den extremen Herausforderungen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und den Folgen der Weltwirtschaftskrise um das Jahr 1930. Denn an sich war sie gar nicht schlecht: Sie ersetzte die Monarchie durch eine Republik, trennte die drei Gewalten strikt, ihr Grundrechtsteil hatte ein beeindruckend soziales Profil. Und auch die beste Verfassung verhindert keinen Völkermord, wenn er vom Inhaber der physischen Gewalt gewollt ist.
Aber sie kann die Zügel straffen – im besten Fall so stark, dass das Biest nicht Fahrt aufnehmen und sich rechtzeitig Widerstand organisieren kann. So wie zwischen den Wahlen 2016 und 2020 in den USA gegen Donald Trump, der sich nach den Midterm Elections 2018 einem von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhaus gegenübersah und während seiner gesamten Präsidentschaft sehr widerständigen Gerichten, eingeschlossen den Supreme Court, den er zu einem Drittel selbst besetzt hatte.
Trump konnte den demokratischen Geist in den USA nicht auslöschen. Dieser Geist fehlte in der Weimarer Republik vor allem auf der rechten Seite. Als Hitler am 9. November 1923 mit General Ludendorff und einigen Tausend Rechtsradikalen in München erfolglos putschte, bot das (an sich nicht zuständige) bayerische Gericht weniger einen Strafprozess als Hitler eine Bühne für stundenlange Attacken gegen die »Landesverräter« in Berlin.[38] Verurteilt wurde er am 1. April 1924 wegen Hochverrats zur Mindeststrafe von fünf Jahren, verbunden mit der Aussicht, nach sechs Monaten zur Bewährung entlassen zu werden – obwohl die Bewährungszeit einer früheren Verurteilung noch lief. Unter ungewöhnlich milden Haftbedingungen schrieb Hitler dann Mein Kampf. Und tatsächlich wurde er schon am 20. Dezember 1924 wieder entlassen. Seine an sich mögliche und von der bayerischen Regierung gewünschte Ausweisung in seine Heimat Österreich scheiterte am Widerstand der dortigen Regierung, die ihrerseits geltendes Recht missachtete.[39]
Man mag sich nicht vorstellen, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn Hitler nicht nur bis Ende 1924, sondern mindestens bis zum Oktober 1927 in Haft geblieben wäre – dem Tag einer von Reichspräsident Hindenburg verkündeten Begnadigungsaktion, von der Hitler profitiert hätte. Und wie hätte sich die Geschichte wohl entwickelt, wenn die Stadt Braunschweig Hitler nicht 1932