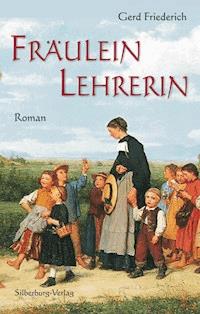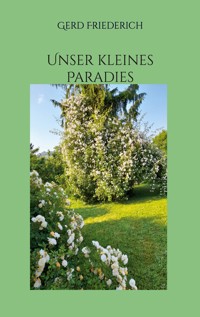
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Landschaftspark im Jahreslauf. Wundersame Begegnungen und glücklicher Fügungen, die zu Herzen gehen. Da ist die kleine Linda, die im Park ihre Hausaufgaben macht, damit ihre Mutter sich zuhause von traumatischen Ereignissen erholen kann. Da ist Otto, der im Park einen Geldbeutel findet und dadurch einer Verbrecherbande auf die Spur kommt. Und da ist die nimmermüde Journalistin und Romanautorin Alice, die einem alten Schulfreund begegnet und sich entscheiden muss, ob sie ihrem Leben eine neue Richtung geben soll. Und da sind vor allem viele einheimische und exotische Bäume, blühende Sträucher und herrliche Blumen, die den Park so einzigartig machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Friederich, aufgewachsen im hohenlohischen Langenburg und schwäbischen Bietigheim an der Enz, studierte in Würzburg fürs Lehramt (Deutsch, Kunst, Geschichte, Geografie) und berufsbegleitend noch zweimal, zunächst in Tübingen (Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Landeskunde), wo er mit einer historischen Arbeit promovierte, und viele Jahre später in Nürnberg (Malerei). Er arbeitete als Lehrer, Heimerzieher, Personalreferent, Schulrat, Lehrerausbilder und veröffentlichte viel Fachliteratur. Jetzt lebt er im Taubertal, schreibt Romane und malt Porträts und Landschaften.
Inhaltsverzeichnis
Unser kleines Paradies
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
LITERATUR VON GERD FRIEDERICH
Fachliteratur
Romane
Unser kleines Paradies
Unser kleines Paradies liegt vor den Toren der Stadt. Kein französischer Garten, geometrisch geordnet und auf Regelmäßigkeit und Symmetrie bedacht. Auch kein Schlosspark, der im Einklang mit einem Prachtbau und etlichen Nebengebäuden ein architektonisches und ästhetisches Gesamtkunstwerk sein will. Es hat weder Türme noch künstliche Ruinen oder historisierende Gebäude. Es ist ein schlichter Landschaftspark.
Anders als französische Barockgärten ist unser Park erst Mitte des 19. Jahrhunderts als Privatgarten eines Industriellen entstanden. Der hiesige Besitzer einer Maschinenfabrik verehrte König Wilhelm I. von Württemberg. Er eiferte dem Monarchen nach, der mit seiner Wilhelma einen prächtigen botanischen Garten mit vielen Bäumen erschaffen hatte. Im Testament vermachte der Fabrikant seine Anlage der Stadt unter der Bedingung, dass sie das Erbe hegt und pflegt. Er bestimmte auch, dass man im Park weder fahren noch reiten, sondern ausschließlich zu Fuß unterwegs sein darf. Und er legte fest, dass auf ewig jedermann freien Zutritt zum Park hat, denn er verstand ihn als demokratische Einrichtung, in der alle gleich sind, ob alt oder jung, reich oder arm. Doch weil er seine Mitbürger und ihre Vergesslichkeit kannte, gründete er eine Stiftung, die bis heute über die Einhaltung der Auflagen wacht und jährlich Geld aus dem Stiftungsvermögen in Erhalt und Ausbau des Parks zuschießt.
Trotz der angestrebten Natürlichkeit ist unser kleines Paradies ein Gesamtkunstwerk aus Grünflächen und Gehwegen, heimischen und fremden Baumarten aus der ganzen Welt, allerlei Sträuchern, weiten Rasenflächen, prachtvollen Blumenrabatten und herrlich blühenden Beeten. Bahngleise, Hecken, Zäune und ein künstlicher Bachlauf grenzen ihn gegen die Stadt ab. Er ist ein Stück gebändigter Natur, geplant, gehegt und gepflegt. Und so ist er – trotz aller Natürlichkeit – eine Mischung aus Kultur und Kunst statt Wildnis und Öde, ein Zipfel vom Garten Eden, eine Ruhezone in einer chaotischen Welt.
Das Kostbarste im Park ist das Arboretum, eine Vielzahl exotischer Bäume, die im Sommer Schatten spenden, im Herbst die schönsten Farben hervorzaubern und im Raureif des Winters bizarre Gestalten annehmen. Dazu zählen der Weiße und der Schwarze Maulbeerbaum, der Blauglockenbaum, der Tulpenbaum, der Urwaldmammutbaum, der Judasbaum, der Götterbaum, der Schnurbaum, der Trompetenbaum, der Taschentuchbaum und viele andere mehr.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde der Park weiter ausstaffiert. Die Lindenallee, der Kinderspielplatz, die Toilettenanlage, die Picknickwiese, die große Spielwiese für Erwachsene mit Volleyballfeld, Bouleplatz, Dame- und Schachfeld und der Trimmdich-Pfad kamen hinzu. Dann das Parkcafé, der Klanggarten, der Kiosk und der Musikpavillon, in dem von März bis Dezember Konzerte, Aufführungen und vielerlei Veranstaltungen bei kostenlosem Eintritt stattfinden. Vorletztes Jahr wurde zur Freude von Alt und Jung in der nordwestlichen Ecke des Parks ein Streichelzoo eingerichtet. Und seit letztem Jahr erfreut eine Schaukelbrücke über den künstlichen Bach vor allem die Kinder.
Ein Park sagt viel aus über die Zeit, in der wir leben. Auch die Pflanzenwelt unterliegt einem Modediktat. Zwar nicht so gewaltig wie die Kleidermode, die schnelllebig und oft so hässlich ist, dass man sie alle sechs Monate ändern muss. Aber auch Blumen folgen modischen Trends. Im Jahr 2020 setzten die Floristen ganz auf Blau: Iris, Hyazinthen, Anemonen, Disteln, Hortensien, Astern und Rittersporn. Jetzt, nach drei Jahren Pandemie, preisen die floralen Werbestrategen mehr Farbe an, weil die Leute wieder sorgenfreier leben wollten: Margeriten in Gelb und Weiß, Schafgarbe in Gelb und Rosa, Zierlauch in allen Blau- und Lilatönen, Freesien in Weiß, Gelb und Violett, Seidenpflanzen in Orange und Rosa, Lilien in nahezu allen Farben.
Unser Park, schön, anziehend und ganzjährig geöffnet, ist Aufenthalts- und Erholungsort für Menschen aus nah und fern. Die Parkgärtner folgen deshalb nicht so sehr den Modetrends der Blumenindustrie, sondern pflegen ihren eigenen Stil. Sie wissen aus langer Erfahrung, welche Pflanzen lieber sonnig, welche eher schattig stehen wollen, welche feuchte oder trockene Böden lieben, in welchem Monat sie aufblühen und wann sie verwelken.
Früher ordnete man die Pflanzen in geometrischen Formen, weil die Zeitgenossen das für schön hielten. Sie wollten vor allem Rabatte, rechtwinklig von niedrigen Buchshecken, Zäunen oder Wegen eingefasst. Heute, weil sich der Geschmack geändert hat, will man Beete mit beschwingten Formen, auch ohne Begrenzungen.
Unser Park hat umrandete Rabatte und unsymmetrische Beete. Die Gärtner züchten Blumen und Stauden in eigenen Gewächshäusern und Freibeeten vor. Sie stellen die Setzlinge gruppenweise nach Robustheit, Wuchshöhen, Wuchsformen und Farbenpracht zusammen. Dann bearbeiten sie den Boden in den Rabatten und Beeten. Und schließlich pflanzen sie viermal im Jahr neu ein, Blumen und Stauden in raffinierten Arrangements.
Der Park ist die grüne Lunge unserer Stadt und ihr Staubfilter. Er ist ein Magnet für Einheimische, Tagestouristen und Urlauber. Und er ist ein Sinnbild für die Welt, wie sie sein könnte. Ein Ort der Schönheit und des Friedens, der Fruchtbarkeit und der innigen Verbundenheit alles Lebendigen. Und vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum unser Park die Menschen anzieht, viele Geschichten mit ihm verbunden sind und so zu unserem Paradies geworden ist.
Januar
Sie mögen sich. Sie verstehen sich gut. Sie schlendern durch den Park. Chefgärtner Schöllhorn, barhäuptig, tippelt tänzelnd voraus, seine Arme pendeln im Takt. Forstdirektor Rempfer schreitet ausgreifend im gefütterten Parka, einen grünen Filzhut auf dem schütteren Haar, den Oberkörper nach vorn geneigt. Immer wieder bleiben sie stehen und besprechen die anstehenden Arbeiten im neuen Jahr.
„Ich fürchte, der Sommer wird wieder heiß“, sagt Rempfer. „Ist die Trockenheit erst einmal da, ist es in der Regel bereits zu spät. Also müssen wir vorsorgen und uns auf eventuelle Wasserknappheit einstellen.“
Schöllhorn bleibt stehen: „Und was heißt das für unseren Park?“
„Zweierlei“, meint Rempfer, „keine zusätzlichen Feste mehr auf den Grünflächen im Park, weil wir sie mit viel Wasser wieder aufpäppeln müssen. Und eine bessere Bewässerung. Das wird der Vorstand der Parkstiftung im nächsten Jahr eingehend beraten müssen.“
Rempfer, Direktor des hiesigen Forstamts und Vorstandsmitglied der Parkstiftung, ist in seinem letzten Berufsjahr. Schon zweimal hat man ihn überredet, nicht in Rente zu gehen; man könne auf seine profunden Fachkenntnisse nicht verzichten. Im Dezember feiert er seinen siebzigsten Geburtstag, spätestens dann, so hat er es seiner Frau in die Hand versprochen, werde er endgültig aufhören. Er ist ein liebenswürdiger Herr, ein guter Zuhörer, angesehen im Land und bei den Leuten. Einer, der immer einen Rat weiß und hilfsbereit ist.
Schöllhorn, Mitte vierzig, ist vor drei Jahren zum Chef der Parkgärtnerei befördert worden. Er ist ein ausgewiesener Fachmann für einheimische Stauden und kennt sich in der heimatlichen Flora aus. In die Baumkunde, insbesondere in die der exotischen Baumarten, hat er sich fleißig eingelesen.
Sie beenden ihren Rundgang unter den zwei Amur-Korkbäumen, die in der Nordostecke des Parks stehen, gleich beim Streichelzoo.
„Meine Lieblinge“, sagt Rempfer mit fester Stimme, die Arme auf dem Rücken verschränkt, und blickt in die weit ausladenden, ineinander verflochtenen Kronen hinauf. „Die idealen Bäume gegen den Klimawandel. Perfekt an trockene Sommer und kalte, windige Winter angepasst. Leider stehen sie viel zu dicht, wie die meisten Exoten, die man bei uns im 19. Jahrhundert gepflanzt hat.“
Schöllhorn ist ganz Ohr. „Im Internet habe ich gelesen, dass die Amur-Korkbäume aus dem Einzugsbereich des Amur stammen. Wissen Sie mehr?“ Er sieht seinen Kollegen fragend an.
„Stimmt“, bestätigt Rempfer, „aus der Grenzregion zwischen China, Korea und Russland. Der Amur fließt sieben Monate lang durch die schneebedeckte Taiga und fünf Monate durch die wüstenartige Tundra. Tiger, Wölfe, Luchse, Braunbären, Elche, Mandarinenten und Kraniche sind an seinen Ufern zuhause.“
Schöllhorn lacht. „Bei uns vergnügen sich bloß Eichhörnchen, Krähen, Elstern und Amseln auf den Bäumen.“
„Kommt auf die Perspektive an“, gibt Rempfer zu Bedenken. „Ich war mal in Casablanca im Zoo. Dort werden Eichhörnchen, Mader und Iltisse in Gehegen gehalten und von den Besuchern bestaunt, während die Affen frei herumturnen oder übers Gelände toben.“
Sie setzen sich auf eine der Bänke unter den waagrechten Seitenästen, die einen großen Schirm bilden, unter dem viele Besucher Schutz suchen, wenn es regnet oder schneit oder die Sonne vom Himmel brennt.
„Ich habe was für Sie.“ Schöllhorn überreicht Rempfer eine kleine Pappschachtel.
„Oh, Korkbaumbeeren! Danke!“
Schöllhorn ist bass erstaunt. „Sie wissen aber auch alles.“
Rempfer schüttelt den Kopf und macht eine abwehrende Geste. „Wenn Sie, mein lieber Herr Schöllhorn, einmal so lange im Beruf sind wie ich, dann wissen Sie mehr als ich. Alles Erfahrungssache.“
Er probiert eine der erbsengroßen, grünschwarzen Beeren. „Schmeckt nach Terpentin“, er schüttelt sich, „soll aber sehr gesund sein. In der traditionellen chinesischen Medizin verarbeitet man diese Beeren zu Hustensaft. Ist gut bei Erkältungen und Atemnot.“
Und dann erzählt er seinem Kollegen, dass der Amur-Korkbaum eine perfekte Bienenweide ist und der daraus gewonnene Honig zu den besten der Welt zählt. Aus den Blättern und dem Bast gewinne man in China wertvolle Grundstoffe für die Pharmaindustrie. Daraus entstünden Medikamente zur Senkung des Cholesterinspiegels, gegen Hautkrankheiten und Verdauungsbeschwerden und zur Bekämpfung und Heilung verschiedener Krebsarten. Alle zehn Jahre schäle man dort die Bäume und presse seinen Kork zu Schuhsohlen, Dämm- und Fußbodenplatten. Und das wertvolle Holz sei im Kern dunkelbraun, im Splint hellgelb und zeige eine sehr schöne Maserung.
*
Zu Jahresbeginn spazieren nur ein paar Unentwegte durch den Park. Am Eingang zum Parkcafé hängt seit Weihnachten ein handgeschriebener Zettel: Betriebsferien bis einschließlich 31. Januar. Auch die Imbissbude ist zu. Sogar der Streichelzoo bleibt für Besucher geschlossen, weil das Personal, bis auf einen Tierpfleger, in Urlaub ist.
Heute schallt ohrenbetäubender Lärm durch den Park. Die Gärtner pusten, mit Laubbläsern auf dem Rücken oder lautstarken Ventilatoren auf Rädern, das letzte Laub aus allen Ecken und Hecken und blasen es wie beim Heuen zu langen Schwaden zusammen.
Am Nachmittag kommen die Gärtner mit Traktor und angehängtem Laubsauger wieder, eine Spende der örtlichen Maschinenfabrik. Die Maschine saugt mit sechs Ventilatoren das Laub ein, häckselt es und bläst es in einen Sammelbehälter, den der Traktor zieht. Dann rechen die Gärtner die Reste zusammen, die der Laubsauger verschluckt und in den Behälter pustet.
*
Otto Langfeld hat ein Viertelstündchen in einem Buch gelesen. Gerade will er aufstehen. Prüfend sieht er an sich hinab, denn er ist vorhin über die feuchte Wiese gegangen. Sind Hosenbeine und Schuhe noch sauber?
Er muss zweimal hinsehen. Da liegt er, ein schwarzer, kleiner Geldbeutel. Direkt neben der Parkbank. So, als sei er jemandem beim Hinsetzen oder Aufstehen aus der Hosentasche gefallen.
Otto Langfeld rutscht an den Rand der Bank und blickt gerade aus. Mit der linken Hand ertastet er den Geldbeutel und nimmt ihn heimlich an sich.
Der Geldbeutel ist klein und dünn. Sehr klein, sehr dünn und schwarz. Darin ein vergoldeter Glückspfennig, ein handgeschriebenes Telefonverzeichnis, ein Medikamentenplan. Und eine kleine Liste mit Größen- und Maßangaben: Wäsche 6, Hemd 41, Jacke 50, Hose 36/30, Socken 42-43, Schuhe 43. Ein Fünfeuroschein im hinteren Geldscheinfach.
Verstohlen blickt er um sich, als könnte jemand aus dem Nichts auftauchen und seinen Besitz zurückfordern. So bleibt er ein Weilchen sitzen. Dann inspiziert er den Geldbeutel noch einmal. Im hinteren Geldscheinfach entdeckt er einen schmalen Papierstreifen: 9rt3mgs4qrs4ftk.onion, in Druckschrift abgefasst. Das kann sich doch niemand merken, denkt er, das muss man sich aufschreiben. Der Streifen ist ins Fach geklebt.
Er ist enttäuscht. Noch nie hat er in einer Lotterie oder in einem Preisausschreiben gewonnen, noch nie etwas Wertvolles gefunden. Wieder eine Niete, denkt er. Keine großen Scheine, keine Kreditkarte. Nur fünf Euro!
Natürlich hätte er einen größeren Geldbetrag zum Fundbüro, eine Kreditkarte zur Bank gebracht. Doch wer geht schon zum Fundbüro und fragt, ob fünf Euro in einem kleinen Geldbeutel abgegeben worden sind? Niemand! Also kann er sich den Weg sparen.
Bleibt eine Frage: Wer hat ihn verloren?
Drüben sitzen zwei junge Mädchen und starren auf ihre Handys. Dort hinten schiebt eine ältere Frau einen Kinderwagen. Sonst ist niemand in der Nähe.
Er steht auf, steckt den Geldbeutel ein und geht durch den Park, den Roman in der Hand. Beim Gehen kann er besser nachdenken.
Vor der großen, jetzt abgeschalteten Fontäne blickt er in den wolkenverhangenen Himmel. Keine Sonne in Sicht, aber auch kein Schnee.
Er stellt sich in der Nähe unter eine Kastanie und durchsucht noch einmal den Geldbeutel. Dann geht er enttäuscht weiter.
Wer ist die unbekannte Person? Eine Frau? Nein! Frauen tragen Handtaschen und lieben große Geldbeutel mit breitem Münzfach und vielen Einsteckschlitzen für Kredit- und Kundenkarten.
Ein Kind? Aber brauchen Kinder einen Geldbeutel? Und solche Listen? Bestimmt nicht!
Halt! Er bleibt stehen. Schuhgröße 43! Ein Mann! Ein junger? So sortiert? Wohl nicht. Eher ein älterer Herr, der, altersklug geworden, alle für ihn wichtigen Informationen mit sich tragen will und mit Pfennigen noch vertraut ist, sonst hätte er einen Glückscent eingesteckt.
Otto Langfeld ist zweiundsiebzig Jahre alt, nicht verheiratet, kinderlos, seit sieben Jahren in Rente. Er kennt die Sorge, einer Verkäuferin nicht antworten zu können: Welche Kragengröße haben Sie? Tragen Sie Wäschegröße S, M oder L? Eigentlich eine gute Idee, dieser Zettel im Geldbeutel.
Die Telefonliste ist merkwürdig. Ein paar Vornamen, ein paar Nachnamen, die Sparkasse, ein Taxiunternehmen, ein Arzt. Keine Ortsangaben. Zwei Festnetznummern mit Vorwahl, ansonsten Mobilnummern.
Wenn der Unbekannte ein Handy besitzt, warum speichert er die Rufnummern nicht dort, sondern schreibt sie auf einen Zettel?
Fragen über Fragen. Otto lächelt vor sich hin. Irgendwie imponiert ihm der Fremde, trägt der doch sein halbes Leben in der Hosentasche spazieren. Die überlebensnotwendigen Medikamente, die wichtigsten Kontakte, die unverzichtbaren Daten für eventuelle Einkäufe, einen Notgroschen und einen Glücksbringer.
Otto beschließt, zur Bank zurückzugehen und noch ein Weilchen zu warten. Vielleicht …
Seit fünfzig Jahren studiert er seine Zeitgenossen. Angeregt durch viele Bücher ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass in allen Menschen vielerlei Eigenschaften schlummern. Manche harmonieren miteinander. Andere passen nicht zusammen, sperren sich oder blockieren sich gegenseitig. Deshalb, so Ottos feste Überzeugung, ist kein Mensch aus einem Guss. In der Erinnerung und in den Romanen werden aus widersprüchlichen Charakteren reine Engel oder abgrundböse Schurken. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Niemand ist nur böse oder nur gut, nur ordentlich oder nur chaotisch. Deshalb täuscht der erste Eindruck eines Menschen fast immer.
Das alles geht Otto Langfeld durch den Kopf, als er sich den Unbekannten vorstellt und auf ihn wartet.
Hose 36/30. Also ein mittelgroßer Mann, etwa ein Meter fünfundsiebzig, Bundweite um die neunzig Zentimeter, eher weniger.
Er wartet auf einen schlanken, drahtigen älteren Herrn, penibel, klar strukturiert.
Den Medikamentenplan kann Otto nicht entschlüsseln. Weder kennt er die Arzneimittel, noch weiß er, ob die vier Namen auf Tabletten, Tropfen oder Sprays hinwiesen. Nur die Zahlen und Striche hinter den Medikamentennamen reimt er sich zusammen. 1 – 1 bedeutet wohl: morgens einmal, mittags keinmal, abends einmal.
Das Kostbarste im Geldbeutel dürfte der Papierstreifen sein: 9rt3mgs4qrs4ftk.onion. Festgeklebt! Damit er nicht versehentlich herausfällt. Er muss wichtig sein für den Fremden, von großer Bedeutung.
Ist das ein Code? Ein Passwort? Ein verschlüsselter Satz?
*
Die ersten Schneeglöckchen erfreuen die wenigen Besucher. Dort, wo die Grasnarbe im Park löchrig ist, dichtes Gebüsch den kalten Wind abhält, der Boden nicht austrocknet und genug Licht auf die Erde fällt, weben diese wagemutigen Pflänzchen reizende kleine Blütenteppiche.
Märchen aus vielen Ländern ranken sich um diese zarte Blume, zum Beispiel das von Hans Christian Andersen: Eine vorwitzige Blumenzwiebel konnte den Sommer nicht erwarten, reckte sich und streckte sich, bis seine weiße Knospe auf grünem Stängel durch die Schneedecke ans Tageslicht schoss. Der erste Sonnenstrahl küsste den frechen Schössling. „Liebliche Blume!", sang der Sonnenstrahl, „wie frisch und leuchtend du bist! Du bist die erste, du bist die einzige Blume, du bist ein Zeichen unserer Liebe! Du läutest den Sommer ein, den schönsten Sommer über Land und Stadt! Aller Schnee soll schmelzen! Fort mit dem kalten Wind! Alles wird herrlich grün. Dann bekommst du Gesellschaft. Flieder und Goldregen und viele, viele Rosen. Aber du bist die erste, so fein und leuchtend wie du ist keine!" Doch Wind und Wetter hatten etwas dagegen, schickten Frost und eisige Winde über das Land und schalten die vorwitzige Blume „Sommernarr!“ Darum heißt das Schneeglöckchen auf Dänisch Sommernarr.
Auch Legenden sind um das Schneeglöckchen entstanden, sogar biblische: Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, es war Winter, wussten sie nicht wohin und setzten sich in ihrer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit auf den Boden. Eva weinte. Ihre heißen Tränen durchbohrten den gefrorenen Boden und lockten eine Blume von unglaublicher Schönheit hervor. So wurde das zarte Schneeglöckchen zum Symbol für die Hoffnung auf eine gute Zukunft. Und es weist auf die kommende Wärme und den nahenden Frühling hin. Es blüht auf, beginnt aber schon bald zu welken, wird unansehnlich und vergeht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Niemand trauert dem verblassten Glanz hinterher. Ein Sinnbild für die Vergänglichkeit allen Lebens.
Das Schneeglöckchen eröffnet den jahreszeitlichen Blütenreigen unendlich vieler Pflanzen, die farben- und formenprächtig unser Leben bereichern und verschönern. Der Park kann in den Wintermonaten nur eine kleine Auswahl bieten: weiße Christrosen, gelbe, blaue und violette Hornveilchen, gelbe Winterlinge, violette Krokusse, gelber Winterjasmin, weißer Winterschneeball, gelbe oder orangerote Zaubernuss. Jede Blüte ist einzigartig. Nicht eine gleicht der anderen. Jede ist ein Original, keine ist eine Kopie.
Botaniker gehen davon aus, dass ein Fünftel aller Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, weil wir Menschen Wälder roden, Feuchtgebiete trockenlegen, landwirtschaftliche Nutzflächen ausdehnen und immer mehr Boden wegen des Städte- und Straßenbaus versiegeln. Dabei beansprucht die Hälfte aller Pflanzenarten nur 2,3 Prozent der globalen Landfläche. Doch selbst das gönnen wir den Pflanzen offensichtlich nicht, obwohl sie mit ihrer Artenvielfalt unsere Ernährung sichern und uns zugleich ein genetisches Potenzial bieten, das die Pharmaindustrie zu unserem Wohle nutzen kann.
Schlendert man durch den Park, stellt sich die Frage: Warum eigentlich lieben wir Pflanzen, Blumen, Sträucher, Bäume? Ist es ihre Schönheit, die wir uns selbst wünschen? Betört uns ihr Duft? Erkennen wir an ihnen unser eigenes Schicksal: wachsen, blühen, vergehen? Sprechen sie unsere Gefühle an? Sind sie Sensoren und Boten unserer Empfindungen und Stimmungen? Wie auch immer, sie wirken harmonisierend auf uns und können uns bei seelischen und körperlichen Beschwerden helfen.
Eine Tasse Melissentee zur Beruhigung, ein warmes Fußbad in Lavendelöl zum Stressabbau, ein kleiner Blumenstrauß als Dank, ein Blumenbouquet mit der Bitte um Entschuldigung, ein Sträußchen als Mitbringsel, um Freude zu bereiten. Lass Blumen sprechen! Oder sag’s durch die Blume, wenn du etwas nicht ansprechen kannst oder magst.
Februar
Das Parkcafé öffnet wieder am 1. Februar, pünktlich um zehn Uhr. Nur wenige Minuten später kommt eine braunhaarige Mitvierzigerin und bestellt ein üppiges Frühstück: schwarzen Tee, zwei Spiegeleier mit Bohnen und Speck, zwei Vollkornbrötchen, Butter, Käse und Honig. Sie lebt nach dem Motto: morgens wie ein König essen, abends wie ein Bettler. Sie trägt weiße Sneakers, rote Socken, eine hellbraune Jeans, einen rotbraunen Alpakapullover, über dessen Rundausschnitt eine weiße Bluse herausschaut, und einen roten, langen Mantel, der nicht zugeknöpft ist.
Sie ist eine Institution in der Stadt. Sie ist Mutter Courage und Kümmerin in einem. Sie fürchtet weder Geschützdonner noch menschliche Tragödien. Sie sorgt sich um andere, sie kann nicht anders.
Manche spötteln, sie gehöre zum Inventar des Parks, sitzt sie doch fast jeden Werktag im Parkcafé, oft auch sonntags, vor sich einen Laptop und eine Tasse grünen Tee, ab und an einen Espresso. Hier isst sie häufig zu Mittag, denn das Café bietet auch eine gute Auswahl an warmen Speisen, Salaten und kleinen Imbissen.
Nach dem kargen Mittagessen, Gulaschsuppe mit Brot, steht sie auf, schlendert durch den Park und nimmt aufmerksam wahr, wo etwas blüht und wer ihr begegnet.
Den Nachmittag verbringt sie zuweilen in ihrer Stadtwohnung, geht hin und wieder in das Café am Marktplatz, in dem sie sich mit Bekannten trifft, trinkt Tee und lässt sich ein Stück Kuchen schmecken, gelegentlich auch eine Schwarzwälder Torte. Ihren Laptop hat sie immer dabei.
Sie ist eine bekannte Publizistin und veröffentlicht unter dem Namen Alice Adler, aber manche munkeln, das sei nicht ihr richtiger Name. Sie erzählt in der Lokalzeitung von ihren täglichen Beobachtungen in der Stadt und im Park. Sie ist freie Journalistin und berichtet in diversen Magazinen von den Sorgen und Nöten im Alltag der kleinen Leute. Und sie schreibt Romane, erfolgreiche sogar.
Heute streift sie nach dem Frühstück durch den Park und trifft in der Nähe des Streichelzoos auf Chefgärtner Schöllhorn, der auf seinem täglichen Kontrollgang ist.
„Wieder zurück aus dem sonnigen Süden?“, fragt er die Autorin, die mit weißer Wollmütze und jetzt zugeknöpftem, rotem Mantel unterwegs ist und offensichtlich friert.
„Ja“, lacht Frau Adler, „vier Wochen auf Madeira sind genug. Aber die Wärme und die Sonne hätte ich schon gerne mitgenommen.“ Sie zieht eine Minikamera aus ihrer Jackentasche. „Was blüht denn gerade?“
Herr Schöllhorn hat diese Frage erwartet, denn Frau Adler stellt sie nach jedem Urlaub. Er führt die Journalistin auf die andere Seite des Tiergeheges. Dort leuchten viele Schneeglöckchen in der Mittagssonne. Und die ersten Winterlinge sind aufgeblüht, herrlich goldgelb kontrastierend zu den weißen Schneeglöckchen. Auch sie bevorzugen lichten Halbschatten in windgeschützter Nähe von Gehölzen. Wo gegraben und gehackt wird, da ziehen sie sich zurück. Sie wollen ungestört sein.
Alice Adler macht Fotos und ein paar Notizen. Dann bittet sie Herrn Schöllhorn um Rat: „Welche Pflanzen würden sie mir für meine tägliche Kolumne empfehlen?“
Schöllhorn zögert keine Sekunde: „Christrose, Schneerose und Lenzrose!“
„Nicht Schneeglöckchen und Winterlinge?“
„Die kennt doch jeder.“ Schöllhorn winkt ab. „Aber Christrosen, Schneerosen und Lenzrosen sind selten und geschützt.“
„Kapiert, Herr Schöllhorn. Bitte zeigen Sie mir Ihre Lieblinge.“
Sie kommen an ein Blumenbeet, darin schneeweiße Christrosen. Frau Adler fotografiert sie von allen Seiten.
„Bereits Mitte November blühen sie auf. Wenn die meisten Pflanzen im tiefen Winterschlaf sind, verschönern die Christrosen Gärten, Balkone und Terrassen“, sagt Schöllhorn. „Es sind unkomplizierte Blumen, winterhart, pflegeleicht und immergrün.“
Er verweist darauf, dass viele Legenden und Mythen sich um die Christrose ranken. Sie zähle zu den ältesten Kulturpflanzen und werde in antiken Erzählungen erwähnt. Bei den Germanen sei sie heilig gewesen. Und im Mittelalter habe man ihr allerlei Heilund Zauberkräfte zugeschrieben.
„Und wo sind die Schnee- und Lenzrosen?“, will Frau Adler wissen.
Der Gärtner zeigt auf das Nachbarbeet: „In wenigen Tagen blühen sie auf. Manche in Weiß, aber die meisten in allen Schattierungen von Gelb über Rot bis Lila und tiefem Blau. So wie die Christrose das Christfest ankündigt, so kündigen die Schnee- und Lenzrosen den Frühling an.“
„Erzählen Sie mir etwas über diese beiden Arten?“
Herr Schöllhorn weist darauf hin, dass die Schneerosen auch winterhart und immergrün sind, aber wegen ihres mediterranen Einschlags mehr Sonne als die Christrosen brauchen. Die Schneerose blühe, wegen ihrer Abstammung von der Christrose, eher pastellfarben: weiß über zartrosa und lindgrün bis hellviolett.
Dagegen erschaffe die Lenzrose eine große Vielfalt an verschiedenen Formen und kräftigen Farben. Sie blühe bis in den späten Frühling hinein und werde bei Gartenfreunden immer beliebter, zumal es, dank intensiver Züchtungen, mittlerweile auch gefüllte und mehrfarbige Sorten gibt.
„So“, sagt Herr Schöllhorn, „ich hoffe, Sie haben jetzt genug Anregungen für Ihren Artikel.“
Frau Adler bedankt sich und geht zurück ins Parkcafé, wo sie sich gleich an die Arbeit macht.
*
Am nächsten Tag erscheint in der hiesigen Zeitung der erste von drei Artikeln, mit zwei Fotos illustriert. Herr Schöllhorn staunt, als er ihn liest.
Frau Adler beschreibt, wie der liebe Gott in seinem Winterhaus im himmlischen Garten Eden sitzt. Er hat es sich vor dem brennenden Kamin gemütlich gemacht und schlürft Kamillentee.
Als ihm ein Engel ein paar Kekse reicht, sagt er: „Kannst du dir das vorstellen? Bei uns heroben ist es angenehm warm, und da drunten auf der Erde frieren die Menschen. Da hat wohl der Luzifer seine Finger im Spiel.“
Der Engel nickt und klimpert ein paar Akkorde auf seiner himmlischen Harfe.
„Komm, hör auf! Das ist fürwahr eine scheußliche Musik. Ruf den Johann Sebastian. Er soll mir etwas Schönes vorspielen.“
Ein Glatzkopf erscheint und verneigt sich. „Zu Diensten“, sagt er untertänig und macht auch noch einen Kratzefuß.
Gott kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Er weiß, der Bach ist bloß so zahm, weil er etwas will. „Setz deine Perücke auf“, ermahnt er ihn, „sonst kennt dich doch keiner!“
Bach saust davon und kommt gleich wieder, nun nicht mehr barhäuptig. Er nimmt vor dem himmlischen Piano Platz und schlägt wundersame, liebliche Töne an.
„Hast du einen bestimmten Wunsch?“, fragt er den lieben Gott.
„Ja“, sagt der Allmächtige, „spiel mir das Lied von der Christrose! Der Caruso soll dazu singen!“
„Warum denn das?“
Gott lacht: „Die Melodie ist aus einem katholischen Gesangbuch, und der Text von einem Protestanten. Das ärgert die greisen Kirchenfürsten in Rom, und mich gaudiert’s, wenn die sich ärgern.“
Bach flitzt, Caruso saust herbei, und so spielen und singen sie gemeinsam:
„Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart Wie uns die Alten sungen, aus Jesse kam die Art. Und hat ein Blümlein bracht. Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht.“
Der Engel applaudiert, die zwei Musikanten verneigen sich, und der liebe Gott nickt beifällig.
„Ich hab noch nie eine Christrose gesehen“, jammert Bach.
Gott lacht. Er hat es längst geahnt. „Wirklich nicht, Johann Sebastian, oder schwindelst du schon wieder?“
Bach zieht eine schuldbewusste Grimasse und wird puterrot im Gesicht, hat ihn der Alte doch abermals durchschaut.
„Also gut“, erbarmt sich der himmlische Vater, „fahr halt noch einmal hinunter auf die Erde und geh in den Park von Meister Schöllhorn. Aber vergiss deine Perücke nicht, Johann Sebastian, sonst halten dich die Menschen für einen streunenden Straßenköter. Gleich beim Streichelzoo blühen seit ein paar Tagen wunderbare Christrosen.“
Bach ist schon an der Himmelstür, da ruft Gott ihm nach: „Nimm den Caruso mit und geh mit ihm anschließend in eine Pizzeria. Sonst heult er wieder. Du weißt doch, er ist Italiener. Er verabscheut das himmlische Manna und isst Spaghetti für sein Leben gern. Lasst euch von Petrus einen Vorschuss geben. Euro! Hörst du!? Nicht Reichsmark wie beim letzten Mal!“
Bach macht abermals einen Kratzefuß.
„Und bring einen Zahlungsbeleg mit! Petrus hat sich bei mir beschwert, du hättest ihn um zehn Euro beschummelt!“
„Mach ich. Sonst noch was?“
„Geh in der Stadtbücherei vorbei und such im Internet das Christrosengedicht von Johannes Trojan heraus, ich hab’s nämlich vergessen.“
„Internet? Nie gehört.“
Der liebe Gott schreibt das Wort und den Namen des Dichters mit dem bloßen Zeigefinger auf einen güldenen Zettel.
Bach nimmt den großen Zettel („Seine Schrift wird von Jahr zu Jahr auch immer größer“, nuschelt er, „der braucht dringend eine Brille“) und verneigt sich tief.
„Den gibst du der Bibliothekarin. Sag ihr, sie soll den Text auf die Rückseite schreiben. Und dann kommt ihr Spitzbuben auf der Stelle heim und berichtet. Sonst raucht’s!“
Am Abend sind die zwei zurück, voll des süßen Weines und müde vom üppigen Essen. Sie überreichen dem himmlischen Vater den großen Zettel, die Fotos von den Christrosen im Park („Sonst sagt der Alte wieder, wir wären nicht da gewesen“, flüstert er Caruso zu), einen Zahlungsbeleg aus der Pizzeria und zählen das Restgeld auf den Tisch.
„Was soll ich mit dem Zaster?“, knurrt der himmlische Vater. „Beleg und Rausgeld bringst du dem Petrus! Wann kapierst du das endlich, Johann Sebastian?“
Bach macht schuldbewusst erneut einen Kratzfuß, und Caruso verneigt sich.
Gott nimmt den großen Zettel, dreht ihn um und liest: Johannes Trojan, Chefredakteur des politischsatirischen Wochenblatts Kladderadatsch, verfasste über dreißig herrlich illustrierte Kinderbücher sowie Erzählungen, Reiseberichte und Naturbeobachtungen. Über die Christrose reimte er:
Die Christrose hebt ihr weißes Haupt in der schweigenden Welt, die der Winter umfangen hält, hebt sie einsam ihr weißes Haupt. Selber geht sie dahin und schwindet eh’ der Lenz kommt und sie findet, aber sie hat ihn doch verkündet, als noch keiner an ihn geglaubt.
„Na ja“, seufzt der liebe Gott, „meine Christrosen hätten Besseres verdient.“ Spricht’s und wirft den Zettel ins Kaminfeuer.
Bach und Caruso aber träumen in dieser Nacht von Christrosen. Und als sie am anderen Morgen erwachen, nehmen sie sich fest vor, demnächst, wenn die Schnee- und Lenzrosen blühen, erneut auf die Erde hinabzusteigen, Fotos im Park zu machen und dann den Tag wieder in der Pizzeria ausklingen zu lassen. Wenn sie nur wüssten, wie sie den Alten rumkriegen könnten.
*
Er war schon immer eher unauffällig, bieder und zuverlässig. Und jetzt das!
Er kommt aus der Herrentoilette im Park, trägt blaue Segeltuchschuhe, schwarze Jeans, ein blaues Hemd mit grauer Weste, einen Parka und auf dem Rücken einen sehr großen Rucksack.
Den ganzen Tag hat er im Park verbracht, hat mit niemandem gesprochen, ist mehrmals dieselben Wege gegangen und ist wiederholt gedankenverloren dagestanden und hat geschaut.
Thomas Specht, den die Leute den Abendgärtner nennen, weil er ausschließlich nachmittags bis zur Sperrstunde Dienst tut, hat den Rucksackträger die ganze Zeit beobachtet. Irgendwo hat er ihn schon einmal gesehen. Aber wo? Und er fragt sich, wozu man im Park einen so großen Rucksack braucht.
Gegen halb acht macht er sich auf seinen täglichen Kontrollgang. Seit sieben Uhr sind die Eingänge geschlossen, aber über die Drehkreuze kann man den Park jederzeit verlassen. Die Eingangstür zum Vorraum der Toiletten und der Waschräume schließt automatisch um halb acht, zeitgleich zur Lautsprecherdurchsage, die zum Verlassen des Parks auffordert. Drei weitere Warnhinweise folgen.
Specht umrundet einmal das Parkgelände. Ist am Streichelzoo alles in Ordnung? Haben die letzten Besucher das Gelände verlassen? Hat jemand etwas liegenlassen? Wo ist etwas beschädigt und muss dringend repariert werden?