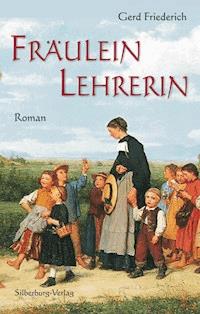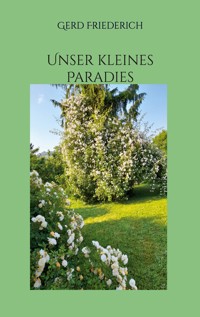Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Überarbeitete, ins Hochdeutsche übertragene und stark gekürzte Neuausgabe der erfolgreichen Enzheim-Trilogie. Sie war in schwäbischer Mundart abgefasst und bestand aus den Romanen Kälberstrick, Sichelhenke und Tod dem König. Herbst 1841: Mord im Städtchen. Die dörfliche Dreifaltigkeit aus Pfarrer, Schultheiß und Lehrer muss den Fall aufklären. Frühjahr 1842: König Wilhelm I. von Württemberg hat angekündigt, das Städtchen zu besuchen. Man wartet und wartet ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Friederich, aufgewachsen im hohenlohischen Langenburg und schwäbischen Bietigheim an der Enz, studierte in Würzburg fürs Lehramt (Deutsch, Kunst, Geschichte, Geografie) und berufsbegleitend noch zweimal, zunächst in Tübingen (Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Landeskunde), wo er mit einer Arbeit zur Schulgeschichte promovierte, und viele Jahre später in Nürnberg (Malerei). Er arbeitete als Lehrer, Heimerzieher, Personalreferent, Schulrat, Lehrerausbilder und veröffentlichte viel Fachliteratur. Jetzt lebt er im Taubertal, schreibt Romane und malt Porträts und Landschaften.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Linnfurt um 1840
Ende August 1841
Sichelhenke
Der Läpple ohne Käpple
Immer Ärger über die Regierung
Leichenschmaus
Heiße Spur?
Jahrhundertfest
Neue Sparkasse, neue Gemeindeverordnung
Des Schultes Töchterlein bockt
Erntedankfest
Reformationstag
Martini
Februar 1842
Linnfurter Alltag
Der Nikolaus ist da
„Tod dem König!“
Schwer verwundet
Verpappte Hochzeit
Österreichisch-preußische Allianz
Nichts als Ärger
Schwerer Fehler
Der Bart ist ab
LITERATUR VON GERD FRIEDERICH
Vorwort
Schwäbisch ist zweifellos eine schöne und kreative Mundart. Damit das auch außerhalb Schwabens bekannt wird, habe ich sie in meiner Enzheim-Trilogie aus Kälberstrick, Sichelhenke und Tod dem König zumindest teilweise verwendet und für nichtschwäbische Leserinnen und Leser eine Wörterliste der Dialektwörter angehängt.
Natürlich deuteten meine schwäbischen Textpassagen die Mundart nur an, denn lautgetreu geschrieben sind sie auch für Schwaben schwer zu entziffern. Vor allem die fürs Schwabenland so charakteristischen Nasal- und Gutturallaute können mit den 26 Buchstaben unseres Alphabets nicht annähernd wiedergegeben werden.
Immer wieder haben mich des Schwäbischen unkundige Leserinnen und Leser darauf hingewiesen, dass ihre Freude an der Lektüre doch arg getrübt wird. Deshalb habe ich mich entschlossen, eine hochdeutsche Variante der drei Romane herauszugeben und dabei den Text zugleich zu kürzen und zu überarbeiten.
Das Städtchen Linnfurt (vormals Enzheim) ist frei erfunden. Auch die handelnden Personen habe ich mir ausgedacht. Aber die Kulisse des Romans entspricht dem, was die landesgeschichtliche Forschung besagt. Die folgenden fünf Seiten beschreiben den exakten historischen Hintergrund der Handlung.
.
Ende August 1841
„Was stinkt denn da so gottserbärmlich?“ Der Schultheiß und Lindenwirt Fritz Frank, den man dienstlich den Schultes und privat den Aberjetza nennt, steht auf, marschiert in seiner leeren Schankstube auf und ab, schnüffelt wie ein Bär auf Honigsuche in alle Ecken und beschnuppert sich. Witternd zieht er die Luft ein.
„Ich riech nix“, bekennt der Scharwächter arglos.
Der Schultes schließt die Fenster. Vielleicht hat draußen jemand geodelt. Er setzt sich und atmet tief durch. „Sapperlott, jetzt stinkt’s noch mehr!“ Schimpfend steht er wieder auf, geht kreuz und quer durch den Saal und folgt mit geblähten Nüstern der irritierenden Duftspur. Neben dem Hilfspolizisten bleibt er stehen und hechelt. „Du bist der Stinker!“ Entsetzt weicht er zurück.
„Kann nicht sein, kann nicht sein!“, braust der Scharwächter auf. Er habe sich heute schon gewaschen. Gottlob Vorderlader, so sein amtlicher Name, war einst Soldat, bis er nach den napoleonischen Kriegen beim Militär ausgemustert wurde. Seitdem ist er Feld- und Wengertschütz sowie Hilfspolizist in einem.
Der Schultes reißt alle Fenster auf und schreit einer Magd.
Obermagd Paula kommt aus der Küche gerannt. „Wo brennt’s?“
„Aberjetza riech mal.“
Paula hält sich sofort die Nase zu. „Gülle und Schnaps“, näselt sie mit erstickender Stimme, torkelt ein paar Schritte, schnappt nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen und klemmt sich mit Daumen und Zeigefinger die Nase wieder zu. Wortlos deutet sie auf den Scharwächter, rollt die Augen, als falle sie in Ohnmacht, und flüchtet in die Küche.
„Steh auf!“, brüllt der Schultes den verdatterten Scharwächter an.
Der Hilfspolizist gehorcht aufs Wort, aber der Stuhl ist trocken, der Hosenboden auch.
Nach ausgiebigem Gezerf und Gezänk gesteht der Mann im blauen Amtskittel mit den roten Litzen, dass er, weil heute doch Sichelhenke ist, von Scheune zu Scheune gehen musste, um nach dem Rechten zu sehen. Das sei schließlich seine Pflicht als Sicherheitsorgan der Stadt Linnfurt an der Linn.
„Und da haben sie dich mit Schnaps, Wein und Most abgefüllt.“ Der Schultes fragt nicht, er stellt es amtlich fest. Er kennt seine Linnfurter in- und auswendig. Darum kann er bei diesem reichlich geübten Säufer in Uniform den nüchternen vom betrunkenen Zustand unterscheiden.
Den mündlichen Bescheid weist der Scharwächter mit aller Bestimmtheit als böswillige Unterstellung zurück. Er habe bloß elf Schnäpse und fünf Gläser Wein gekriegt. Ja, und dreimal habe er aus einem Mostkrug trinken dürfen. Die Leute würden immer geiziger.
„Hast Gülle gesoffen in deinem Rausch?“
„Nein!“ Der Hilfspolizist fuchtelt mit den Armen und ringt um Worte, weil seine Zunge so schwer im Gaumen hängt. Mit letzter Kraft bringt er endlich hervor, dass ihn der Geselle vom Küferschorsch absichtlich stolpern ließ. Und dabei sei er versehentlich in die Jauchegrube gefallen. Aber sofort habe er sich am Laufbrunnen auf dem Marktplatz Gesicht und Hände gewaschen, er sei doch ein reinlicher Mensch.
Der Schultes flucht sein ganzes Repertoire an Verwünschungen und Beleidigungen alphabetisch rauf und runter. Aus moralischen Gründen können sie nur auszugsweise wiedergegeben werden: „Allmachtsdackel! Hosenscheißer! Katzenmelker!! Ober-dubbeler!!! Rauschkugel!!!“.
Wütend stößt er die Tür zur Küche auf und erteilt Paula die Weisung, das gesamte Dienstpersonal, das in der Scheune beisammensitzt und Sichelhenke feiert, müsse sofort zum Appell in der Linde antreten. Der Scharwächter werde ausgemistet! Und zwar jetzt! Von den Schweißfüßen bis hinter die dreckigen Ohren. Gefahr im Verzug! Sonst könnte morgen schon in ganz Linnfurt die Seuche ausbrechen.
Die dienstbaren Geister treten vollzählig in der Linde zum Befehlsempfang an, die Gesichter leuchtend rot vom Alkohol und von der immensen Schufterei der letzten fünf Wochen an der frischen Luft. Grinsend halten sich die Mägde und Knechte die Nasen zu und schnappen mit offenem Mund nach Luft, wie ein taubstummer Gesangverein bei der Generalprobe.
„Aberjetza“, der Schultes baut sich vor seiner Mannschaft auf, „machen wir das so.“
Die Mägde erhalten die Order, im Sutrai [Keller, Untergeschoss] sofort einen Zuber mit lauwarmem Wasser sowie Bürsten und Striegel bereitzustellen. Auf unterdrücktes Murren fügt der Schultes an, dass bis morgen Abend um acht, wenn die Linde wieder öffnet, noch genügend Zeit zum Feiern in der Scheune und auf der Linnwiese bleibt.
Zuerst müsse der Rossknecht den Saufkopf dreimal in der Viehtränke untertauchen, damit der Dreck eingeweicht wird.
„Vorwäsche“, lacht der Knecht, „kapiert.“
Dann soll er ihn splitterfasernackt ausziehen und im Zuber mit der Wurzelbürste abschrubben.
„Soll ich Seife nehmen?“
„Nein, die ist zu teuer. Aberjetza hat meine Frau einen alten Essig, der schon hinüber ist.“ Sie solle ihm ein starkes Essigwasser herrichten, damit es dem ganzen Lumpenzeug, das auf dem Scharwächter herumkrabbelt, schwindelig wird. Mit diesem scharfen Essig müsse man den Stinkstiefel abbürsten und seine Haare spülen. Es könnte nämlich leicht sein, dass der Herr Hilfspolizist bereits von Flöhen, Läusen und der Krätze befallen ist. Notfalls solle sich der Knecht nicht scheuen, schwarze und braune Krusten mit Scheuersand zu bearbeiten und den Kopf des Scharwächters mit dem Pferdestriegel zu filzen. Und zum Schluss solle er ihn nochmal kräftig in der Viehtränke wässern.
„Soll ich dann die saubere Wäsch zum Trocknen aufhängen und bügeln?“, lacht der Knecht.
Der Scharwächter, der bisher nicht wusste, wie ihm geschieht, legt Widerspruch ein. So dürfe man nicht mit ihm umspringen, denn er sei eine Amtsperson.
„Amtsperson?“, höhnt das Stadtoberhaupt, „Quadratsdackel, Saufloddel, Hosenbrunzer!“ Verächtlich winkt er ab. „Wenn‘s Dummsein weh tät, dann müsstest du Tag und Nacht schreien.“
„Paula“, weist der Schultes seine Obermagd an, „du gehst zum Wengerttor.“ Sie solle, wenn der Knecht den Scharwächter entblößt hat, der leidgeprüften Ehefrau die stinkenden und dreckstarrenden Kleider ihres Göttergatten bringen und dafür saubere Wäsche holen.
Der Scharwächter will opponieren, aber der Schultes droht, ihm sein Amt noch heute Abend abzuerkennen, wenn er sich widersetzen sollte.
Linnfurt liegt an der Linn, einem Nebenfluss des Neckars. Es ist ein altes Residenzstädtchen in der ehemaligen Grafschaft Linnfurt-Habsburg-Burgund und das geografische, geschichtliche, politische und kulturelle Zentrum des Königreichs Württemberg.
Unter Friedrich Barbarossa dienten die Herren von Linnfurt als hohe Beamte den mächtigen Staufern. Die Nachfahren Barbarossas balgten sich um diese kleine, aber feine Herrschaft an der Linn, doch den Sieg trugen die Linnfurter davon. Sie jagten ihre Adligen durch die Spieße und kürten selbstherrlich einen Edelmann vom Zürichsee zum Grafen von Linnfurt. Im frühen 16. Jahrhundert schlossen sie einen Vertrag mit den Habsburgern, die Linnfurt dafür zur Stadt und zur Residenz der Grafschaft Linnfurt-Habsburg erhoben. Fünfzig Jahre später erwarb Graf Gottfried VI. von Linnfurt durch Heirat mit Sieglinde von Burgund die Grafschaft Burgund-Bessoin. So kam französische Lebensart an die Linn. 1805 fielen die rechtsrheinischen Teile der Grafschaft im Zuge der napoleonischen Flurbereinigung an Württemberg, die linksrheinischen an Frankreich.
Entstanden ist das Königreich Württemberg am 1. Januar 1806 aus dem Herzogtum Württemberg und zahlreichen Neuerwerbungen. 1840 ist es noch ein reiner Agrarstaat. Achtzig von hundert Württembergern sind Bauern, Weingärtner, Knechte und Mägde. Zwanzig von hundert verdienen als Handwerker, Händler, Soldaten und Dienstboten ihr tägliches Brot. Es ist eines der ärmsten Länder Europas, es hat keine Bodenschätze, und die napoleonischen Kriege haben das Land verwüstet. Zwar fanden die meisten Schlachten nicht auf württembergischem Gebiet statt, aber die ständigen Truppendurchzüge mit Einquartierungen, Beschlagnahmen von Lebensmitteln und Futter bis hin zu Plünderungen und Brandschatzungen raubten das Land und die Bevölkerung aus. Etliche Missernten und die Eruption des Vulkans Tambora gaben den gebeutelten Württembergern den Rest. Im April 1815 war der Vulkan explodiert. Asche- und Schwefelgaswolken verdunkelten zwei Sommer lang den Himmel und verursachten hierzulande eine schreckliche Hungersnot und eine riesige Auswanderungswelle.
König Wilhelm I. von Württemberg bringt das verarmte Land allmählich in Schwung. Er hat das Cannstatter Volksfest als alljährliche Leistungsschau eingeführt, in Hohenheim die erste landwirtschaftliche Hochschule der Welt sowie ein Ackerbauschule, eine Weinbauschule, eine Forschungsanstalt für Saatzucht und Obstbau und eine Pflugfabrik gegründet. Seit Fritz Frank Schultheiß von Linnfurt ist, pflanzen die Linnfurter neue Rebsorten und setzen viele Obstbäume innerorts und außerorts an den Feldrainen. Jetzt wächst in ihren Weinbergen ein vorzüglicher Rotwein. Jetzt haben sie frisches Obst im Herbst und das ganze Jahr Dörrobst in Hülle und Fülle. Und ihr famoser Apfel-Birnen-Most ist weit und breit konkurrenzlos.
Während der Scharwächter Zeter und Mordio schreit, weil der Knecht ihn samt Kleidern mit harter Hand in der Viehtränke eingeweicht und im Sutrai entkleidet hat, eilt die Obermagd durch die menschenleeren Gassen zum Wengerttor. Sie atmet durch den Mund und streckt mit sichtlichem Ekel einen Ferkelkorb weit von sich. Darin liegen Stiefel, Hose, Kittel und Hemd des Badegastes.
Der Weg ist steil und beschwerlich. Aus allen Gehöften dringt das Geschrei der Dienstboten, die unter den aufgehängten Sicheln und Sensen hocken, bechern und das in Linnfurt übliche Schmalzgebäck verputzen. Paula mault vor sich hin: „Aberjetza, aberjetza!“ Gerade dann, wenn auch sie einmal die Hände in den Schoß legen könnte, bruddelt sie, müsse sie in die Oberstadt. Sie stapft wütend die Hauptstraße hinauf, ärgert sich über die gute Laune der Feiernden, streckt am Rathaus dem in der Linde weilenden Schultes die Zunge raus, knurrt ein saftiges „Leck mich …“ und schnauft die Habsburger Straße hinüber bis zum Wengerttor. Es ist zweigeschossig und hat ein kleines Türmchen mit aufgesetzten Zinnen. Dort oben, wo früher die Musketen abgefeuert wurden, wenn sich der Feind von Norden her näherte, flattert Wäsche im Wind.
Außer Atem klopft sie so lange an die Tür, bis die Scharwächterin aufmacht. Sie ist eine verhärmte Frau im mehrfach geflickten Schaffschurz, barfuß, mit einem Kopftuch, das sie im Nacken verknotet hat. An ihrem Schürzenzipfel hängt ein kleiner Bub, eine Rotzglocke über der Lippe.
„O jegesle“, die Hausfrau schlägt vor Entsetzen fast die Füße über dem Kopf zusammen, „ich seh schon.“ Sie rümpft die Nase. „Ist das alles, was von dem Drecksack übrig ist?“
Bevor sie die Magd hereinbittet, ruft sie ihrer Wilhelmine zu, die auf dem Misthaufen vor dem Nachbarhaus spielt: „Helmle, gleich gehst runter von dem Misthaufen, du Drecksau!“
Paula überkommt Mitleid. Die treue Seele tröstet und berichtet. Sie lässt nichts aus, beschreibt den Suff, das Güllebad, den Gestank, die Vorwäsche, die Hauptwäsche und die Desinfektion.
Die Scharwächterin schüttet der Magd ihr Herz aus. Die ewige Geldnot, die Armut im Haus, die Angst vor der Zukunft bringe sie um den Verstand. Jedes Mal, wenn ihr Gottlob nicht rechtzeitig heimkommt, packe sie das Grausen. Dann sitze sie bibbernd in der Küche und male sich aus, wie sie ihre sieben Sachen packen undmit ihren neun Wuserle [Kindern] als Bettlerin von Haus zu Haus ziehen müsse. Eigentlich sei ihr Mann bloß ein Dubbel. Wenn er nüchtern sei, kümmere er sich rührend um die Kinder. Wäre da nicht der regelmäßige Suff, könnte sie gut mit ihm zusammenleben. Habe er jedoch ein paar Schnäpse intus, verwandle er sich in einen Hanswurst und versaubeutele noch den letzten Notgroschen. Wenn der Schultes ihrem Gottlob einmal ein Licht aufstecken würde, wäre sie dem Herrn Stadtvorsteher auf ewig dankbar.
Die Stiefel ihres Mannes werde sie gleich schrubben, trocknen und einfetten, verspricht sie. Er habe aber nur das eine Paar, also müsse er solange barfuß laufen. Dann holt sie geflickte Strümpfe, genäht aus braunem Leintuch, ein langes Nachthemd und einen Stuckblätz [Flicklappen]. Auch für die Hose und den Kittel gebe es leider keinen Ersatz. Deshalb solle sich ihr Mann nach dem Bad den Stuckplätz um sein Gemächt wickeln. Für den kurzen Heimweg werde das im Dämmerlicht genügen. Gleich mache sie sich daran, Hose und Amtskittel zu waschen. Denn morgen früh müsse ihr Mann auf den Läpplehof. Die Läpple sei schon zweimal dagewesen. Aus Sorge um ihren Johann, den man seit geschlagenen drei Stunden nirgendwo mehr gesehen habe.
Paula verspricht der Scharwächterin, beim Schultes ein gutes Wort einzulegen und macht sich auf den Rückweg. Als sie in die Hauptstraße einbiegt, sieht sie ihn von weitem vor der Linde stehen und mit sich selber schwätzen.
Der Herr Stadtpräsident sinniert: Heute ist die Linde zu, weil sowieso niemand kommt. Und morgen Abend macht sie wieder auf, aber da läuft vermutlich auch nicht viel. Denn aus allen vier Himmelsrichtungen hört er seine Linnfurter bechern und frohlocken. Diese Feste in den Gassen und Höfen ärgern ihn seit Jahren, weil dann keiner mehr ins Wirtshaus geht. Bevor der Mond scheint, sind am Sichelhenkensamstag viele schon abgefüllt. Leider, leider. Das sei Brauch, sagen sie, gehöre zur Tradition. Kaum ist der letzte Halm gesichelt, rennen sie vom Feld direkt in die Scheunen und saufen im Dreck und Speck, bis es am Himmel und in ihren Köpfen Nacht wird. Sogar die Vögel sind besoffen. Spatzen und Meisen picken an Birnen und Äpfeln, die überall herumliegen und zu gären beginnen. In Schlangenlinien fliegen sie von Baum zu Baum, torkeln von Ast zu Ast und zirpen ihre Sauflieder. Und am Sichelhenkensonntag muss man nach dem Festgottesdienst, so will es der Brauch, den Dienstboten ein festliches Mahl servieren. Erst am Sonntagabend vertragen die ersten wieder ein Bier oder einen Wein in der Linde. Zum Glück ist die Weizen- und Roggenernte noch einigermaßen zufriedenstellend ausgefallen. Auch Äpfel und Birnen gibt es heuer genug. Dafür wird die Weinernte miserabel. Eigentlich sollte man am Montag … . Sein Ärger schlägt in Wehmut und Demut um.
Und wie er so die Lage bedenkt, steht auf einmal die Paula vor ihm, zeigt auf die geringe Ausbeute in ihrem Korb und berichtet.
„Dann kriegt er halt eine alte Hose von mir“, verkündet der Schultes milde. Ein paar aussortierte Schuhe seien vielleicht auch noch da. Keiner in Linnfurt soll sagen können, das Stadtoberhaupt lasse seine Bürger verkommen.
„Minna!“ Er schreit und schreit, aber nichts rührt sich. „Wo scharwenzelt die schon wieder rum?“
Paula zuckt die Achseln. „Vielleicht hockt sie mit dem Frieder bei den Dienstboten in der Scheuer und feiert mit.“ Frieder ist der älteste Sohn des Lindenwirts und für die Landwirtschaft zuständig. Sie verschwindet im Sutrai und liefert die Wäsche ab.
Derweil geht der Schultes in die Scheune, wo sich, außer der Obermagd und dem Rossknecht, alle versammelt haben, die auf sein Kommando hören. Der Scharwächter habe bloß eine Hose und ein Paar Schuhe, sagt der Schultes zu seiner Frau. „Sei so gut und such dem armen Kerl was raus. Vom Großvater sind noch ein paar Sachen da.“
„Armer Kerl?“ Minna Frank giftet. Wenn einer in der Gülle badet und sich auf dem Misthaufen wälzt, sei das eine Drecksau. „Kein einziges Stückle sollte man der Drecksau geben.“ Dennoch steht sie mühsam auf und wackelt auf ihren krummen Beinen zum Scheunentor hinaus.
Kaum ist sie draußen, stößt Paula lachend zur Lindenschar, schnappt sich ein Glas Wein und berichtet, dass der Scharwächter mit seinem langen Nachthemd und dem Stuckplätz zwischen den Beinen wie ein Hosenscheißer aussieht.
„Stuckplätz?“, fragt Hansli Wägeli, den man im Städtle nur den Schweizer nennt, weil er fürs Milchvieh zuständig ist. Dieses Wort sei ihm nicht geläufig.
„Ja“, sagt Paula und erzählt, was sie im Wengerttor gehört und im Sutrai gesehen hat.
„Na und?“ Der Schweizer zuckt die Achseln und bekennt in kehligem Schwyzerdütsch: „Ich habe auch keine Unterhose.“
Ein kurzes, verlegenes Lachen, dann sind sich alle in der Runde schnell einig: Auch in Schwaben brauchen Männer keine Beinlinge unter der Hose. Frauen erst recht nicht, weil sie drei bis fünf bodenlange Röcke übereinander ziehen. Wenn’s mal pressiert, sei eine Unterhose nur hinderlich. Nicht alles, was vornehme Franzosen und hochnäsige Offiziere voräffen, müsse man nachmachen. Es genüge vollauf, wenn sich die Männer die Hemdenzipfel zwischen die Beine schieben. Und die Frauen könnten ihr Geschäft nicht mehr im Stehen verrichten, wenn sie eine Unterhose tragen müssten. Auf dieses neumodische Zeug könne man hierzulande also gut verzichten.
In dem Augenblick betritt der Scharwächter die Scheune, flankiert von der Lindenwirtin und dem Rossknecht.
Großes Gelächter. Sogar die Lindenwirtin verzieht das Gesicht zu einem breiten Grinsen, als wolle sie sagen: Schaut her, welch rarer Vogel uns da zugeflogen ist.
Im weißen, mehrfach geflickten Hemd steht der geschniegelte und gebügelte Hilfsgendarm mit blank gebürstetem Gesicht und hängenden Schultern vor ihnen. Abwärts eine stockfleckige Tuchhose, knöchellang, enganliegend, quietschgelb mit besticktem Hosenlatz, zu Napoleons Zeiten durchaus salonwürdig. Aus den Hosentaschen hängen die Strümpfe. Die bloßen, vom Schrubben geröteten Füße stecken in schwarzen, flachen Schuhen mit Zierschleifchen. Salonschleicher sagt man in Linnfurt dazu. In solchen Tretern sind einst die vornehmen Herren übers Parkett geschlichen, gepuderte Perücken voller Maden auf dem Kopf und Rüschen an den Manschetten. Um die nassen Haare hat er den Stuckplätz wie einen Turban gewickelt.
Der Badegast will gerade nach dem Wein greifen und sich in die lachende Runde setzen, da kläfft ihn der Schultes an, er solle sich schleunigst vom Acker machen und auf direktem Weg heimgehen. So sei es mit seiner Frau ausgemacht. Und wenn er heute irgendwo nochmal hängen bleibe und ein Maulvoll trinke, außer Wasser natürlich, dann werde er ihm zeigen, wo der Bartel den Most holt.
Sichelhenke
Im Sonntagsstaat sitzen sie um den Küchentisch. Der Schultes und seine Frau. Ihr ältester Sohn Frieder. Magda, die noch ledige Tochter. Wilhelm, Minnas Nestkegele, dem sie viel durchgehen lässt und das demnächst eine Mechanikerlehre beginnt. Dann der Ober- und Rossknecht Karl, die Obermagd Paula, der Schweizer und elf weitere Dienstboten für diverse Haus-, Feld- und Weinbergarbeiten. Die Eltern beider Wirtsleute, die früher mit am Tisch saßen, sind schon vor Jahren gestorben. Der Schultes hat ihrer, wie’s Brauch ist in Linnfurt, gerade beim Tischgebet gedacht.
Die Stimmung ist gedämpft. Die Restsüße gärt noch in den Gedärmen und wattiert die Gedanken. Außerdem lässt man vor dem Frühstück das Erntejahr Revue passieren. Und dabei kommt kaum Freude auf.
Spätestens seit der ersten Heuernte, der Heuete, erinnert der Schultes in seiner kurzen Ansprache, habe jeder gewusst, dass ein schwieriges Jahr bevorsteht. Wegen des langen, harten Winters und der strengen Fröste im Frühjahr sei die Saat zwei bis drei Wochen später aufgegangen als sonst. Das Gras habe sogar erst Mitte Juli zu blühen begonnen. Und weil man für den ersten Grasschnitt warten müsse, bis die Wiesen in voller Blüte stehen, es dann aber oft geregnet hat, sei die Heuete und die Zeit danach eine einzige Flickschusterei gewesen. Statt acht bis neun Wochen, wie in den Vorjahren, seien nur fünf für die Getreideernte übriggeblieben. Denn erst nach Jacobi habe man das erste Gerstenfeld sensen und sicheln können.
„Ja“, sagt der Schweizer, der die Sense wie kein anderer schwingen kann, darum seien die Mäher an den trockenen Julitagen schon nachts um drei losmarschiert. Die Sense auf dem Rücken, den Wetzstein am Gürtel, habe man etwa eine Stunde bis zu den weit entfernten Wiesen gehen müssen, etwas später gefolgt von den Mägden und Knechten, die vorher das Vieh versorgten. Während eine Gruppe Nachzügler die frische Mahd zusammenrechte, wendete die andere das am Vortag gemähte und schon welke Gras und setzte es auf Häufen.
Schließlich, ergänzt der Oberknecht, habe man den Wagen umgerüstet, mit Leitern vergrößert, mit Dielen verlängert, damit mehr Heu geladen werden konnte und weniger Fuhren nötig waren. Dafür mussten die Männer nun das Heu hoch hinaufgabeln, über die aufragenden Wagenseiten wuchten, wo es die fleißigen Frauen gleichmäßig luden. Eine staubige und stickige Arbeit. Bei der Heimfahrt gingen die langen Kerle neben dem hochbeladenen Heuwagen und stützten mit Gabeln die schwankende Fracht während der Fahrt. Die kleineren griffen in die Radspeichen, weil die Feldwege löcherig und gefährlich waren.
Der Lindenwirt erhebt sich. „Und das war noch nicht einmal die Hälfte der Schufterei.“ Während der letzte Heuwagen entladen worden sei, habe der Schweizer die Sicheln und die Kornsensen mit Rechenaufsatz gedengelt. Am nächsten Morgen um drei sei die Schufterei für alle weitergegangen. Wochenlang, bis gestern Nachmittag der letzte Getreidehalm geschnitten, die letzte Garbe in die Scheue gebracht war. Und die Lindenbäuerin, er sieht seine Frau an, während sie verschämt zu Boden schaut, habe seit Mitte August zusammen mit der Justina, die schon das fünfte Jahr am Hof sei, Hanf gerauft, gebündelt, getrocknet, geriffelt und auch noch das erste Leinöl gepresst. Sogar Kirsch- und Träublesaft hätten sie gemacht, Beeren zu Mus und Gelee verarbeitet, Obst-essig hergestellt, Schneidbohnen eingedünstet und Gurken, Perlzwiebeln und Champignons eingelegt.
Er dankt allen für die gute Arbeit, fünf Wochen lang werktäglich sechzehn Stunden. Die Ernte sei heuer zwar nicht besonders gut, aber niemand sei zu Schaden gekommen. Deshalb seien der gestrige Umtrunk in der Scheune, das heutige Festessen nach der Kirche und der Tanz am Nachmittag der verdiente Lohn.
Umständlich nestelt er seine Geldkatz auf. Er weiß, was sich gehört. Dem Oberknecht, dem Schweizer und der Obermagd drückt er einen Extragulden in die schwieligen Hände und sagt ein aufrichtiges Dankschön. Oft erst bei Anbruch der Nacht habe er seine Leute in den Lindenhof torkeln sehen, von der schweren Arbeit und vom langen Weg gezeichnet, kaum noch fähig zu stehen, geschweige denn zu gehen. Dennoch mussten der Oberknecht und der Schweizer im Schein der Petroleumlampen die stumpfen Sensen für den nächsten Tag dengeln und Paula die Mägde zum Füttern, Melken und Misten in den Stall treiben.
Ruhig und voller Hochachtung würdigt der Schultes das Geleistete.
Dann schüttelt er den übrigen Knechten und Mägden die Hand und gibt jedem und jeder einen halben Gulden als Zehrgeld für den Hahnentanz.
Schultes Fritz Frank setzt sich gerührt und wünscht allen einen guten Appetit.
Zunächst gibt es Brotsuppe und Habermark [gedünstete Haferwurzeln]. Das füllt den Magen und kann auch von den Älteren, die kaum noch Zähne im Mund haben, unzerkaut geschluckt werden.
Für ein Weilchen hört man nur das Klappern der Löffel, das leise Kauen und Schmatzen der Hungrigen. Dann ein Wispern, ein verhaltenes Kichern, ein erstes Lachen, die eine oder andere nicht ganz ernst gemeinte Bemerkung.
Horch! Es klopft zaghaft an der Küchentür. Alle Köpfe schnellen hoch, die Augen richten sich wie auf Kommando aus. Die Tür öffnet sich sacht. Im Rahmen steht der Scharwächter in weißem Hemd und gelber Hose, die Salonschleicher an den Füßen, die Haare sauber gekämmt.
Großes Gelächter.
„Napoleon ist auferstanden“, spottet der Oberknecht.
„Schwätz keinen Bäbb [Leim]!“, wehrt sich der Scharwächter. „Mein Kittel und meine Hos sind noch nicht trocken.“
„O verreck“, staunt der Schultes, „du bist ja nüchtern.“
Der aufgeräumte Hilfspolizist entschuldigt sich. Die Läpple sei schon wieder dagewesen. Sie vermisse ihren Mann.
Die Knechte und Mägde lachen, kichern, grinsen bis hinter beide Ohren.
„Dann such ihn halt.“ Der Schultes bleibt ernst.
Mehrfache Zurufe: „Unter alle Heuschober gucken!“ – „Fehlt auch eine von seinen Mägden?“ – „Keine Sorge, der ist nicht fortgelaufen.“
Schon öfter sei der Läpple auf Nachtstreife gewesen, meint der Schultes sachlich. Also bestehe noch lange kein Grund zur Sorge. Nach der Kirche werde er dessen Frau selber befragen.
Der Scharwächter ist von dem Gekichere und Gelächter ganz schalu [verwirrt]. Er zieht das Genick ein und tritt den geordneten Rückzug an, begleitet von munteren Sprüchen.
Dann wendet man sich vergnügt wieder dem Frühstück zu. Jetzt gibt es Milch, Kaffee und Most. Dazu Brot, Marmelade, Luckeleskäs [Quark] und selbstgemachte Wurst.
Pfarrer Abel ist heute gut in Fahrt. Er predigt seine Linnfurter in Grund und Boden, denn er ist ein erfahrener Hirte. Er weiß, dass seine Schäfchen müde sind von der harten Arbeit und voll des süßen Weines. Also trägt er dick auf, damit sie nicht einduseln.
Der dürre Heinrich, Amtsbote der Stadt Linnfurt und zugleich Schläferschreck mit der pfarramtlichen Dienstbezeichnung Kirchendusler, hinkt in der Kirche umher. Der fadenscheinige schwarze Anzug, den ihm sein Onkel vor zwanzig Jahren vererbt hat, glänzt am Hintern und an den Aufschlägen. Eine lange, dünne Stange mit beiden Händen fest gepackt, Empore und Kirchenschiff im Visier, hinkt er die Bankreihen auf und ab. Mit Adleraugen sieht er, wenn jemand vom Schlaf übermannt wird. Kaum klappt einer die Augenlider zu, schon schnellt der Heinrich vor und rammt dem Hammel die Stangenspitze in die Rippen. Ein triumphierender Blick, ein zufriedenes Lächeln: wieder drei Kreuzer verdient. Das ist der Tarif für einmaliges Duseln [Schlafen], zu zahlen gleich nach dem Gottesdienst, direkt an den Stangenheinrich. Aber bei bestimmten Kunden, er kennt sie alle aus Erfahrung, wartet er ein bisschen, ein hämisches Grinsen im Gesicht, bis der Schläfer zu ruseln [schnarchen] beginnt. Dann sind sechs Kreuzer fällig. Außerdem gilt an Sichelhenke ein Sondertarif. Wer nochmals duselt, muss weitere sechs Kreuzer blechen, wer zum zweiten Mal ruselt, sogar zwölf Kreuzer. So wird Sichelhenke für den Hinkenden, der nur einen kleinen Garten und keine Wiesen und Felder hat, auch zum Erntefest. Mit zwanzig wurde er Soldat und drei Jahre später am Knie verwundet. Seitdem dient er dem Schultes als Büttel, Bote und Berichterstatter. Er schellt die Bekanntmachungen aus, besorgt die Amtspost, bestellt Säumige und Schuldner aufs Rathaus, treibt Abgaben und Gebühren ein, erledigt alle anfallenden Botengänge und ermittelt auf Weisung von Schultes und Stadtrat alles, was die Verwaltung wissen will.
Mit Hilfe der gewaltigen Worte des Pfarrers und der kräftigen Stupfer des Kirchenduslers ist die Herde zur Predigt wach. Keine lauten Schnarcher lenken ab. Erwartungsvoll schauen alle zur Kanzel hinauf. Dort steht Abel im schwarzen Talar und spricht seinen Bauern aus dem Herzen, aber nicht nur ihnen.
„Sauwetter heuer“, beginnt er. Ein Jahr der Naturextreme sei das bisher gewesen. Zum Jahreswechsel enorm viel Schnee, vier Fuß hoch auf dem Schlossberg. Hochwasser am 18. Jänner. An der Flößerlände der höchste Wasserstand der Linn seit den Franzosenkriegen. Die fortgerissenen Stämme verursachten große Schäden und lösten schwere Überschwemmungen aus, weil sich das Holz verkeilt hatte. Wieder Frost und Schnee bis Anfang Mai, verderblich vor allem für die Winterfrüchte und die Reben. Leinsamen und Sonnenblumenkerne gingen nicht auf, die Wintergerste nur wenig. Dann, Anfang Juli, ein schwerer Orkan. Auf der Lug zerstörte der Sturm die tausend Jahre alte Eiche. Dennoch brachten Weizen und Roggen eine mittelmäßige Ernte. Beeren gab es reichlich. Die bevorstehende Obsternte werde nicht schlecht ausfallen. Auch die Kartoffelernte dürfte passabel werden, die Weinlese dagegen miserabel.
„Aber“, der Prediger hebt mahnend Finger und Stimme, „vergessen wir nicht, dass wir letztes Jahr alles in allem eine sehr gute Ernte hatten, weit über dem langjährigen Durchschnitt. Auch drei Jahre davor, 1837 also, wurden Scheunen und Fässer randvoll. Und 1834 und 1835 hatten wir sogar zwei Rekordernten hintereinander. Wer mit den reichen Erträgen der Vorjahre gut gewirtschaftet hat, der wird auch heuer über die Runden kommen.“
Er wird leise, weil er weiß, dass jetzt alle wach sind und gespannt seine Schlussfolgerung hören wollen.
„Eigentlich haben wir keinen Anlass, über die Ernten in diesem Jahr zu jammern. Und doch, ich seh’s euren Augen an, ist in etlichen Familien Schmalhans Küchenmeister. Warum? Allein von Sichelhenke 1840 bis Sichelhenke 1841 sind fünf Familien ausgewandert. Drei nach Amerika, eine mit der Ulmer Schachtel [Donaufloß] ins Donaudelta nach Neurussland und eine mit Fuhrleuten ins Oberamt Ravensburg, wo ehemals klösterliche Ländereien seit Jahren brach liegen. Unsere Einwohnerzahl hat sich folglich binnen Jahresfrist von 1084 auf 1051 verringert, trotz der zahlreichen Geburten. Wir werden Jahr für Jahr weniger, weil unsere irdische Ordnung aus den Fugen ist. Reiche werden immer reicher, und Arme werden immer ärmer. Wie soll jemand Rücklagen bilden, wenn er nichts zu ernten hat? Ist es christlich, statt vier Prozent Zinsen zehn zu nehmen und die Verschuldeten gnadenlos in die Gant [öffentliche Versteigerung] zu treiben? Darf es sein, dass den Verarmten das Bürgerrecht aberkannt wird, damit sie der Gemeinde nicht auf der Tasche liegen? Ich fordere Sie alle auf, meine lieben Brüder und Schwestern in Christo, Nächstenliebe zu üben. Gemeinsam sind wir stark. Weil wir heuer weniger zu dreschen und zu keltern haben, bleibt viel Zeit, nachzudenken über das, was wir verbessern könnten. Vielleicht sorgen wir endlich für Sauberkeit auf den Straßen. Das schafft Arbeit und bringt gesünderes Leben in unsere Stadt. Vielleicht sollten wir eine Kasse gründen, die tatkräftigen Mitbürgern Geld zu niederen Zinsen leiht, damit sie etwas Neues wagen können. Ideen gibt es genug. Ich jedenfalls will meinen Beitrag leisten.“
Der Schuster, den der Pfarrer gegen Entgelt die Orgel treten lässt, damit er seine elf Kinder über die Runden bringen kann, legt sich ins Zeug. Die Lunge der Orgel ist der lederne Blasebalg, der sich langsam bläht und aus den Nähten seufzt.
Der Unterlehrer zieht das Kornettregister, weil die Orgel dann so schön schallt. Zum schmetternden Trompetenklang singen Kirchenchor und Gemeinde gemeinsam den Choral „Nun danket alle Gott“, wie immer in Festgottesdiensten zur Erntezeit.
Die Besucher des Gottesdienstes strömen nach Abkündigung und Schlusssegen dem Ausgang zu. In zwei Reihen. Männlein rechts, Weiblein links. So sitzen sie auch in der Kirche. Fast alle sind schwarz gekleidet; nur ein paar Gockeler plustern sich auf und balzen an heiligem Ort mit farbigem Wams zur gelben Lederhose.
Die meisten Frauen tragen sonntags die Linnfurter Tracht: schwarze Schuhe, weiße Strümpfe, langer, schwarzer Taftrock, weißer, bestickter Goller. Darüber ein vorn offenes, kurzes Büble [Weste] aus schwarzem Samt oder Leinen. Auf dem Kopf eine schwarze Bändelhaube. Die Mägde erkennt man an den schwarzen Kopftüchern, selber gehäkelt oder genäht, meist aus billiger Baumwolle.
Die Männer promenieren in schwarzen Schuhen, weißen Strümpfen und schwarzer, langer Tuchhose oder gelber Kniebund-Lederhose. Dazu ein weißes Hemd, darüber ein rotes, blaues oder schwarzes Wams mit vielen Knöpfen. Und als Überzieher einen schwarzen Kittel. Die Hutmode des herrlichen Geschlechts hat im Gegensatz zu den Frauen in den letzten drei, vier Jahrzehnten ständig gewechselt. Farbenprächtiger Dreispitz, den mancher Linnfurter vom Vater geerbt hat. Zweispitz mit aufgeschlagener Krempe. Breitrandiger Reisehut, in der Kirchenversion allerdings ohne aufgesteckten Federbusch. Neumodischer runder Filzhut, wie ihn der Schultes bevorzugt. Oder, wenn’s ganz vornehm sein soll, ein schwarzer Zylinder. Einen Deckel zu tragen ist für alle Linnfurter über vierzehn Pflicht. Natürlich nehmen ihn die Männer ab, so lange sie in der Kirche sind.
Hennendepperle um Hennendepperle schieben sich die Kirchgänger mit hängenden Armen, in der Faust das Opfergeld, zum Opferkasten hin, einer offenen Kiste, die auf dem Boden steht. Den Blick geradeaus, mustern sie das Gewand direkt vor ihrer Nase. Ist es neu? Eine verschwenderische Person! Ist es alt, gar fadenscheinig? Nisten schon die Motten drin? Ein armer Schlucker, der auf der faulen Haut liegt.
Aus den Augenwinkeln registrieren sie, wer auf Armlänge in der Schlange des anderen Geschlechts steht. Und immer wieder ein schneller, ängstlicher Blick in den Kasten. Die Ohren spitzen nach allen Seiten. Was wird gespendet? Wie viele Münzen fallen in den Kasten? Nur eine? Gottlob, ein normaler Mensch. Was, zwei oder drei auf einmal? Pfui! Ein Protz! Hat’s wohl nötig. Muss seine Sünden abbüßen.
Wer da spendet, sieht man nicht, weil die Münzen hälinge aus den Fäusten fallen. Aber man hört es. Silbergeld klimpert fröhlich und hell, wenn es aufschlägt. Kupferkreuzer klingen dumpfer. Hosenknöpfe sind auch dabei; die hört man gar nicht.
Vor dem Kasten steht ein Kastenknecht. Er stiert in die Kiste, damit ihm nichts entgeht. Ein Hosenknopf? Er knipst sein Hirn an. Tatsächlich, da liegt es, das harmlose weiße Knöpfle, aus Kuhhorn gestanzt. „Halt!“, schreit er, „wer war das?“ Er schaut auf. Keine Antwort. Er schluckt. Wer wohl wollte dem Herrgott nur einen Hosenknopf gönnen? Er blickt in lauter fragende, abweisende, ärgerliche, unschuldige Gesichter. Soll er eine Vermutung äußern? Sofort verwirft er den Gedanken. Um Himmels willen! An einem der folgenden Abende bekäme er einen Sack über den Kopf und viele Hiebe auf den Ranzen. Der überlistete Wachmann seufzt brunnentief, läuft rot an vor Zorn und hört die nächsten Münzen im Kasten springen.
Direkt hinter der Tür lauert der Kirchendusler. Er hat ein Gedächtnis wie ein Notizbuch. Darum braucht er keine Buchführung. Er packt die Dusler und Rusler am Arm, zieht sie aus der Schlange und fordert seinen Stupferlohn.
Auf dem Kirchplatz sammeln sich die Linnfurter in Grüppchen. Wie immer am Sonntag, weil hier die wichtigste Nachrichtenbörse des Städtchens ist. Gesehen und gesehen werden. Wer hat den Gottesdienst geschwänzt? Natürlich, der Läpple, wieder einmal. Ist wohl hinter den Weibern her. Kein Wunder sieht seine Frau heute so verhärmt aus. Der Bäcker Schmidlin trägt ein neues Gewand! Macht jedes Jahr die Brötchen kleiner und verdient sich eine goldene Nase mit seinen teigigen Backwaren und dem Linnfurter Intelligenz-Blatt. Die Hämmerle, vulgo Häfnerbäuerin, hat eine neue Bändelkapp aus Samt und Seide. Seit sie im Mai ihren Knecht geheiratet hat, gurrt sie wie ein junges Täubchen.
Ein paar fromme ältere Frauen kreiseln, schauen und raffeln: Wer steht neben wem? Wer redet mit wem? Wer heiratet wen? Wer ist schwanger? Sie hecheln das Neueste durch?
„Je frömmer, je schlechter“, echauffiert sich der Ochsenwirt mit einem scheelen Blick auf die Ratschweiber. „Wo es sogar den Teufel graust, da sind die Klatschweiber dabei.“ Und der Paul Köpfle, dem die Weinstube Rebstöckle gehört, lästert, falls die einmal sterben würden, müsse man deren Gosch extra totschlagen.
Die Schulentlassenen, die nicht verheiratet und noch nicht volljährig sind, verabschieden sich rasch, denn eben stürmt der Unterlehrer aus der Kirche und rennt im Schweinsgalopp hinüber in die Schule.
Eigentlich ist der Schulmeister für die Sonntagsschule zuständig. Doch der kränkelt seit Ostern. Deshalb hat man auch diese Aufgabe dem Unterlehrer aufgehalst. Dabei muss der schon seit Monaten die beiden Volksschulklassen mit hundertsechzig Kindern unterrichten. Zugleich ist er Ratsschreiber, Dirigent des Gesangvereins und Mitarbeiter des Linnfurter Intelligenzblattes. Zum Glück hat er im Frühjahr das zweite Dienstexamen bestanden und konnte vom Provisor zum Unterlehrer befördert werden. So verdient er jetzt etwas mehr, auch wenn er ständig hetzen muss und ihn die viele Arbeit schier um den Verstand bringt. Jedes Mal, wenn der Knöpfles Paul den armen Lehrer flitzen sieht, sagt er mitleidig: „Der hat keine Zeit mehr zum Spätzlekochen, der frisst den Teig roh.“
Jedenfalls müssen alle Ledigen, die älter als vierzehn sind, bis zum Mittagessen in der Sonntagsschule das Lesen, Schreiben und Rechnen bimsen, damit sie die Kulturtechniken nicht verlernen. Weil die Frommen im Städtle Blut und Wasser schwitzen, die Burschen und Mädchen könnten zusammenschlupfen, sind die Schülerinnen und Schüler sittlich fromm geschieden. Und so hocken die Kerle rotzfrech im Schulsaal im Erdgeschoss und lärmen, statt still zu rechnen, während die Mägdelein kreuzbrav im Obergeschoss schreiben. Nur der Lehrer saust ständig von einem Stockwerk ins andere und wird langsam zum Hirsch.
Die Verheirateten, die Verwitweten und die Hagestolze [unverheiratete Männer] sind jetzt auf dem Kirchplatz unter sich. Sie stehen zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert, auch mal zu acht, Männlein und Weiblein gemischt.
Der Schultes schwätzt mit dem Buder, der im letzten Jahr mit dem Stockmachen angefangen hat. Er will wissen, wie sich das Geschäft entwickelt.
Der Neuhandwerker strahlt über beide Ohren. Endlich könne er seine Familie ernähren und im nächsten Jahr sogar beginnen, den Kredit an die Stadtkasse zurückzuzahlen. Spazierstöcke und Peitschenstecken verkauften sich gut. Der Finkenberger, der mit seinem Fuhrwerk täglich auf der Staatsstraße 1 nach Hohenburg, Stuttgart und Heilbronn unterwegs sei, vertreibe die Stöcke und Peitschen gegen Provision. Inzwischen, der Buder reckt sich voller Stolz, stelle er auch Stockpfeifen her; zu Ostern habe er die ersten nach Stuttgart verkauft.
Der Stadtvorsteher hört nachdenklich zu. „Ja, unser Pfarrer hat recht“, meint er endlich, „wir müssen den Leuten zureden, dass sie ein Handwerk oder ein Geschäft anfangen. Meine Linnfurter sind mutlos geworden. Die vielen Missernten seit der großen Hungersnot vor fünfundzwanzig Jahren haben sie trübsinnig und griesgrämig gemacht. Sie jammern von früh bis spät und lassen den Kopf hängen. Auswandern ist für sie der einzige Ausweg aus dem Schlamassel.“
Während er das sagt, sieht er mit einem Auge, wie der Scharwächter die Läpple am Ärmel packt. Sie wehrt sich. Vergeblich. Der Hilfspolizist fasst hart zu und schleppt sie ab.
Und schon stehen beide neben dem Schultes.
„Ihr Mann ist noch nicht daheim“, sagt der Scharwächter.
Andreas Buder lächelt nachsichtig und geht fort.
Die Läpple, eine junge, bildhübsche Frau, kratzt sich verlegen unter der Haube. Sie habe ihren Johann überall gesucht. Keine Spur weit und breit. Trotzig schaut sie dem Schultes ins Gesicht.
Der Statthalter von Linnfurt sinniert. Dabei besichtigt er ausgiebig das Sicherheitsorgan seiner Stadt. Die gestern geerbten Salonschleicher an den Füßen sind noch der vornehmste Teil. Über der löchrigen schwarzen Hose, unter den Achseln mit einer Hanfschnur verknotet, trägt er einen schwarzen, speckigen Kittel. Der ist ihm entschieden zu lang und viel zu weit. Die Kitteltaschen baumeln auf Kniehöhe. Die Schulternähte enden über den Ellbogen. Zweimal sind die Ärmel umgeschlagen.
Der Schultes rollt die Augen. Ihn verdrießt es, wenn ein Diener seiner geliebten Vaterstadt zur Schießbudenfigur verkommt. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel legt er los: „Du siehst aus wie eine zugeschlagene Saustalltür!“
„Was gefällt dir jetzt schon wieder nicht?“
Eine Schnapsfahne beschlägt dem Schultes die Pupillen. Ihm schwillt der Kamm. „Wo ist deine Frau?“, kläfft er ihn an. „Hol sie sofort her.“
Die Läpple will sich verdrücken, doch der Schultes befiehlt ihr zu bleiben.
Sie gehorcht, bleibt aber stumm und sieht zu Boden.
Die Scharwächterin eilt herbei, ihr Mann stolpert hinterdrein.
„Wo hat dein Mann den Schnaps her?“
Aus der Wohnung habe sie allen Alkohol verbannt, sagt die arme Frau, die in sauberen, wenn auch geflickten Kleidern dasteht, ein schwarzes Tuch über den blonden Haaren. Aber auf dem Heimweg von der Linde sei ihr Mann beim Nachtwächter vorbei. Der habe ihm eine alte Hose und einen abgelegten Kittel für den Kirchgang geliehen. Ihre Wäsche sei noch nicht trocken, und mit der gelben Hose habe er sich nicht in den Gottesdienst getraut. Der Nachtwächter sei groß und kräftig, deshalb seien die Kleider ihrem Mann leider viel zu weit. Der Herr Bürgermeister möge das entschuldigen.
Sie fängt zu weinen an. „Schultes“, sie schluchzt auf, „Schultes, du musst mir helfen. Mein Gottlob versäuft unser letztes Geld.“ Sie packt den Stadtvorsteher am Ärmel. „Und am Ende vom Geld ist halt noch zu viel Monat übrig.“
Den Schultes beutelt es. Am liebsten würde er dem Scharwächter ein paar Ohrfeigen verpassen. Doch er beherrscht sich. Hier ist kirchlicher Boden, seiner kommunalen Gewalt entzogen. Vor allem zerfließt er vor Mitleid. Die verhärmte Frau vor ihm war einmal attraktiv. Alle jungen Männer der Stadt prügelten sich einst um sie. Er auch. Als sie in die Schand kam, hat sie aus Verzweiflung den Gottlob Vorderlader geheiratet. Dass der Schultes diesen Säufer seit Jahren im Amt des Scharwächters bestätigt, trotz Eskapaden und Saufereien, liegt letztlich daran, dass er noch immer eine gewisse Zuneigung zu dieser Frau spürt. Er will sie nicht mit ihren Kindern im Stich lassen.
„Geh heim, Agathe, und guck nach deinen Wuserle“, sagt der Schultes milde. „Dein Mann bleibt heut bei mir.“ Etwas Passables zum Anziehen werde sich finden. Über Mittag sei er sein Gast. Dann habe sie einen Esser weniger am Tisch.
Er wendet sich an ihren Mann: „Und nach dem Essen gehst du mit mir zum Hahnentanz auf die Ruglerwies. Du hast heute Dienst.“
Der Scharwächter, der sich hinter dem Rücken seiner Frau versteckt, zieht einen verdrießlichen Mund.
Der Schultes sieht es. Da packt ihn die Wut. „Aberjetza! Bist du der Hilfsgendarm oder ich? An den Feiertagen hast du Dienst. So ist’s seit hundert Jahren. Aber nüchtern! Das weißt du ganz genau. Gnade dir, du Rindvieh, wenn du ab jetzt einen Alkohol bloß anguckst. Dann schlag ich dir deine Füß ab, dass deinen Arsch im Eimer heimtragen musst.“
Und die Läpple fragt er barsch, wo sie ihren Mann schon gesucht habe.
Im Rebstöckle und im Ochsen habe sie ihn gesucht, antwortet sie. Aber da sei er seit vorgestern nicht gewesen.
Dann müsse sie ihm gleich nach dem Mittagessen Bericht erstatten, befiehlt der Schultes, und zwar in der Linde. Höchstpersönlich. Wenn ihr Johann bis dahin nicht zurück sei, werde er ihn suchen lassen.
Das Festessen steht auf dem Tisch, verteilt auf Platten, Schüsseln und Pfannen. Zu jedem Sitzplatz gehört ein Holzteller, ein Löffel und ein Kupfer- oder Messingbecher. Nur der Hausherr besteht auf seinem bemalten Porzellankrug mit ziseliertem Zinndeckel.
Der Schultes setzt sich an seinen Stammplatz, an der oberen Stirnseite des Tisches, auf einen breiten Stuhl mit Armlehnen. Auf der langen Fensterbank lässt sich der Schweizer nieder, auf der Stuhlreihe der Oberknecht. Dann folgen zu beiden Seiten des Tisches die Knechte, nach Dienstjahren sortiert. Die Lindenwirtin nimmt ihrem Mann gegenüber am unteren Tischende Platz, eingerahmt von ihren Kindern Magda und Wilhelm. Ihr zur Linken hockt die Milchmagd, zur Rechten die Obermagd Paula. Die übrigen Mägde schließen zu den Knechten auf.
Der Schultes spricht das traditionelle Gebet: „Lieber Herr Jesus, sei unser Gast, und segne alles, was du uns bescheret hast.“
Die Obermagd spielt den Mundschenk bei den Männern, wie immer an den Festtagen. Sie geht reihum und erfragt die Wünsche: Wein, Bier, Most, frisch gepresster Apfelsaft, Milch oder Wasser? Für die Frauen ist die Milchmagd zuständig.
Als Paula hinter den Scharwächter tritt, blickt der Schultes kurz auf und sagt ruhig, aber bestimmt: „Ab heute kriegt der Scharwächter in meinem Haus keinen Alkohol mehr. Keinen Wein, erst recht keinen Schnaps, kein Bier, keinen Most. Nur noch unvergorenen Saft, Milch oder Wasser. Das ist zu seinem Besten. Wer sich nicht an diese Regel hält, verlässt auf der Stelle meinen Hof.“
Eine große Schrecksekunde.
„Im Glas versaufen mehr als im Necker und in der Linn“, erläutert der Schultes seine Weisung.
Erstaunen auf allen Gesichtern, dann hier und da ein verstohlenes Grinsen.
Die beiden Mägde sind fertig und stellen die Krüge auf den Tisch. Wer ausgetrunken hat, muss sich nun selbst bedienen und den Krug, wenn er leer ist, an den Fässern in der Ecke wieder füllen. Nur Bauer und Bäuerin werden weiterhin vom Oberknecht und von der Obermagd umsorgt.
Der Lindenwirt wünscht allseits einen guten Appetit. Die Männer ziehen ihr Messer aus Stiefelschaft oder Hosenbund, während die Frauen nach den ausgelegten Küchenmessern greifen. Die Schlacht um die besten Bratenstücke ist eröffnet.
Jetzt zählt jede Sekunde, denn wie in der Mühle gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Also schaufeln und schlucken sie, was der Löffel hergibt, damit man auch beim Nachschlag vorn dabei ist.
Dem Scharwächter schmeckt’s nicht. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Der Appetit ist ihm vergangen. In der dunkelblauen Joppe, die ihm der Hausherr geliehen hat, und der grauen Hose vom Oberknecht fühlt er sich wohl. Dennoch stiert er lustlos auf seinen Teller. Er will nicht hören und sehen, was um ihn ist. Finstere Zeiten sieht er auf sich zukommen. Die Welt ohne Betäubungsmittel ertragen? Die Not in der eigenen Familie mit wachen Sinnen erdulden? Er seufzt brunnentief. Der Schultes hört es und grinst.
Aber sonst herrscht eitel Sonnenschein am Tisch. Man schmatzt und schwatzt, bechert und lästert. Man lobt das gute und reichliche Essen. Die Soße tropft aus vielen Mündern.
Der Schweinebraten ist zart. Die goldgelben Spätzle, an denen die Bäuerin nicht mit Eiern gespart hat, türmen sich auf drei Platten. Soße gibt es reichlich. Auch Kartoffelschnitz darf man nehmen, so viel man will, dazu Sauerkraut und grünen Salat in rauen Mengen.
Die Löffel schaben im Akkord über die Holzteller. Die Bratenspieße und Schöpfkellen sind schon handwarm, weil sie keine Sekunde liegen bleiben. Die Krüge werden ständig nachgefüllt.
Nach geraumer Zeit schiebt der Schultes seinen Teller von sich und unterbricht das Gerede. Er wischt sich mit dem Handrücken über den Mund, nimmt einen Schluck und räuspert sich.
„Aberjetza, wo hast den Läpple schon gesucht?“, fragt er den Scharwächter.
Erstauntes Aufhorchen.
„Ich?“ Der Angesprochene blickt irritiert auf.
„Ja, wer denn sonst! Ich muss den doch nicht suchen. Und dass die Läpple in den Wirtschaften schon gesucht hat, das hat sie ja selber gesagt.“
„Du weißt doch, dass der immer an den Weibern rumschraubt“, antwortet der Scharwächter verdrießlich.
„Was willst damit sagen?“
„Dass der von allein heimkommt.“
Einhellige Zustimmung am Tisch. Der Läpple sei kein Kind von Traurigkeit. Vergebliche Liebesmüh, den zu suchen.
„Vielleicht nagelt er grad sein elftes Kind“, sagt ein Knecht vorlaut.
„Der hat doch bloß zwei“, korrigiert eine der Mägde.
„Eigene“, spottet es spontan aus der Dienstbotenschar, „aber acht Kuckuckseier.“
Genüsslich werden alle Schandtaten des Aushäusigen aufgezählt. Erst habe sich der Mädelegucker mit dem Heiraten viel Zeit gelassen, dann eine Blutjunge zur Frau genommen, die schöne Anna. Trotzdem sei er immer wieder ausgeflogen, ab und an sogar drei, vier Tage am Stück. Aber das habe bisher niemand gekümmert.
„Langsam! Es könnte ja auch was passiert sein“, beharrt der Hausherr. Dass der Bauer ausgerechnet zur Sichelhenke fehlt, das sei doch wohl neu. Wer anders als der Hausherr soll den Knechten und Mägden für die schwere Erntearbeit danken? Wäre es nicht möglich, dass der Läpple irgendwo liegt und Hilfe braucht.
Betroffene Gesichter.
Vielleicht, schlägt der Ober- und Rossknecht nachdenklich vor, sollte man den Rumtreiber auf seinen Feldern suchen. Denn läge er hilflos irgendwo im Ort, hätte man ihn längst entdeckt. Aus dem Hahnentanz mache er sich nichts mehr, fährt Karl fort, dafür sei er zu alt. Darum sei er bereit, einen Gaul zu satteln und die Felder des Vermissten abzureiten, wenn ihm die Läpple einen Knecht zur Seite stelle, der ihre Äcker und Wiesen kennt.
Auf das Angebot werde er dankbar zurückgreifen, sagt der Lindenwirt, wenn die Läpple keine Entwarnung geben sollte.
Dann servieren vier Mägde unter heftigem Steißgewackel Schüsseln voller Schneeballen. Das süße Naschwerk aus einer Soße von Sahne, Milch, Eigelb, Zucker und Zimt mit den darauf schwimmenden Bergen aus geschlagenem Eiweiß ist die Götterspeise im Hause Frank. Kaum sind die Glasschälchen und Löffelchen verteilt, schon fallen alle über die kühle Köstlichkeit her.
Doch halt! War da nicht ein Klopfen an der Tür? Die Milchmagd springt auf und öffnet.
Draußen ist die Läpple und heult. Nein, sie wolle nicht stören.
Der Schultes steht wortlos auf, geht hinaus und schließt die Tür hinter sich.
„Mein Johann ist noch nicht daheim.“
„Aberjetza“, versucht der Schultes zu trösten, „suchen wir ihn halt.“
Sie schaut ihn unter Tränen groß an.
„Wer kennt eure Felder und Wiesen am besten?“
„Der Oskar.“
„Er soll einen Gaul satteln und gleich herkommen. Mein Karl reitet mit ihm zu euren Feldern und Wiesen hinaus und guckt nach dem Johann.“
Während sie schluchzend das Haus verlässt, bleibt der Schultes nachdenklich im Flur stehen. Merkwürdig. Er schüttelt den Kopf. Da hat einer alles Glück dieser Welt. Eine hübsche Frau, zwei gesunde Kinder, einen prächtigen Hof und offensichtlich so viel übriges Geld, dass er es verleihen kann. Sagt man wenigstens. Zu Wucherzinsen, behauptet man allerdings.
„Einen solchen Dackel wie den gibt’s nicht zweimal“, schimpft der Lindenwirt vor sich hin.
Der Rossknecht kommt aus der Küche und wischt sich den Mund mit der Hand ab.
„Weiß schon“, sagt er zu seinem Bauern, „ich sattle den Braunen. In zwei Stunden sind wir wieder da.“
Schultes und Scharwächter zotteln an den Tischen und Buden vorbei, die vom Linntor abwärts zur Flößerlände aufgeschlagen sind. In ein paar Wochen, zum Erntedankfest, findet hier der größte Krämermarkt der Region statt. Zur heutigen Sichelhenke werden nur Süßigkeiten, Kuchen, Bratwürste und allerlei Krimskrams angeboten. Lauter Kleinigkeiten, die man noch für den Herbst braucht.
Gerade stehen sie vor dem Stand des Seilers, da macht ein gellender Pfiff darauf aufmerksam, dass sich auf der Ruglerwiese etwas tut.
Buben und Mädchen, getrennt nach Schulklassen, sausen barfuß übers Gras. Eltern, Großeltern und Geschwister feuern sie an, belohnen die Sieger mit einem Lächeln und trösten die Verlierer.
Dann sind die unverheirateten Burschen an der Reihe. Zuerst die Vierzehn- bis Siebzehnjährigen, danach die Achtzehn- bis Einundzwanzigjährigen. Dass die schulentlassenen Mädchen jetzt ganz genau hinschauen, ist den Läufern gewiss. Darum legen sich die mächtig ins Zeug. Sie wollen ihrer heimlichen Liebsten ein Zeichen von Kraft und Stärke geben, nur das treibt sie an, denn Preise gibt’s nicht zu gewinnen.
Gleich darauf werden Kühe gesattelt. Jeder, der sich traut, eine Kuh zu reiten, darf teilnehmen. Prinzipiell auch Frauen, aber so lange es diese Veranstaltung gibt, hat‘s noch keine probiert. Denn die sonst so zahmen Tiere sind auf einmal störrisch, bockig, schlagen aus und tun alles, um die Reiter abzuwerfen. Das Publikum kommt in Stimmung und kommentiert lautstark den Kampf der verwirrten Viecher gegen die stärksten Bullen unter den Männern.
In der Zwischenzeit haben ein paar Knechte in der Nähe der Flößerlände eine neun Fuß hohe Stange aufgerichtet. Darauf thront ein gedeckelter Korb, in den ein Hahn gesperrt ist. Unter dem Korb hängt an Schnüren ein Brettchen, auf dem ein Zinnbecher steht, der mit Wasser gefüllt ist.
Die Musikanten stellen sich am Tanzkarree auf. Wieder ist der Unterlehrer im Einsatz. Im letzten Herbst, bevor der Schulmeister ernstlich erkrankte, hat er eine Blaskapelle gegründet, zusammen mit vier Bauern, dem Schneider und dem Maurer. Er selber bläst die erste Trompete und dirigiert eine zweite Trompete, zwei Hörner, zwei Posaunen und eine Tuba. Polka, der neue Tanz aus Polen, ist die Lieblingsmusik des Sextetts. Aber auch Dreher, Hopser, Galopp und den Zwiefachen haben sie drauf.
Der Unterlehrer, die Trompete in der Hand, zählt den Takt vor, und die Musik setzt ein.
Burschen stolzieren mit ihren Mädchen auf die Wiese und beginnen zu tanzen. Dabei versuchen die Paare, unter den Korb zu kommen. Dann muss der Bursche hochspringen, sich auf die Schultern seines Mädchens stützen und versuchen, den Becher mit dem Kopf herunterstoßen. Dabei werden beide natürlich nass. Aber gerade das ergötzt die Zuschauer. Der letztjährige Sieger des Hahnentanzes irrt, als Geißbock verkleidet, zwischen den Tanzenden umher und will ihnen aus einer Gießkanne die Schuhe mit Wasser füllen. Das Paar, das zuerst den aufgehängten Becher dreimal herunterschubst, ist Sieger. Der Bursche erhält den Hahn als Preis, sein Mädchen einen Kuss von ihm und ein buntes Halsband.
Noch ist es keinem Tanzpaar gelungen, den Becher zu kippen, doch die ersten Zuschauer biegen sich schon vor Lachen. Manche johlen und schreien, andere dirigieren und kommentieren. Das erste Paar zieht die Schuhe aus, weil sie vor Nässe triefen.
Der Schultes und der Scharwächter bleiben neben den Polkabläsern stehen. Der Hilfsgendarm ist wieder fast nüchtern, verzieht aber das Gesicht wie eine beleidigte Leberwurst. Die ständige Bewachung behagt ihm offensichtlich nicht. Dafür freut sich der Schultes am Hahnentanz, den er in seiner Jugend einmal gewonnen hat.
Eben fällt der Becher zum ersten Mal, da sieht der Stadtoberste aus den Augenwinkeln, dass es auf der anderen Seite der Tanzwiese unruhig wird. Der Amtsbote winkt herüber.
Der Schultes schaut und beschattet seine Augen mit der Hand. Ist er gemeint? Er eilt auf den Stangenheinrich zu, der ihm entgegenhinkt, Elsa im Schlepptau, die früher in Diensten des Schnellreichs war, der im letzten Jahr der Hehlerei überführt wurde. Jetzt bedient sie in der Weinstube Rebstöckle.
„Was ist, Heinrich?“
„Wir haben einen gefunden, Schultes.“ Der Amtsbote ist aufgeregt und durcheinander. Er ist nicht in der Lage, einen klaren Satz hervorzubringen.
„Wen?“
„Einen Mann.“
„Wo?“
„In den Brennnesseln.“
„Mach keine Faxen.“
Elsa schiebt sich vor und sagt hastig, sie habe noch vor dem Hahnentanz den Hund vom Knöpfle ausführen müssen. Bei der Foltergasse, wo Steine aus der alten Stadtmauer lagern und viele Brennnesseln wachsen, habe der Köter gejault und sei plötzlich auf und davon. Dann sei er hin und her gerannt, habe sich seltsam aufgeführt und sei immer wieder in den Brennnesseln verschwunden. Ein paar Schritte habe sie dem Hund folgen können. Dann habe sie jemand liegen sehen. Nicht genau, weil sie sich nicht näher hingetraut habe. Aber die Schuhe habe sie ganz genau gesehen. Da sei ihr die Angst ins Genick gefahren, und sie sei auf und davon. An der Wette habe sie den Amtsboten Heinrich getroffen. Der sei mit ihr wieder zurück.
„Und, wer ist‘s, Heinrich?“
„Ich bin nicht näher hin. Er liegt auf der Seite. Vielleicht ist er bloß besoffen.“
„Bleib da“, sagt der Schultes zur Elsa. „Und du“, er deutet auf den Amtsboten, „gehst mit mir!“ Er winkt dem Scharwächter. Zu dritt machen sie sich auf den Weg.
Der Läpple ohne Käpple
Wenn man der Schlosstorgasse bis zur Foltergasse folgt, dann ist auf der rechten Seite, gleich nach der Abzweigung zum Kuckucksnest, ein Platz, auf dem Steine, Schutt und Holz lagern und die Leute ihr altes Zeug hinschmeißen: durchgerostete Pflugscharen, morsche Wagenräder, zerschlissene Schuhe sowie allerlei Hausrat und Gerätschaften. Alles, was sich nicht mehr reparieren lässt. Die Jahresringe des Lebens eben. Gegen die Nachbargrundstücke, eines gehört dem Läpple, grünen wilde Sträucher. Zur Gasse hin haben sich brusthohe Brennnesseln ausgesamt.
Dorthin führt der Amtsbote seine Begleiter. Sie folgen der niedergetrampelten Brennnesselspur. Da liegt ein Mann in Schaffhose und Kittel, eine grüne Schürze umgebunden. Er liegt auf der Seite, als habe er sich schlafen gelegt und mit Zweigen und Grünzeug gegen die Kälte zugedeckt.
Der Schultes stößt mit dem Fuß an die derben Stiefel des Liegenden und ruft: „Aberjetza, steh auf!“
Kohlmeisen und Spatzen stieben davon, aber der Mann rührt sich nicht.
„Heinrich, tu mal die Äste weg“, befiehlt der Schultes.
Der Amtsbote bückt sich und wirft die ersten Zweige beiseite, bückt sich erneut und weicht entsetzt zurück. „Der Läpple“, stößt er hervor und wird kreidebleich.
Der Scharwächter schaut zu. Er rührt keine Hand. „Ich mein, der tut keinen Schnaufer mehr“, stellt er fest.
Der Schultes und der Amtsbote drehen den Läpple auf den Rücken. Auf der Brust ist ein Blutfleck, mitten drin steckt eine Sichel. Offensichtlich ist der Vermisste mit der Sichelspitze erdolcht worden. Direkt ins Herz. Gerade so, als habe man an ihm die Sichel aufgehängt.
Der Schultes zieht vorsichtig die Sichel aus dem Körper. Es blutet nicht nach.
„O, der ist schon lang hin“, stellt er fachmännisch fest und betrachtet die Sichel. Ein ganz normales Werkzeug. Auf dem Griff ist ein großes L eingebrannt. L wie Läpple, zweifellos. „Mit der eigenen Sichel ermordet werden“, sagt er kopfschüttelnd, „das ist kein Vergnügen.“
„Guck, Schultes!“ Der Scharwächer deutet mit langem Finger auf den Kopf des Toten.
Dem Läpple fehlt das linke Ohr.
„Wahrscheinlich abgeschlagen mit der Sichel“, vermutet der Amtsbote.
Er sucht und wird schnell fündig. In den Brennnesseln, nur zwei, drei Fuß vom Kopf entfernt, liegt das Ohr.
„Da haben zwei gestritten“, sagt der Schultes, „der erste Schlag hat sein Ohr erwischt, der zweite mitten ins Herz getroffen.“ Auch die niedergetrampelten Brennnesseln würden darauf hinweisen.
„Der Läpple ohne Käpple, das gibt’s doch nicht“, stellt Heinrich nach einer andächtigen Pause fest.
„Das tät mich schon interessieren, wer die Kappe hat.“ Der Schultes reibt sich nachdenklich das Kinn.