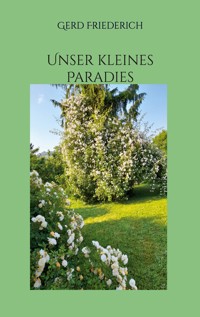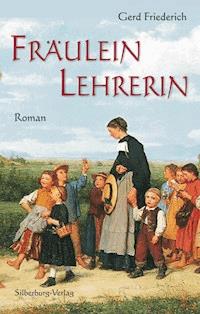
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Württemberg 1871: Schon als kleines Mädchen hatte Sophie davon geträumt, Lehrerin zu werden - nun besucht sie das kurz zuvor gegründete Lehrerinnenseminar. Doch in den Schulen im Land herrscht harter Drill und die jungen Frauen müssen in ihrer Ausbildung und ihrem Berufsalltag viel erdulden. Miserable Unterkünfte, Hungerlöhne und völlige Isolierung sind dabei nicht das Schlimmste. Ihren männlichen Kollegen geht es dagegen weitaus besser. Anstatt Kopfnüsse und Ohrfeigen zu verteilen, kümmert sich Sophie um die Sorgen und Nöte der Kinder; im schlichten Eintrichtern von Merkversen und Kirchenliedern sieht sie wenig Sinn. Mit ihrer einfühlsamen Art und modernen Einstellung eckt die junge Pädagogin an. Während sie um Respekt und Anerkennung kämpft, versucht sie gleichzeitig den rätselhaften Selbstmord ihrer Kollegin Hanna zu lösen - gemeinsam mit dem charmanten Photographen Gustav Leber. Doch das strenge Heiratsverbot, dem Lehrerinnen unterworfen sind, verwehrt eine gemeinsame Zukunft und Sophie muss sich entscheiden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Friederich
Fräulein Lehrerin
Gerd Friederich
Fräulein Lehrerin
Roman
Dr. Gerd Friederich, Jahrgang 1944, studierte in Würzburg (Lehramt), Tübingen (Pädagogik, Philosophie, Tiefenpsychologie, Landeskunde) und Nürnberg (Malerei). Er arbeitete in Schulen, Schulverwaltung und Institutionen zur Lehrerbildung. Jetzt lebt er im Taubertal, schreibt Romane und malt Porträts und Landschaften.
1. Auflage 2015
© 2015 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen,
unter Verwendung des Gemäldes
»Der Schulspaziergang« von Albert Anker.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1692-2
E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1693-3
Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1433-1
Besuchen Sie uns im Internet
und entdecken Sie
die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
Inhalt
Autor
Prolog – September 1870
Seminar
Vermächtnis
Veränderung
Entscheidung
Hartingen
Unglück
Glück
Schulkampf
Befreiung
Privatschule
Winterhausen
Eugensburg
Die Hauptpersonen
Kurze Geschichte der Lehrerin
Fachbegriffe
Weitere Bücher und E-Books aus dem Silberburg-Verlag
Prolog – September 1870
Mittagszeit. Ein penetranter Geruch nach Rauch, Pferdemist, Bratfett und Kohl lag in der Luft. Handkarren quietschten, Wagen klapperten, Kutschen rumpelten übers Pflaster. Eine Handvoll Betuchte, auf den ersten Blick erkennbar an der eleganten Garderobe, drängelten vor der Menütafel des Gasthauses »Wilder Mann«. Buben und Mädchen flitzten mit knurrenden Mägen von der Schule heim. Verkäufer schleppten Kartons und Kisten. Laufburschen schossen durch die Menge. Nur ein paar vornehme Damen schlenderten, trotz des Lärms und Getümmels, von Schaufenster zu Schaufenster und musterten die Auslagen mit kritischem Blick.
»Franzosen bei Sedan vernichtend geschlagen!«
Die Passanten erstarrten für einen Augenblick. Sie reckten die Hälse und eilten auf den Zeitungsverkäufer zu, der an der Laterne vor der Kreditkasse stand. Im Nu hatte er alle Zeitungen verkauft. Schon lagen sich wildfremde Menschen in den Armen, strahlten vor Stolz und gratulierten sich zum Sieg. Beispiellose Begeisterung erfasste die Menge.
Ein Mann riss sich den Hut vom Kopf. »Hoch! Hoch! Hoch!«, schrie er. »Ein dreifaches Hoch auf Preußens König Wilhelm!« Vivatrufe ohne Ende, dann die deutsche Volkshymne »Wacht am Rhein«, barhäuptig und voller Inbrunst gesungen.
Bevor sich die Leute zerstreuten, schmetterten sie »Heil Dir im Siegerkranz«, als hätten sie geahnt, dass das schon bald die Kaiserhymne in einem neuen deutschen Kaiserreich werden würde.
Verdammt! Irgendwo musste sie doch sein.
Als sie vor seinem Fotoladen in der Altstadt vorbeigehuscht war, hatte er spontan seine Ladentür verschlossen und war ihr nachgerannt. Er konnte nicht anders, denn er wollte sie endlich ansprechen, ins Kaffeehaus einladen und vor seine Kamera schleppen.
Immer noch atmete er schwer. Von der obersten Stufe der breiten Friedhofstreppe sah und hörte er fast alles, was in dieser Straße vor sich ging.
Gustav Wagner ärgerte sich. Zum dritten Mal war sie ihm entwischt.
Dass sie ihn ausgerechnet in der Turmgasse zum Narren hielt, die er von allen Straßen der Stadt am besten kannte, verdross ihn besonders. Hier hatte er im Auftrag seines Onkels, der einen Buch- und Postkartenverlag betrieb, vor drei Jahren einzelne Gebäude, ganze Häuserzeilen und vielsagende Augenblicke geschäftigen Treibens fotografiert. Wochenlang, zu allen Tageszeiten, im strahlenden Sonnenlicht, in der morgendlichen und abendlichen Dämmerung, ja sogar bei Regen. Illustrierte Stadtporträts, bebilderte Reiseberichte und Ansichtskarten, hatte der Onkel gelockt, erzielten gute Gewinne, und er hatte recht behalten. Als Wagner damals seine Gerätschaften vor dem Turm aufbaute, sprachen ihn viele Leute an. Hausbesitzer baten, auch ihr Anwesen zu fotografieren. Manche wollten, als sie hörten, eigentlich sei er Porträt- und Landschaftsmaler, ihr Zuhause in Aquarell oder Pastell verewigt wissen. Und den Kunsthändler Wölfling porträtierte er sogar in Öl, posierend vor dem eigenen Geschäft.
Wagner kniff die Augen zusammen und grübelte. In welchem Haus mochte sie wohl sein?
Am anderen Ende der Turmgasse stand der mittelalterliche Gefängnisturm, einst ein Teil der Stadtmauer. Durch den Torbogen unter dem Verlies rasselte früher der Leichenwagen auf dem Weg zum alten Friedhof, der direkt hinter Wagner auf einer Anhöhe lag. Aus der stinkenden Gasse zwischen Turm und Friedhof war eine prächtige Einkaufsmeile geworden, die renommierten Kauf- und Bankhäusern sowie wohlhabenden Bürgern eine feine Adresse gab: die angesehene Goldschmiede Florian, das Kurzwarengeschäft Bändele, der Galanterie- und Modehändler Zeitlos, die alteingesessene Vorschussbank Hafermann, dann eine Schanklaube, die zum Gasthaus »Wilder Mann« gehörte, die Buchhandlung Waffenschmied, die Schnellsohlerei Haas und Söhne, die berühmte Konditorei »Weber« direkt neben dem abgewirtschafteten Haus eines alten Laternenanzünders, die Blechnerei Kupfer und noch etliche Detailgeschäfte mehr. In den Hinterhöfen lauerten, wie Zecken in den blühenden Wiesen, Höckner, Trödler und Lohndiener auf flanierende Kunden. Und in Kellern und Mansarden werkelten auf engstem Raum fingerfertige Leute wie Kammmacher, Goldsticker und Schwefelhölzchenmacher.
Wohnte die Schwarzhaarige auch in dieser Straße? Oder machte sie nur Besorgungen?
Wagner zog seine goldene Taschenuhr aus der Westentasche. Es war halb eins, also blieb ihm bis zur Öffnung seines Salons um zwei Uhr noch genug Zeit. Gerade stach die Sonne durch die Wolken, Spatzen zeterten in den Büschen über der Treppe. Er schaute zum Himmel auf und sah sie vor sich, wie sie ihn auf dem Marktplatz versehentlich angerempelt hatte, ganz in der Nähe seines Ateliers. Ihre schwarze Lockenpracht und das ebenmäßige Gesicht hatten ihn sofort angerührt.
»Entschuldigung«, hatte sie gehaucht.
Er war mit offenem Mund stehen geblieben und hatte ihrem anmutigen Gang hinterhergestarrt. Als sein Verstand wieder eingesetzt hatte, war sie längst entschwunden.
Zwei Wochen später hatte sie die Fotos in seinem Schaufenster bewundert und sein Lächeln durch die Glasscheibe erwidert. Sie war nur wenig kleiner als er, zartgliedrig und lebhaft. Ihre großen, dunklen Augen und die schwarzen Haare, die ihr etwas Geheimnisvolles gaben, faszinierten ihn. Darum hatte er alles daran gesetzt, ihr erneut zu begegnen, aber sie blieb zunächst wie vom Erdboden verschluckt.
Einige Zeit danach hatte er beobachtet, wie sie über den Marktplatz hastete, und von da an durchs Fenster gelauert und Buch geführt. Wann immer es ihm möglich war, hatte er minutiös notiert, woher sie kam und wohin sie entschwand, hatte aufgelistet, an welchen Tagen und um welche Uhrzeit sie wie eine Sternschnuppe aufleuchtete und wieder verlosch. Schon nach wenigen Einträgen war klar: Sie bog allabendlich kurz nach sechs aus der Schlossgasse auf den Marktplatz ein und geriet beim Rathaus wieder aus dem Blick. Immer war sie in Eile.
Nahm sie morgens den umgekehrten Weg? So oft wie möglich hatte er vormittags aus dem Fenster geguckt, sie aber nie gesehen. Sie suchen gehen? Als erfolgreicher Fotograf ihretwegen einfach den Laden zusperren?
In aller Frühe hatte er vor dem Rathaus gewartet. Und tatsächlich! Kurz nach sieben war sie die Bahnhofstraße heraufgerannt und mit federnden Schritten über den Marktplatz in die Schlossgasse gesaust. Noch zweimal hatte er dort Wache gestanden. Beim ersten Mal hatte sie ihm einen belustigten Blick zugeworfen, als wolle sie ihn auffordern, ihr nachzueilen. Beim zweiten Mal war sie ihm irgendwie bedrückt erschienen. Sie hatte ihn nicht, wie sonst, angelächelt.
Ihr ernster Ausdruck hatte den Beschützerinstinkt in ihm geweckt, bis er nur noch einen einzigen Gedanken fassen konnte: Er musste endlich mit ihr reden und sie für sein neues Buch ablichten. Dieses eine Gesicht fehlte noch in seiner Sammlung. Schließlich war er ein gemachter Mann, angesehen und anerkannt als Autorität für Porträts. Sie konnte ihm gar nicht widerstehen, wenn er erst einmal mit ihr redete. Davon war er felsenfest überzeugt. Gut, er war Ende zwanzig und damit gewiss zehn Jahre älter als sie. Doch vor seiner Kamera hatte sich noch jede junge Dame von ihrer strahlendsten Seite gezeigt.
Wagner wickelte die Uhrkette um seinen Zeigefinger und beobachtete ungeduldig das Treiben in der Turmgasse. Immer noch blieb sie verschwunden. Plötzlich lachte er vor sich hin. Das Leben war wirklich komisch. Da liefen so viele hübsche Frauen herum, und ausgerechnet diese eine entzog sich ihm?
»Halt!«
Er schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. Mittag! Halb eins! Noch nie hatte er sie um diese Zeit gesehen. Etwas Außergewöhnliches musste vorgefallen sein. Er war irritiert, schloss die Augen und dachte nach. Sollte er warten, bis sie irgendwo in der Menschenmenge auftauchte? Oder die Turmgasse auf und ab gehen und auf einen gnädigen Zufall hoffen?
Er entschied sich, in der Friedenskirche nebenan, die zugleich als Friedhofskirche diente, seine Gedanken zu sammeln, dann wollte er durch die Turmgasse bummeln und sich langsam auf den Heimweg machen.
Vor dem Kirchenportal blieb er stehen und blickte an der Fassade hinauf, die er schon mehrfach abgelichtet hatte. Sie war erst vor zehn Jahren im neugotischen Stil errichtet worden, die Mauern aus gelben Ziegelsteinen, über dem Kirchenportal eine Rosette aus farbigem Glas, ganz oben ein Dachreiter, der drei Glocken trug. Durch die breite Flügeltür, die in einem Spitzgewölbe saß, trat er in das lichte Haus. Genau gegenüber stand der Altar mittig in der fünfseitigen Apsis, die eine bemalte Stuckdecke hatte, im Gegensatz zum Kirchensaal, den hölzerne Kassetten nach oben abschlossen.
Er ging durch den Mittelgang zwischen den Bänken nach vorn, blieb vor den Altarstufen stehen, betrachtete sinnend die hölzerne Kanzel und drehte sich um.
Da!
Sie schrak auf und sah ihm kurz in die Augen. Ein dumpfes Klatschen oder Schlagen. Sie stürmte hinaus. Er rannte ihr nach. Wo war sie? Er blieb unschlüssig stehen. Zwischen den Gräbern war sie nicht, auch nicht auf der breiten Treppe hinunter zur Turmgasse. Er lief hin und her, aber sie blieb verschwunden.
Was hatte sie in der Kirche gemacht?
Wütend kehrte er dorthin zurück. Rechts vom Eingang war sie gestanden, in einer Nische unter der Orgelempore. Genau an der Stelle fand er ein Kreuz an der weißen Wand, davor ein Pult, darauf ein großes Buch, zugeklappt, offensichtlich ein Freud- und Leidbuch, wie neuerdings in vielen Kirchen. Vom Zuschlagen könnte das Geräusch herrühren, das er gehört hatte, bevor sie aus der Kirche stürmte.
Sollte sie …?
Durfte man das überhaupt lesen? Was ging es andere an, wenn ein Mensch mit sich haderte? Oder seine Sorgen und Nöte vor dem Allerhöchsten ausbreitete?
Wagner rang mit sich. Vielleicht kann ich ihr helfen, beruhigte er sich, und schlug das Buch auf. Er blätterte. Ihr Eintrag, es musste ihrer sein, denn es war der letzte, endete mitten im Wort. Er las einmal, schüttelte den Kopf, las ein zweites und drittes Mal. Endlich begriff er. Entsetzt schlug er das Buch zu und suchte fassungslos das Weite.
Am nächsten Tag blieb sie verschwunden. Weder konnte er sie frühmorgens entdecken noch am Mittag, erst recht nicht am Abend, obwohl er sich redlich mühte.
Am darauffolgenden Montagmorgen stand Gustav Wagner vor seinem Atelier am Marktplatz. Ringsum drei- und viergeschossige Fachwerke, viele überputzt und pastellfarben getüncht. Geschäfte und Werkstätten dicht an dicht. Geradeaus streckte sich der quadratische Michaelsturm weit über die Dächer. Er protzte in alle Himmelsrichtungen mit vier prächtigen Uhren, vergoldeten Ziffern und Zeigern, die jedoch nicht wie sonst in der Sonne blitzten. Die Menschen verweilten auch nicht vor den Auslagen der Läden. Sie hasteten unter den Dachvorsprüngen von Haus zu Haus. Denn der Himmel war geschlossen. Dunkle Regenwolken wälzten sich über Eugensburg. Erste Tropfen fielen.
Der Duft von Seifenlauge, verbranntem Horn und Pferdemist lag in der Luft. Der Schmied, die speckige Schirmmütze ins Genick geschoben, beschlug einen Schimmel. Das heiße Eisen brannte sich qualmend in den geglätteten Huf. Vor dem Haus nebenan hockte der Wagner vor seinem Schneidstuhl, warf ständig besorgte Blicke zum Himmel und schnitzte mit dem Zieheisen die Sprossen für ein neues Rad. Hinter ihm rubbelten Frauen, Kopftücher umgebunden und die Ärmel hochgekrempelt, Weißwäsche übers Waschbrett. Vor der Uhrenhandlung hatte ein Scherenschleifer seine fahrbare Werkstatt aufgebockt. Sie war auf ein Wagenrad montiert. Die Brille auf der Nase, die Pfeife im Mund und die schwarze Kappe zur Seite verrutscht, so war der Handwerker auf der Stör ganz in seine Arbeit versunken. Er drückte ein Messer an den Schleifstein, während er die Kurbel mit dem rechten Fuß trat. Das Sirren des Stahls schrillte in den Ohren.
Ein Grauhaariger näherte sich, blieb direkt neben Wagner stehen und las den Aushang im Schaufenster: »In meinem gut beheizten fotografischen Salon werden von neun Uhr morgens bis sechs Uhr abends, auf Wunsch auch an Sonn- und Feiertagen, Porträtbilder in beliebiger Größe und Rahmung jeder Art gefertigt. Preis der Bilder von einem Gulden bis zwei Gulden zweiundvierzig Kreuzer. Besonders möchte ich meiner verehrten Kundschaft meine Miniaturporträts für Visitenkarten, Broschen und Fingerringe empfehlen.«
Der Alte zögerte, ging ein paar Schritte weiter, kam zurück und las noch einmal.
»Wollen Sie zu mir?«
Der Mann lüftete den Hut, der so altbacken und abgetragen war wie seine gesamte Kleidung. Unverhohlen musterte er den eleganten Herrn mit dem glatt rasierten Gesicht, der einreihigen Jacke aus braunem Wollstoff, der grauen Tuchweste, den schmalen Hosen, den schwarzen Halbstiefeln und dem weißen Hemd mit Eckenkragen, unter dem eine modische, blaue Langkrawatte aus Seide klemmte. Offensichtlich überlegte der Alte, ob er sich einen so vornehmen Fotografen leisten konnte.
»Angenehm, Gustav Wagner. Bitte beehren Sie mein Atelier.«
»Was kosten zehn Bildchen?«
»Kommt drauf an.« Gustav Wagner taxierte ihn unauffällig.
»Auf was?«
»Wie groß sie werden sollen.«
»Dass man sie auf ein kleines Blatt Papier kleben kann.«
Wagner legte die Stirn in Falten. »Sie wollen Visitenkarten selbst machen?« Er war in Stadt und Land bekannt für seine Besuchskarten mit Bildnis im Visitformat, die ein Pariser Fotograf vor ein paar Jahren erfunden und zum Patent angemeldet hatte, das Wagner gegen Gebühr nutzen durfte. Seitdem hatte er großen Zulauf.
Der Alte hüstelte verlegen. Schwere Tränensäcke hingen unter schwarzen Augenringen. Unendlich müde sah er Wagner an. »Nein, Trauerkarten.«
»Dazu brauche ich aber ein Foto des Verstorbenen.«
Der Mann griff in sein Jackett und nestelte ein Bild heraus. Wortlos übergab er es.
Wagner erstarrte, schnappte nach Luft. Er wollte etwas sagen, sein Entsetzen ausdrücken, seine Trauer bekunden, sein Beileid aussprechen, doch die Stimme versagte ihm.
»Sie kennen meine Hanna, Herr Fotograf?«
Wagner nickte und schluckte. »Bitte kommen Sie herein.« Er hielt dem Mann die Tür auf, führte ihn ins Atelier und bot ihm Platz an. »Was ist passiert?« Er zog einen Stuhl heran und setzte sich neben ihn.
Der Alte rang um Fassung. »Sie hat sich am Freitagmittag von der Eisenbahnbrücke gestürzt.« Er räusperte sich. »Ich kann es noch immer nicht fassen.« Tränen liefen über seine blassen, unrasierten Wangen.
Wagner schauderte. Zuhören, einfach nur zuhören, damit der alte Mann seinen Schmerz in Worte fassen konnte. Doch die Neugier war stärker: »Wie ist es passiert?«
»Ein Bekannter ging mit seinem Hund spazieren.« Der Mann berichtete stockend. »Dort, wo die Häuser aufhören und ein geschotterter Weg an den Gleisen entlangführt. Der Bekannte war auf dem Heimweg, als ihm Hanna entgegenkam.«
Der Mann schluckte schwer.
Wagner holte ein Glas mit Wasser und drückte es ihm wortlos in die Hand. Der Alte trank gierig.
»Er hat gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt, als er ihr aufgewühltes und tränenüberströmtes Gesicht sah. ›Geht es Ihnen nicht gut?‹, hat er sie gefragt. Sie hat nicht geantwortet.«
Der Alte weinte lautlos. Er wischte sich mit der Hand die Tränen aus den Augen.
»Mein Bekannter hat gesagt: ›Sie haben Kummer, ich seh’s Ihnen an. Kann ich Ihnen helfen?‹ Sie hat nur den Kopf geschüttelt. In der Hand hatte sie eine kleine Schnapsflasche. Stellen Sie sich das vor! Meine Hanna verträgt doch keinen Schnaps!«
Wagner starrte den alten Mann an.
»Mein Bekannter hat sie angefleht: ›Ich lade Sie ein, kommen Sie auf einen Kaffee zu mir.‹ Sie ist grußlos weitergegangen. Er hat ihr lange nachgesehen. Als er merkte, dass sie auf den Trampelpfad einbog, der zur Eisenbahnbrücke führt, rannte er ihr nach.«
Der alte Mann schlug die Hände vors Gesicht. »Zu spät! Er ist … zu spät gekommen! Sie war zu weit weg! Er konnte das Unglück nicht mehr verhindern!«
Die letzten Sätze hatte der alte Mann geschrien. Jetzt sah er Wagner aus verweinten Augen an. »Sie«, er stockte und schüttelte den Kopf, »ist übers Brückengeländer geklettert.«
Er schluchzte auf. Wagner hielt den Atem an und sah in das fassungslose Gesicht des Alten.
»Meine Hanna ist übers Brückengeländer gestiegen. Sie hat ihr Halstuch an die oberste Geländerstange gebunden.« Der alte Mann war am Ende seiner Kräfte. Er weinte hemmungslos und schniefte. »Sie hat sich … ihren Rock … über das Gesicht gezogen … und ist gesprungen.« In Tränen aufgelöst stammelte er: »Ein … gellender … Schrei … ihr … Todesschrei.« Er atmete tief durch und flüsterte: »Dann sei es still gewesen.«
Beide schwiegen lang. Sie sahen sich nicht an.
»War sie vorher noch bei Ihnen?«
»Nein, sie muss direkt von der Schule zur Brücke …«
»Wer hat Ihnen die schreckliche Nachricht gebracht?«
»Mein Bekannter, zusammen mit Pfarrer Wienzle und einem Polizisten.«
»Ich mache Ihnen Trauerkarten, wenn Sie wollen. Bild und Text. Aber dazu müsste ich einiges über Ihre Hanna wissen.«
»Ich dachte, Sie kennen sie.«
»Ich weiß nicht einmal ihren Namen. Jeden Tag ist sie über den Marktplatz gehuscht. Wenn sie mich sah, lächelte sie.«
Ein helles Licht blitzte über das düstere Gesicht des Alten. »Ja, sie war ein Sonnenschein.« Er wischte sich mit der Hand ausgiebig die Augen aus. »Sie war mein Sonnenschein.«
Er trank einen Schluck Wasser.
Wagner sah den alten Mann voller Mitleid an.
»Ich verstehe es nicht«, der Grauhaarige schüttelte den Kopf, »ich werde es nie begreifen.« Er schluchzte auf. »Meine Sonne leuchtet nicht mehr. Sie ist untergegangen.«
Er weinte und jammerte. Dann erzählte er. Es tat ihm sichtlich gut, einen geduldigen Zuhörer zu haben und über sie sprechen zu dürfen.
Sie sei die Tochter einer deutschen Magd und eines Sizilianers, der bettelarm nach Deutschland gekommen war. Ein junger Maurer ohne Arbeit. Er hatte gehört, dass man Eisenbahnen durch Deutschland bauen wollte, wozu man viele Brücken, Viadukte und Tunnels brauchte. Zu Fuß und mit dem Schiff hatte er sich aufgemacht und beim Bau der hiesigen Brücke eine Anstellung gefunden.
»Ach Gott, was haben die armen Leutchen mitgemacht!« Der alte Mann zog ein Taschentuch heraus, wischte sich die Tränen ab und schnäuzte sich. »Als dann ein Kind unterwegs war, wollten sie heiraten. Doch er war katholisch und sie evangelisch. Man hat es ihnen verweigert. Sie wissen ja, wie stur christliche Kirchen sein können. Predigen Barmherzigkeit und säen Enttäuschung und Zwietracht.«
Bald darauf sei er bei der Arbeit in die Tiefe gestürzt. Genau da, wo auch Hanna …
»Zufall? Oder ist meine Hanna erst durch seinen Tod auf die Idee gekommen?« Der Alte wandte sich an seinen Zuhörer: »Was meinen Sie, Herr Fotograf?«
Wagner zuckte die Achseln.
Die Magd habe tagaus, tagein in der Blechnerei Kupfer geschuftet, sieben Tage in der Woche für einen Hungerlohn. Kaum sei ihr Zeit geblieben, sich um das Kind zu kümmern. Darum habe Hanna, die im Nachbarhaus mit ihrer Mutter in einer elenden Kammer hauste, tagsüber viel auf der Gasse gespielt. Oft sei sie auch bei ihm gewesen, denn er arbeite ja nur nachts. Und als ihre Mutter an Schwindsucht starb, Hanna war erst sechs, habe er das kleine Mädchen zu sich genommen. Es hatte ja sonst niemand mehr auf der Welt.
»Die Blechnerei in der Turmgasse?«
Der alte Mann nickte.
»Dann sind Sie der Laternenanzünder?«
Er nickte wieder.
»Wie alt ist … Verzeihung … war sie?«
»Am 2. Dezember wäre sie zwanzig geworden.« Er trank noch einen Schluck, dann erzählte er weiter. Hanna sei ein sehr kluges Kind gewesen. Das habe ihr Lehrer öfters betont. Darum habe Pfarrer Wienzle ihr kostenlos Privatstunden in Latein gegeben und sie im Mädchenlyzeum angemeldet, das vor ein paar Jahren nahe beim Schloss eingerichtet worden war, als erste höhere Mädchenschule weit und breit. Dort sei sie als Tagesschülerin gewesen, ohne Schulgeld zu zahlen, weil sie so gut lernte. Danach habe sie den allerersten Ausbildungskurs im neuen Lehrerinnenseminar besucht, das dem Lyzeum angegliedert wurde, und seit letztem April die Erstklässler an der dreijährigen Vorschule des Lyzeums im Lesen und Schreiben unterrichtet. Als Examensbeste sollte sie mit dem Seminar in Kontakt bleiben und angehende Lehrerinnen in den Unterrichtsalltag einführen.
»Hat sie weiterhin bei Ihnen gewohnt?«
»Aber ja! Sonst hätte sie in einer jämmerlichen, ungeheizten Kammer unter dem Dach der Schule hausen und dafür noch viel Geld zahlen müssen.«
Gustav Wagner war aufgewühlt. Er wusste nun, warum sie ihm auf ihrem Weg von der Turm- in die Schlossgasse nur zu bestimmten Zeiten begegnen konnte. Er dachte an ihren stummen Hilferuf, ihren Eintrag im kirchlichen Freud- und Leidbuch, der unvollständig geblieben war, weil er sie beim Schreiben gestört hatte. Am Samstagabend war er noch einmal dort gewesen und hatte ihre letzten Sätze abgeschrieben.
Einen Augenblick überlegte er, dem Laternenanzünder eine Abschrift zu geben, verwarf jedoch den Gedanken, weil er den Kummer des alten Mannes nicht mehren wollte. Hanna musste ein unlösbares Problem gewälzt und keinen Ausweg mehr gewusst haben. Anders ließ sich nicht erklären, dass sie sich mittags Mut antrank. Wollte sie ihre Angst vor dem selbst gewählten Grauen dämpfen? Aber was hatte sie in den letzten Wochen so aus der Bahn geworfen?
»Gibt es irgendeinen Grund, warum Hanna das getan haben könnte?«
Der Alte schüttelte den Kopf. »Seit Freitag zermartere ich mir den Kopf. Nachts liege ich wach und grüble. Aber ich weiß keine Antwort.«
Sie schwiegen sich wieder an und hingen trüben Gedanken nach.
»Bis wann?«
Der Alte blickte irritiert auf.
»Bis wann brauchen Sie die Trauerbildchen?«
»Morgen wird meine liebe Hanna begraben. Da würde ich gern die Karten verteilen. Mein Sonnenschein soll nicht vergessen werden. Ich darf ja nichts in die Zeitung setzen.«
»Ich gestalte die Sterbebildchen für Sie. Wie viele soll ich machen?«
»Zehn.«
»So wenige?«
»Kommt ja doch kaum jemand.«
»Ich mache lieber ein paar mehr. Kostenlos natürlich, wenn Sie mir sagen, was ich unter das Bild schreiben soll.«
Bei aller Bestürzung über Hannas Tod war Wagner während des Gesprächs aufgegangen, dass er mit Sterbebildchen gute Geschäfte machen könnte. Bisher hatte seines Wissens kein anderer Fotograf eine solche Idee gehabt.
Am nächsten Tag um zwölf hängte Gustav Wagner ein Schild an seine Ladentür: »Wegen eines Trauerfalls heute Nachmittag geschlossen.« Dann machte er sich auf den Weg zur Turmgasse.
Der alte Mann hatte, wie er tags zuvor noch berichtete, ein wahres Martyrium hinter sich, denn zum Schmerz wegen Hannas Tod kamen allerlei Scherereien hinzu. Zum Glück, wenn das Wort Glück in dieser traurigen Lage überhaupt entschuldbar ist, war Pfarrer Wienzle von allem Anfang an eingeweiht. Der hatte am Samstagmorgen den Lampenanzünder erneut aufgesucht, ihn über die anstehenden Probleme aufgeklärt und Auswege aufgezeigt.
Keine Zeitung nehme die Todesanzeige einer Selbstmörderin an, hatte Wienzle gesagt, weil man Nachahmer fürchte. Der alte Mann solle es erst gar nicht probieren und sich den Weg dorthin sparen.
Auch klärte der Pfarrer über die Beerdigung auf. Wäre Hanna katholisch gewesen, hätte man sie nicht in geweihter Erde beisetzen dürfen, sondern hinter dem Friedhof an der gefürchteten Selbstmörderwand verscharren müssen, freilich ohne priesterlichen Segen, weil Selbstmord nach katholischem Glauben eine schwere Sünde sei und Selbstmörder direkt zur Hölle führen. Dagegen lehre die evangelische Kirche, allein die Gnade Gottes schließe dem Selbstmörder den Himmel auf. Weil aber niemand auf Erden wisse, wie Gott einen Menschen beurteile, sei es erlaubt, einen Selbstmörder überall auf dem Friedhof zu beerdigen, allerdings ohne geistlichen Segen, es sei denn, der zuständige Pfarrer komme zur Überzeugung, der oder die Unglückliche habe sich im Wahn das Leben genommen. Hanna, so Wienzle, sei evangelisch getauft und habe einen klaren Verstand gehabt. Das wisse er aus den vielen Lateinstunden mit ihr. Also könne sie gar nicht bei Sinnen gewesen sein, als sie sich von der Brücke stürzte. Darum werde er Hanna kirchlich beerdigen wie jeden anderen Verstorbenen auch.
Doch ein Problem könne er nicht lösen, gestand Wienzle: die Aufbahrung der Toten bis zur Beerdigung. In die Leichenhalle auf dem Friedhof dürfe kein Selbstmörder gebracht werden und hier, er habe sich in der kleinen Wohnung des Lampenanzünders umgesehen, könne man den Sarg auch nicht lagern. Doch der alte Mann widersprach. Er bestehe darauf, dass seine Hanna bis zur Beerdigung bei ihm bleibe. Einen Bestattungsunternehmer könne er sich nicht leisten, aber ein befreundeter Schreiner zimmere gerade einen einfachen Fichtensarg. Gleich nachher werde er zur Polizei gehen und Hanna mit seinem Handwägelchen heimholen.
Als Gustav Wagner kurz nach halb eins in die Turmgasse einbog, fand er die Fenster am Haus des Lampenanzünders verhängt. Die Eingangstür stand offen. Fackelndes Licht wies den Weg zur düsteren, muffigen Wohnstube, wo eine kleine Gästeschar im stillen Gebet verharrte. Auf dem Tisch war der geschlossene Sarg aufgebahrt, geschmückt mit einem Strauß duftender roter Rosen und von zwei Reihen hoher Kerzen eingerahmt. Das Bild an der Wand veranschaulichte den bequemen und den steinigen Weg des Lebens. Daneben klebte ein altes Kalenderblatt. Darunter stand ein abgewetztes Sofa mit einem kleinen Beistelltischchen. Auf dem Fenstersims blühte eine weiße Geranie.
Der alte Mann begrüßte den Besucher, nahm einige Sterbebildchen entgegen, warf einen kurzen Blick darauf und dankte mit dem Anflug eines Lächelns. Während Wagner vor den Sarg trat und der Toten gedachte, verteilte der Alte die Andenken an seine Hanna.
»Wollen Sie sich selbst überzeugen, dass sie nicht verrückt war?«
Wagner war von der Frage überrascht.
»Gehen Sie nur«, sagte der Alte. »Die Tür zu ihrer Dachkammer ist offen.«
Wagner stieg hinauf, blieb aber wie angewurzelt unter der Tür stehen. Einen so wohlgeordneten Kosmos auf kleinstem Raum hatte er noch nie gesehen. Sein fotografischer Instinkt war geweckt. Das hier musste er mit seiner Kamera festhalten. Er lebte zwar von Porträts und Visitenkarten, aber für Gebäude und Interieurs schwärmte er. Nach dem Buch »Eugensburg – Straßen und Häuser einer Stadt« und dem demnächst erscheinenden Band »Zeitgesichter« wollte er sich mit der Ausstattung von Räumen befassen. Zwei, drei Blicke in Hannas Kammer könnten jedes Buch bereichern.
Er hörte Stimmen und stieg wieder hinab.
Pfarrer Wienzle war eingetroffen und betete laut: »Gott der Vater wolle dich, Hanna Scheu, durch seine Barmherzigkeit führen in das Reich, das seine Auserwählten ewig preisen. Unser Herr Jesus sei bei dir und beschütze dich. Und der Heilige Geist sei in dir und erquicke dich. Der dreieinige Gott segne und bewahre dich bis zur Auferstehung des Lebens. Amen.«
Vom Friedhof her läutete das Totenglöckchen. Vier junge Männer kamen leise in die Stube und schulterten den Sarg auf Weisung eines Hageren. Das sei der Schreiner mit seinen Leuten, ein Freund des Hausherrn, flüsterte eine Frau. Die Männer trugen den Sarg vors Haus und setzten ihn auf dem Handwägelchen ab, das mit schwarzen Tüchern ausgekleidet war. Der Alte deckte ein Bahrtuch darüber, so sanft und liebevoll, als bette er ein schlafendes Kind zur Nachtruhe.
Die Trauernden sammelten sich zum Leichenzug. An der Deichsel des Wägelchens die beiden Schreinerlehrlinge, hinten als Schieber die beiden Gesellen. Dann Pfarrer Wienzle, gefolgt vom gramgebeugten Alten, der die roten Rosen trug und sich auf den starken Arm des Schreiners stützte. Dahinter sieben oder acht barmherzige Bekannte des Laternenanzünders. Schließlich Gustav Wagner, der seine Trauerbildchen nach beiden Seiten verteilte.
Der helle Klang des Glöckchens, dazu das Rasseln der eisenbeschlagenen Räder, der erbärmliche Anblick des Gefährts und die kümmerliche Trauerschar erregten Mitleid. Nachbarn und Passanten blieben stehen, tuschelten, lasen, was Wagner ihnen zusteckte, und gaben ihr Wissen sofort weiter. Was niemand erwartet hatte, trat ein: Aus jedem Haus, an dem der Sarg vorbeirumpelte, schlossen sich Leute an, denn die Kunde vom Tod der jungen Lehrerin, die alle vom Sehen kannten, verbreitete sich schneller als das Wägelchen übers Pflaster klappern konnte. Dort, wo die Turmgasse steil bergan stieg und die beiden Gesellen kräftig schieben mussten, sah sich Wagner um und staunte. Aus der dürftigen Trauerschar war eine stattliche Prozession geworden.
Durchs schmiedeeiserne Friedhofstor schob sich der Zug, schlängelte sich in weitem Bogen über den Rasen, führte vorbei an prächtigen Grabmälern und eingesunkenen Grabplatten, deren Inschriften Wind und Wetter verwischt hatten. Vorbei an Reihen neuerer Grabsteine, geschmückt mit allerlei Symbolen. Oft ein christliches Kreuz, zuweilen ein Anker als Zeichen der Hoffnung in stürmischer See oder ein Palmzweig als Sinnbild für Unsterblichkeit und Wiedergeburt, seltener eine Mohnkapsel, die auf den ewigen Schlaf hinwies.
So erreichte der Trauerzug das offene Grab. Die jungen Männer senkten den Sarg in die Erde, verneigten sich und traten in den Hintergrund. Pfarrer Wienzle sprach ein Gebet und stimmte ein Lied an, das viele mitsangen. Mit zu Herzen gehenden Worten würdigte er die Verstorbene, warf dreimal Erde in die Grube und sagte: »Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.«
Als der Alte ans Grab trat, geführt vom Schreiner, brach er in lautes Wehklagen aus. Er war untröstlich in seinem Schmerz. Sein Freund entwand ihm behutsam den Blumenstrauß aus den verkrampften Fingern und ließ Blüte für Blüte auf den Sarg hinabregnen. Dann nahmen die Trauergäste Abschied am Grab und sprachen dem Laternenanzünder ihr Beileid aus. Schließlich segnete der Pfarrer die Verstorbene und übergab sie in die Obhut Gottes.
Wenige Augenblicke später lag die Grube verlassen da, bis auf eine junge Frau mit ausdrucksstarkem Gesicht, die sich im Hintergrund gehalten hatte. Sie starrte lange auf den Sarg und warf schließlich einen Strauß bunter Feldblumen hinunter.
Gustav Wagner, der die Rotblonde erspäht und ihr zuvor ein Sterbebildchen zugesteckt hatte, beobachtete sie von Weitem.
Eine Verwandte oder gar eine Freundin der Toten?
Sie am Grab anzusprechen, gehörte sich nicht. Also wartete er draußen vor dem Hauptportal. Doch sie kam nicht. Offensichtlich hatte sie den Friedhof durch eine der Seitentüren verlassen.
Seminar
»Wo hast du dich herumgetrieben?« Fräulein Krämer, am Lehrerinnenseminar zuständig für weibliche Handarbeiten und Hausordnung, war empört.»Ich habe mich nicht herumgetrieben.«
»Dann gesteh endlich, wo du gewesen bist!«
Sophie schwieg.
»Du hättest vorher um Erlaubnis fragen können!«
»Sie hätten mich ja doch nicht gehen lassen.«
»Aha! Also doch! Du hast verbotswidrig das Seminar verlassen!« Die Krämerin holte tief Luft. Sie war sehr erregt. »Und du bist da gewesen, wo du nicht hättest sein dürfen, sonst würdest du es ja zugeben, du Miststück!« Sie schlug Sophie mit der flachen Hand ins Gesicht. »Pfui! Du hast gegen die Hausordnung verstoßen und dich herumgetrieben. Wahrscheinlich steckt ein Mann dahinter.«
Sophie sah den Schlag kommen, wich aber nicht zurück. Trotzig blickte sie der Seminarlehrerin ins Gesicht. »Ja, ich habe die Hausordnung verletzt. Nein, ich habe mich nicht herumgetrieben, und ich habe mich auch nicht mit einem Mann getroffen.«
»Geh sofort auf deine Stube!«, keifte die Krämerin. »Bis auf Weiteres verlässt du nicht das Haus! Ich werde den Vorfall dem Herrn Oberlehrer melden!«
Sie setzte Sophie mit herrischer Geste vor die Tür. »Eine impertinente Person«, schimpfte sie vor sich hin, »die muss hier weg. Ein räudiges Schaf verdirbt die ganze Herde.«
Wütend riss sie die Schublade unter ihrem Schreibtisch heraus und entnahm ihr eine Kladde, auf der in deutscher Schrift stand: »Sittliche Aufführung.«
Sie blätterte bis zu der Doppelseite, die mit »Sophie Rössner« überschrieben war. Dann klappte sie das in den Tisch eingelassene Tintenfass auf, tauchte ihre Stahlfeder in die Tinte und ergänzte auf der linken Seite die Bemerkungen über Charakter und Wandel im Allgemeinen: »Widerborstig, verstocktes Gemüt, lügt. Möglicherweise hat sie sich mit einem Mann eingelassen.« Und auf der rechten Seite notierte sie unter Benehmen: »Frech, aufsässig, hält sich nicht an die Ordnung. Verlässt das Seminar ohne Genehmigung und treibt sich herum.« Die Feder kratzte, und die Tinte spritzte, als die Seminarlehrerin das Datum daruntersetzte, so wütend war sie.
Sie trocknete den Eintrag mit dem Löschpapier und legte die Kladde in die Lade zurück. Spätestens bei der Zeugnisausgabe würde dieses unverschämte Frauenzimmer sein freches Auftreten bereuen. Das Zeugnis sammelte nämlich nicht nur die Noten in den Prüfungsfächern. Nein, auch die Fähigkeiten, das Geschick, den Charakter und die sittliche Aufführung konnte man schwarz auf weiß darin nachlesen.
Fräulein Krämer sprang auf, strich sich das Kleid glatt und prüfte vor dem Spiegel an der inneren Schranktür, ob die Frisur saß. Der Herr Oberlehrer sollte einen guten Eindruck von ihr gewinnen. Vielleicht überkam ihn eines Tages doch noch die Lust. Sie seufzte tief. Ach, der liebe Kollege hatte ja keine Ahnung, dass er durch ihre kühnsten Träume geisterte.
Schnurstracks eilte sie aus dem Zimmer, setzte ihr strahlendstes Lächeln auf, straffte sich und hüpfte federnd die Treppe hinauf. Erwartungsvoll klopfte sie an die Tür seines Büros, das direkt über ihrem lag.
Brettschneider erhob sich hinter seinem Schreibtisch. Er schien höchst erfreut.
»Liebste Kollegin«, säuselte er und kraulte sich den Bart, »es ist mir immer ein Vergnügen, mit Ihnen Konversation zu pflegen.« Mit ausladender Geste forderte er sie auf, sich neben ihn auf das Sofa zu setzen.
Fräulein Krämer fühlte sich geschmeichelt. Mit beiden Händen spannte sie ihren bodenlangen Rock und ließ sich vorsichtig auf der fadenscheinigen Couch nieder.
Brettschneider drückte sich neben sie, legte seine Hand auf ihr verhülltes Knie und schmachtete sie an. »So, jetzt erzählen Sie mal. Was haben Sie auf dem Herzen?«
Eugen Brettschneider unterrichtete Rechnen, deutsche Sprache, Geschichte, Erdkunde, Schönschreiben und Zeichnen am Seminar. Außerdem überwachte er die unterrichtspraktischen Versuche der Seminaristinnen in der Übungsschule. Pfarrer Adalbert Finkenberger, der auf Dienstreise weilte, vervollständigte den hauptamtlichen Lehrkörper. Er war Vorstand, Pfarrer und Lehrer in einer Person. Ihm oblag es, die jungen Damen sowohl in Religion, biblischer Geschichte und im Memorieren von Bibelzitaten zu unterweisen als auch in Pädagogik, die hier Schulkunde hieß. Diese vier Fächer – Religion, biblische Geschichte, Memorieren und Schulkunde – bildeten den Kern der Ausbildung. Sie standen dienstags, mittwochs und freitags auf dem Stundenplan. Außerdem hielt Finkenberger montags um sieben Uhr in der Früh die Wochenandacht und predigte sonntags in der nahen Stiftskirche am Marktplatz. Ferner kamen ein privater Klavierlehrer und ein Gesangslehrer vom Konservatorium stundenweise ins Haus. Beide musischen Fächer waren Pflicht für alle Seminaristinnen. Fakultativ wurde, gegen zusätzliche Bezahlung, auch Violinunterricht geboten.
Das Seminar residierte in einem alten Haus in der Schlossgasse. Zur Straße hin begrenzte ein Rundbogen aus grauem Sandstein das Grundstück. In das große hölzerne Tor war mittig eine schmale Tür eingelassen. Der Schlussstein des Torbogens trug einen steinernen Leoparden, Wappentier eines alten Fürstengeschlechts.
Wollte man ins Seminar, musste man genau unter dem Leoparden durch die kleine Tür, dann die Einfahrt entlang bis zur hinteren Hausecke und von dort über eine kleine Treppe zur Pforte an der Rückseite des Gebäudes. Über der Pforte stand, in deutscher Druckschrift, ein Zitat aus dem Johannesevangelium: »Weide meine Schafe.« Deshalb hieß man die Seminaristinnen in der Bevölkerung nur die Schafe von der Schafweide, während die Fräulein untereinander lästerten, sie hausten in einem Schafstall. Hinter der Pforte lag der Wachhund auf der Lauer, wie die jungen Hausbewohnerinnen spotteten, eben jene Berta Krämer. Ihrem Schreibtisch gegenüber war eine große Glasscheibe in der Wand, durch die sie alle Ein- und Ausgehenden kontrollieren konnte. Vom Hausflur kam man direkt in den Speisesaal, von da aus sowohl in den Waschraum und die Toiletten als auch in die Küche, in der zwei Zugehfrauen für das leibliche Wohl der Seminaristinnen sorgten. Die Büros des Oberlehrers und des Pfarrers befanden sich im ersten Stock, ebenso die beiden Lehrsäle. Darüber, unter der Dachschräge, lagen die vier Schlaf- und Arbeitsräume der Mädchen. Sommers war es dort stickig und schwül, winters kalt und zugig.
Brettschneider bearbeitete das Knie seiner Kollegin, während sie, von wohligen Schauern erregt, mit schwülstigem Blick und honigsüßer Stimme vortrug, sie sei zutiefst gekränkt worden.
»Ich bin untröstlich«, gurrte er.
Sie, betört und zugleich den Tränen nahe, schilderte ihm mit bebender Stimme, Sophie verletze nicht nur alle Grenzen der Hausordnung, sondern verschlinge abends auch liederliche Lektüre. Zweimal habe sie die angehende Lehrerin beim abendlichen Kontrollgang erwischt, wie sie heimlich ein Schmutzwerk las, hingeschmiert von einem gewissen Marlitt. »Blaubart« oder so ähnlich heiße der Schund.
»Was für eine schauderhafte Liebesgeschichte«, stöhnte Brettschneider, »und ausgerechnet in den Händen einer künftigen Erzieherin, der wir Kinder anvertrauen wollen?«
»Sie kennen den verderbten Schmachtfetzen, lieber Herr Kollege?« Das Fräulein Seminarlehrerin blickte den innig Verehrten verstört an.
»I wo!« Brettschneider tätschelte ihre Wange und massierte ihren Schenkel. »Vom Hörensagen, meine Verehrteste, nur vom Hörensagen. Ein junges Ding soll sich in dem Roman in einen alten Wüstling verlieben. Stellen Sie sich das vor.« Er schüttelte sich vor Ekel.
»O Gott«, stöhnte die Oberaufseherin, »die Rössner verdirbt uns die ganze Herde.«
Er runzelte die Glatze. »Bitte holen Sie den lausigen Fratz augenblicklich her. Ich lese ihm die Leviten.«
Der schneidende Ton entzückte die Krämerin. Sie spritzte auf und sauste davon. Wenige Augenblicke später schob sie Sophie zur Tür herein.
Brettschneider schoss auf Sophie zu und schlug zweimal so heftig auf sie ein, dass ihr Kopf zur Seite flog. Auf ihren Wangen zeigten sich sofort rote Male. »Das ist für den Verstoß gegen die Hausordnung«, fauchte er sie an. »Und jetzt rede: Wo warst du?«
Sophie verengte ihre Pupillen und kniff die Lippen zusammen.
»Zum letzten Mal«, schnaubte er, »rede!«
Sie schwieg.
Brettschneider nahm einen Stock aus dem Schirmständer hinter der Tür. »Hand her!« Er packte Sophie am rechten Handgelenk und pfefferte ihr fünf Tatzen auf die Fingerspitzen.
Sophie schoss das Wasser in die Augen.
»Sobald Pfarrer Finkenberger zurück ist, werden wir über deine Entlassung aus dem Seminar beraten. Bis dahin verlässt du nicht das Haus! Heute Abend gibt’s kein Abendessen für dich! Und jetzt geh mir aus den Augen!«
Gegen fünf Uhr betrat ein bärtiger Herr das Seminar. Er war wohl schon in seinen Siebzigern, strahlte aber Elan und Kraft aus. Seine lange Joppe aus schwerem, schwarzem Wollstoff war am Kragen mit schwarzem Samt besetzt. Um den Hals trug er ein blaues Tuch, dessen Enden er unter sein weißes Leinenhemd gestopft hatte. An der dunkelblauen Samtweste prangten silberne Rosettenknöpfe, und aus einem Knopfloch hing eine silberne Uhrkette, die in der Westentasche verschwand. Die Manchesterhose bauschte sich über den Schaftstiefeln. In der linken Hand hielt er einen runden Filzhut, an dem über der Krempe eine silberne Schnalle blinkte, die ein breites schwarzes Samtband zusammenhielt.
Fräulein Krämer flitzte aus ihrem Zimmer und versperrte ihm den Weg.
»Sie wünschen?« Schon die Frage zeigte, dass sie keinerlei Menschenkenntnis besaß. Sonst hätte sie nämlich gewusst, dass sie einen stolzen Oberschwaben vor sich hatte, der nichts mehr hasste als das dumme Gewäsch einer aufgeblasenen Türsteherin.
»Ich möchte Fräulein Sophie Rössner sprechen.«
»Nicht möglich«, log sie spitz.
»Ist Sophie nicht da?« Der Besucher schien besorgt.
»Geht Sie nichts an.«
»Ist sie etwa krank?«
»Nein!«
»Ich hörte, am Mittwochnachmittag sei kein Unterricht, da dürften die jungen Damen Besuch empfangen.«
»Wie ich schon sagte«, erwiderte die Lehrerin schnippisch, »geht Sie das nichts an.«
»Auch wenn ich Sophies Großvater bin?«
»Ja, auch dann nicht.«
Er wurde etwas lauter: »Ich habe eine Tagesreise hinter mir und soll meine Enkelin nicht sprechen dürfen!?«
»So ist es.«
Sein dröhnendes Lachen hallte in Flur und Stiegenhaus wieder. Türen öffneten sich leise im ganzen Haus. Neugierige Ohren lauschten dem imposanten Bass.
Fräulein Krämer wich einen Schritt zurück. Dafür wurde nun der Gast umso deutlicher: »Jetzt hören Sie mir genau zu, verehrte Dame. Ich habe einen ganzen Tag auf der schwäbischen Eisenbahn vertrödelt, hab mich vom Bodensee bis hierher durchrütteln lassen und soll nun meine Enkelin Sophie nicht sehen dürfen? Wer will mir das verbieten? Sie etwa?«
»Verlassen Sie sofort das Haus!«, kreischte die Aufseherin, kreidebleich im Gesicht.
»Ich denke nicht daran! Ich will auf der Stelle den Herrn Vorsteher dieses Etablissements sprechen!«
»Pfarrer Finkenberger ist diese Woche nicht da.«
Wortlos drückte der Bärtige den Zerberus an die Wand. Er polterte die Treppe hinauf, die keifende Krämerin hinterdrein.
Im ersten Stock schritt er von Tür zu Tür und las die Schilder. »Lehrsaal I«, »Lehrsaal II«, »Pfarrer Finkenberger, Vorsteher« und »Oberlehrer Brettschneider«.
An der letzten Tür klopfte er und drückte sie im selben Augenblick auch schon auf.
Brettschneider saß mit vor Schreck geweiteten Augen hinter seinem Schreibtisch, denn er hatte gelauscht.
»Sie wünschen?«, fragte er scheinheilig und rutschte tiefer in die Polster seines Lehnstuhls, als wolle er sich gleich unter dem Tisch verkriechen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass die Krämerin ins Zimmer schlich und die Tür hinter sich schloss. Vermutlich wollte sie ihrem verehrten Kollegen beistehen, falls er Hilfe benötigte.
»Hier!« Der zornige Besucher knallte etwas auf den Tisch und deutete mit dem Zeigefinger darauf.
Brettschneider las.
»Wie mein Pass ausweist, bin ich nicht irgendein Hanswurst, dem man die Tür weisen kann.« Der Fremde klopfte mit der Fingerspitze auf seinen Ausweis. »Ich bin Hans Rössner, der Großvater von Sophie Rössner. Ich muss meine Enkelin sprechen.«
Brettschneider behielt den Erzürnten und seine Kollegin im Auge. Er überlegte. Die Krämerin nickte ihm aufmunternd zu.
»Das ist …«, er fuhr sich in den Kragen, » … heute … leider nicht möglich«, sagte er endlich. Sein Arm zuckte, als erwarte er Hiebe und wolle sich dagegen wappnen.
»Warum nicht?«
Brettschneider versank noch tiefer hinter seinem Schreibtisch. Entgeistert starrte er den Fremden an.
»Warum ausgerechnet heute nicht?«, herrschte der Fremde den Verängstigten an und warf seinen Hut direkt vor ihn auf den Tisch. »Was ist heute anders als gestern?«
»Sie hat … Arrest!«, mischte sich die Krämerin mit spitzer Stimme ein.
Dem Gast verschlug es für einen Augenblick die Sprache. »Arrest?« Er holte tief Luft. »So bei Wasser und Brot?« Er ballte die Faust. »Hinter Gittern, wie ein Spitzbube?«
»Gehen Sie, oder ich lasse die Gendarmen holen!« Brettschneider hatte sich wieder berappelt.
Im ersten Moment war der stolze Mann aus Oberschwaben wie vor den Kopf geschlagen. Gendarmen? Es arbeitete in seinem Gesicht. Offensichtlich erwog er alle Möglichkeiten. Schließlich stützte er sich mit seinen schwieligen Pranken auf den Schreibtisch, beugte sich vor, dass sich seine Nase schier in die Stirn des Oberlehrers bohrte, und starrte ihm direkt in die Augen. Seine Stimme wurde leise und scharf: »Ich komme wieder.« Er setzte ein süffisantes Lächeln auf. »Gnade Ihnen, wenn ich meine Sophie dann nicht sehen kann.« Mimik und Gestik zeigten einen unbändigen Willen.
Mit eiskaltem Blick bannte er Brettschneider, der die Augen niederschlug. Bärbeißig nahm er seinen Pass vom Tisch, setzte den Hut auf und verließ grußlos das Zimmer.
Blitzschnell, wie man es bei gefährlichen Raubtieren tat, wurde hinter ihm die Tür ins Schloss gedrückt.
Auf dem Weg zur Treppe sah der zornige alte Mann eine Hand aus einem Türspalt winken. Sophie spähte mit einem Auge aus einem der Lehrsäle und flüsterte ihm zu: »Hier bin ich, Großvater.«
Er horchte auf. Ein Strahlen lief über sein Gesicht. Behände schlüpfte er in den großen Raum, schloss leise die Tür und umarmte seine Enkelin. Erst auf den zweiten Blick erkannte er, wie man seine Sophie zugerichtet hatte. Beide Wangen waren feuerrot. In ihrer rechten Hand zerknüllte sie ein Taschentuch, das einmal weiß war und jetzt voller Blut.
»Was geht hier vor?«
Sophie berichtete, was geschehen war, warum man sie misshandelt hatte und jetzt mit Hausarrest und Rauswurf bedrohte.
Der alte Rössner war entsetzt. Nicht nur über das, was seiner Enkelin widerfahren war, sondern vielmehr darüber, wie sie vor ihm stand. Ein Häufchen Elend, zartgliedrig und zerbrechlich. Dabei kannte er sie bisher nur als Wirbelwind, als fideles Mädchen, das tanzen konnte wie ein Derwisch, lustige Lieder sang und sich auf dem Klavier dazu begleitete oder aus ihrer Geige herrliche Melodien hervorzauberte.
»Mach dir keine Sorgen, Kind.« Der alte Rössner nahm die Untröstliche wieder in die Arme und strich ihr sanft über den Rücken. »Niemand schmeißt eine Sophie Rössner hinaus. Verlass dich drauf.«
Sophies aufgestaute Empörung löste sich, die Schmerzen kamen wieder. Sie vergoss ein paar Tränen und schluchzte: »Und zu essen soll ich auch nichts kriegen.«
Da packte den Großvater der heilige Zorn. »In einer Viertelstunde bin ich wieder da«, zischte er durch die Zähne. »Ich ruf dir dann!«
Er spähte in den Flur. Niemand da. Er rumpelte die Treppe hinunter, wischte die geifernde Rausschmeißerin, die sich ihm erneut in den Weg stellte, wortlos zur Seite und hastete aus dem Haus.
Doch schon bald kam er wieder, in der rechten Hand einen großen Krug, gefüllt mit frisch gezapftem Bier, in der linken ein rot-weiß kariertes Tuch, zu einem Bündel geschnürt.
Als ihn die Krämerin aufhalten wollte, ranzte er sie an: »Was steht an Ihrer Tür?«
Sie zuckte zurück.
»›Weide meine Schafe‹, das steht dran!«
»Weiß ich wohl!«
Er rollte mit den Augen. »Sie …! Sie haben doch vom Weiden keine Ahnung!«
»Werden Sie nicht auch noch frech!«
»Aus dem Weg, Sie wurmstichige Bohnenstange!« Entschlossen zwängte er sich an ihr vorbei. »Wenn die Schafe nichts zu fressen kriegen«, fauchte er sie über die Schulter an, »dann hat der gute Hirte keine Ruhe, weil die Viecher nicht gedeihen können. Sie verstoßen gegen Gottes Gebot! Sie lassen die Schafe nicht weiden! Darum muss ich das Füttern jetzt übernehmen!«
»Unverschämtheit!«
Er spottete: »Sie sind halt kein Hirte, sondern bloß eine dumme Gans.«
Die Aufseherin starrte ihn mit offenem Mund an. Es hatte ihr tatsächlich die Sprache verschlagen. Zum ersten Mal, seit sie hier das Sagen hatte, fehlten ihr die Worte.
»Sophie!«, schrie der Großbauer, »komm, ich hab was zum Vespern dabei!«
Breitbeinig stakste er die Treppe hinauf, wo seine Enkelin schon auf ihn wartete, und verschwand mit ihr wieder in einem Lehrsaal, die Krämerin maulend hinterdrein.
Er stellte den Bierkrug auf einem der Tische ab, knotete das karierte Tuch auf und präsentierte einen üppigen Imbiss: zwei Brezeln, vier Brötchen, ein Stück gerauchte Schinkenwurst, einen Bollen Käse, zwei Rettiche, zwei Gurken und einen Kohlrabi.
»Schau, Kind, was für eine saftige Weide. Jetzt setz dich hin und iss dich satt«, munterte er Sophie auf.
Der Seminarlehrerin fielen die Augen aus dem Kopf. Sie kochte vor Wut, sagte jedoch nichts, tat auch nichts, weil sie dem alten Kraftprotz nicht gewachsen war.
»Raus hier und Tür zu!«, schnauzte er sie an und zog ein langes Messer aus dem Stiefelschaft. »Sonst schmeckt’s uns nicht.«
»O, o, o! Wenn das mal gut geht!« Der alte Rössner blieb mitten auf der Straße stehen und raufte sich die Haare. »Ach, was gäbe ich dafür, wenn ich dem Mädchen helfen könnte.«
Er erschrak. Ganz in Gedanken hatte er laut gesprochen. Eine entgegenkommende Frau betrachtete ihn schon, als wäre er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Er streckte ihr die Zunge heraus und lief weiter.
Wo geht’s hier zum »Gasthaus Sonne«? Er sah sich suchend um. Egal! Warum in der trostlosen Kammer die Wand anstarren und Trübsal blasen? Fragen kann man später noch. Erst einmal mit sich ins Reine kommen!
In einer dunklen Hausecke zündete er sich eine Zigarre an, dann schritt er paffend durch unbekannte Gassen und überlegte hin und her.
Nicht zum ersten Mal in seinem langen Leben stand er vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Nicht zum ersten Mal wusste er auf Anhieb keinen Ausweg. Nicht zum ersten Mal fühlte er sich zwischen Hammer und Amboss.
Und doch schwante ihm, wie er eine Lösung finden könnte: Immer dann, wenn etwas ausweglos schien, hatte sich letztlich doch ein Weg aufgetan, wenn man bereit war, über Zäune zu steigen und sich vielleicht auch die Hose zu zerreißen. Je auswegloser die Situation, desto geduldiger musste man das Problem entwirren und dann konsequent zupacken.
Er lehnte sich an einen Zaun, spuckte Tabakkrümel aus und sog an seinem Stumpen, bis die Zigarrenspitze wieder glühte. Warum sollte es ihm auch diesmal nicht gelingen?
Er reckte sich, holte tief Luft und marschierte voller Zuversicht durch die Gassen der Altstadt.
Aber wo anfangen? Wen fragen? Was tun? Irgendetwas musste doch geschehen! Sophie durfte nicht untergebuttert werden! Vielleicht hätte er diese Giftspritze und diesen Gnom gleich an die Wand schlagen sollen, bis sie Milch gegeben hätten.
O Gott, das arme Mädchen! Sophie! Meine Sophie so ohnmächtig! Ihr fröhliches Gesicht verfinstert, als flehe sie: Großvater, hilf mir!
Das Gefühl kannte er zur Genüge. Was hatte er als Kind nicht alles erdulden müssen. Die Mutter bei seiner Geburt gestorben, der Vater zuvor im Krieg gefallen. Not und Elend überall. Immer und überall nur Krieg. Dieser verfluchte Napoleon hatte Tod und Armut in jedes Haus gebracht.
Er schüttelte fassungslos den Kopf. Hunger und Durst im Armenhaus. Nirgendwo gelitten. Überall schubste man ihn herum, bis er irgendwann im Waisenhaus landete. Ein Nichts und Niemand, einer, an dem sich die meisten die Hände abwischten. Mit anderen Waisenkindern karrte man ihn schließlich nach Hohenheim in die neue Ackerbauschule. Man wollte ordentliche Ackerknechte aus den verarmten Buben machen. Tüchtige Männer, die ihrem Dorf nicht auf der Tasche lägen.
Wieder nur leere Versprechungen. Prügel und Ohrfeigen den lieben langen Tag. Morgens, beim Lesen, Schreiben und Rechnen, kräftige Hiebe mit dem Stock. Nachmittags, bei den Feldarbeiten, Tritte, Faustschläge und saftige Ohrfeigen.
Gott sei Dank war einer anders, ein junger Landwirtschaftsmeister. Der rastete nicht bei jeder Gelegenheit aus, prügelte nicht bei jedem Befehl. Nein, der hatte Mitleid und zeigte dem völlig verängstigten Buben, wie man die Felder von Unkraut und Steinen säubert, Getreide, Kartoffeln, Rüben und Klee pflanzt, pflegt und erntet. Wie man Obstbäume veredelt und Obst zu Saft und Most verarbeitet. Wie man Dächer abdichtet, Zäune aufrichtet, Sensen dengelt, eine Pflugschar schärft und Schuhe flickt. Und genau dieser Christoph Rössner hatte ihn nach Oberschwaben mitgenommen, als er den Dienst in Hohenheim quittierte, und hatte ihn adoptiert.
Der alte Rössner knirschte mit den Zähnen und spuckte aus. Um jeden Preis musste er solch üble Erfahrungen seiner Enkelin ersparen. Dem Glatzkopf im Seminar traute er alles zu. Und diese giftige Kröte im Terrarium hinter dem Eingang hätte gut in ein Weiberzuchthaus gepasst.
Sophie! Wie liebte der alte Rössner diesen Namen. Seine älteste Tochter hieß so, nun auch seine älteste Enkelin. Und die ältere Sophie wurde sogar die Patentante der jüngeren.
Fuhr die kleine Sophie mit ihrem Vater Hansjörg in der Sommervakanz an den Bodensee, die berühmte schwäbische Eisenbahn machte das inzwischen möglich, fielen für den alten Herrn Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Denn dann kam am Sonntag auch seine große Sophie mit ihrem Mann zu Besuch. Zwei Sophien am Tisch, die sich auch noch blind verstanden. Das machte ihn glücklich und sprachlos zugleich. Immer wieder glitt dann sein Blick von der Älteren zur Jüngeren. Hätte das doch seine Frau noch erleben dürfen!
Der alte Rössner war vor dem Schlossgarten angekommen. Er trat die Zigarre aus und hielt sich an den schmiedeeisernen Gitterstäben fest. Verächtlich schaute er auf den Prachtbau, den der Fürst dem armen Volk abgepresst hatte. Und jetzt, schoss es ihm durch den Kopf, lag es an ihm, ob seine kleine Sophie in diesem Seminar untergepflügt wurde oder wuchs und gedieh.
Er schlug sich mit der Hand an die Stirn. Da war doch schon einmal …! Ja, richtig! Hansjörg hatte in Stuttgart bei der obersten Schulbehörde vorreiten müssen, weil man ihm gegen Ende der Revolutionsjahre politischen Verrat andichten wollte.
Und wenn er morgen nach Stuttgart führe und genau dort den Fall seiner Sophie vortrüge? Könnten die hohen Herren nicht …?
Der alte Rössner dachte nach. Wie war doch gleich der Name dieser Behörde? Fällt mir noch ein, sagte er sich. Wenn nicht, kann man sich ja durchfragen.
Nein, nein, beruhigte er sein Gewissen, der eigene Hof war versorgt. Die in Sommerfelden konnten noch ein paar Tage auf ihn verzichten. Die Ernte war ja eingebracht. Das hier war wichtiger. Morgen würde er nach Stuttgart fahren.
»Das freut mich aber, dass du mich auch einmal besuchst.« Georg Ocker begrüßte den alten Rössner herzlich.
»Wie geht es Hansjörg?«
»Danke. Gut, hoffe ich.«
Zornig über den gestrigen Empfang im Lehrerinneninstitut war der Bauer vom Bodensee mit dem Zug nach Stuttgart gedampft und hatte sich zum Konsistorium, der Oberschulbehörde, durchgefragt. Der Pförtner hatte ihm den Namen des für Eugensburg zuständigen Referenten genannt: Oberkirchenrat Ocker.
Erst als er in den dritten Stock hinaufstieg, kam dem alten Rössner beim Verschnaufen in den Sinn, dass so zuhause auch der Nachbar hieß, Schulmeister Ocker, ein im sechzigjährigen Schuldienst ergrauter und beliebter Mann.
Erwartungsvoll hatte er an der angegebenen Tür geklopft und tatsächlich den Sohn eben jenes Schulmeisters angetroffen, der überrascht und erfreut zugleich den Besucher willkommen hieß.
»Weißt du, ich arbeite erst seit kurzem hier«, sagte Ocker. »Ich hatte bisher keine Zeit, Hansjörg zu schreiben und ihm von meiner neuen Dienststelle zu berichten.«
»Er ist immer noch Schulmeister in Winterhausen. Ein bisschen kränklich ist er schon, aber sonst mit seinem Leben zufrieden. Er jammert nie. Kennst ihn ja.«
Ocker nickte. Der älteste Sohn des Besuchers war sein bester Freund in der Volksschule gewesen. Fast täglich hatten sie auf dem Rössnerhof gespielt, bis Hansjörg ins Lehrerseminar einrückte und er selbst zum Landexamen nach Maulbronn und dann zum Studieren nach Tübingen musste. Nach dem Theologiestudium hatte er etliche Jahre als Landpfarrer und Bezirksschulinspektor gedient, bis er heuer als Referent ins Konsistorium berufen worden war, zuständig für die Ausbildung der Volksschullehrer, die im Königreich Württemberg nicht Staatsbeamte sein durften, sondern, anders als im übrigen Deutschland, Kirchendiener bleiben mussten, wie es im Beamtendeutsch hieß.
»Und was macht seine kleine Sophie?«
»Ihretwegen bin ich hier.«
»Warum, was ist mit ihr?«
Der alte Rössner berichtete ausführlich, dass Sophie Lehrerin werden wollte und was sich am Vortag im Seminar ereignet hatte.
»Schau, Georg, hab ich dir mitgebracht.« Er legte Sophies Taschentuch auf den Schreibtisch.
Ocker nahm es mit spitzen Fingern und hielt es gegen das Licht. »Blut? Stammt das alles von Sophies Hand?«
»Ja, der Brettschneider hat so hart zugeschlagen, dass die Haut an den Fingern geplatzt ist.«
Ocker schüttelte den Kopf. »Versteh ich nicht. Ich kenne den Brettschneider zwar nicht, aber dem Hörensagen nach soll er ein erfahrener Lehrer sein. Eigentlich müsste er wissen, dass alle Strafen verboten sind, die Verletzungen verursachen. Das kann sogar strafrechtlich als Körperverletzung geahndet werden.« Er blickte den alten Bauern ernst an. »Willst du ihn anzeigen?«
»Du kennst mich doch, Georg. Ich will nur, dass der Brettschneider und diese Krämer meine Sophie gerecht behandeln. Mehr nicht.«
»Hat dir Sophie verraten, wo sie gewesen ist?«
»Bei einer Beerdigung.«
»Eines Verwandten?«
»Nein, ihrer Freundin Hanna. Die war Lehrerin an der Übungsschule des Seminars.«
»Warum hat Sophie nicht um Erlaubnis gefragt, bevor sie das Seminar verlassen hat?«
»Weil sich die Freundin das Leben genommen hat.«
Ocker schlug die Hände vors Gesicht. »O Gott!«
»Kommt das öfter vor?«
Ocker nickte. »Ab und zu, leider.« Er räusperte sich. »Schrecklich ist das.« Er stöhnte. »Weiß man, warum?«
»Ich glaube nicht. Sie sei von einer Brücke gesprungen, heißt es.«
Nach einer Weile meinte Ocker: »Trotzdem hätte Sophie fragen sollen. Bestimmt hätte man sie gehen lassen.«
»Sophie bezweifelt das entschieden. Brettschneider und seine Kollegin hätten nämlich beim Mittagessen verkündet, diese Hanna sei plötzlich schwer erkrankt und komme vermutlich nicht wieder.«
Ocker schwieg. Er überlegte, wie er den Vater seines alten Freundes beruhigen könnte. Plötzlich fiel ihm ein, dass er die entscheidende Frage noch gar nicht gestellt hatte: »Wie konnte Sophie überhaupt wissen, was wirklich vorgefallen war, wenn das Seminar die Wahrheit verschwiegen hat?«
»Wie halt der Zufall so spielt, Georg. Ein Mädchen, das mit Sophie die Schlafstube im Seminar teilt, musste mit ihrem Vater zum Fotografen. Dort sah sie auf einem Tisch Trauerkärtchen mit Foto und Namen der Verstorbenen liegen. Sie war zu Tode erschrocken. Es wollte ihr nicht in den Kopf, was sie gelesen hatte. Darum fragte sie den Fotografen und erfuhr so Tag und Stunde der Beerdigung.«
»Schwieg Sophie, um die Kameradin zu schützen?«
Der Gast machte eine zustimmende Geste. »Auch, aber hauptsächlich deshalb, weil das Seminar Hannas Tod vertuschen wollte. Sophie konnte nicht bitten, zu Hannas Beerdigung gehen zu dürfen. Sie fürchtete, das hätte ihre Lehrer der Lüge überführt und Ärger gegeben.«
Der Herr Oberkirchenrat drehte einen Bleistift zwischen seinen Fingern und schaute in sich gekehrt zum Fenster hinaus. Die Geschichte beschäftigte ihn sehr. Nachdenklich legte er den Stift zur Seite, fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und sah seinen Besucher versonnen an. »Bedenke, lieber Hans, der Tod der jungen Frau hat gewiss Verwirrungen ausgelöst.«
»Ich weiß wirklich nicht, worauf du hinaus willst.«
»Die Seminarlehrer befürchten wohl, dass dieser Selbstmord alle Vorurteile gegen Frauen im Schuldienst bestätigt.«
Der Besucher rollte die Augen. Er wusste nicht, was sein Gegenüber andeuten wollte. »Georg, red’ bitte nicht um den heißen Brei herum.«
Über das Gesicht des Kirchenbeamten huschte ein Lächeln. Nachsichtig sagte er: »Du weißt bestimmt, dass sich viele Gemeinden weigern, eine Lehrerin aufzunehmen. Frauen seien den Anstrengungen im Schulberuf körperlich und seelisch nicht gewachsen, behaupten die Gegner. Die Überforderung lege sich aufs Gemüt und rufe nervliche und psychische Leiden hervor.«
»Quatsch!«, empörte sich der Rössner. »Du hast doch mit eigenen Augen gesehen, was deine Mutter und deine Schwestern geleistet haben. Tag und Nacht haben sie geschuftet. Bis zur Sichelhenke oft fünfzehn, sechzehn Stunden am Tag. Meine Frau auch. Du kanntest sie ja. Was hat die das Jahr über weggeschafft! Mit zwei Knechten konnte sie es aufnehmen.« Er machte eine wegwerfende Gebärde. »Körperlich und seelisch nicht gewachsen! Dass ich nicht lache!«
»Reg dich nicht auf, Hans. Ich bin ja deiner Meinung, aber sag das mal einem, der gegen Lehrerinnen ist.«
»Kein Mensch im Dorf steht frech hin und behauptet, eine Frau sei der Arbeit in der Schule nicht gewachsen. Weil dem die Bäuerinnen zeigen würden, wo der Bartel den Most holt. Das weißt du so gut wie ich. Solchen Blödsinn kann bloß ein hirnverbrannter Stadtmensch verzapfen.«
Ocker staunte nicht schlecht. Täglich stritt man im Konsistorium, ob die erst vor Kurzem begonnene Ausbildung von Lehrerinnen nicht doch ein Irrweg sei. Und dieser Mann aus dem Volk rückte das Problem in wenigen Worten zurecht, indem er darauf hinwies, wie belastbar Landfrauen waren.
Der Rössner dachte lange nach. Dann sagte er: »Sophie hat mir viel erzählt über den täglichen Drill, die vielen Strafen, das Strammstehen und Marschieren in Zweierreihen, wenn die Mädchen sonntags zur Kirche gehen oder am Nachmittag Stadtgang haben, aber nie etwas über Gegner. Was sind das für Leute?«
»Hauptsächlich Lehrer. Fast alle unterrichten an Schulen in der Stadt.«
Erst verschlug es dem Besucher vor Zorn die Sprache. Dann hieb er mit der Faust auf Ockers Schreibtisch. »Verdammt noch mal! Bringt doch die Lehrerinnen aufs Land! Bei uns sind sie willkommen.«
»Geht nicht, Hans, weil im Gesetz steht, dass Lehrerinnen nur an großen Schulen eingesetzt werden dürfen, und zwar als rangniedrigste Lehrkräfte. Und so große Schulen gibt es nur in der Stadt.«
Fassungslos starrte der alte Bauer den Oberkirchenrat an. In seinem Gesicht arbeitete es. Schließlich fragte er: »Was haben eigentlich die Lehrer gegen Frauen?«
»Sie fürchten die weibliche Konkurrenz. Darum hetzen sie die Eltern auf. Leider machen auch einige Pfarrer mit.«
Der Rössner dachte an die Zukunft seiner Enkelin und ärgerte sich maßlos. So viel Borniertheit konnte er nicht fassen. Er stand auf, stützte sich mit beiden Armen am Schreibtisch ab und blickte Ocker zornig in die Augen: »Erklär mir noch eines, Georg: Wozu im Seminar die vielen Maulschellen, Kopfnüsse und Tatzen, das Eckenstehen und der häufige Arrest?«
»Ordnung muss sein. Wenn sie nicht im Lehrerseminar eingeübt wird, ja wo dann? Nur so kommt Disziplin in die Schule.«
»Will man die Mädchen zu deutschen Soldaten dressieren?«
»Komm, komm, Hans, du übertreibst.«
»Geschliffen und die Seele ausgepfiffen?« Der alte Rössner lachte höhnisch. »Will man Dreschmaschinen aus den Mädchen machen?«
Ocker schaute seinen Gast erschrocken an.
Am nächsten Morgen gegen halb neun unterwies Oberlehrer Brettschneider die Seminaristinnen des zweiten Ausbildungskurses im Tauschrechnen.
Er kommandierte und diktierte wie ein Feldherr, gockelte wie ein Hahn auf dem Misthaufen, stellte jene bloß, die ihn mit verächtlichen oder spöttischen Blicken bedachten, ärgerte sich maßlos über jeden Fehler und quittierte kleinste Abweichungen von der Schreibnorm mit Stockschlägen auf die Hand.
Schon bei zwei Patzern verhängte er, hämisch grinsend, die immer gleiche Strafarbeit. »Schreib hundertmal: ›Artig, flink und rein müssen deutsche Mädchen sein.‹ Aber ich warne dich. Wehe, du schreibst nicht gestochen scharf!«
Irgendwann zu später Stunde musste die Bestrafte bei Kerzenlicht im Lehrsaal hocken und die hundert Sätze ins Klassenstrafheft kringeln, denn tagsüber blieb ihr keine Zeit. War da ein Schnörkel zu viel oder ein Abstrich verwackelt, gleich büßte sie übers Wochenende im Karzer.
Die Seminarfräulein wussten, dass ihr Lehrer launisch, unbeherrscht und ungerecht war, oft sogar gehässig, heimtückisch und niederträchtig. Sie hatten Angst vor ihm, schimpften heimlich über die vergeudete Zeit und die ständigen Schikanen, aber wagten nicht, sich jemandem anzuvertrauen.
Es klopfte.
Gereizt riss Brettschneider die Tür auf.
Draußen stand ein vornehmer Herr im braunen Einreiher, den steifen Filzhut in der Hand.
»Können Sie nicht lesen?«, schnauzte Brettschneider. »Unten steht doch, dass Besuche während der Unterrichtszeit nicht gestattet sind.«
Der Herr lächelte nachsichtig. »Gewiss, gewiss, aber die Ausbildungsordnung schreibt vor, dass sich das Konsistorium ab und an vom ordnungsgemäßen Betrieb dieser Anstalt überzeugen muss.«
Brettschneider stierte den Mann fassungslos an. Langsam dämmerte ihm, dass vor ihm ein Abgesandter der vorgesetzten Oberschulbehörde stand. Kreidebleich stammelte er: »Ich bitte untertänigst um Verzeihung, werter Herr …«
»Ocker, Oberkirchenrat Ocker.«
Mit einer tiefen Verbeugung bat Brettschneider den Gast herein.
Die Mädchen spitzten die Ohren und beobachteten mit klammheimlicher Freude, wie ihr gottgleicher Pauker in Sekundenschnelle zu einem glatzköpfigen Gnom zusammenschnurrte, der um den Fremden herumwieselte. Sie erhoben sich, schauten den Besucher freundlich bis belustigt an, manche sogar neckisch.
»Guten Morgen, Herr Oberkirchenrat!«, grüßten sie im Chor.
»Auch ich wünsche einen guten Morgen«, erwiderte Ocker, grinste und verbeugte sich leicht.
Lautlos setzte sich die Klasse wieder, während Brettschneider einen Stuhl herbeischleppte und nach hinten stellte.