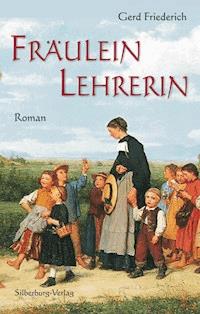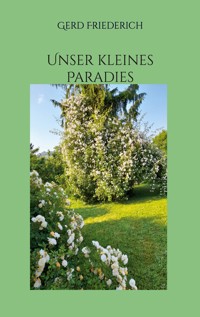4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mai 1945. Stunde Null. Der Bauer Karl Balbach muss Bürgermeister werden. Die Amerikaner wollen es so. Und schon hat er viele Probleme am Hals. Flüchtlinge und Heimatvertriebene zwangsweise einquartieren. Wohnungsnot lindern. Lebensmittelmarken verwalten. Streit zwischen Einheimischen und Zugezogenen schlichten. Schule wiedereröffnen. Schulspeisung organisieren. Währungsreform durchführen. Für moderne Landtechnik werben. Flurbereinigung durchsetzen. Landflucht bekämpfen, und vieles mehr. Wie schlägt er sich? Und wie geht es den Dorfbewohnern? – Eine Liebeserklärung an das Leben auf dem Land.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dr. Gerd Friederich, aufgewachsen im hohenlohischen Langenburg und schwäbischen Bietigheim an der Enz, studierte in Würzburg fürs Lehramt (Deutsch, Kunst, Geschichte, Geografie) und berufsbegleitend noch zweimal, zunächst in Tübingen (Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Landeskunde) und viele Jahre später in Nürnberg (Malerei). Er arbeitete als Lehrer, Heimerzieher, Personalreferent, Schulrat, Lehrerausbilder und veröffentlichte viel Fachliteratur. Jetzt lebt er im Taubertal, schreibt Romane und malt Porträts und Landschaften.
Inhalt
1945
1975
Tagebuchauszug
Karl Balbach
Paula Balbach
Hans Balbach
Lena Ledlein
Alma Zeller
Vroni Zeller
Martha Merker
Walter Merker
Baldur Diesche
2010
Die Erde erfroren,
die Blumen gestorben,
tief alles verschneit,
der Himmel betrübt;
es ist ein Leid.
Geht alles vorüber,
nichts ist verloren,
denn aus dem Tode
wird neues Leben
und wieder Freude geboren.
(Karl Stirner)
1945
Sonnenfurt an der Neide ist ein altes Pfarrdorf. Es liegt in Hohenlohe, dem ehemaligen Herrschaftsgebiet um Kocher, Jagst und Tauber. Der Mittelpunkt des Dorfes ist die Kirche aus dem Jahr 1454, in der rund hundert Jahre später die erste evangelische Predigt gehalten wurde. Das Rathaus, 1596 errichtet, dient heute auch als Zehntscheune, Spritzenhaus und Ortsarrest. Zwischen beiden Gebäuden steht das Pfarrhaus. Und vor Kirche, Rathaus und Pfarrhaus ist der Kirchplatz, im Sommer beschattet von einer mächtigen Linde.
1627 wütete im höher gelegenen Ortsteil ein Feuer, das zwölf Häuser zerstörte. Die Einwohner standen zusammen und halfen den Geschädigten beim Wiederaufbau. Seitdem wuchs die Gemeinde, langsam, aber stetig. Und als die alte, einklassige Volksschule zu klein wurde, bauten die Sonnenfurter 1887 in Fronarbeit ein neues Schulhaus.
Man braucht Zeit, das Gesicht dieses Landstrichs zu enträtseln. Geht die Sonne über dem Dorf auf und lichten sich die Schleier über der Neide, enthüllen sie eine friedliche, geruhsame Landschaft von pastellfarbener Schönheit. Jedes Fleckchen Erde ist bebaut. Noch im kleinsten Garten sieht man, dass die Bewohner im Einklang mit der Natur und den Jahreszeiten leben. Erwärmen die ersten Frühlingsstrahlen die Gemüter, gleich steigt bei den Sonnenfurtern die gute Laune. Es zieht sie aus dem Haus, als dürsteten sie nach Licht. Stolz schreiten sie über ihre Äcker und Wiesen, nehmen eine Handvoll Erde auf und werfen sie prüfend in den Wind. Sie streifen durch die Wälder rings um den Ort, atmen tief ein und aus. Und bei Nacht hat es den Anschein, als zwinkerten die Sterne ihnen zu. Sie beginnen mit der Feldarbeit und werkeln von früh bis spät, nur alle Sonntage nicht. Sogar im Winter gönnen sie sich keine Ruhe.
Sonnenfurt ist eine Bauernnation mit einem selbstständigen, selbstbewussten Volk, schaffig, wortkarg und zurückhaltend, fest verwurzelt seit tausend Jahren, nie von fremden Horden verwüstet, kein Haus im Krieg jemals beschädigt, die Bewohner zu keiner Zeit gezwungen, andere Sitten anzunehmen, weshalb sich von Generation zu Generation eine ungestörte Tradition im Jahreslauf entwickelt hat, an der zäh festgehalten wird. Man spürt die Gelassenheit von Natur und Mensch, an die sich anpassen muss, wer hier nicht untergehen will.
Das Dorf lebt von der Landwirtschaft, der Viehzucht und dem Holzeinschlag. Der Weinbau erlosch gegen Ende des 19. Jahrhunderts, weil die Peronospora sämtliche Rebstöcke befiel. Damals gab es noch kein Mittel gegen diese Blattkrankheit. Am Mühlkanal der Neide rattert seit rund zweihundert Jahren eine Getreide- und Ölmühle, mit Wasserkraft betrieben, zu der auch ein Sägewerk gehört. Der Besitzer Gustav Bäuerle baute 1901 eine Wasserturbine in den Mühlkanal und schloss mit den Hausbesitzern Stromlieferverträge. Bei Niedrigwasser produziert ein Dampflokomobil die Elektrizität.
Auch im letzten Krieg wurde Sonnenfurt verschont. Und so blieb die überkommene Ausstattung des Dorfes bis zur Kapitulation 1945 erhalten. Zwei Gasthäuser, die Linde und das Rössle. Eine Bäckerei mit kleinem Angebot an Lebensmitteln und Obst. Und das Lädle, ein Tante-Emma-Laden für alles, was die Landbevölkerung braucht. Von und mit den Landwirten lebten ein Schmid, ein Maurer, ein Schreiner, ein Schuster und ein Viehhändler. Eine Metzgerei wurde nicht vermisst, denn die meisten Bauern schlachteten zweimal im Jahr und waren gern bereit, Fleisch und Wurst zu verkaufen. Damit war das Leben autark. Starb jemand, mussten die Angehörigen den Toten selbst einsargen und vom Bürgermeister bescheinigen lassen, dass alle Vorschriften eingehalten wurden.
*
Karl Balbach ist seit kurzem Bürgermeister. Die alten Leute nennen ihn Schulz, was so viel wie Schultheiß bedeutet. Die Amerikaner haben ihn dazu gemacht, gegen seinen Willen. Er ist ein angesehener Bauer, ein großer, muskulöser Mann mit grünen Augen, meist heiterer Miene und vielen Flausen im Kopf. Eigentlich wollte er gar nicht ackern, sähen, ernten, melken, misten und sich rund um die Uhr schinden, ohne einen freien Tag in der Woche, im Monat, im Jahr. Viel lieber wäre er auf die höhere Schule gegangen, wie sein Lehrer vorgeschlagen hatte. Als er das beim Vespern am Abend seinem Vater erzählte, lachte der bloß und meinte: »Auf einen Pädagogenfurz kann man kein Haus bauen.« Damit war die Sache ein für alle Mal vom Tisch. Widerstand duldete sein Vater nicht. Auch den Zweitwunsch vermasselte er ihm. Allerdings ungewollt. Wenn schon nicht höhere Schule, dann wollte Karl wenigstens Schreiner werden, weil Werken sein liebstes Schulfach war. Und den Hof wollte er erst übernehmen, wenn er die Eltern im Ausgeding wusste. So war’s nach viel Streit und zähem Ringen abgemacht. Doch ein Vierteljahr vor Konfirmation und Schulentlassung verunglückte der Vater tödlich, erschlagen von einer Eiche beim Holzmachen im eigenen Wald.
Die Mutter drohte, flehte, weinte und überredete schließlich ihren Sohn, mit ihr zusammen den Hof weiterzuführen. Sie lockte ihn mit der Zusage, er dürfe sich eine Werkstatt einrichten und die Posaune blasen, so oft er wolle. Denn dem Vater war dieses »Gehupe«, wie er verächtlich sagte, gewaltig auf die Nerven gegangen. »Mach nicht so viel Krach!«, brüllte Bauer Balbach, kaum war der erste Ton verklungen. Darum musste Karl im Pfarrhaus üben, spielte er doch für sein Leben gern im Posaunenchor und half in der Blaskapelle aus, wenn es an Bläsern mangelte. Sommers, nach getaner Arbeit, musizierte er nun nach Vaters Tod in seinem Zimmer. Und winters, wenn ihm mehr freie Zeit blieb, verbrachte er viele Stunden in seiner Werkstatt mit Sägen, Fräsen, Hobeln, Schleifen und Schnitzen. Sogar in den Sarg der Mutter, die vor sieben Jahren an einer Blutvergiftung starb, hatte er eigenhändig Margeriten geschnitzt, die Lieblingsblumen der Verstorbenen.
*
Jetzt, Mitte Mai 1945, lebt Karl Balbach mit Elfriede, einziger Tochter des hiesigen Bäckermeisters, und den Kindern Hans und Sophie mitten in Sonnenfurt. Jedem, der die Hauptstraße auch nur einigermaßen kennt, wird das zweigeschossige, über hundert Jahre alte Haus auf der rechten Seite schon aufgefallen sein. Es hat eine vornehme Fassade, die Wände weiß verputzt, alle Fenster und die Haustüre mit gelblichem Sandstein umrahmt, der mit Bänder- und Blumenmotiven reich ziseliert ist.
Das Familienleben der Balbachs spielt sich, wie im Dorf üblich, meist in der Küche ab. Auf den Fensterbänken werden frostempfindliche Setzlinge fürs Freibeet aufgepäppelt. Der kleine Hans sitzt gern auf dem karmesinrot gefliesten Boden und bestaunt den Sparherd, an dem schon die Urgroßmutter gestanden hat. Der Herd ist weiß emailliert und wird heiß, sehr heiß, wenn die Mutter kocht. Darum darf sich Hans nur bis zum weißen Strich auf dem Fußboden nähern. Mutter und Vater haben es ihm eingeschärft, unter Androhung von Strafen wie großes Aua, Fingerchen verbrühen und lange im Bett liegen müssen. Bisher hat Hans seine Finger gerettet, weil er die Hände auf dem Rücken verschränkt, wenn er zuschaut, wie Holzscheite und Briketts im Herd verschwinden. Tabu sind für ihn auch die drei Griffe am Herd. Einer für den Backofen, der zweite für den Kasten mit heißem Wasser und der dritte für den Wärmeschrank.
Rechts daneben steht noch ein Herd, auch er mit einem weißen Strich zur Verbotszone erklärt. Die Großmutter wollte ihn, weil er so praktisch ist. Darauf bereitete sie die kleinen, schnellen Gerichte zu. Die Mutter hat Hans das ulkige Wort, das auf der Herdklappe steht, langsam und deutlich vorgelesen: Graetzor.
Auch der Graetzor ist weiß, hat vier lange Beine und frisst weder Holz noch Kohle, sondern braucht elektrischen Strom. Hans stellt sich winzig kleine Männchen vor, die in der dicken, bräunlichen Schnur hin und her flitzen.
Auf einem Hängeregal hoch über dem Graetzor hockt ein rundes, schwarzes Ding, die Brat- und Backröhre. Sie heißt Siemens und hat auch eine solche Schnur und keine Klappe fürs Brennmaterial.
Der marmorierte Spültisch ist Elfriede Balbachs ganzer Stolz. Den hat sie sich von ihrem Vater zur Hochzeit gewünscht. Bäckermeister Otto Hölzle hat sich nicht lumpen lassen. Das beste und teuerste Modell hat er gekauft, eines mit einem großen Behälter über der Spüle, einem Zapfen unten dran und einem Hebel an der Seite. Pumpt man am Hebel, dann rauscht Wasser in den Behälter, zum Kochen, zum Geschirrspülen, zum Gesicht- und Händewaschen und Rasieren, denn die Häuser in Sonnenfurt haben noch kein fließendes Wasser. Neben dem Behälter hängt ein kleiner Spiegel, in den der Vater morgens mit aufgeblasenen Backen und Schaum im Gesicht schaut.
Auf der anderen Seite der Küche ist die Eckbank, davor der große Esstisch mit drei Stühlen. Hier wird gegessen, hier malt Sophie gern mit Buntstiften, hier schaut Hans Bilderbücher an, wenn die Mutter kocht oder bäckt. Gleich neben der Bank ist eine verglaste Türe. Durch die erreicht man den großen Innenhof schneller als über die breite Einfahrt links am Haus entlang. Im Hof, auf drei Seiten von Wohnhaus, Scheune und Stallungen begrenzt, auf der vierten mit einem Holzzaun, steht ein gewaltiger Nussbaum. Unter ihm plätschert ein Laufbrunnen. Das Wasser fließt in einen bemoosten steinernen Trog, von dort in den kleinen Bach, der eingedolt ist und zweihundert Meter weiter in die Neide mündet. Oder es gurgelt in den Behälter über dem Küchenherd, wenn man den Hebel betätigt hat. Neben dem Küchenbüffet ist noch eine Türe. Sie bleibt für Hans und Sophie bis auf Weiteres verschlossen. Nur wenn die Mutter sie öffnet, dürfen die Kinder in die fensterlose Speisekammer spicken, in der die unverderblichen Lebensmittel lagern. Die verderblichen sind im tiefen, kalten Keller.
Auch die Wohnstube ist Hans und Sophie verwehrt, es sei denn, Besuch ist da, oder es gibt etwas zu feiern. Dann sitzt Hans mit größtem Vergnügen neben seiner Schwester auf dem breiten Sofa in der guten Stube und schaut sich alles genau an. Die Fenster, an den übrigen Tagen des Jahres hinter dicken Vorhängen verborgen, spiegeln sich auf dem blitzblank gebohnerten Dielenboden. Die dunkle Holzdecke, die beiden sepiabraunen Landschaftsbilder an der Wand, das gewaltige Büffet, die große Standuhr mit dem goldenen Pendel hinter der Glasscheibe, der Ohrlehnsessel, der dem Vater vorbehalten ist, und das Tischchen neben dem Sessel mit rosa Lampenschirm auf vergoldetem Fuß – das alles imponiert den Kindern, verleiht es dem Raum doch etwas Geheimnisvolles. Und überall Zierdeckchen, geklöppelt oder gehäkelt. Sie anzufassen, ist ihnen verboten. Hans betrachtet gern den Kachelofen neben sich, auf dem Pferde und Kühe, Schafe, Gänse und Hühner modelliert sind, während Sophie sich ein reich besticktes Kissen auf den Schoß legt und die Fleißarbeit ihrer Mutter bewundert.
An Mutters oder Vaters Hand darf Hans in den oberen Stock hinaufsteigen. Allein hinaufkrabbeln oder hinunterrutschen hat ihm die Mutter streng untersagt, ist er doch erst neulich die ganze Treppe hinabgepurzelt. Zum Glück hat der rosa Läufer, der auf jeder Stufe mit einer Messingstange befestigt ist, den Sturz etwas gemildert. Dort oben, neben dem elterlichen Schlafzimmer, ist sein Zimmer, das er sich mit Sophie teilt. Wenn sie in die Schule kommt, soll sie in die leere Kammer umziehen, in der früher die Großmutter schlief und die jetzt leer steht. Neben dem Zimmer der Kinder ist ein kleiner Raum, spärlich möbliert mit halbhohem Schränkchen, Waschschüssel und gusseiserner Badewanne. Und gleich daneben, welch ein Luxus, ist eine zweite Toilette im Haus, die man hier Abtritt nennt, auch sie mit Spülung aus der weiß emaillierten Kanne.
*
Der kleine Hans sitzt am liebsten auf der obersten Stufe der Haustreppe, beobachtet aufmerksam, was auf der Hauptstraße und in der Nachbarschaft vor sich geht, und lacht. Frohsinn und Lebensfreude stehen ihm ins Gesicht geschrieben. Den Leuten, die vorübergehen, gefällt es, dass dieser kleine Junge ihnen zuwinkt und so froh und munter ist. Manche bleiben sogar stehen und fragen ihn aus. Ob der Vater auf dem Feld, in der Werkstatt oder im Rathaus ist. Was die Mutter in der Küche kocht oder bäckt. Und ob ihm vom vielen Schauen nicht langweilig wird.
Leider hat sein Vater seit ein paar Wochen nicht mehr so viel Zeit, weil er oft im Rathaus amten muss. Deshalb sagt er häufig, wenn seine Frau ihn um etwas bittet: »Keine Zeit!« Hans hat sich das gemerkt. Und wenn nun jemand mal wieder stehen bleibt, den er partout nicht mag, dann sagt auch er: »Keine Zeit! Keine Zeit!«
Auf der anderen Straßenseite spielt sich selten Interessantes ab. Dort wohnt Wilhelm Wagner, der reichste Bauer im Ort. Er ist schon über siebzig und nicht mehr so umtriebig. Lieber sitzt er im Wirtshaus und kommentiert die hohe Politik und alles, was im Dorf geschieht. Hört er etwas, das ihm gegen den Strich geht, wirft er die Hände in die Luft und empört sich: »Es ist zum Haareraufen!« Dabei glänzt sein blanker Schädel wie ein polierter Kürbis.
Seine Tochter Paula, eine mittelgroße Frau mit fein geschnittenen Gesichtszügen, kennt Hans natürlich, auch wenn sie sich selten auf der Straße blicken lässt. Sie rennt nicht durchs Dorf, tratscht nicht herum, nein, sie sitzt lieber in der Küche und liest. Hans hat es selbst gesehen. Ihre Handschrift sei wie gemalt und zeuge von guter Bildung, hat die Mama neulich gesagt. Sieht Paula den kleinen Hans vor seinem Haus sitzen, geht sie zu ihm hin, hält ein kleines Schwätzchen oder schenkt ihm etwas. Mal ein paar Bonbons, mal eine Handvoll Walnusskerne, zuweilen sogar eine Kreide, wie sie die Lehrer in der Schule haben, oder einen Buntstift. Hans mag Paula, und Paula mag Hans.
Der alte Wagner und seine Paula bewohnen ein zweistöckiges Haus, bis zur ersten Geschossdecke aus Sandsteinen gemauert, darüber aus Backsteinen, verputzt und grün gestrichen. Haus, Scheune und Stallungen umschließen ein Viereck, in dessen einer Ecke ein Backhäuschen steht, überragt von einem mächtigen Kastanienbaum. Vor dem Krieg hatte Wagner Knechte und Mägde, jetzt lebt er mit seiner Tochter in dem großen Haus allein. Neulich durfte Hans an Paulas Hand auf den Dachboden hinaufsteigen und sich aus einer Truhe Bilderbücher aussuchen, die Paula in ihrer Kindheit genossen hatte.
Schaut Hans nach links, dann blickt er zur wundersamsten Schaubühne, die jahrhundertelang Kirchplatz und dann, zwölf Jahre lang, Adolf-Hitler-Platz hieß. Dort spielt sich oft etwas ab, das es zu bestaunen gilt. Mal wird Fangerles von Mädchen aufgeführt, mal Töpfelschlagen von den Buben. Wenn die Kreisel surren, hält Hans es nicht mehr. Er rennt los, verfolgt von Sophie, die ihren kleinen Bruder bewacht wie ein Hütehund. Hans geht in die Hocke, klatscht vor Freude in die Hände und beobachtet ganz genau. Es ist noch gar nicht so lange her, da wackelte er auf seinen kurzen Beinchen den Kreiseln hinterher, wie den Hühnern, Enten und Tauben auch, bis ihm die Mutter klar gemacht hat, dass die anderen Kinder das gar nicht mögen.
Inzwischen weiß Hans ganz genau, wie man den Kreisel zum Schnurren bringt. Man wickelt die Peitschenschnur um den Kreisel, zieht kräftig und ruckartig die Schnur weg, und schon surrt er. Damit er nicht umfällt, muss man ihn mit wohl dosierten Peitschenhieben in Schwung halten. Hans beneidet die großen Buben, die den gedrechselten Töpfel, wie dieser Holzkreisel in Sonnenfurt heißt, gekonnt über den ganzen Platz treiben und auf einem vorher vereinbarten Punkt austrudeln lassen. Die besten Töpfel, das weiß sogar Hans, haben eine Spitze aus Eisen und tanzen besonders schnell und lang.
Nach einem Weilchen setzt sich Hans wieder auf seine Haustreppe und schaut die Hauptstraße hinauf und hinunter. Vor ihm scharren sich Wagners Hühner in den Sand am Straßenrand ein und dösen vor sich hin. Oder ein Fuhrwerk rumpelt über die Neidebrücke und zuckelt an Hans vorbei die Straße hinauf. Oder der einarmige Dorfbüttel hat eine Besorgung zu machen, bleibt vor Hans stehen und plaudert mit ihm. Mitunter schlurft ein altes Mütterchen in die Kirche, die, wie viele Häuser im Dorf, ganz aus Sandsteinen errichtet wurde. Manchmal bimmelt jemand am zweigeschossigen Pfarrhaus. Gleich steht Pfarrer Krüger unter der Haustür und bittet den Gast herein. Immer wieder verschwindet irgendwer im Rathaus und kommt nach einer Weile wieder heraus, mal fidel, mal mürrisch. Gegen Abend, noch bevor Hans ins Bett muss, schlendern junge und alte Männer, den Hut ins Gesicht gedrückt oder keck ins Genick geschoben, zum Gasthaus Linde, das, von der ausladenden Sommerlinde halb verdeckt, den Dorfplatz zu Wagners Gehöft hin begrenzt. Und früh morgens, Hans hat längst ausgeschlafen, liefern Bauersleute unter Aufsicht des Molkereiwärters ihre Zwanzig-Liter-Milchkannen am Milchhäuschen ab und halten nebenher ein Schwätzchen. Der Molkereiwärter, ein Kleinbauer aus dem Ziegelgässle, den die Sonnenfurter nur den Molker nennen, wiegt die Milch, schreibt sie dem betreffenden Bauern gut und wartet, bis der Milchwagen eintrifft. Dann lädt er zusammen mit dem Kutscher die schweren Kannen auf den Wagen, den Pferde zur Molke in Öschelhain ziehen. Samstags entrahmt der Molker die angelieferte Vollmilch sofort und gibt die Magermilch gleich zurück. Wenig später kommt ein dreirädriges Lieferwägelchen und bringt den Rahm zum Butterwerk in die Kreisstadt.
*
Montagabend. Hans sitzt auf dem Fensterbrett des elterlichen Schlafzimmers im ersten Stock. Wenn er will, dann spricht er schöne, lange Sätze. Heute jedoch kaspert er herum und plappert unverständliches Zeug.
»Magst einen Keks?«, fragt die Mutter und hält ihren Sohn fest, damit er nicht herunterfällt.
Hans liebt Kekse. Besonders Haferkekse, denn die backt Opa Hölzle. Das Wort »Großvater« hat sich der Opa verbeten, weil er es nicht leiden kann. Und beim mundartlichen »Ehne« geht er in die Luft, weil er seinen eigenen Großvater so nennen musste, obwohl der ein arger Hallodri und Tunichtgut gewesen sei und für seine Enkel nichts übrig gehabt habe. »Opa« und »Oma«, hatte der Hölzle eines Tages Tochter und Schwiegersohn belehrt, das klinge gut und sei kurz und damit von kleinen Kindern schnell zu erlernen.
Opa Hölzle hat eine innere Uhr. Sie weckt ihn jeden Werktag um Viertel nach zwei. Leise wälzt sich der Sechzigjährige aus dem Bett, damit seine Frau nicht aufwacht, kocht Kaffee in der Küche und trinkt zwei Tassen im Stehen, heimlich. Niemand im Ort soll wissen, dass die Hölzles noch echten Bohnenkaffee haben.
Frisch gestärkt steigt Otto Hölzle hinunter in seine Backstube im Untergeschoss, heizt den Backofen ein und verarbeitet den Teig, den er tags zuvor angesetzt hat. Dazu singt er: »Der Teig ist aufgegangen …« Irgendwann wird er das Lied zu Ende dichten, irgendwann, doch bis dahin summt er die fehlenden Zeilen nach der Melodie »Der Mond ist aufgegangen«.
Der Hölzle-Bäck, wie ihn die Sonnenfurter nennen, knetet den Teig, portioniert ihn zu Brotlaiben, schiebt ihn in den Ofen, formt Brezeln und Brötchen und stellt sie beiseite. Kaum ist das Brot knusprig gebacken, schon entfalten sich die Brezeln und Brötchen in der Glut. Sind auch sie knackig und resch, tüftelt er mittwochs und samstags, so er noch Mehl hat, Kuchen und süße Stückchen aus den wenigen Zutaten, die ihm verblieben sind. Vor allem Schneckennudeln, Apfeltaschen, Mohn- und Streuselgebäck.
Um sechs schließt seine Frau die Bäckerei auf, an die ein kleiner Lebensmittelladen angebaut ist. Im Dorf nennt man die stets heitere Bäckermeisterin nur »Stöpsel«, weil sie kurz und dick ist wie ein Flaschenkorken.
Kaum ist der Laden geöffnet, gleich bildet sich eine Schlange vor dem Eckhaus an der Hauptstraße zum Schmiedgässle. Und das von Montag bis Samstag. Weil Mangel an vielem herrscht, muss man zeitig auf den Beinen sein. Backwaren und Lebensmittel gibt es nämlich nur, solange der Vorrat reicht, und ausschließlich auf Lebensmittelkarten.
Die Arbeit am Samstagmorgen lässt Bäckermeister Hölzle mit einem lieb gewordenen Ritual ausklingen. Für seine Enkelkinder Hans und Sophie backt er Haferkekse und kleine Brezelchen, die er anschließend selbst den Kindern überbringt. Die warten schon sehnsüchtig auf Opa Otto. Dann wird im Hause Balbach ausgiebig gefrühstückt, während Oma Gertrud bis ein Uhr im Laden ausharren muss. An und für sich könnte sie ihr Geschäft schon um neun zusperren, denn bis dahin ist alles, was man auf Lebensmittelmarken kriegen kann, längst ausverkauft. Aber manchmal will jemand etwas, das nicht rationiert ist. Schnürsenkel zum Beispiel, oder Schuhcreme, Nähnadeln, Stopf- und Häkelgarn und Wolle. Oder jemand holt seine Arznei ab, die der Apotheker hier deponiert. Oder Kinder stürmen den Laden, weil er für sie das Paradies ist, gibt es hier doch allerlei Schleckereien: Himbeerbonbons, Lakritzschnecken, Brausestangen oder Pulverbrause im Tütchen, wahlweise Himbeer-, Waldmeister- oder Zitronengeschmack.
Also sitzt Oma Gertrud in ihrer geblümten Kittelschürze auf einem Holzstuhl und wartet auf große und kleine Kundschaft. Nebenher klebt sie mit der nach Mandeln duftenden Paste die abgeschnittenen Lebensmittelmarken auf Zeitungspapier, das sie als Nachweis beim Landratsamt abliefern muss. Dort wird genau kontrolliert, ob die Zahl der Marken mit den zugeteilten Warenmengen übereinstimmt. Ist die Klebearbeit fertig, flickt die fleißige Bäckersfrau ihre Wäsche, bestickt Sofakissen oder häkelt Tischdeckchen. »Fehlt bloß noch, dass du für den Klodeckel auch einen Überzieher häkelst«, lästerte neulich ihr Otto.
Eigentlich hatte Doktor Waller die Idee mit den Haferkeksen, gebacken aus grobem Hafermehl, etwas Honig, damit der Teig nicht so bröckelig ist, und fein gemahlenem Anis. Hans leidet immer mal wieder unter Blähungen, weshalb Waller auch Körnlestee verordnet hat, wie man in Sonnenfurt sagt, eine Mischung aus Anis, Fenchel und Kümmel.
Der alte Landarzt hat seine Praxis in der Kreisstadt. Doch zweimal in der Woche macht er Hausbesuche, auch und gerade in den Dörfern ringsum. Knattert er auf seiner klapprigen Horex über die steinerne Neidebrücke, weiß jeder in Sonnenfurt, gleich ist der Doktor da. Wer dringend ein Rezept braucht, aber keine Zeit für einen Arztbesuch hat, der rennt auf die Straße und passt die stinkende und dröhnende Höllenmaschine ab. Die Bremsen quietschen, die Reifen knautschen, und schon hört Doktor Georg Waller zu, zieht vielleicht ein Stethoskop, womöglich einen Blutdruckmesser aus der Innentasche seiner Lederjacke, ohne vom tuckernden Zweirad abzusteigen oder gar die Motorradbrille abzunehmen, lässt den Bittsteller die Zunge herausstrecken, zweimal tief ein- und ausatmen und füllt das Rezept auf dem Tank seiner Maschine aus. Das nimmt er gleich mit und bringt es dem Apotheker, der direkt neben seiner Praxis in Öschelhain residiert. Dafür packt man dem Doktor mal ein paar Eier, mal einen Hefezopf, mal eine Wurst oder ein Stück Fleisch in seine Packtaschen. So erspart sich der Patient den weiten Weg in die Praxis, und der Doktor füllt seine Speisekammer, was in Notzeiten wichtiger ist als ein sattes Plus auf dem Konto bei der Bank.
Am nächsten Abend rumpelt der Apotheker in seinem alten DKW mit Holzvergaser durchs Dorf und bringt den reichen Bauern die Medikamente. Auch er nimmt lieber Naturalien als Geld. Und wenn er schon einmal da ist, wirft er noch einen kurzen Blick in den Stall, kennt er sich doch mit den wichtigsten Tierkrankheiten aus und hat meist ein passendes Präparat dabei. Die Arzneimittel für die Habenichtse liefert er in der Bäckerei ab, wo man sie abholen kann. Dafür besorgt der Apotheker, eine Hand wäscht die andere, dem Hölzle allerlei Backzutaten, die kaum noch zu haben sind.
*
Hans und Sophie rekeln sich auf dem Bett ihrer Eltern. Während Sophie mit Buntstiften malt, schaut Hans ein Bilderbuch an. Interessiert betrachtet er einen Löwen.
»Mag der Löwe auch Kekse?«, fragt er seine Mutter.
Sophie lacht.
»Nein«, sagt die Mutter.
»Warum?«
»Weil er Fleisch frisst.«
»Warum?«
»Weil er Hunger hat.«
»Warum keine Brezelchen von Opa Otto?«
Sophie kringelt sich vor Lachen. »Der ist aber dumm!«
Die Mutter überhört Sophies Einwurf. »Weil Opa Otto nur für die Menschen Brezelchen backt und am liebsten für Sophie und für dich.«
»Warum nicht für Löwen?«
»Weil er nicht genug Mehl hat.«
»Warum hat er nicht genug Mehl?«
»Weil nicht genug Getreide gewachsen ist. Du weißt doch, dass das Getreide zu Mehl gemahlen wird.«
Hans legt das Bilderbuch zur Seite, erbettelt sich noch einen von Opas Keksen und will wieder aufs Fensterbrett.
Zufrieden knabbert er seinen Keks und betrachtet interessiert, was drunten auf der Straße und auf dem großen Platz vor der Kirche passiert.
Eben hat er seinen Vater entdeckt. »Papa! Papa!« Er klopft an die Scheibe und winkt.
Karl Balbach steht auf der Hauptstraße, hört das Klopfen, blickt suchend an seinem Haus hinauf und lacht seinem Jüngsten zu.
Elfriede Balbach, dreißig, brünette und schlank, muss ihren Sohn mit beiden Händen festhalten, sonst fällt er vom Fensterbrett.
»Was macht Papa?«
»Papa schreibt auf, wer Flüchtlinge aufnehmen muss.«
»Was ist das?«
»Flüchtlinge sind arme Menschen, die von zuhause fliehen mussten und jetzt nicht wissen, wo sie schlafen können.«
»Auch Kinder, Mama?«
»Ganz bestimmt.«
»Warum?«
»Weil Krieg war.«
»Warum?«
»Ach Kind …«
»Was ist Krieg, Mama?«
»Wenn du größer bist, mein Schatz, erkläre ich es dir.«
*
Elfriede Balbach ist jeden Tag von Herzen froh, dass der Krieg ihr Dorf verschont hat. Sie bewundert immer noch den Mut ihres Mannes, der Mitte April an der Seite von Pfarrer Krüger, eine weiße Fahne schwenkend, den anrückenden Amerikanern entgegen gegangen war. Die fremden Soldaten lagen angriffsbereit im Buchenwäldle oberhalb des Dorfes in Deckung. Ein amerikanischer Offizier trat ihnen in den Weg, den Revolver auf die beiden Zivilisten gerichtet. Pfarrer Krüger bat ihn auf Englisch, er möge Sonnenfurt schonen. Das Dorf werde sich kampflos der US-Armee ergeben.
Daraufhin rasselte ein Panzer die Hauptstraße hinab bis zum Adolf-Hitler-Platz, der schon bald wieder Kirchplatz heißen wird, und hielt vor dem Gasthof Linde direkt unter der mächtigen Sommerlinde. Als kein Schuss fiel und immer mehr weiße Tücher aus den Fenstern flatterten, folgte ein zweiter Panzer, hinter dem drei, bis an die Zähne bewaffnete GIs gebückt Deckung suchten, die Maschinenpistolen im Anschlag.
Wieder blieb alles ruhig. Zwei Jeeps rollten ins Dorf, jeder besetzt mit vier Soldaten. Der eine hielt direkt vor dem Rathaus, der andere neben der Friedhofsmauer. Die Soldaten positionierten sich so geschickt, dass sie ganz Sonnenfurt im Blick hatten. Kurz darauf näherten sich Infanteristen. Sie machten sich sofort daran, das Dorf zu durchkämmen.
Ein Haus nach dem anderen inspizierten sie, vom Keller bis zum Dachboden, fahndeten nach Wehrmachtssoldaten, ließen Stroh- und Rübenhaufen umschichten, Bretterverschläge beseitigen und Regale zur Seite rücken. Konzentriert und trotzdem lässig taten sie ohne erkennbaren Hass ihre Pflicht, aber misstrauten allem und jedem. Und vor jedem Haus fragten sie die Bewohner: »No SS? No Nazi?« Zum Schluss schraubten sie das Schild »Adolf-Hitler-Platz« ab und rissen das Spruchband »Wer gäb dem Bauern Stolz und Ehr, wenn nicht der Adolf Hitler wär« herunter, das über die Neidebrücke gespannt war.
Balbach und Krüger kannten das Risiko, von umherstreifenden SS-Einheiten als Vaterlandsverräter gerichtet zu werden. Darum versteckten sie sich noch in derselben Nacht in einer für Nichteingeweihte unzugänglichen Kammer im Kirchturm. Balbach machte, als er das Haus verließ, seiner Frau weis, Pfarrer Krüger und er müssten mit den Amerikanern mitkommen; spätestens bei Kriegsende seien sie wieder da. Frau Krüger hingegen wusste Bescheid. Allabendlich stieg sie im Schutz der Dunkelheit durchs Flurfenster im Erdgeschoss und versorgte die beiden, die ihr Versteck erst am Tag nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht verließen.
*
Elfriede Balbach fasst ihren Hans unter den Armen, stellt ihn auf den Boden und steigt mit ihm und Sophie ins Erdgeschoss hinab.
Der Himmel ist noch hell, etwas gelb, dazu reichlich rot und, knapp eine Handbreit über dem Horizont, ein bisschen silbrig, als Mutter und Sohn auf die Straße treten. Die Schwalben kuscheln bereits in ihren Nestern unterm Dachvorsprung oder schlafen schon.
»Hustine«, sagt Hans und lacht. In der Scheune gegenüber stottert die Häckselmaschine.
»Ja, Hustenmaschine«, bestätigt die Mutter.
Man hört einen Hammerschlag, dann läuft sie wieder rund und spuckt maulgerechtes Futter für die Kühe und Pferde aus.
Wagner, reichster Bauer im Ort, kommt aus seiner Scheune und stellt sich ins Abendlicht. »’n Abend, Elfriede«, ruft er über die Straße. »Die Wasserturbine am Mühlenkanal liefert schon den achten Tag Strom. Der Bäuerle ist ein Teufelskerl. Nur wir in Sonnenfurt haben Strom, von früh morgens bis spät abends.«
»Da hast du wohl recht«, sagt Elfriede und wendet sich ihrem Mann zu.
»Jetzt hoff’ ich bloß, dass uns der Wilhelm heute Abend keinen Ärger macht.« Karl Balbach spricht leise, damit Nachbar Wagner ihn nicht hören kann.
»Du hast ihm schon zweimal ins Gewissen geredet. Mehr kannst du nicht tun.«
Balbach lacht seinen Nachbarn an. Zugleich raunt er seiner Frau zu: »Der Wilhelm ist ein Dickschädel. Ob sich der von den Amerikanern etwas befehlen lässt? Ich habe da meine Zweifel.«
*
Hildegard Krüger kniet zur selben Zeit in der Waschküche und schrubbt die grauen Steinfliesen mit Seifenlauge. In Gedanken ist sie bei ihrem Kurt, von dem sie seit Februar noch kein Lebenszeichen hat. Jeden Morgen deckt sie den Tisch auch für ihn, weil sie sich Mut machen will und hofft, ihn bald wieder in die Arme schließen zu dürfen. Jeden Abend betet sie für ihn. Jede Nacht liegt sie lange wach und bangt um ihren Sohn. Nur schwer kann sie ihre Wut auf die Nazis im Allgemeinen und Ortsgruppenleiter Diesche im Besonderen zügeln, der sich an ihrem Mann rächen wollte, der treues Mitglied der Bekennenden Kirche war und bleiben wird. Diesche hatte veranlasst, dass ihr Kurt von einer Stunde auf die andere von der Schulbank weg zur Flak musste. Sie kann es immer noch nicht fassen, wie diese Strolche in nur sechs Jahren an der Macht einen Krieg vorbereiten und in weiteren sechs Jahren die ganze Welt in Brand setzen konnten. Darum hat sie ihrem Mann zugeraten, mit der weißen Fahne den Amerikanern entgegenzugehen und um Schonung des Dorfes zu bitten. Darum ist sie Nachbar Balbach dankbar, dass er ihren Mann begleitet hat. Darum ist sie klaglos Abend für Abend aus dem Flurfenster geklettert, trotz ihrer Rückenschmerzen, hat sich im Schutz der Dunkelheit durch die Mesnertür in den Kirchturm geschlichen und die beiden Männer versorgt.
Ächzend steht sie auf. Sie ist zwar erst sechsundvierzig, aber leidet seit Monaten unter den Folgen eines Bandscheibenvorfalls. Nachdenklich stelzt sie in die Küche und setzt Wasser auf. Möglicherweise kommt auf sie und ihren Mann heute noch viel Arbeit zu. Darum will sie ihm vorher einen Kräutertee ins Büro bringen.
Beim Aufbrühen fällt ihr der amerikanische Offizier ein, der vor zwei Wochen wie aus heiterem Himmel neben ihr stand, als sie die Blumen vor dem Pfarrhaus goss. Er war in Begleitung von zwei baumlangen Militärpolizisten. Sie erschrak so, dass sie nur noch stammeln konnte: »My … my … husband … is …«
Weiter kam sie nicht, denn der blutjunge Mann lachte und stellte sich in perfektem Deutsch vor: »Ich bin Leutnant Brown. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Alles in Ordnung. Ich müsste nur etwas mit dem Herrn Pfarrer besprechen.«
»Mein Mann macht gerade einen Krankenbesuch«, murmelte sie ein wenig verlegen. »Er muss jeden Augenblick da sein. Darf ich Sie ins Pfarrbüro einladen?«
Leutnant Brown nickte, hieß seine Begleiter im Jeep warten und ließ sich in das helle Zimmer im Erdgeschoss bringen, in dem er sich suchend umsah: ein Schreibtisch, eine kleine Sitzgruppe, ein mächtiger Schrank und viele Regale voller Bücher.
Ob sie Tee servieren dürfe, fragte sie den glattrasierten Offizier mit den kurzen, braunen Haaren und den lebhaften Augen. Allerdings könne sie nur einen Kräutertee anbieten. Echter Bohnenkaffee und schwarzer Tee seien derzeit weder erhältlich, noch erschwinglich.
Leutnant Brown dankte und setzte sich in einen Sessel, während sie sich beeilte, einen Kräutertee aufzubrühen.
Als sie das Tablett ins Pfarrbüro trug, war ihr Mann schon mit dem Offizier ins Gespräch vertieft. Beim Tischdecken hörte sie, wie der Amerikaner ihrem Mann für seinen beherzten Einsatz und das unblutige Ende des Krieges in Sonnenfurt dankte.
»Sie haben großen Mut bewiesen«, lobte Leutnant Brown. »Andernorts haben Leute, die von sich aus den Krieg beenden wollten, dafür mit dem Leben bezahlt. Sie hingegen haben Ihrer Gemeinde und höchstwahrscheinlich auch unseren Soldaten viel Leid und Blutvergießen erspart. Ich danke Ihnen, Herr Pfarrer.«
Brown stand auf und schüttelte erst ihrem Mann, dann ihr feierlich die Hand.
Kaum hatte sie das Zimmer verlassen, wollte Brown alles über Sonnenfurt zur Nazizeit wissen. Auf wiederholte Nachfrage habe er einräumen müssen, berichtete ihr Mann später, dass das Dorf bis Kriegsende zerstritten war, nicht zuletzt deshalb, weil er als bekennender Christ die deutsche Politik kritisch gesehen, sich aber keine Blöße gegeben habe. Ortsgruppenleiter Diesche, ein miesepetriger Mann, habe nur darauf gelauert, ihn anzeigen zu können. Diesche sei ein scharfer Nationalsozialist gewesen, der in den Ort eingeheiratet und als Ortsfremder die Sonnenfurter drangsaliert und kujoniert habe, unterstützt von ein paar hiesigen Gesinnungsgenossen. Ein Einheimischer wäre in einer so kleinen Gemeinde mit Sicherheit vorsichtiger aufgetreten. Nach dem Einmarsch der Sowjetarmee in Berlin habe Diesche Reißaus genommen. Dabei habe er noch im Februar verkündet: »Und wenn heute der Ami hier einmarschieren sollte, wäre ich der Erste, der ihm in Uniform entgegengehen würde.« Doch als es ernst wurde, sei er nicht mehr gesehen worden. In der Nähe von Ulm habe er sich seiner Festnahme durch Selbstmord entzogen, wie er von Diesches Frau wisse. Die wohne mit vier unmündigen Kindern und ihrer Mutter hier in der Sonnenhalde. Sie wage sich allerdings kaum noch unter die Leute.
Dann fragte der Offizier nach jenem aufrechten Mann, der Krüger zu den anrückenden US-Truppen begleitet und die weiße Fahne getragen habe.
»Das war mein Nachbar über die Straße.« Krüger deutete zum Fenster hinaus. »Karl Balbach.«
»Was ist das für ein Mensch?«
»Ein schlauer Kopf, ein Bastler, ein Tüftler, ein exzellenter Handwerker und ein umsichtiger Bauer. Er tut viel für unsere Gemeinde und probiert ständig Neues aus.«
»Zum Beispiel?«
»Er hat ganz in der Nähe seines Hauses eine eingezäunte Weide mit Schutzhütte und Wasserstelle errichtet. So können sich seine Puten, Schafe, Schweine und Ziegen weitgehend selbst versorgen.«
»Kein Nazi?«
»Nein, nein, ein christlich gesinnter Mann.«
»Was wissen Sie sonst noch über ihn?«
Krüger dachte nach. »Ich glaube, er wird demnächst vierunddreißig oder fünfunddreißig. Er ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.« Krüger blickte kurz zur Decke und dann dem Offizier wieder in die Augen. »Ach ja, er spielt Posaune und dirigiert den hiesigen Posaunenchor.«
»Zuverlässig?«
»Ja.«
»Besonnen?«
»Aber ja.«
»Ich habe Ihr Ehrenwort?«
»Sie können sich darauf verlassen, Herr Leutnant, dass Karl Balbach nichts getan hat und auch künftig nichts tun wird, was gegen sein Gewissen und gegen die Interessen seiner Mitbürger verstößt.«
»Dann ist er unser Mann.«
»Wozu, Herr Leutnant, wenn ich fragen darf?«
»Wir müssen die Verwaltung wieder in Gang bringen.
Viele Menschen irren verzweifelt durchs Land. Ausgebombte, Flüchtlinge, Fremdarbeiter, auch Juden, die das Inferno überlebt haben. Die alle müssen wir unterbringen und versorgen. Das geht nicht ohne ein paar gutwillige Deutsche.«
»Und wie kann Karl Balbach dabei behilflich sein?«
»Ich will ihm das Amt des Bürgermeisters übertragen.«
»Sie wissen aber, Herr Leutnant, dass Sigismund Lange seit zwölf Jahren unser Bürgermeister ist.«
»Wir arbeiten nicht mit Nazis zusammen. Wer von 1933 bis heute ein Amt inne hatte, ob er nun Parteimitglied war oder nicht, ist für uns nicht glaubwürdig. Oder trauen Sie diesem Herrn Balbach das Amt etwa nicht zu?«
»Doch, doch! Jederzeit!«
Leutnant Brown ließ sich den Weg zu Lange beschreiben. Dann eilte er zum Jeep, gab Befehl, zur Eichwaldgasse hinaufzufahren, hieß Lange einsteigen und teilte ihm auf der kurzen Fahrt zum Rathaus mit, er sei seines Amtes enthoben.
Balbach war nicht zuhause. Seine Frau sagte dem amerikanischen Offizier, dass er gerade Löcher zuschaufelt, die Wildschweine hinterlassen haben, und Maulwurfshügel einebnet. Sie beschrieb ihm, wie man dorthin kommt. Der Jeep holperte über die Feldwege. Dann eröffnete Leutnant Brown dem verdutzten Landwirt in wenigen Sätzen, er wolle ihn zum Bürgermeister ernennen, und bat ihn einzusteigen.
Im Amtszimmer des Bürgermeisters musste Lange, ein feister, selbstherrlicher Mann, die Gemeindekasse und alle Schlüssel an Balbach übergeben. Auf Langes Einwand, nur er wisse in der Gemeinde Bescheid, fuhr ihm der Offizier über den Mund. Mit seinesgleichen mache die Armee kurzen Prozess. Jedes offene oder versteckte Widerwort werde umgehend bestraft. Ab sofort dürfe Lange das Rathaus nicht mehr betreten. Auch werde er sich demnächst vor Gericht verantworten müssen. Also solle er künftig besser den Mund halten.
Und so wurde Karl Balbach in Arbeitskleidung, den blauen Schurz umgebunden, von einer Sekunde auf die nächste der erste Mann in Sonnenfurt. Viele Einheimische fanden das gut, schätzten sie doch Balbach als höflichen, hilfsbereiten, lebensbejahenden Menschen.
*
Wilhelm Schubert, Tagelöhner, seit Ende des Ersten Weltkriegs zugleich Dorfbüttel in Sonnenfurt, wurde bei Verdun schwer verwundet. Im Lazarett musste man ihm den linken Arm amputieren. Trotzdem ist er nach wie vor ein treuer Anhänger des letzten deutschen Kaisers. Dass der ein Kriegstreiber gewesen sei, will er nicht gelten lassen. Zum Zeichen für Kaisertreue und Vaterlandsliebe trägt er einen Schnurrbart wie Kaiser Wilhelm. Ist er im Dienst, setzt er die amtliche blaue Mütze auf und hängt sich die Schultertasche um. Darin verwahrt er die Rathauspost, die er austragen muss, oder die neuesten Bekanntmachungen. So wie neulich.
Schubert schnappte sich die Handschelle aus Messing, zog durchs Dorf und verkündete an den vom Gemeinderat vor hundert Jahren festgelegten Plätzen, was ihm der Bürgermeister aufgetragen hatte. Breitbeinig stellte er sich hin und schellte. »Bekanntmachung!« Er schellte erneut und wartete, bis die Leute zusammenliefen. Dann wiederholte er: »Bekanntmachung!« Als es still war, räusperte er sich und las mit lauter Stimme vor: »Alle Personen im besetzten Gebiet haben unverzüglich und widerspruchslos alle Befehle und Veröffentlichungen der Militärregierung zu befolgen. Gerichte der Militärregierung werden eingesetzt, Rechtsbrecher zu verurteilen. Widerstand gegen die Besatzungstruppen wird unnachsichtig gebrochen. Strafbare Handlungen werden schärfstens geahndet. Das ist ein Befehl von General Dwight D. Eisenhower, Oberster Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte.«
Wenig später gingen Leutnant Brown und Bürgermeister Balbach, begleitet von zwei Militärpolizisten, von Haus zu Haus. Jedem im Dorf fiel sofort auf, dass Brown bemerkenswert gut Deutsch sprach, akzentfrei sogar, meinten einige. Andere wiesen darauf hin, die Familie des jüdischen Viehhändlers Braun aus dem Nachbarort sei 1937 über Nacht verschwunden. Ob da wohl ein Zusammenhang bestünde?
Brown notierte Zahl und ungefähre Größe der Räume, während Balbach sämtliche Hausbewohner auf einer Liste erfassen musste. Ein Bauer in der Langen Gasse hatte den Zugang zu einem Zimmer mit einem Kleiderschrank verstellt. Er wollte die Soldaten hinters Licht führen, doch die nahmen ihn auf Weisung von Leutnant Brown sofort fest, obwohl Balbach um Schonung bat, und brachten ihn am Abend ins Gefängnis der Kreisstadt. Wilhelm Wagner führte die Amerikaner zwar anstandslos durch sein großes Haus, vom Keller bis auf den Dachboden, aber die Weisung des Offiziers, demnächst Flüchtlinge aufzunehmen, belächelte er hochnäsig. Balbach beobachtete, dass sich der Offizier eine Notiz machte.
In den folgenden Tagen requirierten die Amerikaner Kleider und Wäsche für die bald eintreffenden Flüchtlinge und richteten im Rathaus eine Kleiderkammer ein.
Ende Mai installierten zwei GIs ein Radio in Balbachs Dienstzimmer im Rathaus, damit der Bürgermeister die Anweisungen der Amerikaner per Funk hören könne. Bevor sie wieder ihren Jeep bestiegen, hinterließen sie einen Brief, in dem Balbach angewiesen wurde, am 3. Juni um halb zwölf Uhr selbst Radio zu hören und die ganze Gemeinde eindringlich auf diesen Termin hinzuweisen.