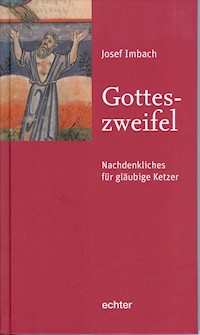Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Warum die Liebe den einen durch den Magen und anderen auf die Nerven geht? Wie aus einer Heiligen eine Hure wurde? Worüber griesgrämige Christenmenschen nachdenken sollten? Das erfährt, wer sich mit Heiligenviten und -legenden befasst. Heilige gelten als Vorbilder. Aber längst nicht alle sind nachahmenswert. So ist etwa die Grenze zwischen Glaubenseifer und Fanatismus oft fließend. Mehrere "Heilige", die sich zeitweise großer Verehrung erfreuten, haben nie existiert. Andere verdanken ihren Aufenthalt im Heiligenhimmel weniger ihrer Lebensweise als vielmehr der Legende, die für ihre Geschwätzigkeit bekannt und allemal bereit ist, Unerfreuliches zu beschönigen und zu verklären. In seiner launig-lockeren Darstellung folgt der Autor dem paulinischen Rat: "Prüft alles und behaltet das Gute!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josef Imbach
Unstimmigkeiten im Reich Gottes
KURIOSES UND KRITISCHESAUS DEM LEBEN DER HEILIGEN
Verlag Friedrich PustetRegensburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3445-3
Umschlaggestaltung: www.martinveicht.de
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2023
eISBN 978-3-7917-6249-4 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unter
www.verlag-pustet.de
Inhalt
Statt eines Vorworts ein kurzer Hinweis
Prüft alles und behaltet das Gute!
Warum das Gegenteil von Gut nicht Böse ist
Serienangefertigte Heiligenscheine
Wie Martin zur Gans und ein Bettler zu einem halben Mantel kam
Heiterkeit und Heiligkeit
Worüber griesgrämige Christenmenschen nachdenken sollten
Weil sie nicht existierten, hat man sie erfunden
Wie ein Heiliger ein Wunder verhinderte
Weidmann oder Fischer?
Wie ein Legendenklau Hubertus zum Jäger machte
Verweigerter Kinderwunsch
Wie eine Witwe trickreich ihr Recht einfordert
Der Wundertäter von Myra
Wie ein Bischof zum Weihnachtsmann mutierte
Wenn Gebet, dann Gebet – wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn
Wenn Bußprediger sich als Gesundheitsapostel betätigen
Der gute Wirt
Warum die Liebe den einen durch den Magen und anderen auf die Nerven geht
Wenn Lüstlinge lügen
Warum Keuschheit sich lohnt
Ein Gott zum Davonlaufen?
Weshalb wir uns wundern, dass ein miesepetriger Prophet als Heiliger gilt
Amore sacro und amore profano
Wie eine Heilige zur Hure wurde
Gotteslob unter der Wüstensonne
Warum Versteckenspielen für eine Sensation sorgt
Wenn der Himmel leer scheint
Was Heiligenbiografien häufig verschweigen
Eine Reise zum Mittelpunkt der Welt
Warum Liebe keine Grenzen kennt
Der Kopf der Kopflosen
Wie ein Übersetzungsfehler das Nachleben belasten kann
Die Kirchenbank
Wie man es anstellt, Gott und dem Mammon zu dienen
Von der Schädlichkeit des Gotteseifers
Wenn Intoleranz als Tugend gilt
Der Zeuge, der nicht zeugen durfte
Wie ein Zweifler sich im Glauben bewährt
Vom Küchenmeister zum Ketzerbekämpfer
Warum ein Kardinal vor dem Heiligenhimmel antichambriert
Wenn der Bischof machtlos ist
Wie heidnische Schicksalsgöttinnen im Christentum überlebten
Dank
Bildnachweis
Hinweise und Anmerkungen
Namenregister
Statt eines Vorworts ein kurzer Hinweis
Es ist ein groß Ergetzen,
sich in den Geist der Zeiten zu versetzen.
J. W. Goethe, Faust I
Kein Heiliger verkörpert die ganze Heiligkeit. Vielmehr bringt jeder nur eine wesentliche Seite zum Leuchten, weil auch er nur einen Teil von Gottes Strahlen widerspiegelt.
Walter Nigg
Die geschnitzten Heiligen haben in der Welt mehr ausgerichtet als die lebendigen.
Georg Christoph Lichtenberg
HEILIGE GELTEN ALS VORBILDER, wobei allerdings längst nicht alle von ihnen nachahmenswert sind. Zumal manche durch ihr Verhalten zeigten, wie man sich nicht verhalten sollte. Was ihre Lehren betrifft, tun wir gut daran, sie nicht unbesehen zu übernehmen, sondern ein Wort des Paulus zu beherzigen: „Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1 Thess 5,21).
Was für Lebensbeschreibungen allgemein gilt, trifft auch für Hagiografien zu; hin und wieder handelt es sich um Mogelpackungen. Nicht überall wo Tugend draufsteht, ist diese auch drin. So etwa ist die Grenze zwischen Glaubenseifer und Fanatismus oft fließend. Einzelne von Heiligen geübte Praktiken erweisen sich bei näherem Hinsehen als dubios, mitunter gar als schädlich. Was man ihnen nachsagte oder andichtete, erweist sich nicht selten eher als skurril denn als erhebend.
Mehrere ‚Heilige‘, die sich zeitweise großer Verehrung erfreuten, haben nie existiert. Andere wiederum verdanken ihren Aufenthalt im Heiligenhimmel weniger ihrer Lebensweise als vielmehr der Legende, die für ihre Geschwätzigkeit bekannt und allemal bereit ist, Unerfreuliches zu beschönigen und zu verklären.
Prüft alles und behaltet das Gute!
WARUM DAS GEGENTEIL VON GUT NICHT BÖSE IST
DASS ES AUCH ZWISCHEN HEILIGEN zuweilen zu Unstimmigkeiten kommen kann, ist schon im Neuen Testament belegt. Denken wir bloß an Petrus und Paulus, die beiden Säulen der Kirche! Der eine war ein Hitzkopf, der andere ein Eiferer. Das konnte nicht gut gehen; prompt gerieten sie aneinander. Dabei standen doch bloß Tischmanieren zur Debatte. Bekanntlich hatte Petrus keinerlei Hemmungen, in Antiochien zusammen mit den Heidenchristen zu tafeln, was eine Übertretung der jüdischen Speisegesetze beinhaltete. Später jedoch, als einige aus dem Judentum zugewanderte Christenmenschen auftauchen, die sich weiterhin mit koscherer Kost begnügten, geht Petrus zu seinen bisherigen Tischgenossen auf Distanz, damit die Neuangekommenen von seinen veränderten Essgewohnheiten nichts mitbekommen sollten. Dieses Verhalten kann ein Paulus partout nicht billigen, weshalb er Petrus glattweg als Heuchler apostrophiert (Gal 2,11–13).
Gut drei Jahrhunderte später bereitet diese Kontroverse einem Augustinus und einem Hieronymus nicht nur einiges Kopfzerbrechen, sondern auch ein paar schlaflose Nächte. Ist es überhaupt denkbar, dass die zwei Ur- und Erzheiligen Petrus und Paulus so unfreundlich miteinander umgegangen sein sollen? Dass Heilige sich gelegentlich die Haare raufen, mag ja noch angehen. Aber dass sie einander in die Haare geraten? Andererseits aber haben Lukas (in der Apostelgeschichte) und Paulus (im Galaterbrief) ebendiesen verwirrenden Tatbestand mit schwarzer Tinte auf blassgelbem Pergament festgehalten – und diese Äußerungen haben unbestritten höhere Qualität, weil sie in den heiligen vom Geist Gottes inspirierten Schriften stehen. Das steht für Hieronymus und für Augustinus außer Zweifel. Zweifelsfrei aber steht für die beiden auch fest, dass Petrus und Paulus, diese beiden Stützpfeiler der Kirche, sich nicht wie zwei verkrachte Erben überworfen haben konnten.
Diese Möglichkeit war für die beiden Kirchenväter absolut undenkbar. Das geht aus ihrem in dieser Sache geführten Briefwechsel hervor. Schließlich kamen sie überein, dass es sich nicht um eine wirkliche, sondern bloß um eine fingierte Auseinandersetzung gehandelt haben könne, gewissermaßen um eine didaktische Übung oder um eine dialektische Lektion, um den die Frage der Beschneidung diskutierenden Christenleuten den Willen Gottes vor- und sie selber zur Einsicht hinzuführen. Nach Ansicht der beiden Kirchenmänner haben Petrus und Paulus mit ihrer künstlich inszenierten Auseinandersetzung so etwas wie ein pädagogisches Gesellen- oder Meisterstück geliefert.
Meinungsunterschiede gab es unter anderem auch zwischen Franz von Assisi und Antonius von Padua. Ersterer verbot seinen Gefährten den Besitz von Büchern (die damals sehr kostbar waren), während der Paduaner (der allerdings aus Lissabon stammte) viel auf Gelehrsamkeit hielt. Später allerdings ließ sich Franziskus doch noch davon überzeugen, dass geschulte Prediger oft mehr auszurichten vermögen als seelengute Einfaltspinsel.
Manche Diener Gottes, wie Bernhard von Clairvaux oder Ignatius von Loyola, konnten sich schon deshalb nicht in die Haare geraten, weil sie entweder eine Tonsur trugen oder mit einer Glatze glänzten.
Als etwa Zehnjähriger las ich häufig in einer Heiligenlegende, dem einzigen Buch, das unsere Familie besaß und das derzeit in meinem Bücherregal noch immer ein Gnadendasein fristet: Leben der Heiligen Gottes nach den besten Quellen bearbeitet von P. Otto Bitschnau (Verlag Benziger & Co, Einsiedeln/Waldshut/Köln 1880, 998 Seiten; 6,11 Kilogramm). Dabei brachte ich in Erfahrung, dass manche Wüstenheilige der ersten Jahrhunderte sich angeblich ihr Lebtag nicht wuschen, um Gott zu gefallen. Worauf der damals nach Vollkommenheit strebende Junge spontan beschloss, sie sich zum Vorbild zu nehmen. Die diesbezüglichen Versuche wurden von den Eltern mehr oder weniger erfolgreich abgeblockt, glücklicherweise, wie ich inzwischen sagen muss.
Wie wohlgefällig die ägyptischen Wüstenväter und Wüstenmütter mit ihren unsauberen Tugenden ihren Mitmenschen waren, steht auf einem anderen Blatt. Wir tun also gut daran, nicht alles, was die Heiligen lebten und lehrten, unbesehen zu übernehmen.
Nicht wenige Einsiedler, die unter der prallen Wüstensonne schmorten, sind inzwischen vom Halbdunkel der Geschichte umhüllt. Weshalb wir uns jetzt notgedrungen einem Eremiten aus der frühen Neuzeit zuwenden, der historisch besser greifbar ist.
Die Rede ist von Julián de San Agustín (um 1553–1606), einem Seligen aus Kastilien, der sich im Alter von 18 Jahren in die Einöde begibt, um sich abzutöten. Was im Wortsinn zu verstehen ist. Wenig später nimmt er das Ordenskleid des heiligen Franz. Zweimal wird er wegen seiner religiösen Überspanntheit aus dem Orden entlassen, schließlich aber doch wieder aufgenommen. Fortan schleicht er mit Ketten an den Füßen durch die Gegend, zerschlägt sich mit Steinen die Brust, trägt während eines Vierteljahrhunderts einen schweren eisernen Bußgürtel auf der nackten Haut, legt sich beim Gebet Dornen unter die Knie, mischt sich Asche in den scheußlichen Brotbrei, mit dem er sich ernährt, und stirbt schließlich an einem seiner häufigen Schwächeanfälle, nachdem er sich zu wiederholten Malen medizinischen Untersuchungen unterzog, sodass fünf Ärzte unter Eid aussagen konnten, dass seine Bußwerke nach menschlichem Ermessen schon längst hätten zum Tod führen müssen.
Derlei Kasteiungen, wie sie auch von vielen anderen Heiligen berichtet werden, sind bestimmt nicht weniger gesundheitsschädigend als das Rauchen. Ein Fachmann unserer Zeit spricht im Hinblick auf solche masochistischen Praktiken von einem „Fall für die Psychiatrie“.1 Damit wäre eigentlich alles gesagt – wenn es nicht immer wieder vorgekommen wäre, dass man psychisch krankhaftes Verhalten von Heiligen den Gläubigen als Vorbild hingestellt und diese so ihrerseits krank gemacht hätte.
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass ein falsches Heiligkeitsideal, das nicht in der Jesusnachfolge, sondern in einer massiven Leibfeindlichkeit wurzelt, sich auch wandeln konnte. So zeigte sich ein Ignatius von Loyola (1491–1556) seinem eigenen Zeugnis zufolge von der leibverachtenden Askese der alten Väter derart beeindruckt, dass er sich nach seiner Bekehrung zunächst in grobes Sackleinen kleidete, und da er zuvor „entsprechend der Gepflogenheit jener Zeit sehr auf die Pflege des Haares bedacht war und er noch immer eine schöne Frisur hatte, beschloss er nun, es einfach wachsen zu lassen, wie es wolle, ohne es zu kämmen oder zu schneiden oder irgendwie während der Nacht oder bei Tag zu bedecken. Auch seine Nägel, für deren Pflege er früher besondere Sorgfalt aufgewandt hatte, ließ er wachsen.“2 Eines Tages jedoch, während einer Vision, „wurde sein Verstand plötzlich über sich selbst erhoben“. Da „gab er jene früher geübten Strengheiten auf, seitdem er Gottes reichen Trost einmal spürte und die Frucht sah, die er im Verkehr mit Menschen in deren Seelen erreichte. Er schnitt sich wieder die Nägel und die Haare.“ Künftig praktizierte Ignatius keine selbstzerstörerische Askese mehr, sondern betrachtete den Dienst an den Mitmenschen als die geeignetere Form der Abtötung.
Was aber, wenn Ignatius keine Einsicht gezeigt hätte? Hätte man ihn trotzdem (wie manch andere fehlgeleitete Heilige auch) zur Ehre der Altäre erhoben? Die Antwort kann nur in einer Gegenfrage bestehen: Warum nicht? Es verhält sich ja nicht so, dass nur psychisch ausgeglichene Menschen heilig werden können. Allerdings sollte man sich davor hüten, jede Marotte zu einer Tugend hochzustilisieren, bloß weil sie von einem oder einer Heiligen praktiziert wurde.
Nicht nur bezüglich der Lebensführung der Heiligen, sondern auch hinsichtlich mancher von ihnen verbreiteter Lebensregeln ist eine gewisse Vorsicht geboten, bevor man sie mit dem Prädikat vorbildlich versieht.
Die Tatsache etwa, dass sich in den Schriften des heiligen Johannes Chrysostomos (349 oder 344–407) eine ganze Menge antisemitischer Äußerungen findet, ermächtigt die Christgläubigen in keiner Weise, die Juden anzufeinden und sich dabei auf den Kirchenlehrer als Autorität zu berufen. Offenbar hatte der heilige Bischof völlig vergessen, welchem Volk Jesus entstammte, als er in seiner Kirche in Konstantinopel in acht Predigten gegen die Juden hetzte. Die Synagoge, behauptet er, sei ein Ort der Gesetzwidrigkeit und ein Bollwerk des Teufels; ihre Anhänger bezeichnet er als Schwelger und Schlemmer und habgierige Geldmenschen, die, weil untauglich zur Arbeit, nur mehr zur Schlachtung (!) geeignet seien …3 Mag der Eifer dieses Bischofs und Kirchenvaters auch vorbildlich sein, so darf man darüber doch nicht übersehen, dass seine Haltung gegenüber den Juden verabscheuenswert ist.
Dass man gut daran tut, die Unterweisungen der Heiligen kritisch zu betrachten, zeigt auch das Beispiel des Kirchenlehrers Hieronymus (347–420). Leider glaubte dieser große Theologe und Bibelübersetzer, sich auch als Pädagoge hervortun zu müssen. Aufschlussreich in dieser Hinsicht ist sein ausführlicher Brief an eine römische Dame namens Læta, die ihn anfragt, wie ein Mädchen zu erziehen sei, das die Eltern (!) für den Stand der Jungfrauen vorausbestimmt haben. Die Antwort fällt klipp und klar aus. Schon die Art, das Kind zu kleiden, muss daran erinnern, dass es Jesus versprochen ist. Nicht nur Mode, auch Musik ist verpönt, der Umgang mit Altersgenossinnen verboten. Vorbild ist Maria, die der Verkündigungsengel bekanntlich ganz allein in ihrem Kämmerlein angetroffen hat. Allein soll das Kind seine Mahlzeiten einnehmen. Während manche Seelenführer einem heranwachsenden Mädchen das Baden bloß in Gegenwart anderer Frauen verbieten, gibt sich Hieronymus in diesem Punkt kategorisch: „Ich persönlich missbillige jede Art von Bad, weil eine Jungfrau so viel Schamgefühl haben müsste, dass sie den Anblick der eigenen Nacktheit nicht erträgt.“ Als Gesellschafterin für ein solches Mädchen ist nicht die erstbeste fröhliche Dienstbotin geeignet, sondern nur eine ernsthafte Person von hässlichem Äußeren, „mit einem Schatten von Traurigkeit im Gesicht“.4
Das ist nun wahrlich dicke Post, nicht nur deshalb, weil es sich um einen sehr umfangreichen Brief handelt. Mag sein, dass hinter diesen sonderbaren Vorstellungen eine gute Absicht steckt. Aber auch nach damaligen Maßstäben muss man eine derartige Erziehungsmethode als sträflich bezeichnen.
Damit dürfte deutlich geworden sein, dass die Lebensweisen und die Lebensregeln mancher Heiliger weder mustergültig noch nachahmenswert sind.
Und dass das Gegenteil von gut nicht schlecht ist, sondern gut gemeint.
Serienangefertigte Heiligenscheine
WIE MARTIN ZUR GANS UND EIN BETTLER ZU EINEM HALBEN MANTEL KAM
SPÄTESTENS GEGEN ENDE OKTOBER, wenn Rilke wieder einmal recht behält („Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. / Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, / wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben …“) und der Herbst schon fortgeschritten ist und an die bald einmal fällige Martinsgans erinnert, läuft selbst militanten Atheisten und eingefleischten Agnostikerinnen das Wasser im Mund zusammen. Der Gänsebraten kommt zusammen mit dem noch jungen, kaum vergorenen Wein aber erst am 11. November auf den Tisch, zu Sankt Martini, wie aufrechte Christenmenschen zu sagen pflegen.
Einer Legende zufolge soll Martin einst dem norwegischen König Olav I. Tryggvason († 1000) im Traum erschienen sein und ihn aufgefordert haben, anstelle des heidnischen Gottes Odin ihn, Martin, durch Trankopfer zu ehren. Auf diese Weise erhielt ein kollektives Besäufnis, wenn es sich denn schon nicht verhindern ließ, zumindest einen christlichen Anstrich. Im österreichischen Burgenland verbreitet war der Brauch des Martinilobens, der darin bestand, am 11. November jungen Wein auszuschenken. In Köln sprach man in diesem Zusammenhang von der Martinsminne. Ausgelassene Trinkgelage am Martinsfest in weiten Teilen Europas sind schon früh dokumentiert. Bereits im 6. Jahrhundert sah sich eine im französischen Auxerre abgehaltene Synode gezwungen, die feuchtfröhlichen Exzesse der Martinijünger zu verbieten, allerdings mit mäßigem Erfolg. Aus mährischen Dörfern ist bekannt, dass noch im ausgehenden 19. Jahrhundert der neue Wein nach demjenigen benannt wurde, der am Martinitag den größten Rausch davongetragen hatte. Der hieß dann je nach Namensträger Sepplwein oder Franzlwein oder Gustlwein …
In den Dörfern, an denen am Martinsabend zu Ehren des heiligen Bischofs der Laternenumzug stattfindet (ein Brauch, der sich in vielen Gegenden erhalten hat), gehen sogar jene auf die Straße, die mit der Kirche nichts am Hut haben.
Über den Ursprung dieser Veranstaltungen gibt ein handgeschriebenes aus dem 11. Jahrhundert stammendes Missale aus dem Kloster von Monte Cassino Aufschluss. Für die Eucharistiefeier am Martinstag war damals ein Evangelientext vorgesehen, in dem es unter anderem heißt: „Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen“ (Lk 12,35). Vom Licht war auch in dem im Auftrag des Konzils von Trient erneuerten Römischen Brevier von 1568 in einer der Lesungen zum Martinsfest die Rede: „Dies ist die Lampe, die angezündet wird, die Tugend unseres Geistes und Sinnes …“
Heute weiß kaum jemand mehr, dass die Vorweihnachtszeit vorzeiten nicht mit dem ersten Adventssonntag, sondern bereits unmittelbar nach dem Martinstag begann. Dies wiederum hängt mit dem ursprünglichen Datum des Weihnachtsfestes zusammen, das anfänglich am 6. Januar, also an Epiphanie (‚Erscheinung des Herrn‘; später auch ‚Dreikönigstag‘ genannt), gefeiert wurde. Auf Weihnachten bereitete man sich mit einem vierzigtägigen Fasten vor, welches an die Zeit erinnern sollte, die Jesus vor seinem öffentlichen Auftreten in der Wüste zubrachte. Die vierzig Tage zählte man unter Auslassung der Sonnabende und der Sonntage von Epiphanie aus zurück und gelangte so zum 12. November, dem Tag nach Sankt Martini. Als man in Rom im 3. Jahrhundert die Feier des Weihnachtsfestes auf den 25. Dezember vorverlegte, verkürzte sich die lange Bußzeit ganz von selbst. Offiziell wurde die neue Fastenordnung von einer im Jahr 581 in Mâcon abgehaltenen Kirchenversammlung bestätigt – und gleichzeitig gemildert: „Vom Tag des heiligen Martin an bis Weihnachten muss [nur] am Montag, Mittwoch und Freitag gefastet werden.“ Schon damals empfanden viele diese Vorschrift als hart. Inzwischen ist sie längst nicht mehr in Kraft. Das gilt auch für manche andere mit dem 11. November verbundene Gepflogenheiten. Während der vorweihnachtlichen Fastenzeit waren im Mittelalter nicht nur lärmige Festivitäten, sondern auch sämtliche Rechtsgeschäfte untersagt. Dieses Verbot wiederum bewirkte indirekt, dass ‚Martini‘ zu einem wichtigen Zinstermin wurde und dass an diesem Tag der Gesindewechsel stattfand. Die Handwerker und Händler veranstalteten bei dieser Gelegenheit den letzten großen Jahrmarkt. Dass es dabei oft recht weinfeucht zuging, lag in der Natur der Sache. Tatsächlich fällt der Martinstag in etwa mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem der Traubensaft die Gärung erreicht. Gleichzeitig mussten die auf den Bauernhöfen gemästeten Gänse wegen des anstehenden Futtermangels geschlachtet werden. Damit ist auch das Geheimnis gelüftet, wie der heilige Martin zur Gans und die Weinbauern zu ihrem Patron kamen.
Das Gansessen am Gedenktag des Heiligen, das vielerorts noch heute zum festen Repertoire gehört, beflügelte auch die Fabulierfreude fantasievoller Prediger, die die Mär in die Welt setzten, dass sich der schüchterne Martin nach seiner Wahl zum Bischof in einem Gänsestall versteckte, um das Amt nicht annehmen zu müssen, und dann vom Schnattern der aufgeregten Tiere verraten wurde …
Dass das Gansessen am Martinstag immer schon ein bisschen ausgelassen begangen wurde, dokumentieren einige in einer Handschrift aus der Zeit um 1400 überlieferte Liedverse, die man vermutlich zum Auftakt des Gelages anstimmte:
Martin, lieber Herre, nun lass uns fröhlich sein,
heut zu deinen Ehren und durch den Willen dein.
Die Gäns’ sollst du uns mehren, und auch den kühlen Wein;
gesotten und gebraten, sie müssen all herein!
Herein kamen sie nicht nur in die Mäuler und Mägen, sondern bisweilen sogar in die Predigten. Von einem gewissen Melchior de Fabris ist überliefert, dass er gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine Martinspredigt hielt, deren Titel uns heute mehr erheitert als erbaut.
Von der Martins Gans. Ein schöne nützliche Predig / darinnen zuo sehen ein feyne außlegung deß H. Evangelij: Unnd ein hailsame anmanung / wie und was gestalt wir S. Martins Gans essen / und unser leben in ein andern gang richten sollen. / Gedruckt im Closter zuo Thierhaupten 1595.
Kann man es dem Prediger verübeln, wenn er in seiner Betrachtung den Blick der Gläubigen auf das Evangelium lenkt, ohne dabei die Gans aus dem Auge zu verlieren?
Im Zusammenhang mit dem zu Martini verzehrten Gänsebraten sind im Lauf der Zeit allerlei Spiele entstanden, so etwa das sogenannte Gansscheibenschießen, bei dem der Sieger eine ‚Martinsgans‘ gewann. Eine besondere Volksbelustigung bildet das Gansreißen (in der Schweiz spricht man von der ‚Gansabhauet‘) mancherorts noch heute. In dem am schweizerischen Sempachersee gelegenen Städtchen Sursee spannt man dazu einen Draht über den Rathausplatz, an dem eine abgestochene Gans hängt. Ein mit Maske und stumpfem Säbel ausstaffierter Kandidat (mittlerweile sind auch Frauen willkommen) muss Kopf und Rumpf der Gans mit einem einzigen Hieb trennen. Wer’s schafft, kriegt die Beute.
Der um 316 geborene Martinus wuchs als Sohn eines römischen Militärtribuns in Pannonien im heutigen Ungarn auf. Die Jugend verbrachte er in Pavia, der Heimat seines Vaters, wo er erstmals mit dem Christentum in Berührung kam. Im Alter von zehn Jahren wurde er in die Gruppe der Taufbewerber aufgenommen. Als Sohn eines römischen Offiziers war er zum Militärdienst verpflichtet. Mit 15 Jahren gehörte er zur Leibwache Kaiser Konstantins II., der in Mailand residierte. Ab 334 war Martin als Soldat der Reiterei im gallischen Amiens stationiert. Irgendwann begegnete er an einem kalten Wintertag einem frierenden Bettler. Spontan teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und gab die eine Hälfte dem Unglücklichen. 351 empfing er als 35-Jähriger die Taufe. Ein Jahrfünft danach, nachdem er sich vom Krieger zum Pazifisten gemausert hatte, wurde er aus dem Heerdienst entlassen und zog sich als Einsiedler auf die Insel Gallinara bei Genua zurück. Wieder in Gallien, errichtete er 361 in Ligugé das erste Kloster des Abendlandes. Zehn Jahre danach, als der Bischofssitz von Tours vakant wurde, wollte ihn das Volk gegen den Widerstand des Klerus zum Bischof haben. Statt in der Stadt zu residieren, wählte er als Wohnsitz eine Holzhütte vor der Stadtmauer.
Am 8. November 397 verstarb der als Mönchsvater und Missionar hochverehrte Martin im Alter von 81 Jahren. Am 11. November wurde er in Tours unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen.
Was wir über Martin wissen, verdanken wir zum größten Teil seinem Freund und Biografen Sulpicius Severus. Dessen Vita Martini jedoch unterscheidet sich nur wenig von anderen Heiligendarstellungen, mittels derer man in der Antike den Gläubigen die Heiligen schmackhaft zu machen versuchte. Viele dieser Viten, die von der Spätantike bis hinauf ins hohe Mittelalter verfasst wurden, gleichen einander fast wie eineiige Zwillinge. Die Menschen, die uns daraus entgegentreten, tragen allesamt ähnliche Züge. Die meisten von ihnen haben nichts zu lachen; das würde ihrem Ansehen schaden. Das Essen ist ihnen eine Last, Schlaf gilt als Zeitverschwendung. Wenn sie nicht gerade predigen oder ein Wunder wirken, nutzen sie ihre Zeit zum Psalmodieren und Meditieren.
Die Vita Martini des Sulpicius Severus kann geradezu als Paradebeispiel für diese Art von Erzählungen gelten. Belobigung und Bewunderung halten sich die Waage.
O wahrhaft seliger Mann, an dem kein Falsch war! Keinen hat er gerichtet, keinen verurteilt, keinem Böses mit Bösem vergolten! Ja eine solche Geduld hatte er angesichts aller ihm zugefügten Ungerechtigkeiten, dass er sich auch von den untersten Klerikern ohne Wehr beleidigen ließ. Niemand sah ihn jemals zornig, niemand aufgeregt, niemand traurig, niemand lachend; immer blieb er gleich. Himmlische Freude trug er auf seinem Gesicht; er erschien als einer außerhalb der Natur des Menschen. Niemals war in seinem Munde etwas anderes als Christus, in seinem Herzen nichts anderes als Frömmigkeit, Frieden, Barmherzigkeit.5
Vor allem eines können wir hier herauslesen, nämlich dass der Verfasser sorgfältig darauf bedacht war, seine Leserschaft am Lesen zwischen den Zeilen zu hindern. Ihm ging es nicht um Berichterstattung, sondern einzig und allein um Erbauung.
Tatsächlich bleibt der Bischof von Tours in dieser Schilderung völlig profillos. Mit den Worten des Biografen: Er ist „außerhalb der Natur des Menschen“ – eben nicht von dieser Welt. Die Darstellung ist frisiert, die Gestalt stilisiert, die Persönlichkeit idealisiert. Es handelt sich um einen typischen beziehungsweise um einen stereotypen Text, der wie ein serienmäßig fabrizierter Heiligenschein zu Aberhunderten anderen Christenmenschen passen würde, die im liturgischen Kalender ihren Platz behaupten.
Da fragt man sich spontan: Was hat der heilige Martin in seinem Herzen verspürt, als die Neidhammel unter den Klerikern ihn angifteten? Wie hat er sich verhalten, wenn ihm ein flennender Junge über den Weg lief? Was hat er beim Anblick einer schönen Frau empfunden, vor allem wenn diese ihm auch noch sympathisch erschien?
Ein lebensnaheres Profil bekommt die Gestalt dieses Heiligen, sobald wir ihn in Verbindung bringen mit den liturgischen Texten, die uns die Kirche zum Martinsfest mit auf den Weg gibt, nämlich einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja und einen Passus aus dem Matthäusevangelium. Das Jesajabuch verweist darauf, dass Gott von den Menschen erwartet, „die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind“ (Jes 61,1). Der Evangelientext hingegen ruft in Erinnerung, wo wir Jesus heute begegnen, vor allem in den Armen, den Hungernden, den Notleidenden, kurzum in all jenen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind (vgl. Mt 25,31–40).
Martin teilt seinen Mantel mit dem Bettler. Basler Münster. Im Zug des reformatorischen Bildersturms wurde der Bettler weggemeißelt, sodass Martin nicht mehr als Heiliger, sondern als gewöhnlicher Ritter erscheint
.
Und Martin? Er zeigt uns, was das konkret bedeutet, indem er den halben Mantel an einen Bettler verschenkt.
Warum nur die eine Hälfte? Weil die andere offiziell Eigentum des römischen Kaisers war, der den Offizieren die halbe Ausrüstung zur Verfügung stellte. Den Rest mussten sie selbst berappen. Martin hat demnach alles verschenkt, was ihm persönlich gehörte.
Die andere Mantelhälfte, die cappa, wie Fachleute sagen, galt lange als wunderwirksame Reliquie. Die wurde, bevor sie irgendwann zwischen dem Schlachtengetümmel des Mittelalters, den theologischen Scharmützeln um Martins Namensvetter Luther oder den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts verloren ging, in einer eigens dafür gebauten capella aufbewahrt, zu deren Betreuung man einen capellanus bestellte. Wenn der heilige Martin seinen wärmenden Überwurf nicht zweigeteilt hätte, gäbe es heute weder Kapellen noch Kapläne.
Ein trauriges Schicksal ereilte den erlauchten Heiligen zusammen mit vielen anderen mit einer Aureole geadelten Gestalten, als die Stadt Basel sich 1529 zur Reformation bekannte. Im Zug des damaligen Bildersturms wussten die Neugläubigen nichts Besseres, als die am rechten Münsterturm angebrachte Reiterstatue zu verstümmeln. Den Bettler zu seinen Füßen haben sie kurzerhand weggemeißelt, wodurch der Heilige zum kommunen Ritter degradiert wurde.
Heiterkeit und Heiligkeit
WORÜBER GRIESGRÄMIGE CHRISTENMENSCHEN NACHDENKEN SOLLTEN
ZWEI HEILIGE VOR ALLEM