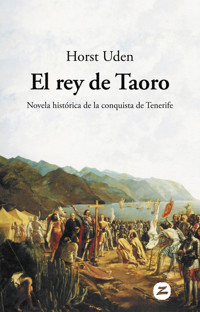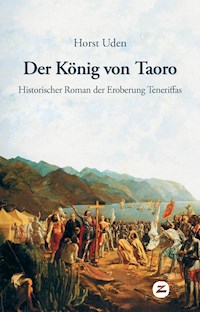Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zech Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Historische Romane und Erzählungen
- Sprache: Deutsch
Um die "Glücklichen Inseln" ranken sich zahlreiche Sagen und Legenden. Horst Uden hat den kanarischen Archipel in den 1930-er Jahren besucht und Erzählungen von allen "acht" Inseln aufgezeichnet. Er schildert Märchen und Mythen, Piratenabenteuer, Liebesgeschichten, Volksweisheiten, Anekdoten. Teneriffa, die Glückliche... Gran Canaria, die Heldenhafte... La Palma, die Grüne... La Gomera, die Legendäre... El Hierro, die Geheimnisvolle... Fuerteventura, das Aschenbrödel Lanzarote, die Sandige... San Borondón, die Geheimnisvolle... ...INSEL
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Uden
Unter dem Drachenbaum
Legenden und Überlieferungen von den Kanarischen Inseln
Über das Buch
Um die »Glücklichen Inseln« ranken sich zahlreiche Sagen und Legenden, Überlieferungen aus der Zeit der Guanchen, Geschichten über die spanische Eroberung, Piratenabenteuer, Volksweisheiten, Anekdoten, Märchen und Mythen. Horst Uden hat den kanarischen Archipel in den 1930er Jahren besucht und Erzählungen von allen Inseln aufgezeichnet.
Der Autor
Eugen Kuthe (Pseud. Horst Uden) wurde 1898 in Schlesien geboren, er starb 1973 in Spanien. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wanderte er nach Andalusien aus, gründete Familie in Málaga und reiste von hier aus in zahlreiche Länder Lateinamerikas. Er arbeitete als Buchhalter, Hoteldirektor und Übersetzer, schrieb Abenteuerromane, Reiseberichte, Theaterstücke. Das hier vorliegende Buch »Unter dem Drachenbaum« entstand nach einem Besuch auf den Kanarischen Inseln in den 1930er Jahren, zusammen mit dem historischen Roman »Der König von Taoro«.
Plan des kanarischen Archipels und Reiseweg des Verfassers
»Nur noch der Ozean bleibt uns,
der die sel‘gen Gefilde umspület.
Lasset die Segel uns hissen,
die herrlichen Inseln zu schauen...«
Die Ursage
In dem wilden, zerklüfteten Randgebirge, das das Land Iberia wie ein unübersteigbarer Wall nach Norden abschloß, lebte die Nymphe Pyrene als Hüterin der Heiligen Quelle, die silbern aus hohem Felsen in den kleinen, waldumstandenen Weiher sprudelte, auf dem weißgelbe Seerosen ihre stolzen Häupter wiegten. Vor sich hinträumend lag sie am Uferrand und spiegelte ihren schneeigen Körper in der leise zitternden Flut. Buntfarbige Schmetterlinge umgaukelten sie wie eine Blume, ein Falter setzte sich mit ausgebreiteten Flügeln auf ihren Arm: lebender, blaugoldschimmernder Schmuck, wie ihn nur Götter trugen. Hie und da unterbrach der ferne Lockruf eines Vogels das gleichmäßige Plätschern des Wassers und das leise Rauschen windgeregter Erlen. Arkadischer Friede schien in dem Waldtal zu herrschen, das Zeus der Nymphe Pyrene als Wohnstätte zugeeignet. Und doch war dem nicht so.
Hoch oben in den geräumigen Höhlen der himmelstürmenden Schroffen trieben die wilden Giganten ihr Unwesen, spielten Fangball mit windzerrissenen Gewitterwolken, rollten mächtige Steinblöcke über die schrägen Felshalden und lebten in stetem Kampf untereinander. Ihr Brüllen klang wie das Rollen des Donners, und ihre Schreie glichen pfeifendem Sturm, der heulend durch abgründige Schluchten fegte. Nichts war ihnen verhaßter als friedliche Stille und träumerische Einsamkeit, wie sie im stillen Waldtal herrschten, wo die liebliche Quelle der Nymphe Pyrene silberhell in den grünen Weiher sprang.
Immer wieder hatten sie versucht, das stille Tal zu verwüsten und zu ihrem Tummelplatz zu machen, immer wieder vergebens. Riesige Felsen rollten sie herab, doch der Wald fing sie mit seinen mächtigen Armen auf, und so sehr sie sich auch gegen die Bäume stemmten, ihre Füße verfingen sich im Dickicht, Dornen zerkratzten ihnen Gesicht und Hände, stachliges Gestrüpp versperrte ihnen Weg und Steg. Wütend ließen sie ab von dem nutzlosen Kampf und fuhren hinauf zu den Höhen, Rats zu pflegen.
Ein züngelnder Blitz zeigte ihnen, wie sie ihren grimmigen Feind, den Wald, vernichten konnten. Mit mächtigen Fäusten griffen sie hinein in die geballten Wolken, fingen den feurigen Strahl und schleuderten ihn unter gellendem Hohngeschrei in die Tiefe. Krachend fuhr er in die Kronen der knorrigen Korkeichen. Flammen schlugen aus dem Gestrüpp, dunkler Qualm hüllte das Tal in nachtschwarze Finsternis.
Doch schon nahte der Rächer, den Zeus gesandt, die ungeschlachten Giganten zu vertilgen und Pyrene zu retten. Herakles war es, der Liebling der Götter, der abenteuersuchend an der Küste Iberias gelandet, Rast von weiter Reise im Hochgebirge hielt.
Von dem Toben der Giganten erwachte er aus seinem Schlummer. Mit mächtigen Sätzen stürmte er hinauf auf die höchste Schroffe, Umschau zu halten, welch neue Heldentat seinen Ruhm noch vergrößern konnte.
Da hatten ihn die Giganten auch schon erblickt und als Todfeind erkannt. Von allen Seiten versuchten sie, die Höhe zu erklimmen, den Göttersohn in den Abgrund zu stürzen. Doch pfeifend wirbelte seine Keule auf ihre Köpfe nieder, zerschmetterte die um Felsen geklammerten Arme der Riesen. Dem letzten, dem es gelungen war, sich hinaufzuschwingen, brach Herakles das Rückgrat. Dumpf zerschellte der Körper des Unholds in der Tiefe.
Erschlagen lagen die Giganten auf der Felshalde, doch unentwegt wütete der lohende Feuerbrand im Tal des Friedens. Da klang wie heller Glockenton ein Ruf an das Ohr des strahlenden Siegers. Lauschend beugte er sein Haupt über den steilen Altan. Nun hörte er ihn wieder... schwächer... verzweifelter...
Wie ein Sturmwind sprang er hinab und schlug mit der Keule eine breite Gasse durch das Gewirr der brennenden Bäume, zertrat das glimmende Unterholz und gelangte bald zur heiligen Quelle Pyrenes.
Am Ufer des Sees, vom beizenden Qualm halb erstickt, lag die Nymphe. Schnell hob er sie auf und trug sie in rasendem Lauf durch züngelnde Flammen auf die rettende Halde, wo er die Ohnmächtige behutsam unter einem schützenden Felsen bettete. Sinnend betrachtete er ihre herrliche Gestalt, und auf einmal erschienen ihm all seine ruhmreichen Abenteuer schal und fade gegen ein geruhsames Leben an der Seite dieser traumschönen Göttin. Und wieder hob er sie auf und trug sie hinab ans Gestade, sie als Gemahlin in seine Heimat zu führen.
Doch die Nymphe bat ihren Retter flehentlich, sie zurückkehren zu lassen zu der Heiligen Quelle, die ihre Welt war, und Herakles ließ sie schweren Herzens ziehen. Doch heimlich folgte er ihr von weitem, da er sich von ihrem Anblick nicht trennen konnte.
Schmerzlich bewegt, den Kopf zur Erde geneigt, schritt Pyrene über verkohlte Äste und gefällte Bäume dem kleinen Weiher zu, der jetzt wie eine schmutzige Pfütze zum Himmel starrte. Statt der stolzen Seerosen trieb versengtes Holz auf der rußigen Flut, kein Schmetterling umgaukelte mehr seine Ufer, kein flötender Lockruf eines fernen Vogels drang mehr an ihr Ohr. Nicht die friedliche Stille der Einsamkeit war es, die sie wiederfand, sondern die unheimliche Stille eines ausgebrannten Trümmerfeldes.
Noch einmal hob sie den Kopf und blickte traurig über die verwüstete Stätte ihrer träumerischen Jugend. Dann stürzte sie tot neben dem Weiher zu Boden.
Hier fand sie Herakles. Tränen rannen über das Antlitz des Helden, als er den Körper der Geliebten hinauftrug auf die höchste Schroffe, wo er ihre Feinde, die Giganten, besiegt. Dort errichtete er der Toten in vierzig Tagen und vierzig Nächten ein gewaltiges Mausoleum, dessen Spitze bis in die Wolken ragte und das er Pyrenaia nannte. Nach ihm heißt bis auf den heutigen Tag der ganze Gebirgszug die Pyrenäen.
Viele Monde hatte Herakles die geliebte Göttin beweint, als er gen Süden aufbrach und neuen Abenteuern entgegenzog. So gelangte er nach langer Wanderung zum Berge Calpe, der Iberia mit dem Land der Atlanten verband. Von seiner Spitze gewahrte er zum erstenmal den Ozeanus, der wie ein breiter Gürtel um die Erde lief, und den nur der Berg, auf dem er stand, von dem Meer seiner Heimat trennte.
Zu seinen Füßen, am Gestade von Iberia, lag die Burg Gades, die der dreiköpfige Riese Gerion erbaut hatte, vor dem ihn die Göttin Athene gewarnt. Doch unbekümmert stieg Herakles hinunter, den Burgherrn mit eigenen Augen zu schauen.
Bereitwillig ließ ihn Gerion in die Mauern von Gades ein. Die Kunde vom Siege des Helden über die wilden Giganten hatte den Riesen erschreckt, und er fürchtete sich, Herakles die Gastfreundschaft zu verweigern. Doch heimtückisch, wie er war, sann er auf eine List, den Göttersohn zu verderben. Wozu hatte er drei Köpfe? Mit dreien konnte man mehr denken als mit einem. Er kannte die Abenteuerlust seines Gastfreundes, und so begann er, ihm von den Hesperiden zu erzählen.
Gea, die Göttin der Erde und der Fruchtbarkeit, hatte Hera zur Hochzeit mit Zeus zwölf goldene Äpfel geschenkt, die geheime Kräfte verliehen. Wer von ihnen aß, wurde unsterblich und ewige Jugend war ihm beschieden. Mitten im Land der Atlanten stand der blühende Baum, den die Hesperiden, die sieben goldlockigen Töchter des Atlas und der Hesperis, behüteten. Doch listig verschwieg ihm Gerion, daß ihnen der hundertköpfige Drache Ladón zum Schutze beigegeben war.
Kaum hatte Herakles von den geheimnisvollen Früchten vernommen, als es ihn zum Aufbruch drängte. Froh entließ ihn der Riese aus dem quadersteingefügten Burgtor, das er fest hinter ihm verschloß, nachdem er ihm den Weg über den Berg Calpe ins Reich der Atlanten gewiesen...
Als die Sonne zum fünften Male über die Erdscheibe stieg, beleuchteten ihre Strahlen die goldenen Äpfel der Hera, die funkelnd in dem grünen Laub der gewölbten Baumkrone lockten, in deren Schatten die blauäugigen Hesperiden lagerten. Ihr lieblicher Gesang ließ Herakles anhalten und verzückt der göttlichen Melodie lauschen.
So gebannt war er von den zauberhaften Tönen, daß er nicht bemerkte, wie der Drache Ladón aus seiner hinter Dornenbüschen verborgenen Höhle schlich und sich lautlos von der Seite näherte, den kühnen Helden in Stücke zu reißen.
Erst der heiße Atem des Hundertköpfigen ließ ihn aus seiner Erstarrung erwachen. Blitzschnell erkannte er die Gefahr und schon sprang er mutig dem heimtückischen Angreifer entgegen.
Ein Dutzend Köpfe des Untieres lagen bereits am Boden, ehe es wußte, daß es diesmal um Tod und Leben ging. Einen Satz tat es auf Herakles zu, doch schon hatte dieser sich gebückt und ihm von unten her sein Schwert ins Herz gerannt. Tot stürzte der Drache neben seinem Überwinder zu Boden.
Als Herakles jetzt mit kühner Hand die goldenen Äpfel pflückte, die er in seinem Wams barg, stimmten die Hesperiden, die atemlos dem fürchterlichen Kampf zugeschaut, einen Klagegesang an. Und also lautete er:
Weh’ dir, o Land der Atlanten,
Dessen Friede der Fremde gestöret,
Als er mit frevelnder Hand
Unsern Wächter Ladón erschlug!
Von dem Baume der Jugend
Riß kühn er die goldenen Früchte,
Die Gea, Göttin der Erde,
Hera zur Hochzeit erkor.
Weh’ uns, den Hesperiden,
Deren Daseinszweck nun verloren,
Seit uns der Hort geraubt,
Den die Göttin uns anvertraut!
Wehe euch, Brüder Titanen,
Die ihr hoch in den Bergen wohnet,
Mächtiger als das Gebirge
Ist des Ozeanus Flut!
Untergang ist uns beschieden,
Den Kindern des Landes Atlantis,
Tief auf dem Grunde des Meeres
Lebet sein Name nur fort.
Unbekümmert um das Jammern der Jungfrauen trat Herakles den Heimweg an, die goldenen Früchte der ewigen Jugend seiner Schutzgöttin Athene zum Angebinde darzubringen. Als er an dem Tempel Neptuns vorbeikam, nahe der Stadt der Atlanten, trat ihm König Atlas an der Spitze seiner Söhne, der Titanen, entgegen, den Raub der goldenen Äpfel zu rächen. Doch Zeus half dem griechischen Helden: ein gewaltiger Erdstoß machte den Tempel erzittern, ein Blitzstrahl zerschmetterte die Bildsäule Neptuns, unter den Trümmern des Heiligtums begraben lag König Atlas.
Unmenschliche Wut erfaßte die Titanen. Bäume rissen sie aus, die Säulen des Atriums schwangen sie über ihrem Haupt, Herakles zu zermalmen. Nur schleunige Flucht konnte den Drachentöter retten.
Wie eine Hirschkuh jagte er durch Täler und über Höhen gen Norden, verfolgt von den blindwütigen Söhnen des Atlas, die immer näher rückten. Doch schon hatte er den Gipfel des Berges Calpe erreicht, faßte mit beiden Händen sein mächtiges Schwert, hob es auf zu den Wolken, und mit sausendem Hieb spaltete er ihn in zwei Teile: der Engel der Vernichtung hatte seinen Arm geführt.
Brausend mischten sich die Fluten des Ozeanus mit dem Meer seiner Heimat, stiegen auf und schossen hinein in die Täler von Atlantis, das Zeus zum Untergang bestimmt. Erschreckt flohen die Titanen ins Gebirge, ein Felsenschloß zu errichten, sich vor der Sintflut zu retten.
Herakles aber kehrte um und suchte nächtens nach Hesperis, der Witwe des Atlas, deren Schönheit man über den ganzen Erdkreis besang. Einen brennenden Baum wie eine Fackel schwingend, überstieg er die Trümmer der Stadt und fand sie zitternd in einer Grotte. Doch als Hesperis dem strahlenden Helden ins Antlitz sah, entbrannte ihr Herz in jäher Liebe und freiwillig folgte sie ihm.
Bei Morgengrauen hob Herakles die Königin auf die Schulter, die Meerenge zu durchwaten, die sie nach der Spaltung des Berges Calpe von Iberia trennte. Da erschauten die Titanen die Flucht ihrer Mutter. Vom hohen Gebirge stürzten sie gewaltige Quadersteine in die See, den Todfeind zu vernichten. Doch unversehrt erreichte Herakles die Mauern von Gades.
Hier erwartete ihn der Riese Gerion, nahm ihm Hesperis von den Schultern und setzte sie im Burghof ab. Dann griff er nach einem Felsen und schmetterte ihn auf den verhaßten Fremdling nieder, der dem Drachen Ladón entgangen war. Doch Herakles fing ihn mit dem Rücken auf, übersprang die Mauer und tötete den Unhold. Auf dem Grabe Gerions aber wuchs ein greulicher Drachenbaum, dessen Stamm rotes Blut über den Tod des Burgherrn von Gades weinte.
Inzwischen hatte Hesperis den Söller erstiegen und schaute von den Zinnen nach dem in den Wogen des Ozeanus versinkenden Atlantis. Tiefe Trauer erfaßte die Königin, und von Schmerz übermannt stürzte sie sich ins Meer.
Die Titanen aber gaben den Kampf gegen die steigenden Fluten nicht auf. Den höchsten Gipfel erklommen sie, einen riesigen Turm zu bauen, den rettenden Himmel zu erklettern. Schon hatten sie die Wolken erreicht, zwei Finger breit nur trennten sie vom Himmel, da stürzte das kühne Gebäude zusammen.
Rasend vor Wut schleuderten sie die Trümmer des stolzen Turms gegen Zeus, der ihnen im letzten Augenblick die Rettung versagt. Da rief der Gott die Elemente gegen sie auf; Blitze zuckten vom Himmel, Regen strömte, immer höher schäumten die Fluten. Der Engel der Vernichtung aber schlug ein breites Grab in den Grund des Ozeanus, in das die Titanen versanken. Dann steckte er sein feuriges Schwert in die Scheide und nahm Abschied von der Erde bis zum Tage des Jüngsten Gerichts.
Von dem mächtigen Reiche Atlantis aber blieben nichts als sieben Bergkuppen, die die Fluten des Ozeanus umspülen: sieben Inseln, die den Namen der Hesperiden trugen. Die goldlockigen Töchter des Atlas aber setzte Zeus als leuchtendes Sternbild in den Himmel.
Teneriffa, die Glückliche Insel
Blüten vom Guaidil
Wie das Traubild einer längst entschwundenen Zeit, wie ein Überbleibsel aus den leuchtenden Gärten der Hesperiden, steht heute noch in den Gefilden Taoros der baumhohe Strauch, dem eine märchenschöne Guanchen-Prinzessin das Sinnbild der Liebe verlieh. Aus den schneeigen Glockenblüten des Guaidil, die auf dem Grund ihres Kelches mit duftigem Rosa überhaucht sind, wand sie dem Sieger die Krone, der beim Beñesmen, dem Erntedankfest, im Ringkampf den herkulischen Gegner überwunden. Hier im Tagoror, der Rats-, Versammlungs- und Festspielstätte von Arautápala, entbrannte ihr Herz in heißer Liebe zu dem stattlichen Jüngling, dem einfachen Vasall ihres Vaters, des mächtigen Königs der Insel.
Sie hieß Guaima und er Tamaide. Sie war von königlichem Blut und er ein bescheidener Hirt, doch edel, mutig und tapfer wie irgendeiner der Guanchen, die auf Teneriffa lebten.
Eines Tages, bei Morgengrauen, stieg Guaima hinunter zum Strand, dem Singsang der Wogen zu lauschen, der ihr wie Liebesseufzer klang. Lange saß sie versunken auf einsamer Klippe und merkte nicht, wie die Sonne höher und höher stieg und den Mittag bereits überschritten hatte.
Da drang ein heller Pfiff an ihr Ohr und rückschauend gewahrte sie, wie ein Jüngling leichtfüßig die Schroffen des Chichimani herabsprang und nun in der Schlucht von Guabana verschwand. Nur zu wohl kannte sie den Pfiff jenes helläugigen Guanchen, der ihr immer wieder in ihren Träumen erschien und dem ihr Herz seit langem entgegenschlug.
Schnell lief sie zurück und ehe sie noch den Bach erreichte, der munter durch die steile Schlucht rieselte, teilten sich die Oleanderbüsche und vor ihr stand der junge, hochgewachsene Hirt Tamaide. Tief verneigte er sich vor der Prinzessin, die nicht nur vom eiligen Lauf wie mit Purpur übergossen schien.
In wohlgesetzter Rede tat Tamaide kund, was die Hirten von den Höhen des Chichimani in der Versammlung der letzten Nacht beschlossen hatten. Und obgleich er wußte, daß sich die Prinzessin nicht weigern konnte, die hohe Ehre anzunehmen – denn wer den Willen des Volkes verachtete, wurde als Feind des Vaterlandes erklärt, und die Strafe Acoráns, des waltenden Gottes, folgte auf dem Fuße –, so erfüllte es ihn doch mit inniger Freude, als er das Aufleuchten in den Augen Guaimas gewahrte. Und also sprach er zu ihr:
»Edle Tochter des großen Königs Bentinerfe, Eures Vaters, dessen treue Vasallen wir alle sind! Lange suchte ich Euch im weiten Tal von Arautápala, und jetzt, da Ihr vor mir steht, will ich Euch Kunde geben vom Beschluß Eurer Untertanen, die mich als ihren Boten ausersehen haben. Einstimmig sind sie übereingekommen, Euch zur Ehrenkönigin zu erwählen, aus deren Hand beim nächsten Beñesmen der Sieger im Ringkampf den Preis entgegennimmt und Euch als Gemahlin heimführt. Wir bitten Euch alle von Herzen, unseren Wunsch zu erfüllen und die Ehrung, die wir Euch zugedacht, anzunehmen.« Ehrfurchtsvoll kniete er nieder und küßte den Saum ihres Tamarcos, des seidenweichen Fellhemdes, das enganliegend bis auf die breitriemigen Xercos, die Sandalen, herabfiel.
Freudig erregt von den wohllauten Worten Tamaides, die gleich den lieblichen Tönen der Hirtenflöte an ihr Ohr klangen, gab die Prinzessin ihre Einwilligung. Dann lief sie schnell zur Königshöhle, dem Vater die frohe Botschaft zu bringen.
Auf seinen federnden Banot, den Speer aus dunklem Eschenholze, gestützt, blickte ihr der Jüngling träumerisch nach...
Der Tag des Beñesmen war herangekommen. Im Alfaribor, der geräumigen Klause von Taoro, herrschte geschäftiges Treiben. Jugendliche Magades, heilige Priesterinnen, die heute als Hofdamen der Ehrenkönigin amtieren sollten, waren dabei, Guaima festlich zu schmücken. Zierliche Muschelketten legten sie um den weißen Hals der Prinzessin, steckten ihr rotleuchtende Miracielosblüten ins Haar, wanden einen Gürtel bunter Feldblumen um ihre Hüften. Dann führten sie Guaima an die heilige Quelle, deren kristallklarer Spiegel das liebliche Bild der Ehrenkönigin zurückwarf.
Der langgezogene Ton des Fatuto, eines gewundenen Muschelhorns, der jetzt zum dritten Male erscholl, mahnte zum Aufbruch. Schnell ordnete sich der Zug, und gefolgt von den Magades schritt Guaima hocherhobenen Hauptes zur Kampfstätte.
Das weite Rund des Tagoror ist mit frischem Grün und leuchtenden Blumen umkränzt. Zwischen Lorbeerzweigen und Palmenwedeln duften berauschend die weißen Schmetterlingsblüten der Retama.
Unter dem uralten Drachenbaum, dem Wahrzeichen Taoros, sitzt auf fellbedecktem Stein König Bentinerfe, umgeben von den Fürsten und Edlen seines Reiches. Über dem Haupt des Herrschers hängt die bastgeflochtene Standarte, die »Añepa«, das Symbol unumschränkter Gewalt. Rings um die Kampfbahn hocken die Vasallen auf herangerollten Steinen, Kinder kauern im Sand. In den Gesichtern aller malt sich gespannte Erwartung.
Feierlich nähert sich der Zug Guaimas und der Priesterinnen, die zu Ehren Acoráns einen Lobgesang angestimmt haben. Ihnen folgen Jünglinge mit Tajarastes, kleinen Handtrommeln, und Chiflas, Flöten. Nach dem Festmahl, dem Guatativoa, werden sie zum Tanz aufspielen.
Tragbahren mit Früchten vom Mocán und vom Erdbeerbaum schwanken heran und werden unter den schattigen Fächerpalmen fern vom Staub der Kampfbahn niedergesetzt. Saftige Brombeeren in bastgeflochtenen Körben, sorgsam bereiteter Gofio, geröstetes und dann gemahlenes Getreide, frische Ziegenmilch in riesigen Tonkrügen und randgeknetete Yoyakuchen häufen sich. Würziger Bratenduft junger Igel und zarter Baifos, Zicklein, zieht herüber, saftige Berghammel prutzeln am Spieße.
Tiefblau, wolkenlos, strahlt der Himmel wie dunkler Saphir, in den der Kegel des Teide sein flimmerndes Haupt stößt. Golden schießt die göttliche Magec, die ewige Sonne, ihre segenspendenden Pfeile über das glückliche Tal von Arautápala.
Die Kampfspiele beginnen. Wettlaufen wechselt mit Steinstoßen und Lanzenwerfen. Hoch- und Weitsprünge werden von anfeuernden Rufen begleitet. Schon fallen die Strahlen der Sonne schräg über die Höhen des Tigaiga, als König Bentinerfe Einhalt gebietet.
Wieder ertönt ein Muschelhorn, und in den Kreis schreitet stolz der Hüne Tagara, Meister im Ringkampf, den noch keiner zu Boden warf. Tief verneigt er sich vor dem Herrscher mit dem königlichen Gruß: »Zahaniat Guayohec!« Ich bin Dein Vasall! Dann sieht er sich herausfordernd nach einem Gegner um. Deutlich steht es in seinem Blick: er will heute den höchsten Preis erringen, der dem Sieger gebührt, die traumschöne Königstochter.
Auch Prinzessin Guaima ist mit ihren Hofdamen in das Rund des Tagoror getreten. In der Hand hält sie den Gánigo, den kleinen, irdenen Krug, das Zeichen des Sieges. Wer ihn erringt, dem gehört auch sie mit Leib und Seele. So will es das Gesetz der Guanchen! Doch ihr unbestrittenes Recht ist es, dem Herausforderer den Gegner zu bestimmen.
Suchend schweifen ihre Augen über die Versammelten. Dann haben sie den gefunden, dem seit langem ihr Herz gehört. Drüben, unter dem blühenden Guaidil, dessen weiße Glockenblüten wie duftige Flocken herabrieseln, steht der Hirt Tamaide und schaut lächelnd zu ihr herüber. Laut ruft sie seinen Namen und federnden Schrittes betritt er die Kampfbahn.
Erstauntes Raunen geht durch die Menge. Tamaide? Tamaide wagt es, mit dem Hünen Tagara zu ringen? König Bentinerfe sucht die Augen seiner Lieblingstochter. Ihr bittender Blick enthüllt ihm den Herzenswunsch der Prinzessin. Da gibt er das Zeichen zum Beginn des Kampfes.
Im nächsten Augenblick halten sich die Gegner umschlungen. Vergebens versucht Tagara, den Hirten zu Fall zu bringen, immer wieder entschlüpft jener dem klammernden Arm des Riesen. Kein Zweifel, an Kraft ist Tamaide dem bärenstarken Sohn des Hochgebirges nicht gewachsen, nur seine Gewandtheit kann ihn vor sicherer Niederlage retten. Er fühlt, wie die Augen Guaimas auf ihm ruhen, er weiß, es geht um das Glück seines Lebens, er muß das Unmögliche möglich machen und Tagara werfen.
Immer hitziger bedrängt ihn der Hüne. Er merkt, wie seine Kräfte schwinden. Da erspäht er eine Blöße des Gegners. Wir ein Pfeil schnellt er vor, unterläuft ihn und wirbelt ihn zu Boden. Schon kniet er auf der Brust des Riesen und drückt seine Schultern zur Erde. Der Kampf ist aus: Tamaide hat gesiegt.
Während donnernde Beifallsrufe den jungen Hirten umbrausen, schleicht Tagara schamvoll aus dem Rund. Fern von Taoro wird er von nun an leben, fern seinen Stammesbrüdern. Diese Niederlage hat sein Herz gebrochen.
Die Prinzessin ist unter den Guaidil getreten und hat mit rascher Hand einen Strauß schimmernder Glockenblüten gepflückt, die sie gewandt zum Siegerkranze flicht. Dann eilt sie, den Erwählten ihres Herzens zu schmücken. Errötend reicht sie dem Niederknienden den kleinen, irdenen Krug und drückt die Blütenkrone auf seine Stirn. Hand in Hand treten die beiden vor den Vater, der sie lächelnd an seine Brust zieht.
Die Vasallen aber werfen die Arme in die Luft. Jubelnd klingen ihre Rufe über den festlichen Tagoror: »Es lebe Prinzessin Guaima! Es lebe der Held Tamaide!«
Noch am selben Abend wurde die Hochzeit gefeiert. Und seit jenem Tage schmücken sich Braut und Bräutigam auf Teneriffa mit Blüten vom Guaidil, wenn sie im Frühling zum Altar schreiten...
Vilaflor
Hoch oben, auf luftiger Höhe, nahe der Ginsterregion, liegt wie ein ruhender Vogel mit ausgebreiteten Flügeln an steil sich hinaufziehendem Hang des Guajara das Dörfchen Vilaflor. Freundlich leuchten seine buntgestrichenen Häuser in der flimmernden Sonne. Oberhalb der letzten Gehöfte, die verstreut zwischen blühenden Weißkirschen ins Tal blicken, beginnt der Wald. Hohe Kanarische Kiefern stehen hier neben schlanken Pinien, deren Kronen sich wie gigantische Schirme über dem nadelbedeckten Boden wölben. Vom Schritt des Wanderers aufgescheucht, fliehen blaue Teidefinken in das dunkle Grün spitzgiebliger Tannen.
Einsam wanderte ich durch den schweigenden Wald, als zwei riesige Kiefern jäh meine Schritte hemmten. Während ich sie betrachtete und Höhe und Umfang zu schätzen versuchte, stand plötzlich wie aus dem Boden gewachsen ein kleines, weißhaariges Männchen neben mir, das mich schelmisch von der Seite mit jugendfrischen Augen anblickte, die nicht recht in das altersdurchfurchte Gesicht zu passen schienen.
»Viele Fremde kommen hierher«, sagte der Kleine ohne Einleitung, als führe er ein begonnenes Gespräch fort, »um den ›Pino gordo‹, die dicke Kiefer, und die ›Madre de agua‹, die Mutter des Wassers, zu sehen, doch nur wenige kennen die Legende, die um die beiden Bäume spielt. Ich will sie Ihnen erzählen.«